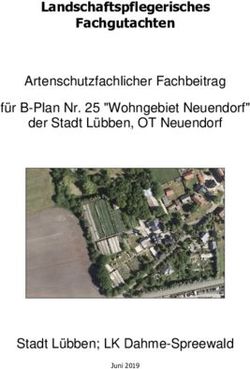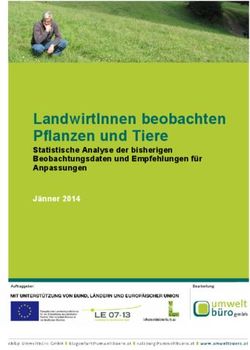Umweltbericht (Teil II der Begründung) - Bebauungsplan Nr. 9.35 und 58. Änderung des Flächennutzungsplans - Gemeinde Rhauderfehn
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gemeinde Rhauderfehn
Landkreis Leer
Bebauungsplan Nr. 9.35
und
58. Änderung
des Flächennutzungsplans
„Ortseingang-Ost“
Umweltbericht
(Teil II der Begründung)
Vorentwurf März 2018
Diekmann • Mosebach & Partner Oldenburger Straße 86 - 26180 Rastede
Tel.: 04402/9116-30 - Fax:04402/9116-40
e-mail: info@diekmann-mosebach.de
www.diekmann-mosebach.deGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans I
INHALTSÜBERSICHT
TEIL II: UMWELTBERICHT 1
1.0 EINLEITUNG 1
1.1 Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort 1
1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden 2
2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 2
2.1 Landschaftsprogramm 2
2.2 Landschaftsrahmenplan 2
2.3 Landschaftsplan 3
2.4 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete 3
2.5 Artenschutzrechtliche Belange 4
3.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 5
3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Schutzgüter 5
3.1.1 Schutzgut Mensch 6
3.1.2 Schutzgut Pflanzen 7
3.1.3 Schutzgut Tiere 12
3.1.4 Biologische Vielfalt 23
3.1.5 Schutzgut Boden und Fläche 23
3.1.6 Schutzgut Wasser 24
3.1.7 Schutzgut Klima und Luft 26
3.1.8 Schutzgut Landschaft 26
3.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 27
3.1.10 Wechselwirkungen 28
3.1.11 Kumulierende Wirkungen 28
3.1.12 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 28
3.2 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 29
3.2.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung und
Eingriffsbilanzierung 29
3.2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung – Nullvariante 32
4.0 VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND KOMPENSATION NACHTEILIGER
UMWELTAUSWIRKUNGEN 33
4.1 Vermeidung / Minimierung 33
4.1.1 Schutzgut Mensch 33
4.1.2 Schutzgut Pflanzen 34
4.1.3 Schutzgut Tiere 34
4.1.4 Biologische Vielfalt 35
4.1.5 Schutzgut Boden 35
4.1.6 Schutzgut Wasser 35
4.1.7 Schutzgut Klima / Luft 35
4.1.8 Schutzgut Landschaft 35
4.1.9 Schutzgut Kultur und Sachgüter 36
4.2 Maßnahmen zur Kompensation 36
4.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 38
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans II
4.3.1 Standort 38
4.3.2 Planinhalt 38
5.0 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 39
5.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen
Verfahren 39
5.1.1 Analysemethoden und -modelle 39
5.1.2 Fachgutachten 39
5.1.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 39
5.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 39
6.0 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 40
7.0 QUELLENVERZEICHNIS 41
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 1: Bewertung der Biotoptypen (nach DRACHENFELS 2012) 11
Tabelle 2: Liste der im Jahr 2017 im Untersuchungsraum nachgewiesenen Brutvögel. 13
Tabelle 3: Begehungstermine und Witterungsbedingungen 15
Tabelle 4: Im Untersuchungsgebiet innerhalb der Untersuchungszeiträume nachgewiesenen
Fledermausarten sowie ihr Gefährdungs- und Schutzstatus und Erhaltungszustand 16
Tabelle 5: Liste der im Jahr 2017 nachgewiesenen besonders geschützten ungefährdeten
Brutvogelarten 19
Tabelle 6: Liste der 2017 im Untersuchungsraum nachgewiesenen Brutvögel, für die eine
artspezifische Betrachtung aufgrund der oben genannten Kriterien vorgenommen wird. § =
besonders geschützt, §§ = streng geschützt 20
Tabelle 7: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 29
Tabelle 8: Eingriffsbilanzierung 29
ANLAGEN
Karte 1: Bestand Biotoptypen
Anlage 1: Faunistischer Fachbeitrag – Brutvögel und Lurche
Anlage 2: Faunistischer Fachbeitrag – Fledermäuse
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 1
TEIL II: UMWELTBERICHT
1.0 EINLEITUNG
Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Entsprechend der Anlage zum Bau-
gesetzbuch zu § 2 (4) und § 2a BauGB werden die ermittelten Umweltauswirkungen im
Umweltbericht beschrieben und bewertet (§ 2 (4) Satz 1 BauGB). „Wird eine Umwelt-
prüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennut-
zungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem
zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzli-
che oder andere erhebliche Umweltweltauswirkungen beschränkt werden“ (§ 2 (4) Satz
5 BauGB).
Der Bebauungsplan Nr. 9.35 wird im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB zur 58. Flä-
chennutzungsplanänderung aufgestellt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung
wird gem. § 2 (4) Satz 1 BauGB ein Umweltbericht mit einer umfassenden Beschrei-
bung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen des gesamten Plan-
vorhabens erstellt. Da somit bereits zeitgleich für den Änderungsbereich der 58. Flä-
chennutzungsplanänderung eine ausführliche Ermittlung der Belange des Umwelt-
schutzes gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB stattgefunden hat, kann die Umweltprüfung im Flä-
chennutzungsplanverfahren gem. § 2 (4) Satz 5 BauGB auf die zusätzlichen oder an-
deren erheblichen Umweltauswirkungen beschränkt werden. Durch die 58. Änderung
des Flächennutzungsplanes werden jedoch keine anderen Umweltauswirkungen er-
wartet, als die im Umweltbericht zum Bebauungsplan abschließend aufgeführten As-
pekte. Der Inhalt des Umweltberichtes zum Bebauungsplan Nr. 9.35 gilt daher gleich-
ermaßen für die 58. Änderung des Flächennutzungsplanes.
1.1 Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort
Die Gemeinde Rhauderfehn beabsichtigt, das Gebiet zwischen dem Wohnmobilstell-
platz „Am Siel“ und der Bundesstraße 438 (B 438) erstmals städtebaulich zu beordnen.
Zu diesem Zweck wird der Bebauungsplan Nr. 9.35 aufgestellt. Zur bauleitplanerischen
Vorbereitung des Planvorhabens erfolgt im Parallelverfahren gem. § 8 (3) S. 1 BauGB
die 58. Flächennutzungsplanänderung.
Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohn- und Geschäftshäusern in der
Gemeinde Rhauderfehn, ist es städtebauliches Ziel, ein gemischtes Quartier zu entwi-
ckeln, das sich in die bestehenden Strukturen einfügt. Hierdurch wird eine städtebauli-
che Nachverdichtung an einen angrenzenden, vorgeprägten Siedlungsbereich ermög-
licht.
Genaue Angaben zum Standort sowie eine detaillierte Beschreibung des städtebauli-
chen Umfeldes, der Art des Vorhabens und den Festsetzungen sind den entsprechen-
den Kapiteln der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 9.35, Kap. 2.2 „Räumlicher Gel-
tungsbereich“, Kap. 2.3 „Städtebauliche Situation und Nutzungsstruktur“, Kap. 1.0 „An-
lass und Ziel der Planung“ sowie Kap. 5.0 „Inhalt des Bebauungsplanes“ zu entnehmen.
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 2
1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden
Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 1,7 ha. Durch die Festsetzung von zwei
Mischgebieten (MI1, MI2), einer Straßenverkehrsfläche und einer privaten Grünfläche
wird ein größtenteils unbebauter Bereich einer baulichen Nutzung zugeführt.
Die einzelnen Flächenausweisungen umfassen:
Mischgebiete (MI1, MI2) ca. 7.760 m²
Öffentliche Straßenverkehrsfläche ca. 1.955 m²
Private Grünfläche Zweckbestimmung „Deichabstandsfläche“ ca. 2.385 m²
Schutzgebiet / Schutzobjekt ca. 5.190 m²
Durch die im Bebauungsplan vorbereiteten Überbauungsmöglichkeiten (u.a. GRZ
+ Überschreitung gem. § 19 (4) BauNVO) können im Planungsraum bis zu ca. 0,38 ha
dauerhaft versiegelt werden (s. ausführlicher im Kap. 3.2.1).
2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE
Die in einschlägigen Fachplänen und Fachgesetzen formulierten Ziele, die für den vor-
liegenden Planungsraum relevant sind, werden unter Kap. 3.0 „Planerische Vorgaben“
der Begründung zum Bebauungsplan umfassend dargestellt (Landesraumordnungs-
programm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), vorbereitende und
verbindliche Bauleitplanung). Im Folgenden werden zusätzlich die planerischen Vorga-
ben und Hinweise aus naturschutzfachlicher Sicht dargestellt (Landschaftsprogramm,
Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan, naturschutzfachlich wertvolle Bereiche /
Schutzgebiete, artenschutzrechtliche Belange).
2.1 Landschaftsprogramm
Das Niedersächsische Landschaftsprogramm von 1989 ordnet das Plangebiet in die
naturräumliche Region Ostfriesisch-Oldenburgische Geest ein. In dieser Region hat
vorrangige Bedeutung u. a. der Schutz der letzten naturnahen Wälder, Hochmoore und
der landschaftstypischen Wallhecken. Aufgrund des geringen Anteils schutzwürdiger
Flächen in dieser Region sind Maßnahmen zur Entwicklung von wertvoller Landschafts-
substanz besonders wichtig. Dazu zählt z. B. die Entwicklung naturnaher Laubwälder
(vor allem Eichenmischwälder trockener und feuchter Sande). Vorrangig schutz- und
entwicklungsbedürftig sind weiterhin u. a. Heckengebiete und sonstiges gehölzreiches
Kulturland. Schutzbedürftig und z. T. auch entwicklungsbedürftig sind Gräben, Grün-
land mittlerer Standorte, dörfliche und städtische Ruderalfluren, nährstoffarme, wild-
krautreiche Sandäcker und sonstige wildkrautreiche Äcker (NIEDERSÄCHSISCHES MINIS-
TERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN 1989).
2.2 Landschaftsrahmenplan
Gemäß Landschaftsrahmenplan des Landkreises Leer mit Entwurfsstand 2001 liegt der
Geltungsbereich in der naturräumlichen Einheit der Hunte-Leda-Moorniederung und
der Untereinheit Klostermoor.
Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes für die Vegetation und die Fauna wird als
erheblich bis stark eingeschränkt (Wertstufe 3 von 3) eingestuft (Karte 3 – Arten und
Lebensgemeinschaften). Den Landschaftscharakter und das Landschaftserleben prä-
gende Erlebnisqualitäten werden in Karte 6 als mäßig eingeschränkt (Wertstufe 2 von
3) dargestellt.
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 3
In Karte 8 wird das Risikopotenzial des Grundwassers mit erhöht bewertet (Wertstufe
2 von 4). Gemäß Karte 9 werden im Plangebiet die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes und/oder die Erlebnisqualitäten des Landschaftsbildes als erheblich bis stark ein-
geschränkt beurteilt (Wertstufe 3 von 3).
2.3 Landschaftsplan
Der Geltungsbereich und seine Umgebung liegen gemäß Landschaftsplan der Ge-
meinde Rhauderfehn (Stand 1993) innerhalb eines Gebietes mit Flussmarschböden.
Das westliche Plangebiet wird bereits zu den Siedlungen gezählt, in denen die natürli-
chen Standortverhältnisse nicht mehr gegeben sind, die Böden durch Aufschüttung und
Abtrag oft stark verändert und der Wasserhaushalt durch Grundwasserabsenkung
durch u. a. Versiegelung stark verändert ist. Als potenzielle natürliche Vegetation wird
für die unbesiedelten Bereiche ein Eschen-Auenwald einschließlich Silberweidenwald
mit stellenweise Eichen-Hainbuchenwald angegeben (Karte 1 – Landschaftseinheiten).
Die nördlich des Burlage-Langholter-Tiefs gelegenen Flächen werden als wichtiger Be-
reich für Arten und Lebensgemeinschaften dargestellt (Wertstufe 2 von 3 – Kriterien
überwiegend erfüllt). Für das Plangebiet wird kein wichtiger Bereich dargestellt (Karte
3 – Arten und Lebensgemeinschaften). Belastungen und Gefährdungen von Natur und
Landschaft gehen von der südlich angrenzenden Bundesstraße aus (Zone mit erhöhter
Schadstoffanreicherung im Boden, Pflanzen und Tieren; erhöhte Lärmbelastung) (Karte
6 - Belastungen und Gefährdungen von Natur und Landschaft). Gemäß Karte 7 – Land-
schaftsentwicklung wird für den südlichen Randbereich entlang der Bundesstraße eine
Allee-Neuanpflanzung angegeben. Das Plangebiet wird nicht als schutzwürdiger Land-
schaftsteil aus lokaler Sicht dargestellt (Karte 8 – Entwicklung schutzwürdige Bereiche).
2.4 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete
Gemäß Kartenserver des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Kli-
maschutz (2018) grenzt östlich und nordöstlich das Landschaftsschutzgebiet Langhol-
ter Meer und Rhauder Meer (LSG LER 00014) an. Das Plangebiet sowie die nördlich
und östlich angrenzenden Flächen werden als wertvoller Bereich für Gastvögel mit dem
Status offen (Stand 2006) dargestellt. Der nördliche und östliche Nahbereich wird ferner
als wertvoller Bereich für Brutvögel dargestellt (Stand 2010; ergänzt 2013). Das Plan-
gebiet und seine Umgebung, die u. a. auch die westlich angrenzende bestehende Be-
bauung einschließt, werden als naturschutzfachlich besonders bedeutsame Gebiete mit
Auenbezug dargestellt.
Im Rahmen der durchgeführten Biotoptypenkartierung konnten im östlichen Plangebiet
mehrere nach § 30 i. V. m. § 24 NAGBNatSchG geschützte Biotope festgestellt werden.
Darunter fallen ein Rohrglanzgras-Landröhricht sowie zwei Flächen, die als Weiden-
Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte zu klassifizieren sind. Die Beseitigung der
Flächenanteile dieser Biotope ist im Rahmen eines separaten Ausnahmeantrages von
Seiten des Eingriffsverursachers beim Landkreis Leer zu beantragen.
Weitere faunistisch, vegetationskundlich oder historisch wertvolle Bereiche oder Vor-
kommen, die einen nationalen oder internationalen Schutzstatus bedingen, befinden
sich nicht im Plangebiet. Ferner bestehen keine festgestellten oder geplanten Schutz-
gebiete nationalen/internationalen Rechts bzw. naturschutzfachlicher Programme.
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 4
2.5 Artenschutzrechtliche Belange
§ 44 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie und Art. 5 der Vo-
gelschutzrichtlinie (V-RL) begründen ein strenges Schutzsystem für bestimmte Tier-
und Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Europäischen
Artenschutzverordnung - (EG) Nr. 338/97 - bzw. der EG-Verordnung Nr. 318/2008 in
der Fassung vom 31.03.2008 zur Änderung der EG-Verordnung Nr. 338/97 - aufgeführt
sind, Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, alle europäischen
Vogelarten, besonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1
der BArtSchV). Danach ist es verboten,
• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert,
• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören
und
• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder
zu zerstören.
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1) werden um den für Ein-
griffsvorhaben relevanten Absatz 5 des § 44 BNatSchG ergänzt, mit dem bestehende
und von der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der
artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesi-
chert werden, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung
der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen:
Entsprechend dem § 44 (5) BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei
nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften
des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 (2) Satz 1 nur für die in
Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen
Vogelarten. Darüber hinaus ist nach nationalem Recht eine Vielzahl von Arten beson-
ders geschützt. Diese sind nicht Gegenstand der folgenden Betrachtung, da gem. § 44
(5) Satz 5 BNatSchG die Verbote des Absatzes 1 für diese Arten nicht gelten, wenn die
Zulässigkeit des Vorhabens gegeben ist.
Zwar ist die planende Gemeinde nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit dem
Bebauungsplan in der Regel nicht selbst die verbotenen Handlungen durchgeführt be-
ziehungsweise genehmigt werden. Allerdings ist es geboten, den besonderen Arten-
schutz bereits in der Bauleitplanung angemessen zu berücksichtigen, da ein Bebau-
ungsplan, der wegen dauerhaft entgegenstehender rechtlicher Hinderungsgründe (hier
entgegenstehende Verbote des besonderen Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht
verwirklicht werden kann, vollzugsunfähig ist.
Die Belange des Artenschutzes werden in Kapitel 3.1.2 und 3.1.3 dargelegt und be-
rücksichtigt.
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 5
3.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN
Die Bewertung der bau-, betriebs- und anlagebedingten Umweltauswirkungen des vor-
liegenden Planvorhabens erfolgt anhand einer Bestandsaufnahme bezogen auf die ein-
zelnen, im Folgenden aufgeführten Schutzgüter. Durch eine umfassende Darstellung
des gegenwärtigen Umweltzustandes einschließlich der besonderen Umweltmerkmale
im unbeplanten Zustand sollen die umweltrelevanten Wirkungen der Bebauungs-
planaufstellung herausgestellt werden. Hierbei werden die negativen sowie positiven
Auswirkungen der Umsetzung der Planung auf die Schutzgüter dargestellt und hinsicht-
lich ihrer Erheblichkeit soweit wie möglich bewertet. Ferner erfolgt eine Prognose der
Umweltauswirkungen bei Durchführung und Nichtdurchführung der Planung („Nullvari-
ante“).
3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Schutzgüter
Die Bewertung der Umweltauswirkungen richtet sich nach folgender Skala:
- sehr erheblich,
- erheblich,
- weniger erheblich,
- nicht erheblich.
Sobald eine Auswirkung entweder als nachhaltig oder dauerhaft einzustufen ist, kann
man von einer Erheblichkeit ausgehen. Eine Unterteilung im Rahmen der Erheblichkeit
als wenig erheblich, erheblich oder sehr erheblich erfolgt in Anlehnung an die Untertei-
lung der „Arbeitshilfe zu den Auswirkungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung von
Bauleitplänen – Umweltbericht in der Bauleitplanung (SCHRÖDTER et al. 2004). Es er-
folgt die Einstufung der Umweltauswirkungen nach fachgutachterlicher Einschätzung
und diese wird für jedes Schutzgut verbal-argumentativ projekt- und wirkungsbezogen
dargelegt. Ab einer Einstufung als „erheblich“ sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
vorzusehen, sofern es über Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu einer
Reduzierung der Beeinträchtigungen unter die Erheblichkeitsschwelle kommt.
Die Einstufung der Wertigkeiten der einzelnen Schutzgüter erfolgt bis auf die Einstufung
der Biotopstrukturen beim Schutzgut Pflanzen, bei denen das Bilanzierungsmodell
nach BREUER (2006) verwendet wird, in einer Dreistufigkeit. Dabei werden die Einstu-
fungen „hohe Bedeutung“, „allgemeine Bedeutung“ sowie „geringe Bedeutung“ verwen-
det. Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ.
Zum besseren Verständnis der Einschätzung der Umweltauswirkungen wird im Folgen-
den ein kurzer Abriss über die durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes verur-
sachten Veränderungen von Natur und Landschaft gegeben.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 9.35 wird die Festsetzung von zwei Misch-
gebieten ermöglicht. Es werden dadurch vorwiegend Gehölzstrukturen und Ruderalflä-
chen überplant. Der gesamte Geltungsbereich umfasst eine Größe von 1,7 ha.
Für die Mischgebiete mit einer Gesamtgröße von rd. 7.760 m² wird eine Grundflächen-
zahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt. Eine Überschreitung ist gemäß § 19 (4) BauNVO mit
50%; höchstens jedoch bis 0,8 durch Nebenanlagen zulässig. Dadurch wird eine maxi-
male Bodenversiegelung von insgesamt rd. 3.240 m² vorbereitet.
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 6
Der westliche bereits bebaute Bereich an der Straße „Am Siel“ mit einer Flächengröße
von ca. 4.800 m² wird als im Zusammenhang bebauter Ortsteil nach § 34 (1) BauGB
eingestuft, so dass unter Zugrundelegung der aktuellen Bebauung und den getroffenen
Flächenfestsetzungen für diesen Bereich keine Eingriffe im Sinne des § 14 BNatSchG
vorbereitet werden.
Durch die Festsetzung einer Straßenverkehrsfläche wird ebenfalls ein Flächenanteil
versiegelt. Ein Teil dieser Straße ist bereits durch die Straße „Am Siel“ versiegelt. Im
Bereich der Straße kommt es insgesamt zu einer Neuversiegelung von rd. 640 m², wo-
bei von einer maximalen Bodenversiegelung von 80 % ausgegangen wurde. Die übri-
gen 20 % werden als artenarmes Straßenbegleitgrün eingestuft.
Die im östlichen Geltungsbereich befindlichen nach § 30 BNatSchG geschützten Bio-
tope werden als Schutzobjekt festgesetzt und damit dauerhaft gesichert und erhalten.
Lediglich ein kleinerer Flächenanteil (rd. 1.160 m²) des Rohrglanzgras-Röhrichts und
des Weiden-Sumpfgebüsches können nicht erhalten bleiben. Hierfür ist ein Antrag auf
Ausnahmegenehmigung für die Beseitigung dieser geschützten Biotopstrukturen beim
Landkreis Leer zu stellen.
Ferner wird durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9.35 bzw. durch die Fest-
setzung der Mischgebiete in vorhandene Waldbestände (ca. 1.935 m²) gemäß § 2 (3)
NWaldLG eingegriffen und nach § 8 NWaldLG Wald in eine Fläche mit anderer Nut-
zungsart umgewandelt. Die Umwandlung bedarf im Fall der Bauleitplanung keiner se-
paraten Genehmigung der Waldbehörde, da diese Regelung der Nutzungsänderung im
Rahmen eines Bebauungsplanes abgearbeitet wird (§ 8 (2) Nr. 3 NWaldLG). Die Wald-
flächen werden planungsrechtlich freigeräumt und extern verlagert. Hierfür wird im wei-
teren Verfahrensverlauf ein Waldgutachten gem. den Ausführungsbestimmungen zum
NWaldLG RdErl.d.ML.v. 2.1.2013 – 406-64002-136 erstellt. Insgesamt weisen die im
Plangebiet befindlichen Waldflächen eine Größe von ca. 1.935 m² auf. Bei einem Kom-
pensationsverhältnis von 1:1 ist ein Ausgleich von 1.935 m² zu erbringen. Über die se-
parate Beregelung der Kompensationsflächen wird die eigentliche Eingriffsbilanzierung
auf den dann planungsrechtlich freigeräumten Flächen, die mit der Wertstufe einer ge-
ringwertigen landwirtschaftlichen Fläche (Wertstufe 1) bewertet werden, berechnet.
Im Folgenden werden die konkretisierten Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die
verschiedenen Schutzgüter dargestellt und bewertet.
3.1.1 Schutzgut Mensch
Ziel des Immissionsschutzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Um-
welteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen
vorzubeugen. Schädliche Umwelteinwirkungen sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen,
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter ein-
wirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen
und ähnliche Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind,
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft herbeizuführen.
Die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) konkretisiert die zumut-
bare Lärmbelastung in Bezug auf Anlagen i.S.d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG). Die DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – enthält im Beiblatt 1 Orien-
tierungswerte, die bei der Planung anzustreben sind.
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 7
Grundlage für die Beurteilung ist die Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe
in der Luft (39. BImSchV), mit der wiederum die Luftqualitätsrichtlinie der EU umgesetzt
wurde.
Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage für den Menschen dar. Im Zusammen-
hang mit dem Schutzgut Mensch sind vor allen Dingen gesundheitliche Aspekte bei der
Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen von Bedeutung. Bei der Betrachtung
des Schutzgutes Mensch werden daher neben dem Immissionsschutz, aber auch As-
pekte wie die planerischen Auswirkungen auf die Erholung- und Freizeitfunktionen bzw.
die Wohnqualität herangezogen.
Für den Menschen stellt das Plangebiet überwiegend eine mit Gehölzen und Wald be-
standene Fläche an der östlichen Grenze des Gemeindegebietes Rhauderfehn dar.
Aufgrund seiner Lage an der Bundesstraße 438 sowie der westlich befindlichen Bebau-
ung, die den Geltungsbereich in Verbindung mit dem Verlauf des Burlage-Langholter
Tiefs begrenzt, ist von einem geringen Erholungswert des Plangebietes auszugehen.
Zur Sicherstellung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen wurden im Zuge des
Planverfahrens die mit der geplanten Gewerbeentwicklung verbundenen Schallemissio-
nen gutachterlich geprüft. Auf Basis einer schalltechnischen Untersuchung zum Bebau-
ungsplan Nr. 9.35 (ITAP 2018) wurden für das Plangebiet Lärmschutzvorkehrungen ge-
troffen. Das Plangebiet befindet sich gemäß der schalltechnischen Untersuchung im Be-
reich der Lärmpegelbereiche III bis V. Es sind demnach erhöhte Anforderungen an die
Schalldämmmaße der Außenbauteile zu stellen. Des Weiteren sind Maßnahmen zum
Schutz von Schlafräumen und der Außenwohnbereiche in den lärmbelasteten Bereichen
entsprechend der Beurteilungspegelbereiche erforderlich.
In dem Bebauungsplan Nr. 9.35 „Ortseingang-Ost“ werden die vorgenannten Lärm- und
Beurteilungspegelbereiche als passive Lärmschutzmaßnahmen entsprechend festge-
setzt. Den Belangen des Immissionsschutzes wird hierdurch Rechnung getragen.
Bewertung
Das Plangebiet und die Umgebung sind durch die vorhandene Infrastruktur bereits vor-
belastet. Darüber hinaus erfolgt die Festsetzung von Lärmpegelbereichen sowie von
Anforderungen für Außenbauteile und Maßnahmen für Schlafräume und Außenwohn-
bereiche, sodass durch die Realisierung der Planung keine erheblichen Beeinträch-
tigungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten sind.
3.1.2 Schutzgut Pflanzen
Gemäß dem BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass
1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter so-
wie
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und
Landschaft auf Dauer gesichert sind. Zur dauerhaften Sicherung der biologi-
schen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbeson-
dere
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 8
a. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließ-
lich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den
Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermög-
lichen,
b. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen
und Arten entgegenzuwirken sowie
c. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geogra-
fischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; be-
stimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen
bleiben.
Um Aussagen über den Zustand von Natur und Landschaft zu erhalten, wurde im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9.35 „Ortseingang Ost““ eine flächendeckende
Bestandserfassung in Form einer Biotoptypen- /Nutzungskartierung durchgeführt. Im
Hinblick auf mögliche Wechselbeziehungen wurde die nähere Umgebung in die Bio-
toptypenerfassung einbezogen. Im Bereich des nördlich und östlich angrenzenden
Landschaftsschutzgebietes LSG-LER 14 „Langholter Meer und Rhauder Meer“ beträgt
die Untersuchungstiefe ca. 50 m. Darüber hinaus erfolgte eine Suche nach Standorten
von gemäß der Roten Liste der Farn-und Blütenpflanzen in Niedersachsen gefährdeten
oder nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 + 14 BNatSchG besonders bzw. streng geschützten Pflan-
zenarten im Geltungsbereich des Bauungsplans. Die Bestandsaufnahme der Naturaus-
stattung erfolgte im Rahmen von Geländebegehungen im Frühjahr und Sommer 2017.
Durch das Vorhandensein bestimmter Biotope, ihre Ausprägung und die Vernetzung
untereinander sowie mit anderen Biotopen können Informationen über schutzwürdige
Bereiche gewonnen werden.
Die nachstehend vorgenommene Typisierung der Biotope und die Zuordnung der
Codes (Großbuchstaben hinter dem Biotoptyp) stützen sich auf den „Kartierschlüssel
für Biotoptypen in Niedersachsen“ (DRACHENFELS 2016). Die Nomenklatur der aufge-
führten Pflanzenarten richtet sich nach GARVE (2004).
Im Plangebiet und in dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich Biotoptypen aus
folgenden Gruppen:
• Wälder,
• Gebüsche und Kleingehölze,
• Gewässer,
• Gehölzfreie Biotope der Sümpfe und Niedermoore,
• Grünland,
• Stauden- und Ruderalfluren sowie
• Siedlungsbiotope / Verkehrs- und sonstige befestigte Flächen.
Lage, Verteilung und Ausdehnung der Biotoptypen sind dem Bestandsplan Biotopty-
pen/ Nutzungen (Plan 1) zu entnehmen.
Das an der östlichen Gemeindegrenze gelegene Untersuchungsgebiet mit einer Größe
von ca. 1,7 ha befindet sich nördlich der Bundesstraße 438 (Untenende) und wird im
Norden und Osten von dem Deich entlang des hier verlaufenden Burlage-Langholter-
Tiefs begrenzt. Im Westen reicht es bis zu der Straße „Am Siel“ bzw. dem parallel zu
dieser verlaufenden Westrhauderfehnkanal/Haupfehnkanal. Für das Plangebiet han-
delt es sich großenteils um ungenutzte Bereiche mit Waldflächen, sonstigen Gehölzbe-
ständen und einem Landröhricht. Im Westen sind an der Straße Am Siel einige Ge-
bäude vorhanden, die von befestigten Flächen umgeben sind.
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 9
Die die westliche Plangebietsgrenze markierende Straße „Am Siel“ ist asphaltiert
(OVS). Am Rande des Verkehrsweges befinden sich befestigte Flächen (OF), auf dem
Randstreifen zu dem westlich angrenzenden Westrhauderfehnkanal bzw. Hauptfehn-
kanal (FKK) sind Teilbereiche mit Scherrasen (GR) vorhanden. Weitere befestigte Flä-
chen umgeben die östlich der Straße gelegenen Gebäude. In den Hausgärten sind
Siedlungsgehölze aus teils einheimischen und teils nicht heimischen Gehölzarten
(HSE/HSN) sowie Ziergebüsche (BZN) vorhanden, am Straßenrand stehen einige Ein-
zelbäume (HBE) mit Stammdurchmessern von 0,3-0,4 m.
Angrenzend an das im Nordwesten des Plangebietes gelegene Gebäude befindet sich
ein naturfernes Stillgewässer (SXZ) mit steilen Ufern und Holzverbau, das zur Haltung
von Hausenten genutzt wird. Eine Gewässervegetation ist außer einzelnen Wasserlin-
sen (Lemna minor) nicht entwickelt. Dieses Gewässer wird von einem Siedlungsgehölz
aus Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa), Birken (Betula spp.) und Hybridpappeln (Populus
spec.) sowie einem Unterwuchs aus Ziergehölzen wie z. B. Alpenrose (Rhododendron
spp.) und Ranunkelstrauch (Kerria japonica) umgeben. Der Gehölzbestand geht im öst-
lichen Verlauf in einen Erlenwald (WU) über. Dieser weist Fragmente eines Bruchwal-
des auf, zählt aufgrund von Entwässerung und dadurch fehlender Kennarten jedoch
nicht zu den nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützten Biotopen.
Neben der Schwarz-Erle herrscht in Teilbereichen die Birke vor, vereinzelt treten Grau-
Erle (Alnus incana) und Hybridpappel hinzu. In der Strauchschicht hat sich die Brom-
beere (Rubus fruticosus agg.) ausgebreitet. Die Krautschicht wird vielfach von der Gro-
ßen Brennnessel (Urtica dioica) und lokal von der fremdländischen Goldnessel
(Lamium galeobdolon) dominiert. In etwas tiefer gelegenen Teilbereichen im Osten des
Waldes treten zunehmend Feuchtezeiger wie z. B. Flatterbinse (Juncus effusus), Rohr-
glanzgras (Phalaris arundinacea), Weißes Straußgras (Agrostis stolonifera) und Rasen-
schmiele (Deschampsia cespitosa) hinzu. Der Wald und die Gehölze werden von einer
Baumreihe (HBA) aus Hybridpappel, Schwarz-Erle und Birke gesäumt, die die nördliche
Plangebietsgrenze begleitet.
Den Erlenwald begrenzt im Süden und Osten ein nicht zügiger ca. 1-2 m breiter Graben
(FGR), der im östlichen Abschnitt auf bis zu 4 m aufgeweitet ist. Aufgrund starker Be-
schattung und vollständiger Austrocknung in niederschlagsarmen Phasen ist eine Ge-
wässervegetation nicht ausgebildet. Typische Arten sind Flatterbinse, Flutender
Schwaden (Glyceria fluitans) und teils Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus). Östlich
und südöstlich des Grabens schließt sich ein Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher
Standorte (BNR) aus vorwiegend Grauweiden (Salix cinerea) an. Dieses zählt zu den
nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopen.
Zwischen dem Sumpfgebüsch und den Siedlungsgehölzen hat sich auf einer ungenutz-
ten Fläche eine halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (UHF) einge-
stellt. Verbreitet finden sich Große Brennnessel und Rohrglanzgras, typisch sind auch
Flatterbinse und Kletten-Labkraut (Galium aparine). In diesem Bereich breiten sich zu-
nehmend Gehölze aus. Diese Sukzessionsgebüsche (BRS) setzen sich aus verschie-
denen Sträuchern wie z. B. Brombeere, Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Weide
(Salix spp.) und Späte Traubenkirsche (Prunus serotina) zusammen. Am nördlichen
Rand der Ruderalfläche stehen zwei Hybridpappeln mit sehr starkem Baumholz von ca.
0,8 m im Durchmesser.
Den Osten des Plangebietes nimmt ein nach § 30 BNatSchG geschütztes Rohrglanz-
gras-Landröhricht (NRG) ein. Neben dem dominanten Rohrglanzgras finden sich wei-
tere Arten feuchter bis nasser Standorte in unterschiedlichen Dichten. Zu diesen zählen
beispielsweise Wasserschwaden (Glyceria maxima), Schlanke Segge (Carex acuta),
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 10
Sumpf-Reitgras (Calamagrostis canescens) und Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphon-
dylium). Stellenweise treten vermehrt Arten halbruderaler Gras- und Staudenfluren, wie
Große Brennnessel, Kletten-Labkraut und Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus praten-
sis), auf. Innerhalb oder am Rande des Röhrichts stehen einige Einzelbäume und Ein-
zelsträucher (BE), unter denen die Weidenbüsche eine Entwicklung von Sumpfgebü-
schen initiieren. Teils kommen Brombeer-Gestrüppe auf, die auf lokal vorhandene et-
was trockenere Bodenverhältnisse hindeuten.
Parallel zu der südlichen Plangebietsgrenze verläuft ein regelmäßig trockenfallender
Graben (FGZ), der abschnittsweise von Baumreihen aus z. B. Schwarz-Erlen und Ge-
wöhnlichen Eschen (Fraxinus excelsior) oder Säulenpappeln begleitet wird. Am Rande
der Bundesstraße 438 befindet sich zudem eine Grünanlage (PZ) geringer Größe mit
Scherrasen und jungen Linden (Tilia spec.).
Die nördliche und östliche Plangebietsgrenze bildet das Burlage-Langholter-Tief. Der
stark ausgebaute Tieflandfluss (FZS) weist in diesem Abschnitt einen künstlichen Ver-
lauf auf und ist beidseitig verwallt. Den schmalen Ufersaum dominieren überwiegend
Große Brennnesseln, vereinzelt finden sich Sträucher von z. B. Weiden oder junge
Schwarz-Erlen. Unmittelbar nordwestlich des Plangebietes befindet sich an der Mün-
dung in den Hauptfehnkanal ein Siel (OWS) und damit ein Querbauwerk mit Staufunk-
tion in dem Fließgewässer. Die Deiche des Tiefs werden von Arten des Grünlandes (GI)
eingenommen, das von Weidelgras (Lolium perenne) und Gewöhnlichem Rispengras
(Poa trivialis) dominiert wird.
Auf der Nordseite des Tiefs befindet sich zum einen ein Wohnmobilstellplatz (PSC) und
zum anderen eine Brache einer nährstoffreichen Nasswiese (GNR), die zu den nach
§ 30 BNatSchG geschützten Biotopen zählt. Verbreitete Arten sind neben Wiesen-
Fuchsschwanz insbesondere Flatterbinse und Rohrglanzgras sowie stellenweise
Schlanke Segge und Rasenschmiele. Als Störungszeiger ist die Große Brennnessel
regelmäßig anzutreffen. Zwischen der Nasswiese und dem Wohnmobilstellplatz ver-
läuft ein Entwässerungsgraben, die Ostseite der Wiese begleitet eine Strauchhecke
(HFS) aus Weiden.
Östlich des Burlage-Langholter Tiefs schließt sich das Langholter Meer (SEF) an, einem
Altwasser mit Wäldern in der Aue. In erster Linie handelt es sich um sumpfigen Weiden-
Auwald (WWS) und teils um Erlen-Auwald (WET). Der gesamte Biotopkomplex ist nach
§ 30 BNatSchG gesetzlich geschützt und ist, wie auch die Nasswiese, Teil des Land-
schaftsschutzgebietes LSG-LER 14 „Langholter Meer und Rhauder
Vorkommen gefährdeter und besonders geschützter Arten im Plangebiet
In dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden keine nach der Roten Liste der
Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004) gefährdete
Pflanzenarten nachgewiesen. Mit der Sumpf-Schwertlilie tritt eine gemäß § 7 Abs. 2 Nr.
13 BNatSchG besonders geschützte Art auf. Streng geschützte Pflanzenarten gemäß
§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG wurden nicht festgestellt.
Für die Sumpf-Schwertlilie liegen insgesamt acht Fundortnachweise vor. Von diesen
entfallen sechs auf den Graben, der den Erlenwald im Süden und Osten begrenzt, und
die übrigen zwei auf den Graben an der südlichen Plangebietsgrenze. Überwiegend
handelt es sich um kleine Vorkommen von weniger als 1 m², an zwei Standorten sind
Bestände von 2-3 m² vorhanden.
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 11
Streng geschützte Pflanzenarten gemäß des Anhanges IV der FFH-Richtlinie traten
nicht auf. Hinweise auf Vorkommen dieser Arten liegen derzeit auch nicht vor, so dass
eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zu den Verboten des § 44 (1) Nr. 4
BNatSchG dementsprechend nicht erforderlich ist.
Bewertung
In Anwendung der Aktualisierung der „Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwendung
der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ nach BREUER (2006) wird eine Bewertung
der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes im
Plangebiet aus Sicht des Schutzgutes Pflanzen durch Wertstufen vorgenommen.
Für die Bewertung des Schutzgutes Pflanzen wird die nachfolgende fünfstufige Bewer-
tungsskala zugrunde gelegt.
Wertstufe Bedeutung des Bereichs für den Naturschutz
5 von besonderer Bedeutung
4 von besonderer bis allgemeiner Bedeutung
3 von allgemeiner Bedeutung
2 von allgemeiner bis geringer Bedeutung
1 von geringer Bedeutung
Tabelle 1: Bewertung der Biotoptypen (nach DRACHENFELS 2012)
Beschreibung Bedeutung / Bewertung
• Weiden-Sumpfgebüsch
nährstoffreicher Standorte Von besonderer Bedeutung Wst. 5
(BNR)
• Erlenwald entwässerter
Standorte (WU)
• Sonstiges naturnahes Suk-
zessionsgebüsch (BRS)
• Strauch-Feldhecke (HFS)
• Rohrglanzgras-Landröhricht
(NRG)
• Halbruderale Gras- und von allgemeiner Bedeutung Wst. 3
Staudenflur feuchter Stand-
orte (UHF)
• Siedlungsgehölz aus über-
wiegend einheimischen Ge-
hölzarten (HSE) / planungs-
rechtlich freigeräumte Flä-
che (vormals NRG, BNR,
WU)
• Nährstoffreicher Graben
(FGR)
• Sonstiger Graben (FGZ)
• Sonstiges naturfernes Still- von allgemeiner bis geringer Be-
Wst. 2
gewässer (SXZ) deutung
• Siedlungsgehölz aus über-
wiegend nicht heimischen
Gehölzarten (HSN)
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 12
Hinsichtlich der Umweltauswirkungen ist zu konstatieren, dass der Geltungsbereich
vorwiegend von Gehölzstrukturen sowie Röhrichtflächen eingenommen wird. Lediglich
im westlichen Teil des Plangebietes befinden sich bereits bebaute Bereiche.
Aufgrund der umfangreichen Versiegelung und Überbauung und dem damit einherge-
henden Verlust von Lebensräumen für Pflanzen sind die Umweltauswirkungen auf das
Schutzgut Pflanzen als erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten (vgl. Kap. 3.2.1).
3.1.3 Schutzgut Tiere
Für das Schutzgut Tiere gelten die übergeordneten Ziele wie für das Schutzgut Pflan-
zen (vgl. Kapitel 3.1.2).
Aufgrund der vorkommenden Landschaftsbestandteile und Strukturen sind neben den
aktuellen Bestand der Biotoptypen zusätzlich die im Planungsraum vorliegenden
faunistischen Wertigkeiten zu ermitteln und darzustellen. Daher wurden für Artengrup-
pen Brutvögel, Lurche und Fledermäuse faunistische Fachbeitrage erstellt, die der An-
lage zu diesem Umweltbericht zu entnehmen sind und deren Ergebnisse im Folgenden
zusammengefasst dargestellt werden.
Brutvögel
Methodik
Zur Erfassung der Brutvogelfauna wurden in den Monaten von März bis Juni 2017
sechs Ganzflächenbegehungen durchgeführt. Die Bestandsaufnahmen erfolgten im
Rahmen einer standardisierten Erfassung nach dem Verfahren der erweiterten Revier-
kartierung. Bei diesem Verfahren werden sämtliche relevanten territorialen Verhaltens-
weisen der Vögel erfasst und kartographisch festgehalten. Auf Grundlage der so erstell-
ten Tageskarten wurde für ausgewählte Zeiger- und Charakterarten der reale Brutbe-
stand ermittelt. Für häufige und weit verbreitete Singvögel erfolgten halbquantitative
Abschätzungen des Brutpaarbestandes.
Als Untersuchungsraum wurde ein erweiterter Untersuchungskorridor gewählt, der vom
Planungsraum ausgehend in nördliche und östliche Richtung im Radius von 100 m
sämtliche außerhalb des Wohnmobil-Stellplatzes gelegenen Grünland-Graben-Areale
sowie die im Umfeld des naturnahen Altwasser befindlichen Biotope des Landschafts-
schutzgebietes nördlich des Burlage-Langholter-Tiefs umfasst.
Ergebnisse
Von den 248 regelmäßig in Deutschland brütenden Vogelarten konnten im Untersu-
chungsraum 30 Arten (vgl. Tabelle 2) nachgewiesen werden, was 15,2 % der aktuell in
Niedersachsen und Bremen brütenden Spezies entspricht. Sämtliche erfasste Vogelar-
ten gehören zur denen im Landkreis Leer bodenständigen und regelmäßig brütenden
Spezies.
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 13
Tabelle 2: Liste der im Jahr 2017 im Untersuchungsraum nachgewiesenen Brutvögel.
Bedeutung der Abkürzungen: Häufigkeit = absolute Zahl der Brut- / Revierpaare (in arabischen
Zahlen) bzw. geschätzte Häufigkeitsklassen (in römischen Zahlen), wobei I = 1 Brutpaar (BP),
II = 2-4 BP, III = 5-10 BP und IV = >10 BP bedeuten. Nistweise: a = Bodenbrüter, b = Baum-/
Gebüschbrüter, G = Gebäudebrüter; RL T-W bzw. RL Nds.: Rote Liste der in der Naturräumli-
chen Region Tiefland-West bzw. in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel (KRÜGER
& NIPKOW 2015); RL D: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015); Ge-
fährdungsgrade: 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, / = derzeit nicht gefährdet, - = nicht
bewertet; Schutzstatus: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§
= streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG, s. Text.
∑ BP RL RL RL BNatSchG/
bzw. Hk- Nist- T-W Nds D BArtSchV
BRUTVÖGEL [AVES] Klasse weise 2015 2015 2015 2009
Stockente, Anas platyrhynchos III a / / / §
Jagdfasan*, Phasianus colchicus II a - - - §
Teichhuhn, Gallinula chloropus 1 a / / V §§
Ringeltaube, Columba palumbus IV b / / / §
Türkentaube, Streptopelia decaocto 1 b / / / §
Buntspecht, Dendrocopos major 2 b / / / §
Eichelhäher, Garrulus glandarius II b / / / §
Rabenkrähe, Corvus corone II G / / / §
Blaumeise, Parus caeruleus III b / / / §
Kohlmeise, Parus major IV b / / / §
Sumpfmeise, Parus palustris 2 b / / / §
Rauchschwalbe, Hirundo rustica 1 G 3 3 3 §
Fitis, Phylloscopus trochilus III a / / / §
Zilpzalp, Phylloscopus collybita IV a / / / §
Sumpfrohrsänger, Acrocephalus palustris 8 a / / / §
Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla IV b / / / §
Gartengrasmücke, Sylvia borin 4 b V V / §
Dorngrasmücke, Sylvia communis 2 a / / / §
Wintergoldhähnchen, Regulus regulus I b / / / §
Kleiber, Sitta europaea 1 b / / / §
Gartenbaumläufer, Certhia brachydactyla 2 b / / / §
Zaunkönig, Troglodytes troglodytes III b / / / §
Star, Sturnus vulgaris 4 b 3 3 3 §
Amsel, Turdus merula IV b / / / §
Singdrossel, Turdus philomelos III b / / / §
Rotkehlchen, Erithacus rubecula III a / / / §
Heckenbraunelle, Prunella modularis III b / / / §
Bachstelze, Motacilla alba II a/G / / / §
Buchfink, Fringilla coelebs IV b / / / §
Gimpel, Pyrrhula pyrrhula 2 b / / / §
Grünfink, Carduelis chloris II b / / / §
∑ 30 spp.* exkl. Neozoen
* = Neozoen (= Spezies, die direkt oder indirekt durch den Menschen eingeführt worden sind) wurden
hinsichtlich einer Gefährdung nicht bewertet; sie werden auch nicht zu der rezenten einheimischen Brutvo-
gelfauna gezählt (vgl. GRÜNEBERG et al. 2015, KRÜGER & NIPKOW 2015) und bleiben daher für die Bilanzie-
rung der Gesamtartenzahl unberücksichtigt.
Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich um größtenteils ungenutzte Bereiche mit
Waldflächen, Sumpfgebüschen, sonstigen Gehölzbeständen, Ruderalfluren und einem
Landröhricht. In nördliche und östliche Richtung schließt das Landschaftsschutzgebiet
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 14
LSG LER 14 „Langholter und Rhauder Meer“ an, das sich aus einem Mosaik aus ge-
schützten Biotopen zusammensetzt.
Aufgrund der vielfältigen Habitatstrukturen brüten im Untersuchungsraum Arten der ver-
schiedensten Vogelgruppen. Das Auftreten einzelner für halboffene Lebensräume cha-
rakteristischer Arten im Untersuchungsgebiet ist aufgrund des verhältnismäßig hohen
Anteils an naturnahen Strukturen zu denen Grünland-Graben-Areale ebenso gehören
wie das Landröhricht und das angrenzende Landschaftsschutzgebiet nicht ungewöhn-
lich (z. B. Dorn- und Gartengrasmücke, Stockente, Sumpfrohrsänger). Allerdings hat
sich im Plangebiet eine eigenständige Vogelwelt entwickelt, die sich zum Teil erheblich
von den übrigen Bereichen unterscheidet. Ursächlich hierfür sind der hohe Gehölzanteil
sowie die visuelle Abschirmung durch den Deich bzw. das Burlage-Langholter-Tief ge-
genüber der unmittelbar angrenzenden Landschaft. Entsprechend wird das Plangebiet
von Gehölzbrütern dominiert, zu denen auch Stammkletterer wie Gartenbaumläufer und
Kleiber gehören. Die beiden genannten Arten sind wie auch Buntspecht, Star und
Sumpfmeise als Höhenbrüter einzustufen.
Die kartographische Darstellung des Brutvogelbestandes zeigt eine relativ gleichmä-
ßige Verteilung der Reviere der dargestellten Brutvogelarten, wenngleich die an der
Westseite des Plangebietes vorhandenen besiedelten Bereiche aufgrund anthropoge-
ner Einflüsse gemieden werden, was ebenfalls auf den in der Nähe befindlichen Wohn-
mobilstellplatz zutreffen dürfte, der von stenöken Vogelarten nicht besiedelt wird. Hier
dominieren ausschließlich Allerweltsarten wie Amsel, Buchfink, Ringeltaube, Zaunkönig
und Zilpzalp. Es treten hier ebenso Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke und Rotkehl-
chen auf.
Sämtliche Brutvögel des Planungsraumes sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG be-
sonders geschützt; mit dem Teichhuhn kommt eine nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG
bzw. Anlage 1 Spalte 3 der BArtSchV streng geschützte Spezies vor. Nach der aktuellen
Roten Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel (KRÜGER & NIP-
KOW 2015) werden Rauchschwalbe und Star als regional und landesweit gefährdet ein-
gestuft. Mit der Gartengrasmücke wird eine Art auf der sog. Vorwarnliste geführt.
Unter Zugrundelegung der Roten Liste der gefährdeten Brutvögel Deutschlands (GRÜ-
NEBERG et al. 2015) gelten zwei Arten (Rauchschwalbe und Star) als gefährdet. Auf die
Vorwarnliste der bundesweit potenziell gefährdeten Brutvögel findet sich mit dem Teich-
huhn eine weitere Brutvogelspezies.
Lurche
Methodik
Die Erfassung der Lurchfauna erfolgte ebenfalls in den Monaten von März bis Juni 2017
und wurde im Rahmen der Brutvogelbestandserfassung über Sichtbeobachtungen, sys-
tematisches Absuchen des Eu- und Sublitorals der im Untersuchungsraum befindlichen
Gewässer und über die Registrierung von Rufaktivitäten durchgeführt. Ferner wurden
terrestrische Habitate in Form von Grünländern und Gehölzen auf potentielle Lebens-
räume von Amphibien untersucht.
Ergebnisse
Im Rahmen der Bestandsaufnahme der Lurchfauna konnte als einiger Vertreter die Erd-
kröte (Bufo bufo) erfasst werden. Diese Art lässt im Verlauf des Jahres eine deutliche
Bevorzugung von Waldbiotopen erkennen mit Verbreitungsschwerpunkt in Brüchen,
Auwäldern und sonstigen feuchteren Waldgesellschaften und auch feuchteren Grün-
landgesellschaften. In der offenen Landschaft ist sie an Büsche, Binsenbulte und hohe
Stauden gebunden.
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeGemeinde Rhauderfehn – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 9.35 und
58. Änderung des Flächennutzungsplans 15
Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes konnten keine Fundnach-
weise von Lurchen erbracht werden. Die o. g. Erdkröte wurde nördlich des Burlage-
Langholter-Tiefs am Rand einer Nasswiese erfasst.
Die Erdkröte gilt nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG als besonders geschützt. In Nieder-
sachsen und Bremen wird die Erdkröte als ungefährdet eingestuft (PODLOUCKY & FI-
SCHER 2013); auch auf Bundesebene besteht für diese Spezies aktuell keine Gefähr-
dung (KÜHNEL et al. 2009).
Fledermäuse
Methodik
Zur Untersuchung der Fledermausfauna wurden insgesamt vier Detektorbegehungen
im Zeitraum von Juni bis September 2017 durchgeführt. Ergänzend wurden an allen
Terminen je zwei stationäre Horchkisten aufgestellt. Die Begehungstermine sind in Ta-
belle 3 dargestellt.
Tabelle 3: Begehungstermine und Witterungsbedingungen
Monat Datum Sonnenun- Von Bis Witterungsbedingungen
tergang
Juni 26.06 22:04 21:00 04:30 18 °C, W 1-2 Bft, abnehmend, klarer Himmel
Juli 21.07 21:46 21:30 05:00 21 °C, ONO 2 Bft.
August 24.08 20:44 20:30 05:45 23 – 15 °C, W < 2Bft, ½ bewölkt
14 °C, W bis S < 2 Bft, bewölkt, leichter Regen
September 17.09 19:54 19:00 01:00
bei Sonnenuntergang
Zudem wurde das Gebäude im Südwesten nach der ursprünglichen Kartierung auf ein
mögliches Fledermausquartier untersucht. Das Gebäude wurde von innen und außen
kontrolliert. Dabei ergaben sich jedoch keine Hinweise auf die Anwesenheit von Fleder-
mäusen oder eine vergangene bzw. aktuelle Nutzung.
Ergebnisse
Im Untersuchungsraum konnten insgesamt sieben Fledermausarten aus zwei Arten-
gruppen erfasst werden. In Hinblick auf die Artengruppe Plecotus lassen sich zwei Arten
anhand von Detektorerfassungen nicht unterscheiden. Aufgrund der bislang bekannten
Verbreitung der Arten ist jedoch davon auszugehen, dass es sich bei der im Plangebiet
des vorliegenden Bebauungsplanes erfassten Art um das Braune Langohr (Plecotus
auritus) handelt. Das Artenspektrum im Geltungsbereich ist in Tabelle 4 dargestellt.
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 RastedeSie können auch lesen