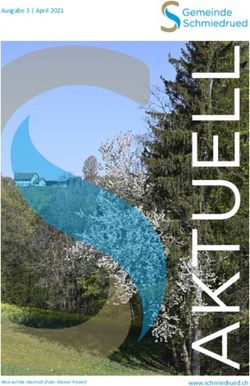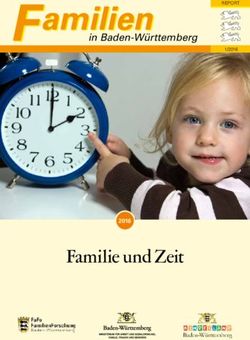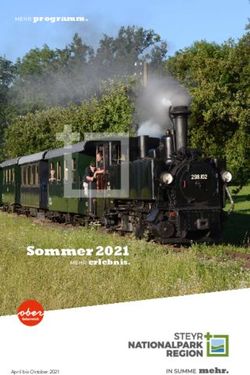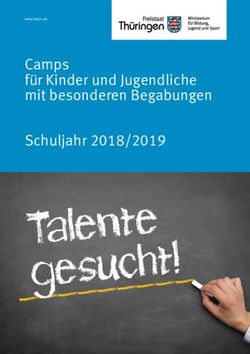VERBAND ALLEINERZIEHENDER MÜTTER UND VÄTER LANDESVERBAND SAAR E. V - Info III 2018
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
VERBAND
ALLEINERZIEHENDER MÜTTER
UND VÄTER
LANDESVERBAND SAAR E. V.
Info III - 2018
VAMV Landesverband Saar e.V.
Gutenbergstr. 2 a, 66117 Saarbrücken
0681 – 3 34 46 FAX: 0681 – 37 39 32
E-mail: info@vamv-saar.de
www.vamv-saar.deInhaltsverzeichnis
Abgabetermin für das nächste Info: 15.August 2018
Titelseite 1
Inhaltsverzeichnis 2
Tag der offenen Tür 40 Jahre OV SB 3
Familienfest 40 Jahre OV SB 4
Was sich in 2018 alles ändert 3
Kinderarmut 5
Wechselmodell 6
Sozialleistungen erhöhen 7
Ehegattensplitting 8
Neue Regelungen bei der Steuererklärung 9
Ehrenamt – Meldepflicht beim Finanzamt 10
Machen Sie mit bei der EVS 2018 11
Familienfreundlichen Arbeitszeiten 12
Alisch 13
Regelungen des Arbeitszeitgesetzes 14
Kinder 15
Urteile 21
Dies und Das 25
Termine OV Saarbrücken 26
Kontaktstellen 30
Termine LV 31
Grundsatzprogramm 32
Forderungen 33
Vorstand 35
Sparkasse 36
zu bestellen: Ratgeber:
Alleinerziehend - Tipps und Informationen
22. Auflage 2016 Versandkosten 5,-- Euro
Impressum: Herausg.: VAMV Landesverband Saar e. V.
Auflage: 900 Stück
Erscheinungsweise: viermal jährlich (Januar, April, Juli, Oktober)
Redaktion: Lydia Oschmann
Verantwortlich: VAMV Landesvorstand
Mitwirkende: Cornelia Norheimer, Ursel Theres, Jürgen Pabst
-2-Einladung
40 Jahre
Ortsverband Saarbrücken
Tag der offenen Tür
Donnerstag 13.09.2018
Ab 11.00 Uhr in der
Gutenbergstr. 2 a in Saarbrücken
Anlässlich unseres 40-jährigen Bestehens laden wir Sie
herzlich ein, auf 40 Jahre unserer ehrenamtlichen Arbeit
zurückzublicken und sich ein Bild von
Themenschwerpunkten und Anliegen zu machen, die
uns am Herzen liegen.
Sie erfahren mehr über unsere durchgeführten und
geplanten Aktivitäten und Lernen uns bei einem kleinen
Imbiss und in einem persönlichen Gespräch kennen.
Wir freuen uns auf Sie!
Der Vorstand
-3-Ortsverband
Saarbrücken
lädt ein zum Familienfest
40 Jahre
Ortsverband Saarbrücken
Sonntag 23.09.2018
Ab 11.00 Uhr erwartet in der
Gutenbergstr. 2 a in Saarbrücken alle
Besucher ein Kunterbuntes Programm
Überraschungsvorführung, Musik, Information,
Gespräche – für Unterhaltung ist gesorgt.
Kinderaktionsprogramm, Kinderbasteln,
Kinderolympiade – lassen Kinderherzen höher
schlagen
Kuchenbuffet, Grill, Getränke und andere
Gaumenfreuden – für das leibliche Wohl ist zu
zivilen Preisen gesorgt.
Schaut vorbei! Wir freuen uns auf euch!
Der Vorstand
-4-Alleinerziehende: GroKo-Maßnahmen gegen
Kinderarmut dürfen keine Luftnummer werden!
Berlin, 13. März 2018. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter
e.V. (VAMV) begrüßt, dass die neue Regierung das Thema Kinderarmut
auf die Agenda setzen will. „Allerdings müssen die Maßnahmen gegen
Kinderarmut so gestrickt sein, dass sie bei Alleinerziehenden
ankommen können. Sonst wird das Paket gegen Kinderarmut eine
Luftnummer“, mahnt Erika Biehn, VAMV-Bundesvorsitzende.
Die geplanten höheren Leistungen für Familien verpuffen für viele
Alleinerziehende, da sie verrechnet werden: Das Kindergeld soll um 25
Euro erhöht werden – aber im gleichen Zuge sinkt der Unterhalts-
vorschuss oder das Hartz IV-Geld. Der Kinderzuschlag soll als Maß-
nahme gegen Kinderarmut steigen – aber solange Unterhaltsvorschuss
und Unterhalt diesen mindern, wird er nicht die Armut von
Alleinerziehenden und ihrer Kinder senken. Der Ausbau des
Unterhaltsvorschuss hatte dieses Problem sogar ausgeweitet.
Familienförderung über höhere Steuervorteile kommt bei Familien mit
kleinen Einkommen nicht an. Alleinerziehende haben mit 44 Prozent
das höchste Armutsrisiko aller Familien. Nach neuen, realitätsge-
rechteren Berechnungen liegt es sogar bei 68 Prozent.
„Unterm Strich fallen Alleinerziehende weiter durchs Raster“, bemängelt
Erika Biehn. „Statt rechte Tasche – linke Tasche zu spielen, braucht es
kurzfristig eine Reform des Kinderzuschlags. Alleinerziehende mit wenig
Geld haben nur etwas von einem höheren Kinderzuschlag, wenn
Unterhaltsvorschuss oder Unterhalt nicht mehr angerechnet werden. Die
neue Regierung muss dieses Problem lösen, ansonsten gehen die
geplanten Maßnahmen gegen Kinderarmut wieder einmal an der
Mehrheit der armutsbetroffenen Kinder vorbei“, unterstreicht Biehn.
„Wenn die Politik Alleinerziehende und ihre Kinder wirklich aus der
Armut holen will, muss sie außerdem eine gebührenfreie und tatsächlich
bedarfsgerechte Infrastruktur für Bildung und Betreuung bereitstellen.
Wir begrüßen, dass die neue Bundesregierung weitere Schritte in diese
Richtung machen möchte“, so Biehn.
Eine aktuelle Umfrage zur Wirkung des erweiterten Unterhaltsvorschuss
finden Sie unter www.vamv.de.
VAMV BV Berlin März 2018
-5-VAMV: Wechselmodell nur einvernehmlich sinnvoll
Berlin, 23. Mai 2018. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.
V. (VAMV) veröffentlicht heute ein Positionspapier zum Wechselmodell.
Der Bundestag berät zur Zeit über Anträge und gesetzliche
Änderungswünsche hierzu. Wenn der Gesetzgeber das Wechselmodell
als Regelfall vorgibt, verhindert er damit jedoch die jeweils beste Lösung
für das Kindeswohl im individuellen Einzelfall.
„Das Wechselmodell ist sehr anspruchsvoll. Als gesetzliches Leitmodell
für alle Familien eignet es sich deshalb nicht. Bei vielen getrennt
lebenden Eltern liegen die notwendigen Rahmenbedingungen nicht vor,
besonders nicht bei Eltern, die sich streiten. Ihnen ein Betreuungsmodell
zu verordnen, das besonders viel Kommunikation und Kooperation
erfordert, wird dem Wohl der betroffenen Kinder nicht dienen“, erläutert
Erika Biehn, VAMV-Bundesvorsitzende. „Aus psychologischer Sicht ist
nicht die Quantität, sondern die Qualität des Kontaktes entscheidend.
Generelle Vorteile eines Wechselmodells für Kinder hat die Forschung
bislang nicht gefunden.“
Auch die Lebensverlaufsperspektive findet zu wenig Beachtung. Gerne
ist die Rede von Eltern, die sich bereits vor der Trennung Erwerbs- und
Sorgearbeit gleichmäßig aufteilen. Diese jedoch kann man in
Deutschland mit der Lupe suchen: „In über 80 Prozent der Familien mit
Kindern ist der Mann der Hauptverdiener. Die Mütter übernehmen dafür
den Löwenanteil an der Kindererziehung und gehen – im Gegensatz zu
den Vätern – selten mit einer existenzsichernden Berufstätigkeit in die
Trennung“, so Biehn. Hier sieht der VAMV Handlungsbedarf: Eltern, die
ein Wechselmodell leben möchten, brauchen faire Unterhaltslösungen,
die weder das Kind noch den ökonomisch schwächeren Elternteil
benachteiligen.
Ein Betreuungsmodell sollte in erster Linie den Bedürfnissen des Kindes
und nicht der Gleichstellung der Eltern dienen. „Das Umgangsrecht
verzichtet bislang aus guten Gründen auf eine Festlegung von
Betreuungsanteilen, um individuelle Lösungen zum Wohl des Kindes zu
ermöglichen“, betont Biehn. „Das sollte im Interesse der Kinder auch so
bleiben. Das Umgangsrecht ist nicht der richtige Ort für
Gleichstellungspolitik. Diese muss zu Beginn des Familienlebens
ansetzen und nicht nach der Trennung.“
Das Positionspapier ist als Download auf www.vamv.de verfügbar.
VAMV BV Mai 2018
-6-Arme Menschen nicht gegeneinander ausspielen
Sozialleistungen endlich erhöhen
Gemeinsame Erklärung vom 6. März 2018
Die momentan geführte öffentliche Diskussion um eine Tafel zeigt, dass
arme Menschen nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen.
Sozialstaatliche Leistungen müssen dafür sorgen, dass für alle hier
lebenden Menschen, gleich welcher Herkunft, das Existenzminimum
sichergestellt ist. Es ist ein Skandal, dass die politisch Verantwortlichen
das seit Jahren bestehende gravierende Armutsproblem verharmlosen
und keine Maßnahmen zur Lösung einleiten. Damit drohen neue
Verteilungskämpfe.
Die Zahl derer, bei denen Einkommen und Sozialleistungen nicht im
Mindesten ausreichen, um Armut zu verhindern, wird zunehmend
größer. Es betrifft Wohnungslose, in Altersarmut Lebende, prekär
Beschäftigte, Alleinerziehende, Erwerbslose und Geflüchtete.
Wieder einmal wird sichtbar, worauf Fachleute seit Jahren hinweisen:
Die Regelsätze in Deutschland sind zu gering bemessen, um
grundlegende Bedürfnisse abzudecken. Für Ein-Personen-Haushalte
und Alleinerziehende sieht der Hartz IV-Regelsatz täglich 4,77 Euro für
Essen und alkoholfreie Getränke vor. Für Kinder im Alter unter sechs
Jahren sind 2,77 Euro vorgesehen, für Kinder von sechs bis 14 Jahren
Dass Menschen, egal welcher Herkunft, überhaupt die Leistungen der
Tafeln in Anspruch nehmen müssen, ist Ausdruck politischen Versagens
in diesem reichen Land. Die Ehrenamtlichen der Tafeln vor Ort dürfen
nicht länger dazu dienen, armutspolitisches Unterlassen auszugleichen.
Die Sicherung des Existenzminimums ist Aufgabe des Sozialstaates
und nicht privater Initiativen und ehrenamtlichen Engagements.
Wir fordern die zukünftige Bundesregierung auf, die Regelsätze in Hartz
IV und der Sozialhilfe auf ein bedarfsgerechtes und existenzsicherndes
Niveau anzuheben. Dies muss auch für die Leistungen für Geflüchtete
gelten, die bisher sogar noch niedriger sind. Sozialleistungen müssen
nicht nur das nackte Überleben, sondern auch ein Mindestmaß an
Teilhabe ermöglichen.
Mehr Informationen unter: der-paritaetische.de/aufruf
-7-60 Jahre sind genug
VAMV NRW verabschiedet Resolution
gegen das Ehegattensplitting
Die Bundesrepublik hat vor 60 Jahren das Ehegattensplitting als ein
Besteuerungsverfahren für Eheleute eingeführt. Die
Mitgliederversammlung des VAMV NRW hat nun festgehalten, dass die
staatliche Förderung in Höhe von jährlich insgesamt 24 Milliarden Euro
ausdrücklich nicht an das Vorhandensein von Kindern gebunden ist,
sondern an den Trauschein. Das Ehegattensplitting ist damit keine
Familienförderung. Die Mitgliederversammlung des VAMV NRW
beurteilt das Ehegattensplitting als ungerecht und fordert die Politik auf,
eine gerechte Förderung für alle Familien einzuführen. „Das
Ehegattensplitting war nie als Familienförderung gedacht“, sagt Nicola
Berkhoff, Vorstandsfrau des VAMV NRW. „Tatsächlich hat die Politik es
genutzt, um die Erwerbsarbeit für Frauen unattraktiv zu machen“. Ein
Ziel, das kein Politiker heute noch ernsthaft verfolgen würde.
Wer heute Familien fördern möchte, kann nicht mit Steuermodellen wie
Ehegatten-oder Familiensplitting arbeiten. In beiden Modellen werden
Kinder nicht gleichbehandelt, sondern am Einkommen der Eltern
gemessen. Eltern, die viel verdienen, bekommen eine hohe Entlastung
für ihr Kind; wer wenig oder gar nichts verdient, dem bleibt nur das
Kindergeld. „Wir brauchen einen Systemwechsel hin zu einer
Förderung, die vom Kind ausgeht, wie es beispielsweise die
Kindergrund-sicherung macht“, fordert deshalb Nicola Berkhoff. In der
Kindergrundsicherung in Höhe von 619 Euro im Monat sind sämtliche
kindbezogenen Transfers wie Sozialgeld, Kindergeld,
Unterhaltsvorschussleistungen, Kinderzuschlag usw. zusammengefasst.
Die Kindergrundsicherung schafft im Gegensatz zu den genannten
Steuermodellen soziale Gerechtigkeit und stellt eine direkte Förderung
von Kindern dar, unabhängig von Familienform und Einkommen der
Eltern.
VAMV NRW 22.03.2018
-8-Neue Regelungen bei der Steuererklärung
Fast jeder hat damit zu tun, keiner macht sie gern, aber in vielen
Fällen ist sie nicht nur notwendig, sondern sogar noch äußerst
nützlich: die Steuererklärung. Die Steuerberater in Ihrer Nähe
erklären Ihnen, weshalb das so ist. PR/bo
Jedes Jahr im Frühjahr stöhnen die Arbeitnehmer, Selbstständigen und
Freiberufler Deutschlands auf: Die Steuererklärung steht an. Dann heißt
es wieder, gesammelte Belege sortieren, sich über rechtliche
Änderungen informieren, Fristen einhalten und sich mit dem zu-
ständigen Finanzamt in Verbindung setzen. Gerade Gesetzesände-
rungen hat nicht jeder Berufstätige auf dem Schirm. Dabei machen die
Experten in Ihrer Nähe darauf aufmerksam, dass sich für Steuer-
erklärungspflichtige diesbezüglich einiges zum Positiven geändert hat.
Eine der wichtigsten Änderungen für Arbeitnehmer, die seit diesem Jahr
gilt, ist wohl die, dass man grundsätzlich keine Belege mehr vorzeigen
muss. Man muss zwar weiterhin sammeln, aber der postalische Weg
ans Finanzamt bleibt einem vorerst erspart und gilt nur noch auf
Nachfrage. Vor allem bei Nachweisen über Spenden kommt einem das
zugute. Die Fachleute weisen jedoch darauf hin, dass man Belege bis
zu zehn Jahre nach Erhalt des Steuerbescheids aufheben sollte – so
lange dürfen Finanzämter nämlich danach fragen.
Neu ist auch, dass gemeldete Rechtschreibfehler von der
Steuerverwaltung geändert werden müssen. Wer das vorher innerhalb
der Einspruchsfrist erst merkt, hatte schlicht Pech. Mit der nun in Kraft
getretenen Änderung will man bei Schreib- oder Rechenfehlern
verhindern, dass falsche Angaben gemacht wurden. Die Finanzämter
dürfen den Steuerbescheid ab nun auch elektronisch an Sie übermitteln
– Ihr Verständnis natürlich vorausgesetzt. Das bringt den Vorteil mit
sich, dass Sie einen Einspruch ebenfalls elektronisch anzeigen dürfen.
Eine Statistik besagt, dass neun von zehn Arbeitnehmern bei einer
Steuererklärung noch „etwas herausbekommen“. Die Steuerberater
Ihrer Region erklären Ihnen, wie Sie Ihre Steuerlast ganz legal
vermindern können und was Sie im Regelfall absetzen dürfen.
Ein wichtiger Posten dabei sind die Werbungskosten. Darunter fällt im
Prinzip alles, was mit Ihrem Beruf zu tun hat: also beispielsweise Kosten
für Bewerbungen, Fortbildungen oder Reisekosten.
Die Experten raten Ihnen dazu, kurze Notizen auf der Rückseite von
Rechnungen zu machen. So erschließt sich dem Sachbearbeiter der
Zusammenhang schneller.
SZ 16.05.2018
-9-Ehrenamt
Meldepflichtig beim Finanzamt
Berlin. (dpa) Wer ehrenamtlich oder als freier Übungsleiter tätig ist und
dafür eine kleine Aufwandsentschädigung erhält, muss seine
Einkommensteuererklärung in diesem Jahr in authentifizierter Form ans
Finanzamt schicken. Das heißt, die Erklärung muss nicht nur
elektronisch versandt werden, es muss auch vorab eine Zertifizierung
beim elektronischen Finanzamt (www.elster.de) erfolgen. „Da die
Registrierung einige Tage in Anspruch nehmen kann, sollten Betroffene
sich rechtzeitig anmelden,“ rät Isabel Klocke vom Bund der
Steuerzahler.
Hinter der Änderung steckt die Pflicht, immer mehr Steuererklärungen
elektronisch an das Finanzamt verschicken zu müssen. Lediglich
Arbeitnehmer und Senioren, die keine weiteren Einkünfte haben, dürfen
die Papierformulare noch mit dem Stift ausfüllen. Kommen jedoch noch
ein paar Euro hinzu, beispielsweise aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit,
muss die Erklärung elektronisch authentifiziert versandt werden.
„Gerade für Arbeitnehmer, die nebenberuflich zum Beispiel in einem
Verein Kinder trainieren, ist die Neuerung ungewohnt“, sagt Klocke.
Denn in der Regel müssen sie für die Einnahmen aus der
Übungsleitertätigkeit oder der ehrenamtlichen Tätigkeit gar keine
Steuern zahlen. Für ehrenamtlich Tätige bleiben bis zu 720 Euro im
Jahr steuerfrei und für Übungsleiter sogar 2400 Euro. Dennoch müssen
die Einnahmen in der Einkommensteuererklärung eingetragen werden.
Wird die Tätigkeit nicht im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses
ausgeführt, besteht jetzt die Pflicht, am authentifizierten Verfahren
teilzunehmen. Die sogenannte komprimierte Steuererklärung, bei der
man die Erklärung zwar elektronisch ans Finanzamt sandte, dann aber
noch einen Papierausdruck mit seiner Unterschrift per Post
hinterherschickte, ist für selbstständige Übungsleiter und ehrenamtlich
Tätige Steuerzahler nicht mehr möglich. Die eigenhändige Unterschrift
wird durch die elektronische Signatur ersetzt. „Lediglich in Härtefällen ist
weiterhin eine Abgabe in Papierform erlaubt“, erklärt Klocke. Dies ist
etwa bei Rentnern denkbar, die keinen Computer zu Hause haben und
sich ehrenamtlich engagieren.
SZ 11.02.2018
-10-Machen Sie mit bei der EVS 2018
Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2018 ist eine
wichtige amtliche Statistik über die Lebensverhältnisse in Deutschland.
Sie liefert Informationen über die Einkommens-, Vermögens- und
Schuldensituation, die Konsumausgaben, die Ausstattung mit
Gebrauchsgütern sowie die Wohnsituation der privaten Haushalte.
Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Seit Januar 2018 führen bundesweit bereits viele tausend Haushalte für
drei Monate ein Haushaltsbuch. Dadurch verschaffen sie sich einen
guten Überblick über ihre persönliche Haushaltskasse und sind zugleich
Teil einer unverzichtbaren Informationsquelle für Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft. Um ein realistisches Bild über die Lebenssituation der
privaten Haushalte in Deutschland zu gewinnen, brauchen wir – die
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder – auch weiterhin Ihre
Unterstützung.
Wir bitten insbesondere um die Mithilfe von weiteren
Paarhaushalten mit Kindern
Alleinerziehendenhaushalten
Mehrgenerationenhaushalten
Haushalten von Selbstständigen oder Landwirten
Haushalten von Arbeitern
Haushalten von Nichterwerbstätigen (ausgenommen
Rentnern/Pensionären)
Haushalten mit einem Nettoeinkommen unter 1 700 Euro
Als Dankeschön für Ihre Teilnahme erhalten Sie eine Geldprämie.
Auskünfte: 0611 – 75-8880
-11-Familienfreundlichere Arbeitszeiten sind nötig
LÖSUNGSANSÄTZE Einige Vorschläge liegen vor
Arbeitszeit ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu realisieren. Nötig ist eine
Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die sich an den Bedürfnissen der
Arbeitnehmer orientiert.
Paare ohne Kinder arbeiten oft beide in Vollzeit. In Familien mit Kindern
oder pflegebedürftigen Angehörigen aber ergeben sich auf die Dauer
viele Probleme, wenn beide Partner weiter vollzeiterwerbstätig sein
wollen. Dazu gehören fehlende Flexibilisierungsmöglichkeiten der
eigenen Arbeitszeit, zeitlich nicht passende Strukturen von
Kinderbetreuungseinrichtungen oder fehlende Hilfe bei der Altenpflege.
Die Ergebnisse des AK-Betriebsbarometers 2017 belegen, wie selten
Arbeitszeitanpassungen in den Betrieben nach den Bedürfnissen der
Beschäftigten Anwendung finden. Die Summe dieser Faktoren lässt
Vollzeit für beide oft nicht weiter zu, beziehungsweise führt zu sehr viel
(Organisations-) Stress für alle Beteiligten. Auch wegen der
bestehenden Verdienstunterschiede kommt es daher bei
Familiengründung meist zu der typischen Aufteilung zwischen Vollzeit
beschäftigten Männern und Teilzeit arbeitenden Frauen. Diese als
kurzfristig geplante Arbeitsteilung lässt sich oft nicht mehr zurückdrehen
und führt in die klassische „Zuverdienerrolle“ der Frauen, die langfristige
Folgen für ihre Verdienst- und Karrierechancen bis hin zur mangelnden
Absicherung im Alter hat. Der Gedanke, unterstützende
Rahmenbedingungen zu schaffen, setzt sich im politischen Raum mehr
und mehr durch. Verstärkt wird die Entwicklung durch sich verändernde
Vorstellungen über Zeitsouveränität gerade in der jüngeren Generation
(„mehr Zeit für Familien“) und die gleichzeitig zunehmenden
Fachkräfteengpässe in der Wirtschaft. Diese macht auch aus Sicht der
Unternehmen attraktivere Arbeitsbedingungen (für Männer und Frauen)
notwendig. Es liegen inzwischen einige Vorschläge auf dem Tisch.
Das angestrebte Ziel ist, die Arbeitszeit stärker den Bedürfnissen der
Beschäftigten anzupassen und nicht umgekehrt
(„lebensphasenorientierte Arbeitszeit“). Die „Familienarbeitszeit“ wurde
2017 vom Bundesfamilienministerium präsentiert. In die gleiche
Richtung gehen die Forderungen der IG Metall in der Tarifrunde 2018.
Sie sehen ein Recht der Beschäftigten vor, aus familiären Gründen für
längstens zwei Jahre die Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden pro Woche
zu verkürzen. Zusätzlich sollen die Beschäftigten vom Arbeitgeber eine
gewisse finanzielle Kompensation erhalten, verbunden mit dem
-12-garantierten Rückkehrrecht auf Vollzeit. Ganz ähnlich sehen es die
Pläne zur Familienarbeitszeit vor: Hier sollen die Betroffenen mit
öffentlichen Leistungen unterstützt und speziell Alleinerziehende
berücksichtigt werden.
Wege aus der Teilzeitfalle
In der Diskussion ist aktuell ein gesetzlich zu verankerndes
Rückkehrrecht von Teilzeitbeschäftigten auf Vollzeit. Dieses soll das
Problem der Teilzeitfalle lösen („einmal Teilzeit, immer Teilzeit“) und
damit nicht zuletzt auch Männer stärker ermutigen, vorübergehend ihre
Arbeitszeit zu reduzieren. Ein solches Gesetz ist überfällig, jedoch
steckt der Teufel im Detail. So ist es für Beschäftigte und Betriebe wenig
praxistauglich, nach einer befristeten Teilzeit mindestens ein Jahr
Vollzeit vorzuschreiben, bevor eine erneute Teilzeit möglich wird. Eine
solche Regelung ginge an den Bedürfnissen der Beschäftigten vorbei
und würde hohe bürokratische Hürden schaffen. Schwierig wäre auch
eine Einschränkung auf Betriebe ab einer Größe von 45 Beschäftigten,
da gerade Frauen sehr häufig in kleineren Betrieben beschäftigt sind.
Gertrud Schmidt AN 1/18
Alisch
-13-REGELUNGEN DES ARBEITSZEITGESETZES
Geschützte Personen: Das Gesetz schützt Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten –
mit Ausnahme von leitenden Angestellten.
Was ist Arbeitszeit? Arbeitszeit ist die Zeit zwischen dem Beginn und
Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen. Auch Arbeits-bereitschaft und
Bereitschaftsdienst gelten in vollem Umfang als Arbeitszeit. Bei
Rufbereitschaft zählt jedoch nur die Zeit, in der die Beschäftigten zur
Arbeit herangezogen werden.
Tägliche Arbeitszeit (Rahmenbedingungen für flexible Arbeits-
zeiten): Grundsätzlich dürfen Arbeitnehmer täglich für acht Stunden
beschäftigt werden. Bis zu zehn Stunden täglich (auch samstags)
darf grundsätzlich nur gearbeitet werden, wenn im Schnitt innerhalb
von sechs Monaten nicht mehr als 48 Stunden in der Woche (sechs
Werktage zu je acht Stunden) gearbeitet wird.
Ruhepausen: Wenn über sechs und bis maximal neun Stunden
täglich gearbeitet werden, ist die Arbeit durch im Voraus fest-
stehende Ruhepausen von insgesamt mindestens 30 Minuten Dauer
zu unterbrechen. Jede Pause muss mindestens 15 Minuten dauern.
Wird über neun Stunden gearbeitet, muss die Gesamtdauer der
Pausen mindestens 45 Minuten betragen.
Nachtarbeit: Nachtarbeit liegt vor, wenn für wenigstens zwei Stun-
den in der Zeit von 23 bis 6 Uhr gearbeitet wird (in Bäckereien von
22 bis 5 Uhr). Nachtarbeitnehmer ist, wer innerhalb seiner
Wechselschichten normalerweise Nachtarbeit zu leisten hat oder wer
mindestens an 48 Tagen im Jahr Nachtarbeit leistet. Für die während
der Nachtzeit geleistete Arbeit muss dem Nachtarbeit-nehmer ein
angemessener Ausgleich in Freizeit oder Geld gewährt werden.
Sonntagsarbeit: An Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen
dürfen Arbeitnehmer grundsätzlich nicht beschäftigt werden. Nur
wenn die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden
können, dürfen Arbeitnehmer in verschiedenen Berufsfeldern
(Notdienste, Pflegeeinrichtungen, Gastronomie, Unterhaltung,
Fremdenverkehr, Presse und Rundfunk, Landwirtschaft, Reinigung,
Bewachung) an solchen Tagen beschäftigt werden. Es gibt auch
Ausnahmegenehmigungen, die seitens der Aufsichtsbehörde
aufgrund gesetzlicher Vorgaben erlassen werden können (wie bei
verkaufsoffenen Sonntagen im Einzelhandel etc.). Grundsätzlich
müssen 15 Sonntage pro Jahr frei bleiben. AK 1/18
-14-Kinder
Kindern droht Gefahr durch Handyspiele
Mainz (dpa) Bunte Bonbons zerplatzen lassen oder auf dem Skate-
board vor der Polizei fliehen: Spiele-Apps sind bei Kindern beliebt, aber
laut jugendschutz.net auch oft gefährlich. Die Internet-Fahnder des
Portals von Bund und Ländern haben 100 aktuelle Spiele-Apps unter die
Lupe genommen.
99 davon sind laut den Jugendschützern „hinsichtlich ihres Umgangs mit
Kinder-, Daten- und Verbraucherschutz kritisch“. Über 60 Prozent
zeigten derart gravierende Mängel, dass sie als „sehr riskant“ eingestuft
wurden.
Besonders gefährlich seien Spiele-Apps mit integrierten Kommunika-
tionsfunktionen. Keine einzige App habe ein ausreichendes Sicher-
heits- und Moderationskonzept geboten, so das Fazit der Jugend-
schützer. Damit seien Cybermobbing und auch Cybergrooming, bei dem
Minderjährige gezielt zu sexuellen Handlungen überredet werden sollen,
Tür und Tor geöffnet.
Viele Apps versuchen Kinder laut den Fahndern zu In-App-Käufen zu
verleiten. Kaum eine Spiele-App kennzeichne Werbung angemessen.
Nutzertracking, also die genaue Analyse des Surfverhaltens, und die
Datenweitergabe an Werbe- oder Marktanalysefirmen seien bei 90 der
100 geprüften Apps festgestellt worden.
Für Eltern, Erzieher und Lehrer hat jugendschutz.net eine eigene
Webseite entwickelt. Diese bewertet die Sicherheit bei beliebten Spiele-
Apps und gibt Tipps zur gefahrlosen Nutzung.
www.app-geprüft.net
SZ 12.04.18
Falls unterwegs etwas passiert:
Kindernotfallausweis immer dabei
In der dunklen Jahreszeit sind Kinder unterwegs besonders gefährdet.
Schnell passiert ein Unfall. Doch wer sind die Eltern, wie sind sie zu
erreichen, fragen sich die Helfer. Ein Kindernotfallausweis hilft weiter.
Eine Ablenkung, eine Unachtsamkeit - und schon ist das Unglück da.
http://www.pressways.de/service/schaeferkindernotfallausweisfront.jpg
-15-Wenn es für Kinder an Bord gefährlich ist
Berlin. In Österreich ist Rauchen im Auto künftig verboten, wenn Kinder
mitfahren. Das regt auch in Deutschland die Debatte um ein Verbot an –
das bislang scheiterte. Von Werner Kolhoff
Eigentlich wäre es nur ein Federstrich im Gesetz. Und genauso
vernünftig wie die Gurtpflicht oder das Handytabu am Steuer. Doch
beim Rauchverbot im Auto tut sich Deutschland notorisch schwer, selbst
wenn es nur auf Fahrten mit kleinen Kindern beschränkt wird. Nun geht
mit Österreich das erste deutschsprachige Nachbarland gegen die
Qualmerei beim Fahren vor – und die Debatte lebt auch hierzulande
wieder auf.
Ab Mai muss in der Alpenrepublik mit bis zu 1000 Euro Geldbuße
rechnen, wer in Gegenwart von Minderjährigen im Wagen raucht. Die
Liste allein der europäischen Länder, die solche oder ähnliche
Regelungen haben, wird damit immer länger: Frankreich, Griechen-land,
Zypern, England, Wales, Schottland, Irland. Und Italien, wo man sogar
mit 5000 Euro bestraft werden kann, wenn Schwangere oder Säuglinge
dem Qualm ausgesetzt sind. In Deutschland jedoch herrscht bisher die
Meinung vor, es handele sich beim Auto um einen privaten Raum, in
dem jeder tun und lassen kann, was er will.
Das vom Passivrauchen betroffene Kind freilich hat diese freie
Entscheidung nicht. In Autos mit ihrem geringen Raumvolumen entsteht
laut einer Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums durch
Rauchen eine Schadstoffbelastung, die dem Fünffachen einer
verräucherten Bar entspricht – und das sogar bei leicht geöffnetem
Fenster. Kinderlungen sind noch nicht ausgewachsen, die Gefahr von
Atemwegsproblemen und von Langzeitschäden ist groß. Bei Säuglingen
erhöht Passivrauchen nach Angaben der Forscher zudem die Gefahr
des plötzlichen Kindstodes.
Echte Gesetzesvorstöße hat es im Bundestag dennoch bisher nicht
gegeben, nur Meinungsäußerungen.
Auszug aus SZ 07./08.04.2018
-16-Schulranzen
Worauf Sie beim Kauf achten sollten
Ab der Einschulung begleitet der Schulranzen das Kind fast täglich über
mehrere Jahre hinweg. Gerade deshalb ist es wichtig, das passende
Modell zu wählen.
Kindern geht es beim Kauf eines Schulranzens meist nur um die Optik.
Für sie steht ein Ranzen mit cooler Farbe oder mit dem Lieblingsmotiv
im Vordergrund. Eltern sollten bei der Anschaffung auch Wert auf
andere Kriterien legen. Denn ein Schulranzen sollte in erster Linie
bestimmte Qualitäts- und Sicherheitsmerkmale erfüllen.
Achten Sie beim Kauf auf die Schulranzen-Norm DIN 58124
In dieser Norm sind vor allem entscheidende Punkte wie Breite des
Ranzens, Ergonomie und Schadstoffbelastung geregelt. Auch ein
geringes Gewicht und optimale Sicherheit spielen eine bedeutende
Rolle. So sollten sowohl an der Vorder- als auch der Rückseite des
Schulranzens fluoreszierende Flächen in Gelb und Orange angebracht
sein. Zusätzliche silberne Reflexstreifen ermöglichen außerdem eine
gute Erkennbarkeit im Dunklen.
Stabilität spielt eine wichtige Rolle
Beim Gewicht des Ranzens ist es wichtig, darauf zu achten, dass er
unbefüllt ein Gewicht zwischen ein bis 1,3 Kilogramm hat. Leichter sollte
er auf keinen Fall sein, da dem Material sonst möglicherweise die nötige
Steife und somit auch die Stabilität fehlt. Besonders im Rückenbereich
ist ein festes Material wichtig, um den Rücken des Kindes nicht unnötig
zu belasten.
Die Schultergurte sollten verstellbar sein
Ein falsch sitzender Schulranzen führt oft zu ungesunden Fehlhaltun-
gen. Deshalb ist eine Verstellbarkeit der Tragegurte besonders wichtig.
Optimal für einen bestmöglichen Tragekomfort sind breite (mindestens
drei Zentimeter), gepolsterte, stufenlos verstellbare Gurte, da sie das
Gewicht optimal verteilen und dafür sorgen, dass der Ranzen mit den
Schultern abschließt. Nehmen Sie Ihr Kind also am besten mit zum
Kauf. Denn nur bei einer Anprobe ist es direkt er-sichtlich, ob der
Ranzen gut sitzt und die Haltung des Kindes stimmt.
So schwer sollte der befüllte Schulranzen sein
Auch das Gewicht des befüllten Ranzens ist ausschlaggebend.
Generell sollte ein Gewicht von etwa zehn bis zwölf Prozent des
Körpergewichts des Kindes nicht überschritten werden. Anzeichen einer
Überlastung sind vor allem eine unnatürliche Veränderung der Haltung
beim Tragen des Ranzens, Rückenschmerzen oder Taubheitsgefühl in
-17-den Fingern. In solchen Fällen sollten die Eltern die Position des
Ranzens überprüfen oder sich gegebenenfalls schnellstmöglich um ein
passendes Ersatzmodell kümmern.
Es ist auch wichtig, wie der Ranzen gepackt ist
Doch nicht nur beim Kauf des Ranzens selbst sollten die Eltern auf-
merksam sein. In den ersten Wochen ist es wichtig, diesen gemeinsam
mit dem Kind zu packen. Denn: auch ein falsch gepackter Schulranzen
kann zu Rückenproblemen und Fehlhaltungen führen. Schwere Bücher
sollten deshalb am besten immer so nah wie möglich am Rücken liegen,
um unnötige Fehlbelastungen zu vermeiden.
Auszug aus Focus
Deutschland ist noch nicht kinderfreundlich genug
Unter anderem beim Bau von Spielplätzen werden
Kinderinteressen in Deutschland weitgehend ausgeblendet.
Berlin. Vom Bau von Spielplätzen bis hin zur Bildung: Die Interessen
des Nachwuchses werden immer noch viel zu wenig berücksichtigt, sagt
eine Studie. Von Stefan Vetter
Kindern im reichen Deutschland geht’s gut – sollte man meinen. Eine
aktuelle Untersuchung des Deutschen Kinderhilfswerks zum Stand der
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, die gestern in Berlin
vorgestellt wurde, kommt zu weniger rosigen Ergebnissen: Mangelnde
Förderung, Defizite bei Chancengleichheit und Mitbestimmung – in
Deutschland werden die Interessen von Kindern immer noch viel zu
wenig berücksichtigt.
Fast drei Jahrzehnte ist es jetzt her, dass die Kinderrechtskonvention
von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Nach den auch von
Deutschland ratifizierten Bestimmungen haben Kinder eigenständige
Rechte auf Gleichbehandlung, Bildung, Gesundheit und Freizeit. Das
Deutsche Kinderhilfswerk sieht bei ihrer Verwirklichung durchaus
-18-Fortschritte. In der „Gesamtschau“ müsse man jedoch feststellen, „dass
die deutsche Gesellschaft Kinderinteressen anhaltend ausblendet und
verdrängt“, kritisierte Verbands-präsident Thomas Krüger gestern bei
der Vorstellung einer entsprechenden Umfrage unter jeweils knapp
1600 Kindern und Eltern.
Demnach sagen zum Beispiel nur acht Prozent der Befragten, dass sie
beim Bau eines Spielplatzes von der Kommune um ihre Meinung
gebeten wurden. In die Planung von neuen Freizeitangeboten
insgesamt sieht sich kaum ein Fünftel angemessen eingebunden.
Große Defizite gibt es auch im Bildungsbereich. Fast ein Drittel der
Kinder und Jugendlichen geben an, dass die Fächer Politik und
Gemeinschaftskunde gelegentlich oder sogar häufig ausfallen. 39
Prozent sagen das über den Sportunterricht. Auch beim Internetzugang
an Schulen herrscht immenser Nachholbedarf. Immerhin 30 Prozent der
Schüler müssen darauf ganz verzichten. Und 21 Prozent sagen, Surfen
im Netz gebe es an ihrer Schule nur für bestimmte Altersgruppen. Jeder
dritte Schüler zwischen zehn und 17 Jahren bekommt dann auch
keinerlei schulische Informationen darüber, was man gegen Mobbing im
Internet tun könnte. Und mit dem Zustand der Schultoiletten ist
immerhin jeder zweite Befragte unzufrieden. Von den Eltern wiederum
geben lediglich 16 Prozent an, dass ihrem Kind eine kostenfreie
Nachhilfe an der Schule zur Verfügung steht.
Zur Kinderarmut hatte das Kinderhilfswerk bereits im Februar Zahlen
veröffentlicht. Demnach hat sich der Anteil der Betroffenen seit der
Einführung von Hartz IV vor 13 Jahren mehr als verdoppelt. Derzeit ist
jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Wie aus den aktuellen Daten
hervorgeht, betrachten drei Viertel der Eltern Unterstützungsangebote
für arme Familien und eine spezielle Förderung für betroffene Kinder
deshalb als „äußerst wichtig“ beziehungsweise „sehr wichtig“.
Union und SPD wollen nun „Kinderrechte im Grundgesetz ausdrücklich
verankern“. So steht es in ihrer Koalitionsvereinbarung. Kinderhilfswerk-
Präsident Krüger begrüßte das Vorhaben, zeigte sich aber „skeptisch“
über dessen Umsetzung. Um einen konkreten Formulierungsvorschlag
soll sich eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Bund und Ländern
kümmern. Darin müssten die Rechte aber auch tatsächlich benannt
werden, mahnte Krügers Stellvertreterin Anne Lütkes. Außerdem
dürften sie kein bloßes „Anhängsel“ im Grundgesetz sein.
Die aktuelle Untersuchung hat freilich auch zu Tage gefördert, dass die
meisten Eltern und Kinder die UN-Kinderrechtskonvention nur dem
Namen nach kennen. So sagt nicht einmal jeder vierte befragte
Erwachsene (23 Prozent) von sich, darüber „ganz gut“ im Bilde zu sein.
SZ 17.05.2018
-19-Jedes fünfte Kind im Saarland lebt von Hartz IV
Die Kinderarmut ist deutlich gestiegen. Das Problem ist im Saarland
größer als in anderen Bundesländern. Von Daniel Kirch
Trotz brummender Konjunktur und sinkender Arbeitslosenzahlen sind
immer mehr Kinder und Jugendliche im Saarland auf Hilfe vom Staat
angewiesen. Der Anteil der Unter-18-Jährigen, die Hartz IV beziehen, ist
zwischen 2012 und 2017 von 13,3 auf 19,6 Prozent gestiegen.
Kinderarmut ist im Saarland damit wesentlich stärker ausgeprägt als in
Westdeutschland (13,5 Prozent), wie die Antwort der Landesregierung
auf eine Anfrage der Linken zeigt. Am stärksten betroffen ist demnach
der Regionalverband Saarbrücken, am wenigsten der Landkreis St.
Wendel. Die Zahlen beziehen sich auf Juni17.
Besonders ausgeprägt ist das Armutsproblem bei kinderreichen
Familien und Alleinerziehenden. Mehr als 44 Prozent der Haushalte mit
drei und mehr Kindern sowie gut 39 Prozent aller Alleinerziehenden-
Haushalte im Saarland sind auf Hartz IV angewiesen.
Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Hartz IV beziehen, ist seit
2016 stark gestiegen. Die Landesregierung begründet dies mit dem
Flüchtlingszuzug. Sie erklärt, anerkannte Asylberechtigte müssten
möglichst schnell in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt integriert
werden. Alleinerziehenden will die Landesregierung auch durch eine
bessere Kinderbetreuung die Rückkehr in den Beruf erleichtern.
Außerdem sollen ab 2019 die Kita-Gebühren sinken.
Auszug aus SZ 18.03.18
Kinder sind so ausdauernd wie Leistungssportler
Sie rennen, springen, kicken ohne Pause und auf dem Bolzplatz
hecheln Erwachsene ihnen nach kurzer Zeit hinterher: Kinder vor der
Pubertät haben eine Durchhaltekraft wie Profi-Athleten. Was erschöpfte
Eltern lange ahnten, hat eine Studie von Wissenschaftlern der Uni-
versität im französischen Clermont-Ferrand ergeben, die im Journal
„Frontiers in Physiology“ veröffentlicht wurde. Fitness-Vergleiche einer
Gruppe von acht- bis zwölfjährigen Jungen mit untrainierten Erwachse-
nen sowie mit Ausdauersportlern zeigten: Kinder haben nicht nur
besonders Müdigkeitsresistente Muskeln, sondern erholen sich auch
schneller von hochintensivem Training. Das Forscherteam hatte dazu
Herzschlag-Raten, Sauerstoff- und Laktat-Werte aller drei Gruppen
gecheckt, die auf Trimmrädern ackern mussten. Die zwölf Jungen –
allesamt keine trainierenden Sportler – schlugen die zwölf untrainierten
Männer dabei um Längen und erzielten Werte, die mit denen der 13
Profi-Athleten vergleichbar waren. SZ 24.04.2018
-20-Urteile
Künftig kostenlose Rechtsberatung an
saarländischen Gerichten möglich
Menschen mit geringem Einkommen erhalten ab dem 1. Mai kostenlose
Rechtsberatung an saarländischen Gerichten. In den Räumlichkeiten
der Amtsgerichte Saarbrücken, Merzig und Neunkirchen werden dazu
anwaltliche Beratungsstellen eingerichtet, teilte das saarländische
Justizministerium mit. Eine entsprechende Vereinbarung haben gestern
der Präsident des Saarländischen Anwaltvereins (SAV), Olaf Jaeger,
und Justizminister Peter Strobel (CDU) unterzeichnet. Bürger, die nach
dem Beratungshilfegesetz Anspruch auf Unterstützung haben, sollen so
schnell und unbürokratisch Zugang zu anwaltlichem Rat erhalten.
„Viele Menschen glauben, sie könnten sich keinen Anwalt leisten. Doch
tatsächlich können sie es sich nicht leisten, sich keinen Anwalt zu
leisten“, sagte SAV-Präsident Olaf Jaeger. „Auch für Bedürftige, die
vielleicht Schwellenangst haben, eine Anwaltskanzlei aufzusuchen,
stellen sich Rechtsfragen, die nur mit anwaltlicher Beratung gelöst
werden können.“
Für die Qualität der Rechtsprechung sie es wichtig, dass Menschen sie
ohne unnötige Hürden und unabhängig von ihrem Geldbeutel in
Anspruch nehmen können, so Justizminister Peter Strobel. „Der Zugang
zum Recht beginnt nicht erst beim Zugang zu den Gerichten, sondern
schon beim Zugang zur rechtlichen Beratung.“ Darum wolle man es für
die Bürger einfacher machen, vor Gericht die eigenen Rechte
wahrzunehmen.
Die neuen anwaltlichen Beratungsstellen treten laut Justizministerium
als zusätzliches Angebot neben die bereits vorhandenen Formen der
Beratungshilfe. So hätten Bürger auch weiterhin die Möglichkeit,
zunächst bei Gericht einen Beratungshilfeschein abzuholen und dann
Rechtsberatung bei einem Rechtsanwalt in Anspruch zu nehmen.
Bundesweit böten bereits über 40 Anwaltvereine in Kooperation mit der
jeweiligen Landesjustizverwaltung anwaltliche Beratungsstellen an. Die
Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigten, dass die anwaltlichen
Beratungsstellen bei den Gerichten stark nachgefragt werden. Rund 40
Prozent der Fälle könnten dort unmittelbar in der anwaltlichen
Beratungsstelle erledigt werden, so das Justizministerium.
SZ 1. April 2018
-21-Mindestens zehn Stunden bezahlen ARBEIT AUF ABRUF
In den meisten Arbeitsverträgen ist festgelegt, wie viele Stunden jemand
arbeiten muss. Es geht aber auch ohne – bei der Arbeit auf Abruf. Dann
richtet sich die wöchentliche Stundenzahl danach, wie viel zu tun ist.
Arbeitnehmer haben bei solchen Verträgen aber Mindestrechte, erklärt
der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Steht im
Vertrag keine Stundenzahl, muss der Arbeitgeber pro Woche
mindestens zehn Stunden bezahlen – unabhängig davon, ob der
Arbeitnehmer sie tatsächlich geleistet hat. Eine Ausnahme gilt nur, wenn
die Arbeit auf Abruf in einem Tarifvertrag anders geregelt ist. Tmn
AK-Konkret 2/18
Antrag auf Teilzeit braucht keine Begründung
Mehr Zeit fürs Kind, einen Angehörigen pflegen oder einfach mehr
Freizeit: die Gründe für eine Teilzeit sind vielfältig. Sie müssen dem
Arbeitgeber auch nicht genannt werden. Es gibt aber andere
Einschränkungen.
Düsseldorf (dpa/tmn) - Arbeitnehmer haben grundsätzlich das Recht,
aus Vollzeit in Teilzeit zu wechseln. Einen Grund dafür müssen sie dem
Arbeitgeber nicht nennen, erklärt der Rechtsschutz des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB).
Ein paar andere Voraussetzungen gibt es aber: So besteht der
Anspruch auf Teilzeit zum Beispiel nur, wenn jemand länger als sechs
Monate bei einem Arbeitgeber mit mindestens 15 Mitarbeitern
beschäftigt ist. Angestellte müssen den Antrag spätestens drei Monate
vor Beginn der gewünschten Teilzeit einreichen.
Vorschriften zur genauen Ausgestaltung der Teilzeit gibt es aber nicht,
und auch zum Umfang der Arbeitszeit-Verkürzung macht das Gesetz
keine Angaben. Theoretisch sind damit den Angaben nach auch sehr
geringe Verkürzungen möglich, um wenige Stunden etwa.
Übertreiben sollte man es damit aber nicht - so wie im Fall eines Piloten
aus Hessen: Der wollte seine Arbeitszeit so verkürzen, dass er einen
zusätzlichen Tag pro Jahr frei hatte, nämlich um genau 0,21 Prozent.
Damit scheiterte er vor Gericht.
Merkur 25.04.2018
-22-Wirklich krank? ARBEITSUNFÄHIG
Beweislast liegt bei Arbeitgeber
Wer sich zu Unrecht arbeitsunfähig meldet, muss mit arbeitsrechtlichen
Konsequenzen rechnen. Hat der kranke oder vermeintlich kranke
Arbeitnehmer aber eine entsprechende Bescheinigung vom Arzt, liegt
die Beweislast beim Arbeitgeber. Darauf weist der Rechtsschutz des
Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hin. Konkret bedeutet das: Der
Arbeitgeber muss Argumente vorbringen, um die Glaubwürdigkeit der
Krankschreibung zu erschüttern. Das kann zum Beispiel die
Vorgeschichte der Arbeitsunfähigkeit sein – etwa dann, wenn der
Arbeitnehmer auffällig oft vor oder nach dem Wochenende
krankgeschrieben war. Hat der Arbeitnehmer im Streit mit „Dann bin ich
eben morgen krank!“ gedroht, ist das ebenfalls ein Anlass für Zweifel an
der Glaubwürdigkeit der Krankschreibung. Gleiches gilt unter
Umständen für die Teilnahme an einem Marathonlauf. Dabei kommt es
aber auf die Umstände der Krankheit an. Denn Sport ist nicht
grundsätzlich verboten, genau wie ein Einkaufsbummel – tabu ist nur
das, was der Genesung im Wege steht. Tmn AK-Konkret 2/18
Private Pakete ins Büro – geht das? ARBEITGEBER
ENTSCHEIDET Urlaub gibt es in der Regel für ganze Tage – und nicht
für zwei oder drei Stunden. Arbeitnehmer haben daher keinen Anspruch
darauf, ihren Jahresurlaub stundenweise zu nehmen. Das geht aus
einem Urteil des Landesarbeitsgerichts (LSG) BadenWürttemberg
hervor, über das der „Rechtsprechungs-Report Arbeitsrecht“ (3/2018)
berichtet. Ein Grund dafür ist, dass Urlaub vor allem zur Erholung dient,
so das Gericht. Deshalb seien Arbeitgeber verpflichtet, wenigstens
einen Teil der Urlaubstage zusammenhängend zu gewähren. Den
Jahresurlaub auf einzelne Stunden zu verteilen, widerspreche dem. tmn
„Wir haben Sie leider nicht angetroffen. Ihr Paket liegt in der Filiale.“ Es
gibt eine Alternative zu solchen nervigen Mitteilungen: sich Pakete
einfach an den Arbeitsplatz schicken zu lassen. Aber darf ich das
überhaupt? Erstmal nicht, sagt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für
Arbeitsrecht und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im
Deutschen Anwaltverein. „Der Arbeitgeber hat das Hausrecht und ist für
die Betriebsorganisation verantwortlich. Arbeitnehmer haben keinen
Anspruch darauf, dass er das erlauben muss.“ In der Praxis kann es
trotzdem erlaubt sein – auf zwei Wegen: erstens ausdrücklich, per
Aushang oder Rundmail etwa, oder zweitens durch die tatsächliche
-23-Handhabung. Die greift dann, wenn Mitarbeiter sich Pakete einfach
schicken lassen und der Arbeitgeber das toleriert. Die Erlaubnis kann
der Arbeitgeber allerdings widerrufen – und zwar nicht nur für die ganze
Belegschaft, sondern auch für einzelne Mitarbeiter. „Wenn jemand zwei
Päckchen im Jahr bekommt, ist das vielleicht was anderes als zehn
Pakete pro Woche“, sagt Oberthür. Mit der Erlaubnis handelt sich der
Arbeitgeber auch Pflichten ein. Denn er muss die Privatsphäre der
Mitarbeiter beziehungsweise das Briefgeheimnis wahren. Das bedeutet:
Es darf dann etwa keine Poststelle mehr geben, die aus
Sicherheitsgründen grundsätzlich alle Post öffnet und im Haus verteilt.
Tmn
AK-Konkret 2/18
Jobcenter muss für Schulbücher zahlen
URTEIL Schulbedarfspauschale reicht nicht aus
Die Kosten für Schulbücher muss im Zweifel das Jobcenter
übernehmen. Nach einer Entscheidung des Landessozialgerichts
Niedersachsen-Bremen (LSG) werden Bücher nicht von der
Schulbedarfspauschale umfasst. Daher gelten diese Ausgaben als
Mehrbedarfsleistungen, für die das Jobcenter aufkommen muss. In dem
verhandelten Fall bekam eine Schülerin der gymnasialen Oberstufe
Hartz-IV-Leistungen. Für neue Schulbücher sollte sie 135,65 Euro
zahlen und einen Taschenrechner für 76,94 Euro anschaffen. Diese
Kosten wollte sie vom Jobcenter als Zusatzleistungen zum Regelbedarf
erstattet bekommen. Das Jobcenter bewilligte mit dem
Schulbedarfspaket aber nur 100 Euro pro Schuljahr. Für eine konkrete
Bedarfsermittlung fehlte der Behörde eine Rechtsgrundlage. Das sah
das LSG anders: Bücher müssten grundsätzlich aus dem Regelbedarf
bestritten werden. Da dieser jedoch nur Kosten für Bücher jeglicher Art
von etwa drei Euro im Monat vorsehe, seien hierdurch weniger als ein
Drittel der notwendigen Schulbuchkosten gedeckt. Hierfür seien
gesetzlich auch sonst keine auskömmlichen Leistungen vorgesehen.
Der Gesetzgeber müsse aber das gesamte menschenwürdige
Existenzminimum einschließlich der Kosten des Schulbesuchs
sicherstellen, so die Richter. Die Kosten für den Taschenrechner seien
aber von der Schulbedarfspauschale abgedeckt. Ein solcher
Taschenrechner müsse nämlich nicht für jedes Schuljahr erneut
angeschafft werden. tmn Aktenzeichen L 11 AS 349/17
AK-Konkret 2/18
-24-Dies und Das
Portionsangaben sind oft unsinnig
VERBRAUCHERSCHUTZ
Die freiwillige Kennzeichnung von Portionsangaben auf
Lebensmittelverpackungen ist oft unsinnig und verwirrend, zeigt ein
Marktcheck der Verbraucher-zentralen (VZ). Sie haben bundesweit 211
Lebensmittel aus acht Produktgruppen überprüft. Teilweise rechnen die
Hersteller mit Miniportionen ihre zucker- und fettreichen Produkte
„gesund“. Anbieter und Gesetzgeber müssen nachbessern, damit
Angaben zu einer leicht verständlichen Einkaufshilfe werden, fordern die
Verbraucherschützer. Vor allem bei Süßwaren entsprechen die
Portionsgrößen meist nicht der Realität. Fruchtgummischlangen oder
Schokoladenriegel etwa werden für die Portionsangabe willkürlich
geteilt. „Wer isst nur ein Drittel eines Schokoriegels oder zwei Drittel
einer Fruchtgummischlange?“, kritisiert Barbara Schroeter,
Ernährungsreferentin bei der VZ Saar. Für Kekse nutzen die Hersteller
völlig uneinheitliche Portionsgrößen: 15 verschiedene Angaben
zwischen fünf und 44 Gramm. „In dieser Form bieten Portionsangaben
überhaupt keine Orientierung“, findet Schroeter. Die
Verbraucherzentralen fordern die Hersteller auf, nur realistische
Portionsgrößen wie einen Riegel, einen Becher oder eine Scheibe
anzugeben. Der Gesetzgeber sollte eine verständliche, farblich basierte
Nährwertkennzeichnung auf der Basis von einheitlichen Werten wie 100
Gramm oder 100 Milliliter auf den Weg bringen. red Foto: dpa/Panther
Media Eine Kassiererin klagte erfolgreich gegen eine Leiharbeitsfirma.
Aktenzeichen 1 Ca 2686/17
www.vz-saar.de
AK-Konkret 2/18
-25-Ortsverband Saarbrücken
Gutenbergstr. 2a, 66117 Saarbrücken, 0681 / 33 44 6
Sparkasse SB, IBAN: DE48 5905 0101 0000 0102 15
BIC: SAKSDE 55XXX
Jürgen Pabst Vorsitzender 0176/54511077
06898/380133
Beate Krebber-Wengler stellvertr. Vorsitz. 0681/41418
www.vamv-sb.de
Termine
Juli 2018
01.07. 11.00 Uhr Frühstück, Spielplatz auf
dem Rodenhof
15.07. 11.00 Uhr Frühstück,
Minigolf im DFG
August 2018
05.08. 11.00 Uhr Frühstück, Schwimmen
gehen
19.08. 11.00 Uhr Frühstück, Besuch
des Mittelalter-
marktes im DFG
26.08 Weltkindertag im
DFG (Helfer gesucht)
-26-Ortsverband Saarbrücken
September 2018
02.09. 11.00 Uhr Frühstück, Lernfest im DFG
09.09. 11.00 Uh Familientag im Saarbrücker ZOO
13.09. 11.00 Uhr Tag der offenen Tür - VAMV
16.09. 11.00 Uhr Frühstück, Minigolf im DFG
23.09. 11.00 Uhr Familienfest beim VAMV
40-jähriges Jubiläum
30.09. Besuch der SR 3 Landpartie
Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat 11 Uhr Frühstück
im Elterncafé.
Man kann auch ohne Teilnahme am Frühstück bei den
Unternehmungen mitmachen. Treffpunkt dann um 13 Uhr
beim VAMV!
Andererseits kann man auch nur zum Frühstück kommen.
Zu allen Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkommen.
ELTERNCAFE
Jeden Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr
Gutenbergstr. 2 a Saarbrücken
(Nähe Hauptstelle Sparkasse Am Neumarkt)
mit Kinderbetreuung
-27-Ortsverband Saarbrücken
Bericht von der Mitgliederversammlung des VAMV
Ortsverband Saarbrücken
Für den 27.01.2018 hatte der Vorsitzende Jürgen Pabst zur dies-
jährigen Mitgliederversammlung eingeladen.11 der 48 Mitglieder
nahmen daran teil. Die drei mitgekommenen Kinder wurden von Sarah
Hitti betreut. Der Vorsitzende legte einen reich bebilderten positiven
Bericht vor, der auch an alle Mitglieder versandt wird. Jürgen lobte auch
den unermüdlichen Einsatz der Vorstandsmitglieder im Elterncafé, das
52 Mal mittwochs geöffnet hatte. 390 Alleinerziehende und 179 Kinder
haben das Eltencafé besucht, sei es zum Plaudern oder um sich Rat zu
suchen.
Jürgen bekleidet das Amt des 1. Vorsitzenden seit 2012. Dem Vorstand
gehört er bereits seit 2001 an. Er ist auch Schatzmeister im VAMV -
Bundesvorstand und stellvertretender Vorsitzender im VAMV –Saar
Landesvorstand. Herzlichen Dank Jürgen.
Jürgen stellte sich erneut zur Wahl, appellierte aber an die Anwesen-
den sich über eine Neubesetzung dieses Amtes Gedanken zu machen.
Einen weiteren Kandidaten gab es nicht.
Auch die stellvertretende Vorsitzende, Beate Krebber- Wengler stellte
sich errneut zur Wahl in dieses Amt. Beates Engagement im Vorstand
reicht ebenfalls bis ins Jahr 2001 zurück. Von 2002 bis 2012 war sie
Vorsitzende und ist seitdem stellvertr. Vorsitzende.
Herzlichen Dank und viel Glück für die nächsten 2 Jahre.
Ruven kandidierte aus familiären Gründen nicht mehr für das Amt des
Schatzmeisters. Er bekleidete dieses Amt mit kurzer Unterbrechung seit
2008. Herzlichen Dank dafür.
Dafür stellte sich erfreulicherweise Pascal Scholtes als Schatzmeister
zur Verfügung. Pascal kennt sich auch beruflich gut mit Zahlen aus und
ist somit der richtige Mann für dieses Amt. Viel Glück Pascal!
Ursel erklärte sich bereit, weiterhin als Schriftführerin die Protokoll und
den Schriftverkehr zu erledigen.
Eva Stoewesand bleibt dem Vorstand als Beisitzerin erhalten.
Susanne stellte ihr Amt als Beisitzerin zur Verfügung, erklärte sich aber
bereit, den Vorstand auch weiterhin tatkräftig zu unterstützen. Dem
Vorstand gehörte sie seit 2012 an. Danke dafür Susanne.
-28-Ortsverband Saarbrücken
Mutig ließ sich Neumitglied Alberto LaLoggia als Beisitzer wählen.
Alle freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit bis 2020 und auf die
Feier des 40jährigen Bestehens des VAMV OV Saarbrücken.
Toi, toi, toi ! Ursel Theres
Die Mitglieder des Vorstandes, gewählt am 27.01.2018
Vorsitzender
Jürgen Pabst Tel.: 06898/ 380133
Kirchstr. 12 Handy: 017654511077
66126 Saarbrücken Email :juergen-pabst@web.de
Geb. : 28.06.53
Stellvertreterin
Beate Krebber-Wengler Tel.: 0681/ 41418
Schweringstr.5 Handy: 017650697288
66113 Saarbrücken Geb.: 30.09.1962
Schatzmeister
Pascal Scholtes Handy: 015128507021
Forbacherstr.53 Email:pascal.scholtes@gmx.de
66117 Saarbrücken Geb.: 08.09.1976
Schriftführerin
Ursula Theres Tel.: 0681 /79786
Mülhauserstr.27 Handy: 01703008050
66115 Saarbrücken Email: u-theres@t-online.de
Geb.: 09.01.1941
Beisitzerin
Eva Stoewesand Tel.: 0681/ 5959529
Lützowstr. 6 Handy: 016096245265
66119 Saarbrücken Email: evastoewesand@gmx.de
Geb.: 15.11. 1977
Beisitzer
Alberto LaLoggia Handy:015206834312
Hafenstr. 33
66111 Saarbrücken Geb.: 28.02.1982
Saarbrücken, 15.02.2018
-29-Sie können auch lesen