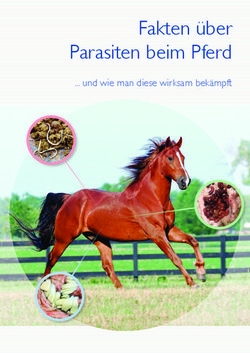Verleihung des Marie Luise Kaschnitz-Preises an Pascal Mercier
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gedankenabenteuer Verleihung des Marie Luise Kaschnitz-Preises an Pascal Mercier Pascal Mercier, der im bürgerlichen Leben Peter Bieri heißt, ist hauptberuflich Philosophie-Professor an der FU Berlin. In seinen Romanen thematisiert er die großen, existentiellen Fragen des menschlichen Lebens: das Sein, den Tod, die Zeit. Dabei will der Romancier die Bedingungen erforschen, unter denen wir zu der Person werden, die wir sind. Für sein literarisches Gesamtwerk verlieh ihm die Akademie im November 2006 den Marie Luise Kaschnitz-Preis. Pascal Mercier beschrieb kürzlich in einem Interview die Trennung zwischen dem Romancier und seiner Person als Professor mit den Worten: „Philosophie inszeniert Gedanken, das Schreiben inszeniert Personen. Die Philosophie versucht, eine Theorie zu verstehen. Das hat nur mit dem Kopf zu tun. Wenn man Figuren entwirft und sich imaginativ in diese versetzt, sind ganz andere Teile der Person beteiligt: Emotionen, Phantasie, Körper.“ Das „Spiel“ mit den Grundfragen menschlicher Identität liest sich in den Werken des Autors gedankenreich und unterhaltsam zugleich – eine seltene Erscheinung in der deutschsprachigen Literatur. Studienleiterin Roswitha Terlinden leitete die Tagung „Gedankenabenteuer“, die mit der Verleihung des Literatur-Preises endete. Nachfolgend ein Auszug aus der Laudatio von Professor Jürgen Trabant, Institut für Romanische Philologie an der FU Berlin, und aus der Dankesrede des Preisträgers: Jürgen Trabant ----------------------- Querido amigo Pascal, Quereria fazer este elogio em português, no idioma de Amadeu de Prado, do poeta e pensador criado por você, nesta língua melancólica que corresponde perfeitamente à sua reflexão linguística e á sua criacão poética. Mas, naturalmente, não é possivel, então volto ao alemão. Ich hoffe, es ist mir trotz meiner deutschen Zunge gelungen, Ihnen die samtene Schönheit jener Sprache kurz vor die Ohren zu führen, die eine der Hauptfiguren des dichterischen Werks von Pascal Mercier ist: portugues. Denn eigentlich müsste eine Lobrede auf Mercier auf Portugiesisch
gehalten werden, im Ton jener etwas melancholischen Tochter des Lateinischen, die keine laute Siegersprache ist, sondern das Instrument der einsamen Stimme eines Pessoa, den Pascal so liebt: Nicht nur das Salz im Meer sind – wie Pessoa dichtet - Tränen Portugals, lágrimas de Portugal, die Sprache selbst ist es nicht minder: lagrimas de Portugal. Die Sprache ist in einem Ausmaß Thema der Bücher von Pascal Mercier wie bei keinem anderen mir bekannten Schriftsteller. Die Bedeutung der Sprache zeigt sich schon an der ins Auge springenden Tatsache, dass die handelnden Personen „Sprachmenschen“ sind. Die Protagonisten der drei großen Romane haben alle sprachbezogene Berufe, und diese sprachliche Berufstätigkeit ist konstitutiver Bestandteil der Welt dieser Romane. Alle Hauptgestalten arbeiten an der Sprache, sie kultivieren die Sprache, sie sind ourives de palavras - Goldschmiede der Worte. Gepriesen wird von allen das sprachliche Raffinement. Perlmann bewundert sprachliche Raffinesse, und er ist selbst ein Meister derselben. Prado ist ein Stilist von hohen Gnaden. Gregorius ist fasziniert von der Eleganz der Prosa von Prado. Und Eleganz ist ein Schlüsselwort bei Pascal Mercier. Er lobt sie nicht nur, er schafft sie selbst. Als höchste Form der Sprache feiert auch Prado die Poesie: „Weißt du, das Denken ist das Zweitschönste. Das Schönste ist die Poesie. Wenn es das poetische Denken gäbe und die denkende Poesie – das wäre das Paradies.“ (NL) Diese Hauptakteure, aber auch die Mehrzahl der Mitspieler, sind des weiteren mehrsprachige Individuen. Das Beherrschen mehrerer Sprachen ist die normale geistige Ausrüstung der Menschen, die die Merciersche Welt bevölkern. Einsprachigkeit ist die Unfreiheit des Geistes Warum ist Mehrsprachigkeit das Normale und Einsprachigkeit für Mercier etwas Defizitäres oder gar Deviantes? Sprache ist zunächst Produktion des Denkens, oder: Sprache ist die Form, in der Menschen ihre Gedanken fassen. Und sie tun das in einer ganz bestimmten Sprache. Einsprachigkeit ist nun die Unfähigkeit, aus einer einmal gegebenen und einzigen geistigen Perspektive auszutreten, einen anderen Standpunkt einzunehmen, sich selbst, das Eigene, mittels der Gewinnung einer neuen Ansicht zu relativieren und sich durch neue Ansichten geistig zu bereichern. Einsprachigkeit ist sozusagen eine fundamentale Unfähigkeit, Alterität auch nur im Ansatz zu begreifen. Aber darum geht es: um das Andere bzw. um den Anderen. Das Motto von Perlmanns Schweigen heißt: „Die Anderen sind wirklich Andere. Andere.“ Das Andere zu denken und auf den Anderen hin zu leben ist dem Menschen aufgegeben. Deswegen kann der Mensch nicht in der ersten und einzigen Sprache bleiben, er muss diese Sprache erweitern, transformieren, kultivieren, er muss sie bearbeiten, und er muss sich auf Anderes öffnen. Hierzu bereiten die anderen Sprachen den Weg. Diejenigen, die nur im Eigenen verbleiben, schöpfen einfach die Möglichkeiten und Forderungen des Menschseins nicht aus. Perlmann bemerkt einmal über einen amerikanischen Kollegen (und über seine Eltern), dass dieser sich in seiner Sprache „suhle“. Er ist in dieser primitiven Sprachwonne ganz bei sich, er kennt keine Alterität, er lebt arrogant im Eigenen, im ídion, er ist ein Idiot. Der Einsprachige hat keinen Abstand von sich, er ist nicht frei. Anderssprachigkeit ist also Bedingung der Freiheit. Einsprachigkeit ist Unfreiheit des Geistes, ein Gefängnis des Geistes. Das Scheitern des Miteinandersprechens Mehrsprachigkeit als Bedingung von Freiheit ist die linguistische Grunderfahrung der Mercierschen Protagonisten. Und dies festzuhalten ist deswegen so wichtig, weil es durchaus nicht
selbstverständlich ist, dass die Vielfalt der Sprachen als etwas Positives erlebt wird. Dass die Vielfalt der Sprachen gar als „Freiheit“, Steigerung des Lebensgefühls, gefeiert wird, ist sogar etwas ganz und gar Ungewöhnliches. Gewöhnlicherweise wird die Existenz vieler Sprachen als Kommunikationshindernis beklagt, nicht als Möglichkeit der Bewusstseinserweiterung begrüßt. Die europäische Philosophie führt von Anfang an Klage über die Sprache, seit Platon verstellt sie die Wahrheit. Sprachlosigkeit ist der ersehnte Horizont der Philosophie. Sprachen sind epistemisch wertlos, und Mehrsprachigkeit ist daher eine überflüssige Belastung des Geistes. Erst die klassische deutsche Sprachphilosophie hat, seit Leibniz, Herder und Humboldt, die Vielfalt der Sprachen ins Positive gewendet und damit auch die Mehrsprachigkeit aufgewertet. Wenn, wie Wittgenstein es formuliert hat, die Grenzen meiner Sprache die Grenzen meiner Welt sind, so sprengt nichts so sehr diese Grenzen, so öffnet nichts so sehr diese Gefängnisse wie das Erlernen und Beherrschen anderer Sprachen. Auf diese helle Seite wirft die andere Dimension der Sprache ihren dunklen Schatten: Die kommunikative Dimension der Sprache birgt die Tragik der Sprache: Oder: Der Abgrund des Nichtverstehens verschlingt auch die noch so hoch entwickelte gedankliche und poetische Sprachlichkeit des Menschen. Man könnte auch sagen: Das Sprechen – wie herrlich und elegant es auch sei - rennt gleichsam immer wieder gegen die Wand des Nichtverstehens. Und dieses Scheitern des Miteinandersprechens macht den narrativen Kern der Mercierschen Bücher aus: Perlmann schweigt, der große Linguist kann nicht sprechen! Die Konflikte des Buches entstehen aus dieser Unmöglichkeit zu kommunizieren, Perlmann kann sich nur in die fremde Sprache flüchten, in den fremden Text, aber er findet nicht zu den Anderen. Prado kann das eigentliche, das große Gespräch nicht führen, das Gespräch mit dem Vater: Denn: „So ist es immer: einem anderen etwas sagen: Wie kann man erwarten, daß es etwas bewirkt?“ Es ist zum einen dieses Im-eigenen-Sprach-und–Gedankenstrom-Bleiben, das die Kommunikation verhindert. Damit verbunden ist zum anderen eine ungeheure Scham und eine Angst gerade der Sprachmenschen, sich den Anderen hinzugeben. „Denn wir offenbaren uns mit unseren Worten nicht nur, wir verraten uns auch“, schreibt Amadeu (416). Sie öffnen sich zwar auf das Andere, auf die fremden Sprachen, aber nicht auf den Anderen. „Die anderen sind wirklich Andere. Andere“. Ich bin meine eigene Grenze, du bist der Andere, auch wenn wir noch so schön, so viel, so vielsprachig reden. Literatur kann Sprachbarrieren überwinden Es gibt zwar noch einen letzten Versuch, die Grenze zu überwinden: das Schreiben nämlich. Die Schrift ist die Hoffnung auf Durchbrechung jenes autistischen Gedankenstroms, Hoffnung auf die Umleitung auf den inneren Strom des anderen, und die Schrift bannt die Angst vor dem Anderen, und sie lindert die Scham. Die Zwillinge schreiben auf, was sie sich nicht sagen können und sagen dürfen. Prado schreibt seinem Vater, der Vater schreibt seinem Sohn. Aber diese Schriften sind Flaschenposten, sie kommen nicht an: Die Hefte von Patrice und Patricia werden gestohlen, die Briefe von Amadeu und seinem Vater verfehlen die Adressaten, die Kommunikation bleibt unmöglich. Allerdings: Die Flaschenposten werden von anderen, Dritten, gelesen und das ist sozusagen die allerletzte Schicht der Sprache bei Mercier, die gleichsam die Hoffnung aufs Verstehen vertritt: das Lesen. Das Lesen der nicht angekommenen Briefe durch einen Dritten – die Literatur - ist eine gottgleiche, außermundane Instanz, in der sich das misslungene Gespräch doch noch ereignet: Die Leser vollenden die gescheiterte Kommunikation. Mercier schafft ja in der Figur des Gregorius den Leser als literarische Fiktion: Gregorius ist der Leser, der die misslungene Kommunikation der portugiesischen Gestalten in seiner Recherche und in seiner Lektüre doch noch zusammenfügen kann.
Aber damit übertreibt er gleichsam das Maß an Alterität, das ein Mensch ertragen kann: Er lernt Portugiesisch, er liest und übersetzt das portugiesische Buch, er liest die Briefe von Amadeu und seinem Vater, er hört zu, er vollendet nicht beendete Gespräche Anderer. Dabei ist er im Begriff, sich selbst zu verlieren. An einem bestimmten Punkt hält er die fremden Wörter nicht mehr aus: Er muss daher die Gegenstände mit ihren schweizerdeutschen Namen belegen. Und er muss zurückkehren. Er muss sich „suhlen“ – in seinem Dialekt. Im Inneren der differenzierten Sprachlichkeit der Mercierschen Menschen steckt die erste Sprache, die Sprache der Kindheit, als letzte Zuflucht. Ganz offensichtlich gibt es einen Punkt des Fremdwerdens, an dem der Verlust des eigenen Ichs droht: Das ist der Augenblick, an dem die erste Sprache, die Muttersprache, aufgesucht wird, an dem der Leser aus der Literatur ins Leben zurückkehren muss. Glanz und Elend menschlicher Sprachlichkeit Mercier preist die Sprachlichkeit des Menschen als das größte kosmische Ereignis, das Erscheinen des Denkens, er erzählt von der Vielsprachigkeit des Menschen als Möglichkeit der Erweiterung dieses Denkens und als Bedingung der Freiheit, er zielt auf höchste sprachliche Gestaltung: aufs poetische Denken. Und er zeigt doch das ewige Scheitern des Miteinandersprechens. Eine melancholische Sprachauffassung, zu der das Portugiesische so wunderbar passt, diese melancholische Tochter des imperialen Lateins: lágrimas de Portugal. Glanz und Elend menschlicher Sprachlichkeit in höchster, in poetischer Form. Das kann nur der Dichter, da kommt keine Sprachwissenschaft mit. Deswegen muss der Linguist nun auch verstummen und in vier kurzen Schlussbemerkungen den Dichter selbst zu Wort kommen lassen. Ich möchte vier Passagen vorlesen. Es sind Passagen zum Höchsten, dessen Sprache fähig ist. Und es sind Passagen von höchster poetischer Schönheit. 1. Zum Ursprung und zur kosmischen Macht der Sprache: „Wenn es im Universum nur ein Wort gäbe, ein einziges Wort, dann wäre es kein Wort, aber wenn es doch eines wäre, so wäre es mächtiger und leuchtender als alle Fluten hinter allen Horizonten.“ (NL 446) 2. Zu Denken und Poesie: „Weißt du, das Denken ist das Zweitschönste. Das Schönste ist die Poesie. wenn es das poetische Denken gäbe und die denkende Poesie – das wäre das Paradies.“ (NL) 3. Zur Poesie und Religion: „Não quero viver num mundo sem catedrais. Preciso da sua beleza e sublimidade. Preciso delas contra a vulgaridade do mundo. [...] Quero ler as palavras poderosas da Bíblia, preciso da força irreal da sua poesia. Preciso dela contra a degeneração da língua e contra a ditatura das frases feitas. Um mundo sem estas coisas seria um mundo no qual eu não quero viver.” Das sagt Amadeu auf Lateinisch - und wir lesen es im Buch auf Deutsch. Aber ich wollte es hier in jener Sprache zu Gehör bringen, in der es eigentlich gedacht ist: em portugues. 4. Und zu aller letzt zum Anfang, der das Wort war:
„Also ist das Wort das Licht der Menschen, sagte er. Und so richtig gibt es die Dinge erst, wenn sie in Worte gefaßt worden sind. Und die Worte müssen einen Rhythmus haben, sagte Gregorius, einen Rhythmus, wie ihn zum Beispiel die Worte bei Johannes haben. Erst dann, erst wenn sie Poesie sind, werfen sie wirklich Licht auf die Dinge.“ (460) Merciers Worte haben diesen Rhythmus, sie sind Poesie und werfen daher Licht auf die Dinge – vor allem auf eines der ganz großen Dinge der Welt: auf die Sprache. Dafür danken und bewundern und preisen wir ihn. Pascal Mercier ----------------------- Ende der achtziger Jahre hatte ich ein Forschungssemester. Es war die Zeit, als ich in der Heidelberger Universitätsbuchhandlung immer seltener vor den philosophischen Regalen stand und immer öfter vor den literarischen. Und so fuhr ich, statt zu forschen, nach Venedig. Es war November. Es begann zu dämmern, und wir gingen auf das Café zu, das es unten im Glockenturm an der Piazza San Marco gibt. Die Scheiben des Cafés waren beschlagen. Plötzlich begann eine Hand in einem Handschuh an der Scheibe zu reiben. Sie gehörte einer Frau, ihr Gesicht wurde jetzt sichtbar. Ich weiß nicht, wie sie ausgesehen hat, denn die reibende Frauenhand hatte eine Erinnerung in mir wach gerufen. Es war eine Erinnerung von enormer Wucht und ich weiß noch genau, dass sie von dem Gefühl begleitet war: Jetzt bricht etwas in dir auf, etwas, das Folgen haben wird. Ich blieb stehen. „Wie heißt das Buch von Alfred Andersch, in dem eine Frau in diesem Café hier die beschlagene Scheibe blank reibt?“, fragte ich meine Frau. „Die Rote“, sagte sie. Wir blieben nicht mehr lange in Venedig, der Ort hatte keine rechte Gegenwart mehr und ich spürte: Die lebendige Zeit würde erst in dem Moment weiterfließen, wo ich zu Hause auf dem Sofa das Buch von Andersch aufschlagen würde. Ich schlug auf und las: „Mailand Stazione Centrale war ein dunkler Ort, besonders im Regen, im Januar, im grauen Spätnachmittag… Franziska war zu einem Schalter gegangen und hatte gefragt, wann der nächste Zug ginge. ‚Wohin?’, hatte der Beamte gefragt. ‚Irgendwohin’, hatte sie geantwortet. Der Beamte hatte sie einen Augenblick lang angesehen, sich dann nach der Uhr umgewendet und gesagt: ‚Der Rapido nach Venedig. Sechs Minuten vor fünf.“ Als ich diese Sätze las, war es, als ginge ein Stromstoß durch mich hindurch. In den Monaten zuvor war ich oft durch die grauen Flure der Bielefelder Universität gegangen. Immer öfter hatte ich mich gefragt, was ich hier eigentlich zu suchen hatte. Und bei diesem Gedanken waren Bilder von weißem Dampf in mir aufgestiegen, den ich in den nächtlichen Straßen von New York aus den Schächten der Subway hatte kommen sehen. Und wenn ich mich diesen Bildern überließ, so spülten sie mich zurück in die Zeit, wo ich als Schüler in Bern im Kino gesessen und all die wunderbaren Schwarz-Weiß-Fime des französischen Kinos gesehen hatte, überzeugt davon, dass das Geschehen auf der Leinwand viel wirklicher war als alles, was draußen auf der Straße geschah. Und nun, nach der Lektüre von Anderschs Buch, war ich wieder auf dem Weg zu jenen Bildern von Jeanne Moreau, Simone Signoret und Jean Gabin. Ich weiß noch heute die Stelle oberhalb des Heidelberger Schlosses, wo ich in den frühen Morgenstunden spazieren ging und den ganz klaren Gedanke dachte: Ich werde mir diese Welt zurückholen, und ich werde es tun, indem ich einen Roman schreibe.
Und damit begann der Weg, der mich zu diesem Pult hier geführt hat. Es war zunächst ein unübersichtlicher Weg, denn ich wusste noch nicht, wie man das macht: in sich ein Thema für ein Buch finden. Nur eines wusste ich: Ich würde der Schwerkraft der Gefühle folgen müssen, die mich zu vergangenen Geschehnissen führten, die Narben hinterlassen hatten. Und so ging ich einige Zeit später, als ich in Bern war, in meine alte Schule, das Progymnasium. Es war dreißig Jahre her, aber verändert hatte sich nichts: nicht die viel zu schwere Eingangstür, nicht die ausgetretenen Treppenstufen, nicht der Geruch, mit dem ich vom ersten Tag an Angst eingeatmet hatte. Als Philipp Perlmann in Paris die Gegenwart einer früheren Reise sucht, ist er verstimmt, dass die Dinge nicht mehr sind wie damals. Und auch ich dachte es, als ich meinen Ärger darüber spürte, dass die alten Klassenbänke neuen gewichen waren. Doch das war nicht so schlimm. Schlimm war, dass die Wand dort, wo damals das Gestell mit den Reagenzgläsern gehangen hatte, neu verputzt worden war, es gab nicht die geringsten Spuren mehr von jener Projektionsfläche der Angst. Es waren zwölf Reagenzgläser, und die Schüler hatten die Aufgabe, sie jede Woche mit neuen Pflanzen zu füllen, deren Namen dann auswendig zu lernen und in Klausuren wiederzugeben waren. Ich war früh im Alphabet, und im ersten Durchgang fand ich zwölf Pflanzen ohne größere Mühe. Aber wir waren dreißig Schüler, und es gab einen zweiten Durchgang. Dort, wo wir wohnten, gab es große Wiesen. Ich suchte zwei Tage, dann, ganz plötzlich, musste ich mich dort im Gras übergeben vor Angst, denn über zwei neue Pflanzen war ich nicht hinausgelangt. Was ich noch weiß, sind Dinge wie diese: Ich erkannte in der Klausur nicht einmal die Kartoffel, ich wurde als Volltrottel vorgeführt, ich bekam einen Schweißausbruch, als ich am Anfang des abgebrochenen Medizinstudiums ein Gestell mit Reagenzgläsern sah, und ich bin nie ohne Angst in den Hörsaal gegangen, wenn ich, Professor für analytische Philosophie, eine Logikvorlesung zu halten hatte. All das wollte ich zu fassen bekommen, als ich damals in Bern im Klassenzimmer saß. Aber es gab ja keine Spuren mehr an der Wand. Ich hatte mich in eine der neuen Schulbänke gesetzt und starrte auf die Wand, hinter deren frischem Verputz die schreckliche Pflanzen-, Mathematik- und Prüfungsvergangenheit verschwunden war. Und da geschah etwas, das meine literarische Arbeit bis heute bestimmt: Ich begann, in einer imaginären Szene zu leben, die mehr Gegenwart besaß als alles, was in dem Gebäude tatsächlich geschah: Ich stand in Gedanken auf, ging zu der Wand und fing mit bloßen Händen an, die Wand aufzukratzen, mit blutigen Fingern, hasserfüllt und durch nichts von dem Ziel abzubringen, bis zu der damaligen Schicht vorzudringen, in der es etwas geben musste, um das ich die Fäuste legen konnte, um es zu erwürgen. Nachher saß ich im Café und dachte: Wenn es in mir zum Schreiben kommt, dann so. Und ich begann, die Geschichte vom blutigen Aufkratzen der Wand aufzuschreiben. Der Titel war: Schulbesuch. Es dauerte, bis mir klar wurde, dass mich die Episode noch etwas anderes gelehrt hatte: Ich brauche, um eine Geschichte zu entwickeln, nur eine winzige Portion Welt: eine verputzte Wand, die Tür des Lehrerzimmers, eine blaue Tür in Lissabon, ein Glitzern auf dem Tejo. Mehr nicht. Das sind Schlüssel, die Korridore der Einbildungskraft öffnen, und in diesen Korridoren liegt das Glück. Beim nächsten Bernbesuch ging ich wieder zum Progymnasium. Das war natürlich ein Fehler. Diese Art Fehler habe ich nie mehr gemacht. Ich nahm eine neue Professur an und erklärte dem Präsidenten, ich wolle nach einem Jahr für ein Jahr verschwinden. Ich sagte nicht: um einen Roman zu schreiben. Aber so war es. Es kostete ihn nichts, und so ließ er mich ziehen. Wir bezogen ein viel zu großes, wunderbares Haus bei Lucca. Darin gab es einen riesigen Salotto, ein runder Tisch in der Mitte, sonst Leere. Ich baute die vielen Bücher auf, die ich brauchen wollte, um ein Buch über Freiheit zu schreiben. Zwei Wochen Ferien gab ich mir, bevor die Arbeit am
wissenschaftlichen Buch begänne. Und in diesen zwei Wochen begann ich, über einen Mann zu schreiben, der nichts zu sagen hatte und sich dessen so sehr schämte, dass er am liebsten nachts ins schwarze Wasser hinausgeschwommen wäre, immer weiter, bis ihn die Kräfte verließen. Aus den zwei Wochen wurden vier, und nach zwei Monaten tat ich etwas, das zum Wichtigsten in meinem Leben gehört: Ich räumte alle wissenschaftlichen Bücher in den Schrank, kaufte ein Dutzend Ringbücher und dachte einen ganzen Winter lang von morgens bis spät in die Nacht nur noch an den Mann, der nichts zu sagen hatte. So entstand Perlmanns Schweigen. Ich habe alle drei Romane, die bisher veröffentlicht sind, am Mittelmeer geschrieben: in Italien, Frankreich, Spanien. Als Kind der deutschen Schweiz fährt man irgendwann durch den Gotthard, kommt bei Airolo aus dem Tunnel, das Licht ist anders und wird immer noch mehr anders, das Eis schmeckt anders, es gibt Bars ohne Türen, nur mit Vorhängen aus Glasperlen, und die Italiener werfen die Kippen einfach auf den Boden. Die Welt des Mittelmeers, sie ist das Land der Freiheit und der Phantasie. Für das Buch, an dem ich jetzt arbeite, konnte ich nicht ans Mittelmeer fahren. Da habe ich mit mir als dem Schreibenden das gemacht, was ich sonst nur in den Geschichten mache: Ich habe schreibend gelebt, als sei ich doch dort. Wir wohnen in Lichtenrade, einer der langweiligsten Ecken Berlins, es könnte Hintertupfingen sein. Aber wenn ich morgens das Telefon rausziehe und den Stift in die Hand nehme, dann ist es, wie wenn ich im Salotto bei Lucca wäre, denn wenn ich als Schüler, was die Wirklichkeit des Imaginären anlangt, ab und zu noch Zweifel hatte, so sind die mittlerweile ganz verschwunden. Ich habe Ihnen diese sehr persönliche Geschichte erzählt, weil ich das Gefühl habe, mich damit am besten für diesen wunderbaren Preis bedanken zu können. Denn nun, da Sie etwas von dem inneren Weg wissen, der mich an dieses Pult geführt hat, können Sie, ohne dass ich große Worte machen müsste, ermessen, wie wertvoll es für mich sein muss, wenn man zu mir sagt: Es sind dabei Geschichten entstanden, die uns etwas bedeuten. Ich werde nach Hintertupfingen in Lucca zurückkehren, und ab und zu, wenn mir danach ist, den ganzen Text einfach zu löschen, werde ich denken: Aber sie haben es dir doch gesagt. Und dann werde ich weiterschreiben, einen Satz nach dem anderen. Merci.
Sie können auch lesen