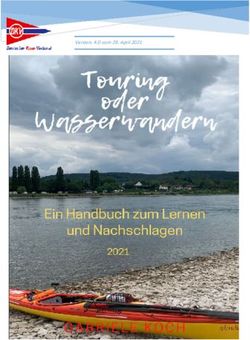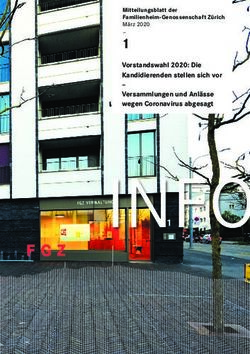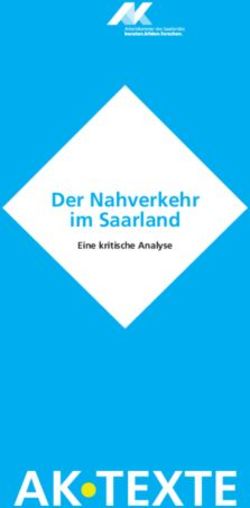Verwaltungsfachangestellten - STARTER-PAKET (VFA-K) 2019/2022 - BVS
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Berufsausbildung zum/zur
Verwaltungsfachangestellten
Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des
Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung
(VFA-K) 2019/2022
STARTER-PAKET
Seite 1Allgemeine Hinweise
für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten / zur Verwaltungsfachangestellten, Fach-
richtung allgemeine innere Verwaltung des Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung
Mai 2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) begrüßen wir Sie als Teilnehmer/in am Ausbil-
dungslehrgang für Auszubildende im bundesweit anerkannten Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachan-
gestellter / Verwaltungsfachangestellte, Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Freistaates
Bayern und Kommunalverwaltung“ (VFA-K 2019/2022).
Unabhängig von weiteren Informationen, die Ihnen im Laufe der Ausbildung noch zugehen, möchten wir
Sie zu Beginn der Ausbildung auf verschiedene Dinge hinweisen:
1. Ausbildungsmaßnahmen der BVS
Die BVS bietet für die Berufsausbildung zum / zur Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung allgemei-
ne innere Verwaltung des Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung, als dienstbegleitende Unter-
weisung einen dreijährigen Ausbildungslehrgang (VFA-K) an, der aus sieben Abschnitten (= Volllehr-
gängen) besteht und der insgesamt 18 Wochen mit 540 Unterrichtseinheiten umfasst.
Wie Sie aus der, Ihrem Ausbildungsleiter übersandten, zeitlichen Gliederung der Ausbildung ersehen
können, schließen sich die Volllehrgänge der BVS grundsätzlich an die jeweiligen Blockunterrichte der
Berufsschule an.
Nur im 1. und 2. Volllehrgang sind die Klassen auf jeweils 2 Blöcke aufgeteilt. Es entsteht damit für die
Hälfte der Klassen ein kleiner zeitlicher Abstand zwischen dem Besuch der Berufsschule und dem Be-
such des Volllehrganges. Die Zuordnung zur 1. bzw. 2. Phase kann vom 1. zum 2. Volllehrgang
variieren.
Berufsschulunterricht und Lehrgänge der BVS sind aufeinander abgestimmt. Entweder werden die Aus-
bildungsinhalte von der BVS oder von der Berufsschule gelehrt. In Ausnahmefällen kann es zu Über-
schneidungen kommen.
Für einen genauen Überblick des Lehrstoffes stellen wir Ihnen dieses Starterpaket mit den Stoffgliede-
rungsplänen, den Lerninhalten und Hinweisen zu den Lernzielen, sowie die Prüfungsordnung zur Ver-
fügung. Den Lehrplan der Berufsschulen können Sie auf unserer Homepage einsehen.
Im Übrigen werden Mitarbeiter der Verwaltungsschule in der „Allgemeinen Einweisung“ im ers-
ten Volllehrgang noch näher auf die Ausbildung, die Volllehrgänge und das Anfertigen von
schriftlichen Arbeiten eingehen.
Seite 22. Lehrbücher
Als Unterlagen für den Unterricht erhalten Sie von der BVS automatisch die notwendigen Lehrbücher.
Diese enthalten teilweise auch den Lehrstoff des Berufsschulunterrichts. Wenn die Lehrbücher grundle-
gend überarbeitet werden, erhalten Sie noch während der Ausbildung die aktuelle Version.
3. Gesetzestexte / Übungsaufgaben
Wir bitten Sie, die erforderlichen, auf den neuesten Rechtsstand gebrachten Gesetzestexte, insbeson-
dere die Vorschriftensammlung für die Verwaltung in Bayern – VSV – Grundwerk (Band 1 - 3), sowie
die Lehrbücher für die einzelnen Lehrgebiete zu den Lehrgängen stets mitzubringen.
Die Lehrgebiete und die 17 während der Volllehrgänge zu fertigenden zweistündigen Aufsichtsarbeiten
finden Sie im beiliegenden vorläufigen Lernmittelplan.
Besonders verweisen wir auf die Hinweise zur Bearbeitung von Übungsaufgaben und auf die
Bestimmungen über die Benutzung von Prüfungshilfsmitteln vom Oktober 2002.
4. Unterrichtshilfen
Übungsaufgaben
Die Bearbeitung von Übungsaufgaben sollten Sie während der Berufsausbildung intensiv üben. Sie
finden auf der Homepage der BVS zahlreiche Übungsaufgaben und die dazugehörenden Lösungsan-
leitungen im Log-in-Bereich.
Nutzen Sie diesen Service und üben Sie so oft es geht anhand dieser Aufgaben. Sie werden sehen, es
lohnt sich.
Für den Zugriff benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort. Sie erhalten diese in unseren
Bildungszentren.
Lernprogramme
Im Teilnehmer-Login auf der BVS-Homepage finden Sie Lernprogramme für die Fächer Staatsrecht und
Allgemeines Verwaltungsrecht. Nutzen Sie ergänzend zum Unterricht und zu den Lehrbüchern die
Chance, am Computer zu lernen und das Wissen zu festigen.
Fachzeitschrift apf
Im Richard Boorberg Verlag GmbH & Co., Levelingstraße 6a, 81673 München, erscheint eine Fachzeit-
schrift „Ausbildung, Prüfung, Fortbildung – apf“-, in der auch für Ihre Ausbildung wertvolle Aufsätze,
Testfragen, Übungs- und Prüfungsaufgaben mit Lösungen enthalten sind.
Seite 35. Zwischenprüfung VFA-K 2021
Die Zwischenprüfung 2021 im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellter / Verwaltungsfach-
angestellte“ wird am Ende des 3. Volllehrgangs an den einzelnen Lehrgangsorten durchgeführt.
6. Lehrgangsbestätigung
Während der dreijährigen Ausbildung sind grundsätzlich alle Aufsichtsarbeiten zu bearbeiten. Eine
Lehrgangsbestätigung über den gesamten Ausbildungslehrgang VFA-K und den Notendurchschnitt aller
von Ihnen bearbeiteten Aufsichtsarbeiten wird von der BVS am Ende der dreijährigen Ausbildungszeit
ausgestellt. Die Noten Ihrer Aufsichtsarbeiten haben keinen Einfluss auf die Zulassung zur Abschluss-
prüfung.
7. Führung des Berichtshefts
Wir weisen darauf hin, dass die in § 6 VFAV vorgeschriebene Führung des Berichtshefts eine der Zu-
lassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung ist (vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 BBiG). Die BVS wird die
Führung der Berichtshefte stichprobenweise prüfen.
Das Muster eines Berichtshefts finden Sie auf der Internet-Seite www.bvs.de unter "Ausbildung Verwal-
tungsfachangestellte/r".
8. Lehrgangsordnung
Alle Auszubildenden bitten wir in besonderer Weise, die Lehrgangsordnung in den Bildungszentren zu
beachten. Halten Sie bitte die Nachtruhe (ab 24.00 Uhr) ein, erscheinen Sie bitte pünktlich zum Unter-
richt. Essen und Trinken ist in den Unterrichtsräumen nicht gestattet. Das Rauchen ist in den Räumen
der BVS nicht erlaubt.
Ferner bitten wir um Verständnis dafür, dass tagsüber keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt
werden sowie der Genuss und die Aufbewahrung von alkoholischen Getränken in den Zimmern nicht
gestattet ist.
Wir bitten Sie, sich während der Lehrgänge so zu verhalten, wie es die allgemeinen Regeln der Höflich-
keit und Rücksichtsnahme anderen gegenüber erfordern.
Seite 49. Sportliche Betätigung
Die BVS versucht, den Lehrgangsteilnehmern nach dem Unterricht sportliche Betätigungen unter Be-
gleitung eines Sportlehrers/Übungsleiters anzubieten. Leider können wir das aus verschiedenen Grün-
den nicht an allen Lehrgangsorten.
Wir empfehlen Ihnen aber, zu allen Lehrgängen Sportbekleidung mitzubringen. Joggen ist überall mög-
lich.
10. Verhaltensweise während des Unterrichts
Gelungenes Lernen erfordert auch eine entsprechende Unterrichtsatmosphäre. Diese zu verwirklichen
ist die Aufgabe aller.
Wir bitten alle Teilnehmer/-innen ihren Beitrag für eine ruhige, konflikt- und störungsfreie, von Wert-
schätzung und Lernwillen geprägte Arbeitsatmosphäre zu leisten und bitten um Verständnis, dass die
Dozentinnen und Dozenten angehalten sind konsequent auf solche Arbeitsbedingungen hinzuwirken
und die Unterrichtszeiten einzuhalten.
Störungen und damit eine Beeinträchtigung des Lernerfolgs entstehen insbesondere durch Unpünkt-
lichkeit, Handynutzung im Unterricht, Gespräche mit Nachbarn, Toilettengänge etc.
Wir bitten daher unbedingt auf Pünktlichkeit zu achten und für unterrichtsfremde Tätigkeiten die Pausen
zu nutzen.
Es obliegt dem/der Dozenten/-in die Nutzung der Handys während des Unterrichtes gegebenenfalls
auch vollständig zu verbieten.
Während des Unterrichts üben die Dozentinnen und Dozenten, als Beauftragte der BVS, eine Vorge-
setztenfunktion aus, die ein Einschreiten gegen Disziplinprobleme, nicht zuletzt im Interesse der Lern-
willigen, zwingend erfordert. Bei erheblichem oder wiederholtem Fehlverhalten wird der Vorfall dem/der
Produktverantwortlichen mitgeteilt, welche/-r im Regelfall den Arbeitgeber/Dienstherrn informiert.
Die BVS wünscht Ihnen Freude an der Ausbildung und viel Erfolg für den vor Ihnen liegenden Berufs-
weg.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian Weininger
Leiter des Geschäftsbereichs Ausbildung
Seite 5Ihre Ansprechpartner für den Ausbildungslehrgang VFA-K
Katja Neumaier
Referentin
Für alle Fragen zu den Themen Stoffgliederungsplan, Inhalt sowie Anmeldungen zum Lehrgang
und Klausuren
Telefon 089 54057-8321
Telefax 089 54057-918321
E-Mail neumaier@bvs.de
Melanie Weiser
Referentin
Für alle Fragen zu den Themen Prüfungen, Kommentierungen, Zuständige Stelle (Eintragung)
sowie Arbeitszeitverlängerung
Telefon 089 54057-8526
Telefax 089 54057-918526
E-Mail weiser@bvs.de
Tobias Stellner
Für alle Fragen zu dem Thema Lehrgangsorganisation (Südbayern)
Telefon 089 54057-8416
Telefax 089 54057-918416
E-Mail stellner@bvs.de
Lukasz Lech
Für alle Fragen zu dem Thema Lehrgangsorganisation (Südbayern)
Telefon 089 54057-8410
Telefax 089 54057-918410
E-Mail lech@bvs.de
Katharina Gentz
Für alle Fragen zu dem Thema Lehrgangsorganisation (Nordbayern)
Telefon 0911 660444-4148
Telefax 0911 660444-4150
E-Mail gentz@bvs.de
Semra Uysal
Für alle Fragen zu dem Thema Lehrgangsorganisation (Nordbayern)
Telefon 0911/660444-4147
Telefax 0911/660444-4150
E-Mail uysal@bvs.de
Heike Elsaesser
Für alle Fragen zu den Themen Prüfungen, Arbeitszeitverlängerung
Telefon 089 54057-8419
Telefax 089 54057-918419
E-Mail elsaesser@bvs.de
In dringenden Fällen erreichen Sie Montag bis Donnerstag von 7.30 – 16.30 Uhr
und freitags von 7.30 – 12.30 Uhr unseren Kundenservice unter Telefon 089 54057-0 oder
kundenservice@bvs.de.
Seite 6INFORMATIONEN
(Stand Mai 2019)
UNTERRICHTSBESUCH In den Lehrgängen werden Sie auf Ihre Prüfung und auf Ihren spä-
teren Beruf vorbereitet. Schöpfen Sie aus dem Unterricht, nehmen
Sie möglichst ausgeruht und hoch motiviert daran teil. Im Übrigen
sind Sie verpflichtet, den Unterricht und sonstige unterrichtsbeglei-
tende Veranstaltungen zu besuchen. Im Unterricht werden Ihnen
die Grundkenntnisse in den verschiedenen Rechtsgebieten vermit-
telt und Sie erhalten hier die Impulse für ein selbstdiszipliniertes
Weiterlernen. Denken Sie auch daran, dass der Unterrichtsstoff
Prüfungsgegenstand ist. Das müsste Motivation genug sein.
GESETZESTEXTE Wir bitten Sie, die auf den neuesten Rechtsstand gebrachten Ge-
setzestexte (VSV), sowie die Formelsammlung und die Lehrbücher
für die einzelnen Lehrgebiete stets zu den Lehrgängen mitzubrin-
gen.
DIENST- BZW. Wenn Sie krank sind und am Unterricht deshalb nicht teilnehmen
ARBEITSUNFÄHIGKEIT können, informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Arbeitgeber, die
örtliche Lehrgangsaufsicht bzw. den Betreuer. Dauert die Krankheit
länger als drei Kalendertage, reichen Sie bitte ein ärztliches Zeug-
nis nach.
UNTERRICHTSBEFREIUNG Hier gelten die Vorschriften über Dienst- bzw. Arbeitsbefreiung
entsprechend. Den Antrag müssen Sie bei Ihrem Arbeitgeber ein-
reichen. Den genehmigten Antrag reichen Sie bei der örtlichen
Lehrgangsaufsicht bzw. dem Betreuer rechtzeitig ein. Die Lehrbe-
auftragten sind nicht zuständig. Eine Unterrichtsbefreiung ist nicht
erforderlich, wenn Sie staatsbürgerliche Pflichten erfüllen müssen
(z.B. Musterung, Eignungsprüfung zur Bundeswehr, Zeugenvorla-
dung, Teilnahme an Gemeinderatssitzungen o.ä.). Die Abwesen-
heit teilen Sie bitte vorher der örtlichen Lehrgangsaufsicht bzw.
dem Betreuer mit.
SONSTIGE UNTERRICHTSVER- In diesen Fällen reichen Sie bitte eine schriftliche Erklärung nach,
SÄUMNISSE, VERSPÄTUNGEN aus der Dauer und Gründe der Versäumnisse hervorgehen.
UNTERRICHTSTAGEBUCH Alle Abwesenheiten werden im Unterrichtstagebuch vermerkt und
den Dienstbehörden am Ende des Lehrgangs mitgeteilt.
NACHTRUHE Suchen Sie bitte Ihre Zimmer spätestens um 24.00 Uhr auf. Es
könnte durchaus dienstrechtliche Folgen für Sie haben, wenn
Sie unerlaubt das Bildungszentrum verlassen oder zur Nachtzeit
nicht anwesend sind und z.B. in einen Unfall verwickelt werden.
Das sollten Sie vermeiden.
AUFSICHT Während des Lehrgangs unterstehen Sie der Aufsicht der Bayeri-
schen Verwaltungsschule (BVS) und der Lehrbeauftragten.
HAUSORDNUNG Bitte beachten Sie, dass der Genuss und die Aufbewahrung von
alkoholischen Getränken in den Zimmern nicht gestattet sind.
Ebenso bitten wir Sie, in den Zimmern und im Speisesaal nicht zu
rauchen.
FREIZEITGESTALTUNG Um das Sportangebot vor Ort nutzen zu können, empfehlen wir
Sportkleidung mitzubringen.
Seite 7ZUM INHALT DIESES STARTERPAKETS
Wir haben Ihnen die wichtigsten Unterlagen für Ihre Ausbildung in dieser Mappe zusammengestellt.
Lesen Sie sie in aller Ruhe durch. Die Unterlagen geben Ihnen nicht nur die Auskünfte über die rechtli-
chen Grundlagen Ihrer Ausbildung und über den Lern- und Prüfungsstoff. Sie erhalten darüber hinaus
auch Tipps und Ratschläge über die sinnvolle Vorbereitung auf die Übungs- und Prüfungsaufgaben. Es
lohnt sich also, die Unterlagen zu studieren.
Im Einzelnen finden Sie im Starterpaket folgende Unterlagen:
STOFFGLIEDERUNGSPLAN / LERNZIELSTUFEN
REGISTER Der STOFFGLIEDERUNGSPLAN konkretisiert die durch Ausbildungsordnung vorge-
gebenen Lehrgebiete.
1 Der Stoffgliederungsplan ist Leitlinie für die Ausbildung und Orientierung für die Vorbe-
reitung auf die Zwischen- und Abschlussprüfung.
Alles, was im Stoffgliederungsplan an Lerninhalten aufgeführt ist, kann in den Übungs-
aufgaben und Prüfungsaufgaben abverlangt werden.
Die LERNZIELSTUFEN sagen Ihnen und natürlich auch den Dozentinnen und Dozen-
ten, wie tief in das jeweilige Thema einzusteigen ist. Während die Lernzielstufe (LZS) I
von Ihnen lediglich verlangt, dass Sie das Wissen (mehr oder weniger auswendig ge-
lernt) wiedergeben können müssen, erfordert die LZS III, dass Sie Fälle bearbeiten
können; hier ist also eine Transferleistung gefragt.
Im Anhang (blau) des Stoffgliederungsplans finden sie auch die vorläufigen Lehrplan-
richtlinien der BERUFSSCHULE abgedruckt.
PRÜFUNGSORDNUNG (POVFA-K)
REGISTER Die PRÜFUNGSORDNUNG für die Abschluss- und Zwischenprüfung im Ausbildungs-
beruf Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter – Fachrichtung allge-
2 meine innere Verwaltung des Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung – ist eine
der rechtlichen Grundlagen für Ihre Ausbildung und Prüfung. Es lohnt sich, diese recht-
zeitig anzusehen.
MERKBLATT ÜBUNGS- UND PRÜFUNGSARBEITEN
REGISTER
Diese Hinweise helfen Ihnen bei der Vorbereitung auf die Übungs- und Prüfungsaufga-
3 ben.
HILFSMITTELREGELUNG
REGISTER
Hier erfahren Sie welche Hilfsmittel für die Übungsaufgaben, Zwischen- und Abschluss-
4 prüfung zugelassen sind.
Seite 8LISTE DER LEHRBÜCHER
REGISTER Die aufgeführten Lehrbücher haben Sie bereits erhalten. Sie bieten Ihnen einen schnel-
5 len und umfassenden Überblick und sind eine wertvolle Hilfe zur Vorbereitung auf den
Unterricht. Aktualisierungen werden Ihnen kostenlos und automatisch während Ihrer
Ausbildungszeit zur Verfügung gestellt.
Die Herausgabe der Lehrbücher stellt eine lange Tradition in der BVS dar. Dabei wird
großer Wert auf Aktualität sowie eine übersichtliche, anschauliche Darstellung und auf
die pädagogisch-didaktische Aufbereitung der jeweiligen Fachgebiete gelegt.
FÜR IHRE EIGENEN UNTERLAGEN UND NOTIZEN…
REGISTER
6
Seite 9Stoffgliederungsplan für
die Auszubildenden im Ausbildungsberuf
Verwaltungsfachangestellte/
Verwaltungsfachangestellter
2019/2022
Stand: Juli 2019
Seite 10Allgemeine Vorbemerkung
Zu den nachfolgenden Stoffgliederungsplänen ist insbesondere auf Folgendes hinzuweisen:
In den Fächern
- Berufsausbildung im öffentlichen Dienst
- Personalwesen
- Allgemeines Verwaltungsrecht
werden durch die Berufsschule die Grundlagen vermittelt. Die Einzelheiten sind den jeweiligen
Stoffgliederungsplänen zu entnehmen.
In den Fächern
- Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre
- BGB in der täglichen Verwaltungsarbeit
- Staatsrecht als Grundlage der rechtsstaatlichen Verwaltungsarbeit
vermittelt ausschließlich die Berufsschule die Grundlagen. Im Unterricht der BVS wird in praxisbezo-
genen Fällen dieses Grundlagenwissen vertieft und auf die Prüfungen vorbereitet.
Für alle Lehrgebiete gilt, dass die Intensität der Stoffvermittlung den Lernzielstufen zu entnehmen ist.
Die Referenten werden gebeten, die Lernzielstufen der Stoffgliederungspläne nicht zu überschreiten.
Seite 11Inhalt
Stoffverteilungsplan .................................................................................................................... 4
Lernmittelplan.............................................................................................................................. 5
1. Lern- und Arbeitstechniken ................................................................................................. 6
2. Einführung in das Recht und Rechtsanwendung ...................................................... ……...7
3. Verwaltungstechnik und -organisation ............................................................................. 10
4. Berufsausbildung im öffentlichen Dienst ........................................................................... 17
5. Kommunale Finanzwirtschaft ........................................................................................... .20
6. Personalwesen .................................................................................................................. 28
7. Kommunalrecht ................................................................................................................. 34
8. Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren............................................... 40
9. Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre ................................................................................. 46
10. Bürgerliches Recht in der täglichen Verwaltungsarbeit .................................................... 48
11. Staatsrecht als Grundlage rechtsstaatlicher Verwaltungsarbeit ....................................... 52
12. Sozialrecht ......................................................................................................................... 57
13. Öffentliche Sicherheit und Ordnung .................................................................................. 61
14. Kommunikation und Kooperation ...................................................................................... 65
Lernzielstufen ............................................................................................................................ 66
Seite 12STOFFVERTEILUNGSPLAN Ausbildungsjahrgang 2019/2022
Stand: Mai 2019
Nr. Lehrgebiete UE 1.VL 2.VL 3.VL 4.VL 5.VL Pro- 6.VL ABL
jekt
1 Allgemeine Einweisung 3 1 2
2 Einführung in das Recht und 20 20
Rechtsanwendung
3 Verwaltungstechnik 20 12 8
4 Verwaltungsorganisation 22 8 14
5 Berufsausbildung im 14 10 4
öffentlichen Dienst
6 Kommunale Finanzwirtschaft 14 12 12
56
6a Praktische Umsetzung 6 4 8
7 Personalwesen 14 14 10 4 8
7a Praktische Umsetzung 56 2 2 2
8 Kommunalrecht 10 12 10 6 8
8a Praktische Umsetzung 52 2 4
9 Allg. Verwaltungsrecht und 10 14 10 6 8
Verwaltungsverfahren
52
9a Praktische Umsetzung 4
10 Verwaltungsbetriebs- 12 12
wirtschaftslehre
11 Bürgerliches Recht in der täglichen 12 4 4
Verwaltungsarbeit
22
11a Praktische Umsetzung 2
12 Staatsrecht als Grundlage 12 4 4
rechtsstaatlicher
Verwaltungsarbeit
22
12a Praktische Umsetzung 2
13 Sozialrecht 16 8
13a Praktische Umsetzung 28 4
14 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 16 8
14a Praktische Umsetzung 26 2
15 Kommunikation und 12 12
Kooperation im beruflichen Alltag
16 Lern- und 8 8
Arbeitstechniken
17 Fachpraktische Fallbearbeitung 32 12 20
18 Handlungsorientiertes Projekt 34 34
19 Klausuren 51 6 12 3 9 9 12
Gesamt 542 91 86 61 55 89 34 52 74
Seite 13Lernmittelplan
Aufgabe Voll-
Lehrgebiete
Nr. Lehrgang
1 Einführung in das Recht und Rechtsanwendung 1.
2 Berufsausbildung im öffentlichen Dienst 1.
3 Kommunale Finanzwirtschaft 2.
4 Verwaltungsorganisation – Verwaltungstechnik 2.
5 Bürgerliches Recht in der täglichen Verwaltungsarbeit 2.
6 Staatsrecht als Grundlage rechtsstaatlicher Verwaltungsarbeit 2.
7 Kommunale Finanzwirtschaft 3.
8 Personalwesen 4.
9 Kommunalrecht 4.
10 Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren 4.
11 Personalwesen 5.
12 Kommunalrecht 5.
13 Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren 5.
14 Allgemeines Verwaltungsrecht / Öffentliche Sicherheit und Ordnung 6.
15 Allgemeines Verwaltungsrecht / Sozialrecht 6.
16 Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre 6.
17 Staatsrecht als Grundlage rechtsstaatlicher Verwaltungsarbeit / 6.
Bürgerliches Recht in der täglichen Verwaltungsarbeit
Seite 14Lern- und Arbeitstechniken
Voll-Lehrgang Lerninhalte Stundenzahl
1. VL 1. – 1.4 8
Lerninhalte Lernziele
1. Lern- und Arbeitstechniken
Die Auszubildenden
1.1 So lerne ich am Besten – mein Lerntyp sollen über allgemeine
und fachspezifische
1.2 Eigenverantwortliches Lernen Lern- und Arbeitstech-
niken verfügen.
1.3 Damit Lernen gelingt: Sie sollen sich bewusst
• Motivation werden, welcher Lern-
• Körper und Gehirnaktivierung typ sie sind und ent-
• Arbeitsplatz sprechende Lern- und
• Lern- und Arbeitsgruppen Arbeitstechniken für
• Aktive Mitarbeit im Unterricht Klausur- und Prü-
• Erfolgreich Klausuren und Prüfungen meistern fungsvorbereitungen
einsetzen können.
1.4 Fachspezifische Lern- und Arbeitstechniken Sie sollen einen Über-
blick über die Fächer
• Überblick über die Fächer verschaffen
haben, Zusammen-
• Umgang mit der VSV und sonstigen Arbeitsmitteln
hänge erkennen kön-
(z.B. Lehrbücher der BVS, Fachliteratur)
nen und mit den ent-
• Richtiges Zitieren von Rechtsvorschriften
sprechenden Lern- und
• Kommentieren von Rechtsvorschriften
Arbeitsmitteln umge-
(Hilfsmittelbestimmung)
hen können.
• Mitschrift und Skripte Sie sollen über das
• Lernen mit Lernmitteln – aktives Lernen und Wiederholen richtigen Zitieren und
• Textanalyse die Möglichkeit und
• Klausuren Zulässigkeit des
Kommentierens, in-
formiert sein.
Seite 15Einführung in das Recht und
Rechtsanwendung
Fachkompetenz:
Sie können
• die verschiedenen Gesetze (z.B. vom Bundestag oder vom Landtag
erlassen) bestimmen und ihrem Rang nach einordnen.
• die für die Einteilung des Rechts wesentlichen Grundbegriffe (z.B.
öffentliches Recht und Privatrecht) anwenden.
Methodenkompetenz:
Sie sind sicher
• bei der Argumentation mit den für die Rechtsanwendung wesentlichen
Grundbegriffen (z.B. Kann-Vorschriften und Muss-Vorschriften).
• bei der Zuordnung des Verwaltungshandelns zum öffentlichen Recht
oder zum Privatrecht und können hieraus Schlussfolgerungen für die
Anwendbarkeit von Rechtsvorschriften ziehen.
• bei der Fertigung schriftlicher Arbeiten.
und beherrschen
• die Kunst, Fälle zu lösen (z.B. Gutachtenstil und Urteilsstil; Prüfung, ob
ein Sachverhalt die Voraussetzungen einer Rechtsvorschrift erfüllt;
Begründung von Lösungen).
Sozialkompetenz:
Sie sind in der Lage
• Sinn und Notwendigkeit der Rechtsordnung als Grundlage eines
geordneten Gemeinschaftslebens und des Verwaltungshandelns zu
erkennen.
• die Rechtsordnung gegenüber anderen Lebensordnungen (z.B. Sitte
oder Religion) abzugrenzen und diese als Grundlagen des Rechts zu
begreifen.
Seite 16Voll-Lehrgang Lerninhalte Stundenzahl
1. VL 1. – 6. 20
Lerninhalte Lernziele
1. Die Bedeutung des Rechts
1.1 Die Notwendigkeit der Rechtsordnung für die Stufe II
menschlichen Beziehungen in einer Gemeinschaft
1.2 Erzwingbarkeit des Rechts Stufe I
1.3 Abgrenzung des Rechts gegenüber anderen Stufe I
Ordnungen, z.B. Religion, Moral, Sitte
2. Rechtsquellen
2.1 Begriff der Rechtsquelle Stufe III
2.2 Geltungsbereich von Rechtsquellen Stufe II
2.3 Arten der geschriebenen Rechtsquellen im Stufe III
nationalen Recht
- Verfassungsrecht
- Gesetze im formellen Sinne
- Gesetze im nur materiellen Sinne
o Rechtsverordnungen
o Satzungen
2.4 Rechtsquellen der EU Stufe I
- Primärrecht
- Sekundärrecht
(Verordnungen/Richtlinien)
2.5 Abgrenzung der Rechtsquellen zu Nicht- Stufe III
Rechtsquellen (Gerichtsentscheidungen, Verwaltungsakte, Verwal-
tungsvorschriften, Verträge, Allg. Geschäftsbedingungen, Vereins-
satzungen, Kommentare)
2.6 Rangordnung der Rechtsquellen Stufe III
3. Die Einteilung des Rechts
3.1 Öffentliches Recht und Privatrecht Stufe III
3.2 Zwingendes und nachgiebiges Recht Stufe III
3.3 Strenges und billiges Recht Stufe III
3.4 Objektives und subjektives Recht Stufe II
Seite 17Lerninhalte Lernziele
4. Personen im Recht Stufe III
4.1 Rechtsfähigkeit
4.2 Natürliche Personen
4.3 Juristische Personen
4.3.1 des öffentlichen Rechts
4.3.2 des privaten Rechts
5. Die Anwendung des Rechts
5.1 Verhältnis der Rechtsnormen zueinander Stufe II
5.1.1 Ranghöheres bricht rangniedrigeres Recht
5.1.2 Jüngeres bricht älteres Recht
5.1.3 Spezialgesetz bricht allgemeines Gesetz
5.2 Aufbau einer vollständigen Rechtsnorm Stufe III
- Tatbestand
- Rechtsfolge
5.3 Subsumtion und Feststellung der Rechtsfolge Stufe III
5.4 Auslegung von Rechtsbegriffen Stufe I
5.4.1 Verbalinterpretation
5.4.2 systematische Methode
5.4.3 teleologische Interpretation
5.5 Lückenausfüllung Stufe I
5.5.1 Analogie
5.5.2 Umkehrschluss
6. Anfertigung von schriftlichen Arbeiten Stufe III
(Methodik und Technik der Fallbearbeitung)
6.1 Genaues Aufnehmen des Wortlauts der Aufgabe Die Lerninhalte sollen
6.2 Herausarbeiten der Fragestellung anhand einfacher Fälle
6.3 Beachten der Bearbeitungshinweise vermittelt und vertieft
6.4 Erheblicher Sachverhalt werden
6.5 Überlegungen zur Reihenfolge der Entwicklung der Lösung
6.6 Erkennen und Gewichten der Probleme
6.7 Zeiteinteilung
6.8 Notizen
6.9 Klären und Lösen der Rechtsfragen
6.10 Aufbau und Gliederung
6.11 Begründung der Lösung/Argumentation
6.12 Gutachtenstil – Urteilsstil
6.13 Zitieren von Rechtsvorschriften
6.14 Form (Rand, deutliche Schrift, Gliederung, Absätze)
Seite 18Verwaltungsorganisation
und Verwaltungstechnik
Fachkompetenz:
Sie können
• die verschiedenen Gewalten sowie die mittelbare und unmittelbare
Staatsverwaltung und Kommunalverwaltung unterscheiden und
Behörden korrekt einordnen.
• die äußere von der inneren Behördenorganisation, sowie Aufbau- von
der Ablauforganisation unterscheiden und mit Fachbegriffen umgehen.
• Sie sind sicher im Umgang mit Organisationsplänen und können
deren Inhalt und gegenseitige Abhängigkeiten erläutern
• Sie sind sicher in der Auswahl und im Abfassen dienstlicher Schreiben
inklusive der sachleitenden Verfügungen.
Sie beherrschen
• die Behandlung des Postein- und –ausgangs.
Methodenkompetenz:
Sie sind sicher
• beim Erkennen von Zuständigkeiten, auch anderer Behörden, und
können die daraus notwendigen Schritte (z.B. Weiterverweisung)
veranlassen.
Sie sind in der Lage
• selbständig Organisationspläne anzupassen und weiterzuentwickeln.
• Posteingänge selbständig zu bearbeiten und in den Geschäftsgang zu
geben.
• Schriftverkehr zu erledigen (Schriftstücke zu fertigen und Anfragen zu
beantworten).
Sozialkompetenz:
Sie können
• kompetent und bürgerfreundlich Zuständigkeiten erläutern.
• die Inhalte der Organisationspläne kompetent und bürgerfreundlich
erläutern.
• fachgerecht entscheiden, in welchem Umfang unter Beachtung der
Bürgernähe/-freundlichkeit Auskunft zu erteilen ist.
Sie sind in der Lage
• im Einzelfall im Rahmen der AGO vorrangig zu behandelnde
Personenkreise zu erkennen.
• unter Beachtung der Maßgabe kurzer Wege zu entscheiden, ob und in
welchem Umfang der Dienstweg einzuhalten ist.
Seite 19Verwaltungsorganisation
Voll-Lehrgang Lerninhalte Stundenzahl
1. VL 1. - 2.3.3.3 8
2. VL 2.3.4 – 5 12
Lerninhalte Lernziele
1. Grundlagen der Verwaltungsorganisation II
1.1 Begriff „Organisation“, Notwendigkeit der Organisation
- institutional
- instrumental
- funktional
1.2 Betrachtungsebenen von Organisationen III
- Äußere und innere Behördenorganisation
- Aufbau- und Ablauforganisation
1.3 Organisationsziele II
- Einteilung der Ziele (in Sach- und Gestaltungsziele, insbes. Ge
setzmäßigkeit der Verwaltung)
- Ziele als Steuerungsinstrument
- Messbarkeit der Ziele
- Zielkonflikte
1.4 Begriff der öffentlichen Verwaltung (Negativdefinition) III
Abgrenzung der öffentlichen Verwaltung zur
- Privatwirtschaft
- Gesetzgebung
- Rechtsprechung
- Regierung
1.5 Aufgaben der öffentlichen Verwaltung II
- Leistungsverwaltung
- Eingriffsverwaltung
- Planungsverwaltung
2. Äußere Behördenorganisation
2.1 Grundbegriffe II
Behörde, Amt, Zuständigkeiten (sachlich/örtlich/funktional), Juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts
2.2 Verfassungsrechtliche Grundlagen
- horizontale Gewaltenteilung
- vertikale Gewaltenteilung
- Aufgabenverteilung zwischen Bund und Länder
2.3 Aufbau der öffentlichen Verwaltung III
2.3.1 Träger der Verwaltung, unmittelbare u. mittelbare Staatsverwaltung,
Bundes- und Landesverwaltung,
Seite 202.3.2 Bundesverwaltung I
o unmittelbare Bundesverwaltung
o mittelbare Bundesverwaltung
o Organisationsgewalt
2.3.3 Landesverwaltung III
2.3.3.1 Unmittelbare Landesverwaltung
- Aufbau
- Hierarchie
- Zuständigkeiten
2.3.3.2 Mittelbare Landesverwaltung
- Körperschaften, Anstalten, Stiftungen d.ö.Rechts
- Beliehene Unternehmer
2.3.3.3 Organisationsgewalt II
2.3.4 Kommunalverwaltung III
o Überblick Kommunalverwaltung
o Verfassungsrechtliche Grundlagen
o Selbstverwaltungsrecht
o Aufgaben und Wirkungskreis
o Gemeinden
o Landkreise
o Besondere Stellung des Landratsamtes
o Bezirke II
o Verwaltungsgemeinschaften
o Zweckverbände
2.3.5 Aufsicht
Behörden- und Staatsaufsicht
2.3.6 Organisationsformen kommunaler Zusammenarbeit
2.4 Organisationsgrundsätze II
- Zentralisation/Dezentralisation
- Konzentration/Dekonzentration
- Einheit/ Einräumigkeit der Verwaltung
III
3. Innere Behördenorganisation
3.1 Organisationspläne
- Aufgabengliederungsplan
- Verwaltungsgliederungsplan, Organigramm
- Geschäftsverteilungsplan
- Arbeitsverteilungsplan
- Stellenbeschreibung
3.2 Aufbau von Behörden, Bildung von Organisationseinheiten
- Stellen
- Instanzen
- Dach- und Facheinheiten
- Linienorganisation
- Besondere Organisationsformen (Stabstelle, Arbeitsgruppen)
3.3 Grundsätze für die Aufbauorganisation
- Zusammenfassung artgleicher Aufgaben
- Organisatorisches Minimum
- Leitungsspanne
- Kompetenzabgrenzung
Seite 214. Betriebswirtschaftlich orientierte Steuerung der Verwaltungen II
4.1 Neues Steuerungsmodell (NSM)
- outputorientierte Steuerung
- Kundenorientierung
- Dezentrale Ressourcenverantwortung
- Überblick über die weiteren Kernelemente (Ressourcenver-
brauchskonzept, Kontraktmanagement, Controlling)
4.2 Weiterentwicklung zum Kommunalen Steuerungsmodell (KSM)
- Gründe für die Weiterentwicklung
- Überblick über die Komponenten
5. Der „neue“ Mitarbeiter in der öffentlichen
II
Verwaltung
- Gruppen- und Teamarbeit
- Leistungsprinzip
- Selbststeuerung und Zielvereinbarung
- Delegation von Verantwortung
Seite 22Verwaltungstechnik
Voll-Lehrgang Lerninhalte Stundenzahl
1. VL 1. – 3.4.4 12
2. VL 3.5. – 7. 8 + 2 PU
Die UE der Praktischen Umsetzung (PU) können individuell z. B. zu Übungszwecken oder zur
Bearbeitung von Teilnehmerfragen genutzt werden.
Lerninhalte Lernziele
1. Grundlagen der Ablauforganisation - Verwaltungstechnik
1.1 Notwendigkeit von Regeln für die Ablauforganisation II
1.2 Allgemeine Geschäftsordnung III
- Rechtsnatur
- Geltungsbereich
- sonstige Vorschriften (z.B. Innerbehördliche Regelungen)
2. Behörde als Dienstleistungsunternehmen (AGO-Zweiter Teil)
2.1 Grundsätze einer bürgerorientierten Verwaltung II
- Verwaltung in der modernen Gesellschaft
- Erwartungshaltungen an die Verwaltung
- Bürgerorientierte Verwaltung
- Grenzen einer bürgerorientierten Verwaltung
2.2 Bürgernähe III
2.2.1 Persönliche Erreichbarkeit
o Öffnungszeiten
o Bürgerbüros
o Abwicklung des Besucherverkehrs
o Bevorzugter Empfang
2.2.2 Telefonische Erreichbarkeit
2.2.3 Schriftliche Erreichbarkeit
2.2.4 Elektronische Erreichbarkeit, E-Government I
2.2.5 Information, Öffentlichkeitsarbeit, Transparenz
2.3 Bürgerfreundlichkeit III
- Verhalten gegenüber dem Bürger
- Beratung und Hilfe
- Nachvollziehbarkeit und Objektivität
- Gesprächstermine
2.4 Auskünfte, Akteneinsicht (AGO, BayVwVfG)
2.5 Verbesserung der Dienstleistungsqualität, Dienstleistungsorientierung als
Daueraufgabe
2.6 Spannungsfeld Hoheitsträger – Dienstleistungs-
Seite 23Unternehmen
3. Geschäftsgang (AGO – Dritter Teil)
3.1 Prozessablauf I
3.2 Behandlung der Eingänge
III
- Kommunikationswege
- Eingangsstelle, Eingangsstempel
- Öffnen und büromäßige Vorbehandlung, insbesondere
Irrläufer, nicht oder unzureichend freigemachte Sendungen,
besondere Empfänger
- dezentral eingehende Sendungen
- Weitergabe in den Geschäftsgang (Sichtung durch Vorgesetzte)
3.3 Sachbearbeitung
- Zuständigkeit (sachlich, örtlich, Weiterleitung bei Unzuständigkeit)
- Allgemeine Grundsätze
- Abstimmung, Federführung, Beteiligung
- Bearbeitung besonderer Fälle (Beschimpfungen,
anonyme Schreiben)
- Förmliche Bearbeitung von Vorgängen
- Form der Sachbearbeitung (Grundsatz der Nichtförmlichkeit,
Kommunikationsformen – mündlich, elektronisch, schriftlich,
Vorrang der IuK-Technik
- unmittelbare und mittelbare Kommunikation, Dienstwegprinzip
3.4 Schriftguterstellung, Handlungsformen der öffentlichen Verwaltung
3.4.1 Formale und sprachliche Gestaltung dienstlicher Dokumente, Be-
arbeitungsvermerke
3.4.2 Bezeichnung und Formen dienstlicher Dokumente
3.4.3 Abfassen dienstlicher Dokumenten inklusive Bearbeitungsvermer-
ke
o dienstliche Schreiben (intern und extern), (Entwurf und Ori-
ginal)
o Aktenvermerk
o Erklärungsniederschrift
o Besprechungsniederschrift I
o Beschlussvorlage III
o Abgabenachricht
o Zwischenmitteilung
o Bescheid in erster Instanz (in Grundzügen, Entwurf im per- I
sönlichen- und unpersönlichen Stil)
3.4.4 Unterschrift, Dienstsiegel II
3.5 Versand, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte (inkl. Zustellung)
3.6 Amtliche Beglaubigung III
Öffentliche Beglaubigung und Beurkundung II
3.7 Schriftgutverwaltung
3.7.1 Notwendigkeit und Aufgaben der Schriftgutverwaltung
3.7.2 Organisation der Schriftgutverwaltung (Standort): Sachbearbeiter-
u. Zentralregistratur
3.7.3 Aktenplan, Aktenzeichen, Geschäftszeichen
3.7.4 Aktenaussonderung, Archivwesen
Seite 244 Zeit- und kostensparender Einsatz von Arbeitshilfsmitteln I
- IuK-Technik
- sonstige technische Hilfsmittel
- Vordrucke
- Fachliteratur und sonstige Informationsmittel
(Internet usw.)
5 Auswirkungen des IuK-Einsatzes auf dem Geschäftsgang I
6. Die Zukunft – ein papierloses Büro? I
7. Persönliche Arbeitsorganisation I
- Schreibtisch-Management
- Probleme vorbeugend bearbeiten
- Störfaktoren
- Zeitspartechniken
- Effektive Besprechungen planen und durchführen
Seite 25Berufsausbildung im
öffentlichen Dienst
Fachkompetenz:
Sie können
• ihr eigene Ausbildung dem dualen System der Berufsausbildung
zuordnen.
• ihre eigenen Rechte und Pflichten, wie Entgeltanspruch,
Urlaubsanspruch, Lernpflicht usw. einordnen.
• die maßgebenden gesetzlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen
von der Begründung bis zur Beendigung des Ausbildungsverhältnisses
erläutern und anwenden.
Methodenkompetenz:
Sie sind sicher
• bei der Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten im Rahmen der
Ausbildungsverhältnisse.
• bei der Mitwirkung von Begründung, Betreuung und der Beendigung
von Ausbildungsverhältnissen.
Sozialkompetenz:
Sie sind in der Lage
• die zentrale Bedeutung der Ausbildung für die eigene Entwicklung und
die Personalentwicklung der ausbildenden Stelle zu erkennen.
• die Kooperation mit anderen Auszubildenden, Mitarbeitern und Vorge-
setzten verantwortungsbewusst zu gestalten.
Seite 26Voll-Lehrgang Lerninhalte Stundenzahl
1. VL 1. – 6.3 10
2. VL 7. – 8.2 4
Die Berufsschule vermittelt u. a. im Fach Personalwesen die Grundlagen für das
Lehrgebiet "Berufsausbildung im öffentlichen Dienst". Darauf aufbauend wiederholt
und vertieft die BVS diese Kenntnisse und ergänzt sie um die Inhalte des Tarifvertra-
ges für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)
Lerninhalte Lernziele
1. Grundlagen Stufe II
1.1 Struktur der Berufsbildung
1.2 Zweck der Berufsausbildung
1.3 Das duale System
1.4 Die schulische Ausbildung
2. Berufsausbildungsverhältnis Stufe II
2.1 Voraussetzungen
2.2 Form und Inhalt
2.3 Nichtige Vereinbarungen
2.4 Eignung
3. Berufsausbildungsvertrag Stufe III
3.1 Gegenstand und Gliederung der Berufsausbildung Die unterscheidenden
3.2 Beginn und Dauer Merkmale zu einem
3.3 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Arbeitsverhältnis sollen
Ausbildungsstätte herausgearbeitet wer-
3.4 Regelmäßige tägliche Arbeitszeit den.
3.5 Probezeit
3.6 Ausbildungsvergütung
3.7 Urlaub
3.8 Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
3.9 Hinweis auf anzuwendende Tarifverträge, Betriebs-
und Dienstvereinbarungen
3.10 Form des Ausbildungsnachweises (Berichtsheft)
Seite 27Lerninhalte Lernziele
4. Pflichten des Ausbildenden Stufe II
4.1 Ausbildungspflicht
4.2 Bereitstellung der Ausbildungsmittel
4.3 Überwachung der Führung des
Ausbildungsnachweises (Berichtsheft)
4.4 Freistellung
4.5 Erziehungspflicht
4.6 Zeugniserteilung
5. Pflichten des Auszubildenden Stufe II
5.1 Lernpflicht
5.2 Pflicht zur Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen
5.3 Gehorsamspflicht
5.4 Geheimhaltungspflicht
5.5 Sorgfaltspflicht
5.6 Führung des Ausbildungsnachweises (Berichtsheft)
6. Jugend- und Auszubildendenvertretung Stufe II
6.1 Rechtliche Grundlagen
6.2 Wahl
6.3 Aufgaben
7. Prüfungen Stufe III
7.1 Prüfungsordnung
7.2 Zwischenprüfung
- Bedeutung
- Prüfungsgebiete
7.3 Abschlussprüfung
- Bedeutung
- Zulassung
- Prüfungsgebiete
- Durchführung
8. Weiterbildungsmöglichkeiten im öffentlichen Stufe I
Dienst
8.1 Beschäftigtenlehrgang II Bekanntmachung BVS im
Bayer. Staatsanzeiger
8.2 Berufliche Fortbildung
Seite 28Kommunale Finanzwirtschaft
Fachkompetenz:
Sie können
die Einnahmen einer Gemeinde bewerten und die allgemeinen
Grundsätze der Finanzwirtschaft beschreiben = Wie finanzieren sie
sich?
die zentrale Bedeutung des Haushaltsplanes für das Handeln der
Verwaltung verstehen und Veranschlagungen (doppisch und kameral)
vornehmen = Wie müssen Finanzen geplant werden?
Haushaltsmittel bewirtschaften = Wie wird über die geplanten Mittel
verfügt?
die Aufgaben und die Organisation kommunaler Kassen beschreiben
und kamerale Buchungen vornehmen = Wer ist für die kassenmäßige
Abwicklung zuständig und wie funktioniert diese?
Methodenkompetenz:
Sie sind sicher
bei der Erstellung von Haushaltsplan und -satzung, z. B. Wie plane ich
den Kauf eines Kopiergerätes?
bei der Anfertigung von Kassenanordnungen, z. B. Was ist für die
Bezahlung der Rechnung zu tun?
der Vornahme einfacher kameraler Buchungen – Wie werden in der
Kasse Vorgänge nachvollziehbar festgehalten oder wie wird die
Bezahlung des Kopiergerätes in der Kasse festgehalten?
Sozialkompetenz:
Sie sind in der Lage
ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass mit finanziellen Mitteln ver-
antwortungsbewusst umgegangen werden muss.
Seite 29Voll-Lehrgang Lerninhalte Stundenzahl
1. VL 1. – 3.1.4 aus Lernfeld 1 14
und kam. Haushaltssatzung aus Lernfeld 2
2. VL 3.2 – 8.4 aus Lernfeld 1 12 + 6 PU
und dopp. Haushaltssatzung aus Lernfeld
2
3. VL 12 + 4 PU
Lernfeld 3
Lernfeld 4
6. VL 8 PU
Die UE der Praktischen Umsetzung (PU) können individuell z. B. zu Übungszwecken oder zur
Bearbeitung von Teilnehmerfragen genutzt werden.
Lerninhalte Lernzielstufe
Lernfeld 1
Haushaltsplan
1. VL - 13 UE
(+ 1 UE aus Lernfeld 2 - nur kam. Haushaltssatzung)
1. Grundlagen (3 UE) Stufe I
1.1 Aufgaben der öffentlichen Finanzwirtschaft Stufe I
1.2 Rechtsgrundlagen Stufe I
1.3 Allgemeine Haushaltsgrundsätze Stufe II
1.3.1 stetige Aufgabenerfüllung
1.3.2 konjunkturgerechtes Verhalten
1.3.3 Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
1.3.4 Jährlichkeit
1.3.5 Jährigkeit
1.3.6 Vorherigkeit und Rechtzeitigkeit
1.3.7 Öffentlichkeit
1.3.8 Zusammenarbeit mit Privaten
1.3.9 dauernde Leistungsfähigkeit
1.3.10 Vermeidung der Überschuldung
1.3.11 Minimierung finanzieller Risiken
1.4 Zeitliche Gliederung der Haushaltswirtschaft Stufe I
Seite 302. Kommunale Einnahmen (3 UE) Stufe III
2.1 Sonstige Einnahmen
- Beteiligung an der Einkommen- und
Umsatzsteuer
-Finanzausgleich
(einschl. staatlicher Zuweisungen)
-Vermögenserträge
(z.B. Ablieferungen gemeindlicher
Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen bzw.
Gewinnanteile aus Beteiligungen an
Unternehmen des privaten Rechts)
- Rücklagenentnahme
2.2 Abgaben
- besondere Entgelte (Gebühren und Beiträge)
- Steuern
2.3 Umlagen (ohne Berechnung; nur Kenntnis)
2.4 Krediteinnahmen
2.5 Rangfolge der Einnahmen und
Möglichkeiten der Beeinflussung
3. Haushaltsgliederung Stufe III
3.1 Kameraler Haushaltsplan (7 UE)
3.1.1 Veranschlagung von Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen
3.1.2 Einteilung in Verwaltungshaushalt und
Vermögenshaushalt
3.1.3 Gliederung des Haushaltsplans nach
Aufgabenbereichen
3.1.4 Gruppierung des Haushaltsplans nach Einnahme-
und Ausgabearten, Bereichsabgrenzung
(insbesondere bei Krediten)
2. VL - 11 UE + 6 Übungseinheiten
(+ 1 UE aus Lernfeld 2 - nur dopp. Haushaltssatzung)
3.2 Doppischer Haushaltsplan (4 UE) Stufe III
3.2.1 Veranschlagung von Erträgen, Aufwendungen,
Einzahlungen, Auszahlungen und
Verpflichtungsermächtigungen
3.2.2 Einteilung in Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
3.2.3 Produktorientierte Gliederung
3.2.4 Kontenrahmen
3.2.5 Ziele und Vorteile des doppischen
Rechnungswesens/Unterschiede zur Kameralistik
3.2.6 Zusammenspiel von doppischer Planung und
Buchführung/Auswirkungen von Erträgen,
Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
auf die Bilanz
4. Veranschlagungsgrundsätze in Abhängigkeit des Stufe III
Haushaltssystems (3 UE)
4.1 Einheit und Vollständigkeit
Seite 314.2 Fälligkeit und Kassenwirksamkeit bzw.
periodengerechte Zuordnung mit
Rundungsmöglichkeiten
(insbesondere Veranschlagung von Investitionen),
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen
ohne Veranschlagung der kalkulatorischen Kosten
bei kostenrechnenden Einrichtungen
4.3 Wahrheit und Klarheit
4.4 Bruttoveranschlagung
4.5 Einzelveranschlagung
4.6 produktorientierte Veranschlagung
4.7 Haushaltsausgleich
4.8 Zielorientierte Steuerung
5. Bestandteile und Anlagen der Haushaltspläne Stufe II
(0,5 UE)
5.1 Bestandteile der Haushaltspläne
5.2 Anlagen
5.3 Rechtsqualität des
Haushaltsplanes/Bindungswirkungen der
Haushaltsansätze
6. Deckungsgrundsätze (2 UE) Stufe III
6.1 Grundsatz der Gesamtdeckung
(Budgetierung vgl. 7.)
6.2 Zweckbindung von Einnahmen, Erträgen,
Einzahlungen
6.3 Deckungsfähigkeit von Ausgaben, Aufwendungen,
Auszahlungen
6.4 Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen
(unter Bildung von Haushaltsresten)
7. Budgetierung (0,5 UE) Stufe II
7.1 Begriff des Budgets und Vorteile der Budgetierung
7.2 Aufstellungsverfahren des Haushalts bei
Budgetierung
7.3 Darstellung im Haushaltsplan und den Anlagen
7.4 Bewirtschaftung der Budgets
8. Mittelfristige Finanzplanung (1 UE) Stufe III
8.1 Finanzplan (Inhalt, Ziele und Erkenntnisse daraus)
Seite 328.2 Investitionsprogramm
8.3 Verfahren, insbesondere Orientierungsdaten
8.4 Unterschied Finanzplan/Haushaltsplan
Lernfeld 2
Haushaltssatzung
1. VL nur kamerale Version (1 UE) –
2. VL nur doppische Version (1 UE)
1. Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung Stufe III
1.1 Haushaltsaufstellungsverfahren
(Eckwertebeschluss, Mittelanforderung/dezentrale
Erstellung, Leistungsziele und Kennzahlen)
1.2 Entwurf der Haushaltssatzung und ggf. Beratung
im Ausschuss
1.3 Beschlussfassung Haushaltssatzung durch
Gemeinderat
1.4 Vorlage Haushaltssatzung und Anlagen an
Rechtsaufsichtsbehörde
1.5 Einholung eventueller Genehmigungen bzw.
Behandlung eventueller Beanstandungen
1.6 Ausfertigung und Bekanntmachung der
Haushaltssatzung
1.7 Auflegung des Haushaltsplans
2. Inhalt der Haushaltssatzung Stufe III
2.1 Rechtsqualität der Haushaltssatzung
2.2 Inhalte
- Summe der Einnahmen oder Ausgaben des
Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts bzw.
Gesamtbeträge und Salden des Ergebnis- und
des Finanzhaushalts
- Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen
(aber nur für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen)
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
- Hebesätze für die Realsteuern
- Höchstbetrag der Kassenkredite
- mögliche weitere Festsetzungen
- Inkrafttreten zum 01.01. des Haushaltsjahres
3. Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit Stufe III
(ohne Voraussetzungen für die Erteilung der
Genehmigungen; nur genehmigungspflichtige Bestandteile kennen)
3.1 Genehmigung des Gesamtbetrages der
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
Seite 333.2 eventl. Genehmigung des Gesamtbetrages der
Verpflichtungsermächtigungen
Lernfeld 3
Bewirtschaftung des Haushaltsplanes
3. VL - 4 UE + 2 Übungseinheiten
1. Möglichkeiten in der haushaltslosen Zeit (1 UE) Stufe II
1.1 Vorläufige Haushaltsführung
- Ausgaben bzw. Aufwendungen und
Auszahlungen
- Einnahmen bzw. Erträge und Einzahlungen
- Stellenplan
1.2 Weitere Möglichkeiten
- unausgeschöpfte Kreditermächtigung des
Vorjahres und des Vorvorjahres
- neue Kredite
- Umschuldung
- verbliebene Verpflichtungsermächtigungen des
Vorjahres
- Fortgeltung des zuletzt festgesetzten
Höchstbetrages der Kassenkredite
- Haushaltsreste
2. Haushaltsbewirtschaftung und – überwachung Stufe II
(1 UE)
2.1 Bewirtschaftungsbefugnis
2.2 Bewirtschaftung der Einnahmen, Erträge und
Einzahlungen
rechtzeitige und vollständige Einziehung
2.3 Stundung, Niederschlagung, Erlass, Kleinbeträge (nur Kenntnis und
Unterscheidung der Billigkeitsmaßnahmen ohne detaillierte Prüfung
der Voraussetzungen und ohne Zinsberechnung)
2.4 Bewirtschaftung der Haushaltsansätze
- Ausgaben des Verwaltungs- und
Vermögenshaushalts
- Aufwendungen des Ergebnishaushalts und
Auszahlungen des Finanzhaushalts
- Vorschüsse und Verwahrgelder
- Vergabe von Aufträgen
(nur § 31 KommHV-K/§ 30 KommHV-D im Überblick)
2.5 Haushaltsüberwachung
2.6 Inanspruchnahme von
Verpflichtungsermächtigungen
2.7 Haushaltswirtschaftliche Sperre und
Berichtspflichten
3. Behandlung von Mehrausgaben (2 UE) Stufe III
3.1 Instrumente der flexiblen Haushaltsführung
3.2 Nachtragshaushaltssatzung,
Nachtragshaushaltsplan
Seite 343.3 Zulässigkeit von über- und außerplanmäßigen
Ausgaben, Aufwendungen, Auszahlungen
und Verpflichtungsermächtigungen
Lernfeld 4
Kamerales Kassen- und Rechnungswesen
3. VL - 8 UE + 2 Übungseinheiten
1. Anordnungswesen (1 UE) Stufe III
1.1 Anordnungsbefugnis
(insb. Übertragungsmöglichkeiten)
1.2 Arten der Kassenanordnungen
(ohne schwierige Fälle)
1.3 Feststellung der sachlichen und rechnerischen
Richtigkeit
(insb. Zuständigkeit und Verantwortlichkeiten)
2. Zahlungsverkehr (inkl. Grundsatz der Trennung Stufe II
von Anordnung und Vollzug,
Gebot der Einheitskasse
mit Einrichtung von Zahlstellen und
Handvorschüssen,
Bestellung des Kassenverwalters durch den
Gemeinderat) (2 UE)
2.1 Verfahren bei Ein- und Auszahlungen
- Erfordernis einer Anordnung
- Zeitpunkt der Einziehung/Leistung
- Nachweise
2.2 Zahlungsverzug (nur Hinweis auf Zuständigkeit der Kasse und
Regelungen im VwZVG und AO)
- Mahnung und Mahngebühren
- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher
und privat-rechtlicher Forderungen
- Säumniszuschläge und Verzugszinsen
- Stundung und Stundungszinsen (ohne Berechnung und detailierte
Kenntnis der Voraussetzungen)
- Niederschlagung, Erlass,
Behandlung von Kleinbeträgen
3. Verwaltung der Zahlungsmittel (1 UE) Stufe II
3.1 Liquiditätsplanung
3.2 Verstärkung des Kassenbestandes
3.3 Kassenkredite einschließlich innerer Kassenkredite
- Begriff und Arten
- formelle und materielle Erfordernisse
4. Kamerale Buchführung (4 UE) Stufe III
4.1 Grundsätze der Buchführung
(ordnungsgemäß, sicher, wirtschaftlich)
4.2 Abgrenzung zur doppelten kommunalen
Seite 35Buchführung
4.3 Geschäftsgang bei Buchungen anhand von
Beispielen
(einfache Buchungsbeispiele
ohne Rotabsetzungen)
4.4 Abschluss der Bücher zum Tagesabschluss
4.5 Behandlung von Unstimmigkeiten beim
Tagesabschluss
4.6 Aufbewahrung der Bücher und Belege
Seite 36t
Personalwesen
Fachkompetenz:
Sie können
• die Arten von Beschäftigungsverhältnissen im öffentlichen Dienst
(Beamte; Tarifbeschäftigte) unterscheiden.
• ihre eigenen Rechte und Pflichten, wie Entgeltanspruch,
Urlaubsanspruch, Arbeitspflicht einordnen.
• die maßgebenden gesetzlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen
von der Begründung bis zur Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses erläutern.
Methodenkompetenz:
Sie sind sicher
• bei der Bearbeitung einfacher Personalangelegenheiten aller
Beschäftigungsgruppen des öffentlichen Dienstes.
• bei der Mitwirkung von Einstellungsverfahren, Mitarbeiterbetreuung
und der Beendigung von Arbeitsverhältnissen.
Sozialkompetenz:
Sie sind in der Lage:
• die zentrale Bedeutung aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu
erkennen und können auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen.
• die Kooperation mit Mitarbeitern verantwortungsbewusst zu
geststalten.
• bei Personalgesprächen mitzuwirken.
Seite 37Voll-Lehrgang Lerninhalte Stundenzahl
3. VL 1. – 2.10 14 + 2 PU
4. VL 3. – 3.7.4 14 + 2 PU
5. VL 3.7.5 – 3.7.9 10
6. VL 4. – 6.3 4 + 10 PU
Die UE der Praktischen Umsetzung (PU) können individuell z. B. zu Übungszwecken oder zur
Bearbeitung von Teilnehmerfragen genutzt werden.
Die Berufsschule vermittelt im Fach Personalwesen Grundlagen des allgemeinen
Arbeitsrechts. Die BVS vermittelt Kenntnisse im Beamtenrecht und im Tarifrecht der
Beschäftigten im öffentlichen Dienst.
Lerninhalte Lernziele
1. Der öffentliche Dienst und seine Angehörigen
1.1 Arbeitgeber im öffentlichen Dienst Stufe II
(insb. Begriffe juristische Person, (Gebiets-)Körperschaften)
1.2 Beschäftigtengruppen Stufe II
(Beamte / Richter / Soldaten / Beschäftigte)
1.3 Unterschiede Beamtenverhältnis/Beschäftigtenverhältnis Stufe III
Unterscheidung nach:
- Rechtsnatur (Bei 1.3 sind nur die
- Rechtsgrundlagen Unterscheidungs-
- Zustandekommen kriterien
- Beendigung herauszuarbeiten)
- Bezahlung
- Soziale Absicherung
- Streikrecht
- Rechtsweg
2. Das Beamtenverhältnis
2.1 Begriff „öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis“ Stufe II
2.2 Grundbegriffe des Art. 33 GG Stufe I
(Leistungsprinzip, Funktionsvorbehalt, Institutionelle Garantie)
2.3 Gesetzgebungskompetenz (Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG) Stufe II
und Überblick über die wichtigsten Gesetze
2.4 Grundbegriffe des Beamtenrechts Stufe III
- Dienstherr
- Oberste Dienstbehörde
- Dienstvorgesetzter
- Vorgesetzter
- Ernennungsbehörde
2.5 Arten von Beamtenverhältnissen Stufe III
(auf Widerruf, auf Probe, auf Lebenszeit)
2.6 Qualifikationsebenen und Fachlaufbahnen Stufe II
Seite 38Sie können auch lesen