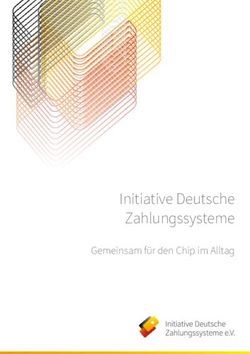XXII. Mesoamerikanistik Tagung XXII. Conference of Mesoamericanistic Studies XXII. Conferencia de Estudios Mesoamericanos
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung XXII. Conference of Mesoamericanistic Studies XXII. Conferencia de Estudios Mesoamericanos 24th to 26th of January 2020 Daten – Veranstaltungsort – Programm – Zusammenfassungen der Beiträge Dates ‐ Venue – Programme – Abstracts Fechas – Lugar – Programa ‐ Resúmenes Conference Room Linden‐Museum Stuttgart Staatliches Museum für Völkerkunde Hegelplatz 1 70174 Stuttgart www.lindenmuseum.de
XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
Veranstalter/Organizers/Organizadoras:
Prof. Dr. Inés de Castro, Director of the Linden‐Museum Stuttgart,
https://www.lindenmuseum.de/
Dr. Antje Gunsenheimer, Dep. for the Anthropology of the Americas, University of Bonn, Speaker
of the Regional Group on Mesoamerican Studies at the German Anthropologcial
Association/Deutsche Gesellschaft für Sozial‐ und Kulturanthropologie, https://rg‐
mesoamerica.de
Anfahrtsbeschreibung / How to get there / Cómo llegar:
Öffentliche Anfahrt/Public Transport/Transporte público:
1: Bushaltestelle Linden‐Museum/Olga‐Hospital: Bus 40, 42, 43
2: Haltestelle Berliner Platz: U 9, U 14
3: alle S‐Bahnen
4: Parkhaus Katharinenhospital
5: Parkhaus Holzgartenstraße
Anfahrt mit dem Auto / By car / En coche:
Verlassen Sie die Autobahnen in Richtung „Stuttgart‐Zentrum“. Orientieren Sie sich zunächst am
Stuttgarter Hauptbahnhof. Von da ab folgen Sie den Hinweisschildern zum Katharinenhospital,
das sich auf der rechten Seite der Kriegsbergstraße befindet. Die Kriegsbergstraße mündet nach
wenigen hundert Metern im Hegelplatz, an dem das Linden‐Museum liegt.
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Das Linden‐Museum befindet sich etwa 10 Gehminuten vom Stuttgarter Hauptbahnhof. Vom
Hauptbahnhof aus halten die Buslinien 40 (Richtung Vogelsang) und 42 (Richtung
Schreiberstraße) direkt am Linden‐Museum (Haltestelle Linden‐Museum/Olga‐Hospital).
2XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
Programme Friday, 24.01.2020
2:00 pm Introduction by organizers Inés de Castro and Antje Gunsenheimer
Panel 1 Moderation: Inés de Castro
2:30 pm Wolfgang Gabbert (Universität Hannover)
Gewaltdynamiken im „Kastenkrieg von Yucatán“ (1847 – 1901)
3:00 pm Ute Schüren (Universität Münster)
Visitas pastorales im südlichen Neuspanien im 18. und frühen 19.
Jahrhundert
3:30 pm Catherine J. Letcher Lazo (University of Bonn)
Kuxa’an suum: Insurrections and Millenarianism in Yucatec Mayan Oral
Literature
4:00 pm Coffee break – Cafecito
Panel 2 Moderation: Patricia Zuckerhut
4:30 pm Stefan Krotz (Universidad Autónoma de Yucatán)
„Im Süden“ und „des Südens“: Einblicke in die Dekolonialisierung der
Anthropologie in Mesoamerika
5:00 pm Eva Kalny (Universität Hannover)
Gewohnheitsrecht€: Selektive Anerkennung am Beispiel Guatemala
5:30 pm Eveline Dürr und Catherine Whittaker (Universität München)
Vigilanz im US‐mexikanischen Grenzraum: Ethnologische Perspektiven in
einem interdisziplinären SFB
6:00 pm Guided tour in the current exhibition “Azteken / Aztecs” by Inés de Castro
(Director of the Museum) and Doris Kurella (Exhibition Curator)
7:30 pm Dinner buffet at the Museum
3XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
Programme Saturday, 25.01.2020 Morning Sessions
Panel 3 Moderation: Romy Köhler
9:30 am Jesús Galindo Trejo (Universidad Autónoma de México)
Die Gründung von Mexico‐Tenochtitlan: Ein Vorschlag der
Archäoastronomie
10:00 am Inés de Castro (Linden‐Museum, Stuttgart)
Zwei Federschilde und eine Grünstein‐Figur aus den Beständen des
Landesmuseums Württemberg
10:30 am Elizabeth Baquedano (Institute of Archaeology, University College London)
THE POWERFUL MALINTZIN – THE CIHUATECUHTLI: Her roles in the Lienzo
de Tlaxcala
11:00 am Coffee break – Cafecito
Panel 4 Moderation: N.N.
11:30 am Uta Berger (Berlin)
Das Zeichen elel, seine Bedeutung nach historischen Quellen
12:00 am Thomas Vonk (Universität Bonn)
Die Freuden und Leiden aztekischer und mixtekischer Schriftzeichen
12:30 pm Christian Prager (Universität Bonn)
Über Semiotik in Maya‐Hieroglyphentexten
1:00 pm Lunch break at the Museum
2:00 pm Free tour through the exhibition
4XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
Programme Saturday, 25.01.2020 Afternoon Sessions
Panel 5 Moderation: N.N.
3:00 pm Romy Köhler (Universität Bonn)
¿Fueron los aztecas los mejores confesados?
3:30 pm Richard Herzog (Universität Gießen)
Europa aus Sicht der Nahua in Werken von Fernando de Alva Ixtlilxochitl
und Domingo de Chimalpahin
4:00 pm Michael Dürr (ZLB und FU Berlin) und Ulrike Mühlschlegel (IAI Berlin)
Wissensproduktion und Wissenstransfer: Ein Otomí‐Glossar des 16.
Jahrhunderts und sein Weg nach Berlin
4:30 pm Coffee break – Cafecito
Panel 6 Moderation: N.N.
5:00 pm Patricia Zuckerhut (Universität Wien)
Koloniale Differenz als radikale Differenz: Geschlecht und „Sexualität“
5:30 pm Christian Brückner (Hamburg)
Bewegte und bewegende Bilder. Mesoamerika im Film
6:00 pm Meeting of the Regional Group on Mesoamerican Studies (open to all
participants) with the following topics: election of new speakers, start of
working paper series
Moderation: Antje Gunsenheimer und Eveline Dürr
8:00 pm Dinner at restaurant
5XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
Programme Sunday, 26.01.2020
Panel 7 Moderation: Antje Gunsenheimer
9:00 am Andreas Fuls (TU Berlin)
Eine astronomische, epigraphische und linguistische Untersuchung des
Mondalters in den Mondserien der klassischen Mayakultur
9:30 am Alejandro J. Garay Herrera (Universität Bonn)
El estudio de los calendarios mesoamericanos en la Sierra de los
Cuchumatanes en el noroccidente de Guatemala
10:00 am Ortwin Smailus, Annette Kern, Karl‐Heinz Kramer und Joachim Classen
(Universität Hamburg)
Von der Biene bis zum Pferd: Tierheilkunde der yukatekischen Maya
10:30 am Iken Paap (Ibero‐Amerikanisches Institut ‐ Preußischer Kulturbesitz, Berlin)
Investigaciones recientes en Santa Rosa Xtampak (Campeche)
11:00 am Coffee break – Cafecito
Panel 8 Moderation: N.N.
11:30 am Ulrich Wölfel (Universität Bonn)
Archäologische Untersuchungen in Yalambojoch
12:00 am Franziska Fecher (Universität Zürich), Markus Reindel (KAAK/DAI) und Peter
Fux (Museum Rietberg Zürich)
Archäologische Forschungen in Nordosthonduras
12:30 am Marieke Joel (Berlin)
Methoden und Konzepte von Haushaltsanalysen
13:00 am Sarah Kauffmann y Alejandro J. Garay Herrera (Universidad de Bonn)
Mujeres nobles y guerreros cautivos: La epigrafía e iconografía maya como
ejemplos de complementariedad interdisciplinar en los estudios mayas
13:30 pm Announcement of Mesoamericanist’s Meeting in 2021 and farewell by
organizers
6XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
Beitragszusammenfassungen/Abstracts/Resúmenes
Friday 24.01.2020
Panel 1
Wolfgang Gabbert (Universität Hannover, Institut für Soziologie)
Gewaltdynamiken im "Kastenkrieg von Yucatán" (1847‐1901)
Während des 19. Jahrhunderts wurde das seit 1821 unabhängige Mexiko durch eine ganze Reihe
von Rebellionen vor allem indigener Kleinbauern erschüttert. Der "Kastenkrieg" von Yucatán"
(1847‐1901), im äußersten Südosten Mexikos, war wohl die bedeutendste dieser Erhebungen. Die
Auseinandersetzungen wurden z.T. mit großer Brutalität geführt und kosteten Tausende von
Menschen das Leben. Der Vortrag wird Ergebnisse des jüngst abgeschlossenen Projektes zu
Gewaltdynamiken im "Kastenkrieg" vorstellen. Dabei wird insbesondere auf bislang wenig
thematisierte Aspekte eingegangen, wie die Bedeutung von Gewalt als Moment der inneren
Organisation der Konfliktparteien, die Identifizierung der Opfer von Gewalthandlungen und die
Methoden zur Feststellung von Opferzahlen.
Ute Schüren (Universität Münster, Historisches Seminar)
Visitas pastorales im südlichen Neuspanien im 18. und frühen 19. Jahrhundert
Die Akten der Inspektionsreisen (visitas pastorales) der Bischöfe sind wichtige historische Quellen,
um die lokalen Bedingungen in den Landgemeinden der Halbinsel Yucatán insbesondere in Hinblick
auf ihre religiöse Organisation zu erschließen. Hier spiegelt sich eindrücklich der Gegensatz
zwischen offiziellen Normen und gewohnheitsrechtlichen Praktiken wider. Der Vortrag beschreibt
diesen Gegensatz am Beispiel der visitas der Chenes‐Region (heute Municipio de Hopelchén,
Campeche) während der späten Kolonialperiode.
Catherine J. Letcher Lazo (University of Bonn, Dep. for the Anthropology of the Americas)
Kuxa’an suum: Insurrection and Millenarianism in Yucatec Mayan Oral Literature
Oral literature, as pointed out by John D. Niles (1999), provides human beings with a means to
create a unique mental world they can inhabit, and locate their lives in time and space. It can thus
not only help the members of a social group to relate their past with the present but can also pave
“the way for an imagined future that may be a more blessed one” (p. 54). The kuxa’an suum (“living
rope”) is a widely spread oral narrative among the Mayan speaking population of Yucatán that
exhibits the above‐mentioned functions. Even though it has been documented by ethnographers,
systematic studies of the plot structure, its characters, and regional variations are still scarce. This
presentation aims at offering new insights into the relationship between the narrative symbolism,
a historical time of crisis, and a coming future when the Yucatec Mayas will resort to insurrection
to alter their condition and gain freedom from domination.
7XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
Friday 24.01.2020
Panel 2
Stefan Krotz (Universidad Autónoma de Yucatán und Universidad Autónoma
Metropolitana‐Iztapalapa, Mexiko)
„Im Süden“ und „des Südens“: Einblicke in die Dekolonialisierung der Anthropologie in
Mesoamerika
Der Vortrag ist eine Einladung, sich nicht nur für die vielfältigen soziokulturellen Phänomene
Mesoamerikas zu interessieren, sondern auch für die dortige anthropologische
Wissensproduktion. Nach Skizzierung zweier alternativer Formen der anthropologischen
Historiographie werden Charakteristiken der im Süden entstandenen Anthropologien vom denen
des Südens (auch „zweite“, „peripherische“ oder „eigene“ genannt) dargestellt. Abschließend
werden kritische Momente des gegenwärtigen De(s)kolonisierungsprozesses der
mesoamerikanischen Anthropologien aufgezeigt.
Eva Kalny (Universität Hannover, Institut für Soziologie)
Gewohnheitsrecht(e): Selektive Anerkennung am Beispiel Guatemala
In mehrheitlich indigen bewohnten Gebieten Guatemalas verhängen indigene Autoritäten immer
wieder Strafen, die im Widerspruch zur nationalen Gesetzgebung stehen und im Rest des Landes
kritisch diskutiert werden. Indigenes Gewohnheitsrecht ist zwar grundsätzlich anerkannt, die
rechtliche Umsetzung allerdings weitgehend ungeregelt. Wichtige Verfassungsreformen
scheiterten im Jahr 2017 im Kongress an Diskussionen zur Anerkennung des indigenen
Gewohnheitsrechts. Dabei folgen auch politische und ökonomische Eliten Regeln und Normen, die
im Widerspruch zur nationalen Gesetzgebung stehen. Die unterschiedlichen Folgen dieser
Regelverstöße sowie die diesbezüglichen Diskurse und Gesetzesreformen veranschaulichen
gesellschaftliche Machtstrukturen.
Eveline Dürr und Catherine Whittaker (LMU München, Institut für Ethnologie)
Vigilanz im US‐mexikanischen Grenzraum: Ethnologische Perspektiven in einem
interdisziplinären SFB
Dieser Vortrag diskutiert Vigilanz im US‐mexikanischen Grenzraum und präsentiert zum einen ein
Teilprojekt des SFB 1369 „Vigilanzkulturen“, zum anderen den Beitrag der Ethnologie in einem
interdisziplinären Forschungskontext. „Vigilanz“ wird als eine Form von Wachsamkeit definiert, die
durch spezifische Werte motiviert ist und Maßnahmen hervorbringt, um diese Werte zu
verteidigen. Das Augenmerk liegt auf Hispanics, die fälschlicherweise als „fremd“ oder als
„MigrantInnen“ gelten, tatsächlich aber nie migriert sind. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich
die erhöhte Aufmerksamkeit mit Blick auf die Anti‐Migrations‐Diskurse auf diese AkteurInnen
auswirkt und welche Praktiken eingesetzt werden, um dieser Situation zu begegnen.
8XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
Saturday Morning 25.01.2020
Panel 3
Jesús Galindo Trejo (UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, México)
Die Gründung von Mexico‐Tenochtitlan: ein Vorschlag der Archäoastronomie
Nach den meisten ethnohistorischen Quellen erfolgte die Gründung der aztekischen Hauptstadt
im Jahr 1325. Auf Befehl des Gottes Huitzilopochtli ließen sich die Azteken am Texcoco‐See nieder,
wo ein Adler auf einem Feigenkaktus saß und eine Schlange verschlang. Am 21. April jenes Jahres
gab es eine totale Sonnenfinsternis, die kurz vor Mittag eine Dunkelheit verursachte, die vier
Minuten andauerte. Dieses eindrucksvolle Signal sollte den Ort bestimmen, an dem sich die
Azteken nach einer langen Pilgerreise von mehreren Jahrhunderten ansiedeln würden.
Huitzilopochtli ließ dort einen Tempel errichten, um das Zentrum der aztekischen Macht zu
formalisieren. Zwei Trecenas nach der Sonnenfinsternis fand der erste Zenitdurchgang der Sonne
statt. Daher wird vorgeschlagen, dass die Gründung von Mexico‐Tenochtitlan am 17. Mai 1325
stattfand.
Inés de Castro (Linden‐Museum, Stuttgart)
Zwei Federschilde und eine Grünstein‐Figur aus den Beständen des Landesmuseums
Württemberg
Elizabeth Baquedano (University College London, Institute of Archaeology)
THE POWERFUL MALINTZIN ‐ THE CIHUATECUHTLI: Her roles in the Lienzo de Tlaxcala
The original Lienzo de Tlaxcala was lost, but several copies, written between the 1530s ‐ 1540s,
have survived to this date. Malintzin’s role has been reduced to the ever‐ important role of Cortés’s
translator or interpreter. However, her role is manifold. The Lienzo depicts Malintzin as a mediator
between the Mexicans and the Spaniards. She is often shown in the middle of the negotiation
process; seen receiving gifts or tribute, and at other times Malintzin is another conquistador
fighting battles or spreading the Christian faith. These and other roles will be evaluated as they are
seen in this conquest pictorial, including her moments of rest besides Hernán Cortés.
Panel 4
Uta Berger (Berlin)
Das Zeichen elel, seine Bedeutung nach historischen Quellen
In der Ausstellung „Azteken” des Stuttgarter Linden‐Museums steht die Keramikfigur des
Todesgottes Mictlantecuhtli oder eines Tzitzimitl, eines Dämons. Mitten aus seiner Brusthöhle
hängt ein dreigelapptes Objekt, das als Leber gedeutet wird. Lage und Form sprechen eher für den
Inhalt der Brusthöhle. Nach Hermann Bayer ist ein zweilappiges Zeichen im C. Xolotl eine Leber,
9XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
elli. Davon leitet er das Morphem elel des Namens Tlacaelel ab. Bayer zitiert Torquemadas
Übersetzung von elel: „de gran Coraçon, y de fuertes, y rigurosas Entrañas“. Er kommentiert diese
Deutung nicht. Im Zusammenhang mit dem dreigelappten Objekt wird das Zeichen und die
Interpretation des Wortes elel bzw. elli nach den Quellen untersucht.
Thomas Vonk (Universität Bonn, Abt. Altamerikanistik)
Die Freuden und Leiden aztekischer und mixtekischer Schriftzeichen
Bekanntlich sind die Zeichen der mixtekischen und der Nahuatl‐Schrift bildhaft: sie zeigen Tiere,
Objekte – und Menschen. Letztere, um die es im Vortrag gehen soll, beziehen ihre Bedeutung oft
durch die dargestellte Tätigkeit, etwa eine Person, die einen Fries umknickt, in der Schreibung des
Ortsnamens Chiyo Canu. Mitunter zeigen die Zeichen aber Menschen in bestimmten Gefühlslagen,
wie sie sich vergnügen, weinen oder Qualen leiden. Interessant wird es aber, wenn diese Zeichen
mit der Ikonografie verwoben werden. So kann ein angreifender Krieger so manches Zeichen in
Schrecken versetzen – oder ein anderes Zeichen gar töten. Im Vortrag werden besonders
eindrucksvolle Beispiele aus beiden Schriftsystemen vorgestellt.
Christian Prager (Universität Bonn, Abt. Altamerikanistik)
Über Semiotik in Maya‐Hieroglyphentexten
Die Funktion und Bedeutung von Hieroglyphentexten der Klassischen Mayakultur gehen über die
phonographische und diskursive Eigenschaft hinaus. Die in Stein gearbeiteten Texte der Maya
erstrecken sich in einem dreidimensionalen Raum und besitzen dadurch semiotisches Potenzial,
für das / die es keine Entsprechungen in der gesprochenen Sprache gibt. So transportieren etwa
die Größe oder Kleinheit der Inschriften, die Form der Textfelder, das Spiel von Text und
Schriftgröße, die Dreidimensionalität oder „Belebtheit“ der Schriftzeichen, farbige Akzente, die
Verwendung verschiedener Bildhauerstile innerhalb derselben Textträger Bedeutungen, die im
geschriebenen Text nicht zur Sprache kommen und kommunikative Bedeutungen zum Ausdruck
bringen, die das Wort alleine nicht vermitteln kann. Am Beispiel einer spätklassischen Stele aus
Piedras Negras möchte ich über das semiotische Potential sprechen, das bislang in den Inschriften
und Bildwerken verborgen liegt.
Saturday Afternoon 25.01.2020
Panel 5
Romy Köhler (Universität Bonn, Abt. Altamerikanistik)
¿Fueron los aztecas los mejores confesados?
La ponencia retoma la pregunta si es que había una confesión indígena prehispánica en el altiplano de
México, o si el Neyolmelahualiztli formaba parte del discurso cristiano introducido en el marco colonial
de la misión. En base a una relectura intertextual de un Huehuetlatolli escrito en nahuatl en letras
latinas en el contexto virreinal de su producción y consiguiente compilación en el Códice Florentino
con otras fuentes (icono‐)gráficas de la época, mostraré que la llamada „etnografía“ en la época
10XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
colonial temprana de Nueva España formaba parte de una mirada teológica específica, puesta en
la religiosidad de los mexicah que los concebió como “pecadores”.
Richard Herzog (Justus‐Liebig‐Universität Gießen, Historisches Institut)
Europa aus Sicht der Nahua, in Werken von Fernando de Alva Ixtlilxochitl und Domingo de
Chimalpahin
Der Vortrag verfolgt die Rolle Europas in den Werken von zwei wichtigen Gelehrten der Nahua
(Azteken): Fernando de Alva Ixtlilxochitl und Domingo de Chimalpahin. Beide lebten im frühen 17.
Jahrhundert in Mexiko‐Stadt, Knotenpunkt zwischen der spanischen Metropole und ihren
Übersee‐Besitztümern. Dadurch waren Chimalpahin und Alva Ixtlilxochitl mit europäischen
Quellen und Wissenssystemen bestens vertraut. Zugleich war beiden Autoren die Weitergabe der
prä‐hispanischen Geschichte ihrer jeweiligen Vorfahren ein zentrales Anliegen. Die Weitergabe
wurde durch die spanische Zerstörung von Nahua‐Quellen und die indigene demographische
Katastrophe entscheidend erschwert. Dieses Spannungsfeld zwischen lokaler Identifizierung und
zunehmend globalen Verbindungen beeinflusste Beide auf unterschiedliche Weise. Es wird hier
anhand zentraler Passagen zu Europa und speziell zu Iberien nachverfolgt, um europäische Blicke
auf Mesoamerika umzukehren.
Michael Dürr (ZLB und FU Berlin) und Ulrike Mühlschlegel (IAI Berlin)
Wissensproduktion und Wissenstransfer: Ein Otomí‐Glossar des 16. Jahrhunderts und sein Weg
nach Berlin
Im Sommer 2018 erhielt das Ibero‐Amerikanische Institut mit dem Nachlass Ulrich Köhlers das
Manuskript eines Glossars in Otomí und Spanisch. Nachforschungen ergaben, dass es sich um eine
Abschrift handelt, die Eduard Seler von Molinas Vocabulario en lengua castellana y mexicana
(1571) anfertigen ließ, und zwar von einem Exemplar mit Randglossen in Otomí. Die Geschichte
dieses speziellen Exemplars und sein Weg durch private Büchersammlungen und Antiquariate
konnte weitgehend nachgezeichnet werden. Die Entstehung der Abschrift wird in den größeren
Zusammenhang von Sammel‐ und Kopieraktivitäten zu indigenen Sprachen Mexikos gestellt, von
der die Nachlässe Selers und Walter Lehmanns im Ibero‐Amerikanischen Institut ein
eindrucksvolles Zeugnis ablegen.
Panel 6
Patricia Zuckerhut (Universität Wien, Institut für Kultur‐ und Sozialanthropologie)
Koloniale Differenz als radikale Differenz: Geschlecht und „Sexualität“
Ausgangspunkt meines Beitrages ist Differenz. Ich beziehe mich – neben Kategorien (oder auch
Markierungen) der Differenz wie Ethnie, Klasse, Geschlecht etc. und ihren Überschneidungen ‐ vor
allem auf koloniale Differenz in Verbindung mit Sexing und Gendering, denen Lateinamerika seit
der spanischen Conquista ausgesetzt ist, aber auch auf eine „radikale Differenz“, die in neuerer
Zeit von verschiedenen Vertreter_innen des Ontological Turn hervorgehoben wird. Diese „radikale
Differenz“ beinhaltet, dass etwas, das scheinbar gleich ist, beispielsweise „Geschlecht“, insofern
11XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
„radikal different“ ist, als es in völlig anderer Weise eingesetzt und somit erzeugt wird. Derlei
„Irrtümer“ (equivocaciones) gehe ich in Hinblick auf Geschlecht und Sexualität mit Fokus auf die
Gottheit Tlazoltéotl‐Toci nach. Tlazoltéotl‐Toci ist auch insofern interessant als sie seitens der
spanischen Kleriker in Böse (Dämonin bzw. Eva) und Gut (Mutter bzw. Maria) aufgeteilt wird, und
auch heute wieder ‐ im Chicana‐Feminismus ‐ eine zentrale Rolle spielt.
Christian Brückner (Hamburg)
Bewegte und bewegende Bilder. Mesoamerika im Film
Seit März 2019 veranstaltet die Mesoamerika‐Gesellschaft Hamburg die Vortragsreihe
„Mesomerika im Film“, die sich umfassend mit der visuellen Repräsentation dieses Kulturraumes
beschäftigt: im Ethnographischen Film, in Geschichts‐ und Archäo‐Dokus, in diversen Spielfilm‐
Formaten (historischer Film, Abenteuer und Fiction) und – an Einfluss und Bedeutung zunehmend
– in Form 'privater' youtube‐Videos, die bisherige filmische und thematische Grenzen und
Konventionen überschreiten. Die vielen Beispiele und Beträge der Reihe bieten Ansatzpunkte für
vertiefende Untersuchungen und weiterführende Forschungen. Im Vortrag werden die Filmreihe
und bereits skizzierte Forschungsansätze vorgestellt, u.a. zu unveröffentlichtem Filmmaterial von
Reisenden aus den 1970er und 1980er Jahren abseits der touristischen Hotspots.
Meeting of the Regional Group on Mesoamerican Studies (open to all participants)
The Regional Group will discuss the possibilities of initiating an online working paper series on
Mesoamerican Research, elect its speakers for the period of 2020 – 2022 and discuss future
activities.
Moderation: Antje Gunsenheimer und Eveline Dürr
Sunday 26.01.2020
Panel 7
Andreas Fuls (Technische Universität Berlin, Institut für Geodäsie und
Geoinformationstechnik)
Eine astronomische, epigraphische und linguistische Untersuchung des Mondalters in den
Mondserien der klassischen Mayakultur
In den Inschriften auf Stelen der klassischen Mayakultur sind in den kalendarischen Informationen
eingebettet oftmals die als Mondserien bekannten Textabschnitte verzeichnet. Zurzeit sind
mindestens 474 Mondserien bekannt, von denen 383 einen Hinweis auf das Mondalter besitzen
und in der Langen Zählung datierbar sind. Neben einem Zahlenkoeffizienten zwischen eins und 28
enthält die Mondaltersglyphe einen verbalen Ausdruck, der einen Hinweis auf das astronomische
Referenzereignis enthalten könnte. Die Zahlenkoeffizienten gaben an, wie viele Tage seit dem
12XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
Referenzereignis vergangen waren. Eine in der Forschung der Mayaastronomie wichtige Frage ist
es zu klären, um welches astronomische Ereignis es sich dabei gehandelt haben könnte.
Alejandro J. Garay Herrera (Universität Bonn, Abt. für Altamerikanistik)
El estudio de los calendarios mesoamericanos en la Sierra de Los Cuchumatanes en el
noroccidente de Guatemala
A lo largo de esta presentación se espera resumir el estado de conocimiento sobre los calendarios
mesoamericanos de 260 y 365 días en la región del noroccidente de Guatemala, específicamente
en la Sierra de Los Cuchumatanes, donde se encuentran los grupos etno‐lingüísticos mayas
akateko, chuj, jakalteko‐popti’ y q’anjobal. Se espera presentar un resumen de las investigaciones
realizadas en esa región hasta la fecha, destacando la importancia que estos calendarios siguen
teniendo para las comunidades indígenas hasta el presente. Se abordarán las semejanzas y
diferencias entre los calendarios de esa zona y los de otras partes del área maya y el resto de
Mesoamérica, realizando una caracterización de los componentes de dichos calendarios y del uso
que reciben de forma contemporánea.
Ortwin Smailus, Annette Kern, Karl‐Heinz Kramer und Joachim Classen (Universität
Hamburg)
Von der Biene bis zum Pferd: Tierheilkunde der yukatekischen Maya
Schon die Bienen‐Almanache im Madrider Codex zeugen von der Bedeutsamkeit der Haltung der
stachellosen Melipona‐Biene bei den yukatekischen Maya. Der Honig dieser Bienen wird bis heute
u.a. in religiösen Ritualen verwendet. Bei Krankheit der wertvollen Insekten führen rituelle
Spezialisten (j‐menoʼob) Heilungszeremonien durch. Auch andere Tiere wurden im Krankheitsfalle
behandelt. In den kolonialzeitlichen medizinischen Handschriften finden sich vereinzelt Hinweise
darauf. Besonders Rezepte bei gesundheitlichen Problemen von Pferden und europäischen
Nutztieren sind hier zu nennen.
Iken Paap (Ibero‐Amerikanisches Institut ‐ Preußischer Kulturbesitz, Berlin)
Neuere Arbeiten in Santa Rosa Xtampak (Campeche)
2018/2019 wurden in Santa Rosa Xtampak, einem prä‐ bis endklassischen Fundort im Westen des
heutigen Bundesstaates Campeche, verschiedene archäologische Arbeiten durchgeführt. Die
vorspanische Siedlung war seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Gegenstand zahlreicher
architektonischer Studien und Konsolidierungsprojekte ̶ trotz dieser umfangreichen Arbeiten ist
das archäologische Wissen über Santa Rosa Xtampak aber nach wie vor oberflächlich. Um eine
solide Grundlage für zukünftige Forschung zu schaffen, haben wir 2018 begonnen, den Plan des
Siedlungszentrums zu überarbeiten, der auf eine Kartierung durch Brainerd, Roys und Ruppert von
1949 zurückgeht. Parallel wurde 2018 durch Archäologen das INAH ein neues
Konsolidierungsprojekt begonnen.
13XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
Panel 8
Ulrich Wölfel (Universität Bonn, Institut für Archäologie und Kulturanthropologie)
Archäologische Untersuchungen in Yalambojoch
Die Chaculá‐Region im nordwestlichen Hochland Guatemalas ist seit 2013 das Ziel archäologischer
Untersuchungen durch das Proyecto Arqueológico de la Región Chaculá (PARCHA). In diesem Teil
des Maya‐Hochlands, am Fuße der Altos Cuchumatanes gelegen, befinden sich zahlreiche
archäologische Stätten, die erstmals 1896 durch Eduard Seler erforscht wurden. In der
Feldforschung 2018 wurden verschiedene Stätten in der Umgebung von Yalambojoch
dokumentiert. Die Stätten Yalambojoch, Unin Witz und Yib'anh Kolan Xak wurden überdies
kartographiert und es wurden hier erstmals Ausgrabungen durchgeführt, wodurch ein erster
Einblick in die vorspanische Geschichte dieses bislang wenig bekannten Teils der Region erlangt
werden konnte.
Franziska Fecher (Universität Zürich), Markus Reindel (KAAK/DAI), Peter Fux (Museum
Rietberg Zürich)
Archäologische Forschungen in Nordosthonduras
Die südliche Grenze Mesoamerikas verläuft durch das heutige Staatsgebiet von Honduras. Die
archäologische Forschung hat sich bisher auf den westlichen, zu Mesoamerika gehörenden Teil
konzentriert und die Mayastadt Copan ist zu einem wichtigen Element der nationalen Identität
geworden. Aber wie sah es in den benachbarten Regionen aus? Der östliche Landesteil wurde von
der Forschung bislang weitestgehend vernachlässigt, so dass grundlegende Fragen zur
vorspanischen Kulturentwicklung offenblieben. Das Archäologische Projekt Guadalupe führt seit
2016 Untersuchungen im nordöstlichen Honduras durch, um einen Beitrag zur Erforschung dieser
wenig bekannten Region zu leisten. Dabei wurden viele spannende Erkenntnisse gewonnen, die in
diesem Beitrag vorgestellt werden sollen.
Marieke Joel (Berlin)
Methoden und Konzepte von Haushaltsanalysen
In Dzehkabtún, einer Mayastätte im Norden Campeches (Mexiko) wurde zwischen 2012 und 2018
eine Hofgruppe ausgegraben, die als Wohnanlage eines Haushaltes interpretiert wird. Sie datiert
in die Späte Klassik und Endklassik (750‐1050 A.D.), einer Zeit die von großen soziopolitischen
Umbrüchen gekennzeichnet ist. Haushalte bilden die kleinste sozio‐ökonomische Einheit einer
Gesellschaft und reflektieren als solche die soziale Organisation sowie Prozesse und
Veränderungen einer Gesellschaft. Für die Analyse von Haushalten sind in den letzten Jahrzehnten
eine Vielzahl an Methoden und Konzepten entwickelt worden, die vorgestellt und deren
Anwendung für die Hofgruppe in Dzehkabtún diskutiert werden sollen.
14XXII. Mesoamerikanistik‐Tagung, Linden‐Museum, Stuttgart
Sarah Kauffmann y Alejandro J. Garay Herrera (Universität Bonn, Abt. für
Altamerikanistik)
Mujeres nobles y guerreros cautivos: La epigrafía e iconografía maya como ejemplos de
complementariedad interdisciplinar en los estudios mayas
Hasta la fecha, muchas preguntas sobre la civilización maya todavía carecen de respuestas
adecuadas, como es el caso con el rol de la mujer maya en la sociedad. El avance en disciplinas
como la epigrafía e iconografía en las últimas décadas ha permitido una mejor comprensión de las
dinámicas al interior de esta civilización. A lo largo de esta presentación, se busca presentar como
las representaciones e inscripciones registradas en la piedra pueden obtener informaciones claves
para mejorar nuestra comprensión del pasado. Se abordarán varios ejemplos en torno a la figura
de mujeres nobles, así como de los cautivos de guerra. Estos grupos tenían un papel menor dentro
de la sociedad.
----
15Sie können auch lesen