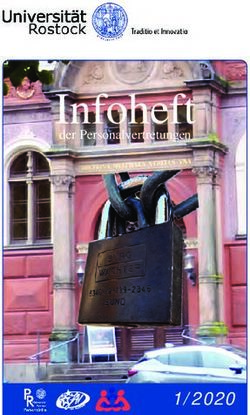2 Initial Berliner Debatte - shop. welttrends. de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Berliner Debatte
Initial
2
31. Jg. 2020
Skandal und
Empörung
Fröhlich
Sündenfall
Inauthentizität
Lim
Mikroaggressionen
in der Hochschule
Peltzer, Pilipets
Die Ironie der
Ibiza-Affäre
Irrlitz
Es tut uns leid, nicht
immer loben zu können
Busch
Beethoven
ISBN 978-3-947802-50-0 in der DDR
www.berlinerdebatte.deBerliner Debatte Initial 31 (2020) 2
Autorinnen und Autoren
Gregor Balke, Dr. Simone Jung, Dr.
Soziologe und Kulturwissenschaftler, Lüb- Soziologin, Leuphana Universität
benau Lüneburg
Ulrich Busch, Dr. oec. habil. Il-Tschung Lim, Dr.
Finanzwissenschaftler, Leibniz-Sozietät der Soziologe, Justus-Liebig-Universität Gießen
Wissenschaften zu Berlin
Michail Maiatsky, Ph.D.
Christine Campen Philosoph, Université de Fribourg,
Soziologin, Universität Koblenz-Landau Université de Lausanne (Schweiz)
Manuel Dieterich Günter Mey, Prof. Dr.
Soziologe, Universität Tübingen Psychologe, Hochschule
Magdeburg-Stendal
Marc Dietrich, Dr.
Soziologe, Hochschule Peer Pasternack, Prof. Dr.
Magdeburg-Stendal Direktor des Instituts für
Hochschulforschung (HoF), Martin-Luther-
Oliver Dimbath, Prof. Dr.
Universität Halle-Wittenberg
Soziologe, Universität Koblenz-Landau
Anja Peltzer, Dr.
Jennifer Eickelmann, Dr.
Medien- und Kommunikationswissenschaft-
Soziologin und Medienwissenschaftlerin,
lerin, Universität Trier
Technische Universität Dortmund
Elena Pilipets, Dr.
Gerrit Fröhlich, Dr.
Medien- und Kulturwissenschaftlerin,
Soziologe, Universität Trier
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Öster-
Wladislaw Hedeler, Dr. reich)
Historiker, Berlin
Martin Seeliger, Dr.
Kai-Uwe Hellmann, apl. Prof. Dr. Soziologe, Universität Hamburg
Soziologe, Technische Universität Berlin
Gerd Irrlitz, Prof. em. Dr.,
Philosoph, Humboldt-Universität zu BerlinBerliner Debatte Initial 31 (2020) 2 1
Skandal und Empörung
Zusammengestellt von Marc Dietrich,
Günter Mey und Martin Seeliger
SKANDAL UND EMPÖRUNG – Simone Jung
ANALYSEN ZU POPKULTUR, Kritische Öffentlichkeiten?
POLITIK UND JOURNALISMUS Formen der Skandalisierung in
der Kulturpublizistik am Beispiel der
Marc Dietrich, Günter Mey, Band Feine Sahne Fischfilet 96
Martin Seeliger
Zur Einleitung 3 Anja Peltzer, Elena Pilipets
Die Ironie der Empörung.
Gerrit Fröhlich Affektive Politik im digitalen
Inauthentizität als digitaler Sündenfall. Afterlife des Ibiza-Videos 108
Öffentliche Konflikte um richtige Spiele,
falsche Gamer und wahre Geschichte
in der digitalen Spielekultur 10 ***
Jennifer Eickelmann Gerd Irrlitz
„Rape Day“ zwischen Realität Es tut uns leid,
und Fiktion. Affektive Öffentlichkeiten nicht immer loben zu können 123
und digitale Spiele 22
Peer Pasternack
Gregor Balke Gefangensein im Bestehenden.
Comedy der Empörung. Über komische Der Rechtspopulismus und die
Inszenierungen sozialer Erregung 35 merkwürdige Didaktik der Aufklärung 134
Martin Seeliger Ulrich Busch
„Wer mir Befehle gibt? Nur meine Eier!“ Ludwig van Beethoven –
Clankriminalität in der Serie „4 Blocks“ 50 Favorit der Musikkultur der DDR 146
Christine Campen, Oliver Dimbath
Gesichter der Empörung 61 REZENSIONEN
Manuel Dieterich Colin Campbell:
Überengagement durch Moralisierung. The Romantic Ethic and the Spirit
Selbst- und Fremdidentifikationen of Modern Consumerism
in einem kommunalen Streit Rezensiert von Kai-Uwe Hellmann 161
um eine Flüchtlingsunterbringung 74
Wolfgang Harich:
Il-Tschung Lim Friedrich Nietzsche. Der Wegbereiter
Kultur der Empörung. Mikroaggressionen des Faschismus / Arnold Gehlen. Eine
als kommunikative Episode und marxistische Anthropologie?
Signatur politischer Konflikte 86 Rezensiert von Ulrich Busch 1642 Berliner Debatte Initial 31 (2020) 2
Merab Mamardaschwili: Renate Lachmann:
Die Metaphysik Antonin Artauds / Lager und Literatur.
Das Wien der Jahrhundertwende. Essays Zeugnisse des GULAG
Rezensiert von Michail Maiatsky 168 Rezensiert von Wladislaw Hedeler 170
Editorial
Empörung – ohne einen Eintrag hierzu wäre Empörung stehen, und stellen die einzelnen
ein Glossar der Gegenwart wohl unvollständig. Texte vor.
Das Phänomen ist selbstverständlich nicht neu. Außerhalb des Themenschwerpunkts set-
Über etwas entrüstet zu sein, ist als moralisches zen wir die Debatte über jene 30 Jahre fort, die
Gefühl eine Alltäglichkeit. Sich empören meint seit 1989/90 vergangen sind (siehe hierzu Heft
aber auch: aufbegehren, aufstehen, den Ge- 4/2019). Gerd Irrlitz spannt in seinem Essay
horsam verweigern. Versteht man Empörung einen großen Bogen von den Entwicklungen
nur als eine negative Emotion, so handelt es der Nachwendezeit bis zur Digitalisierung
sich um eine individuelle Angelegenheit. Ver- unserer Tage. Ausgehend von dem Bedauern,
steht man unter Empörung jedoch Aufruhr als „Deutscher von drüben“ nicht in der er-
und Widerstand, so handelt es sich um ein hofften Weise Lob spenden zu können, fragt
soziales Phänomen, das über das Individuum er nach Perspektiven einer erneuerten sozia-
und seine psychischen Regungen hinausweist. listischen Bewegung. Die AfD charakterisiert
Doch nicht nur, wer sich empört, sondern auch, er als Wiedergänger jenes Konservatismus, der
was Empörung hervorruft, ist von Bedeutung. in der restaurativen Phase der alten BRD po-
Üblicherweise wird Anstoß genommen an pulär war. Peer Pasternack geht von den eigen-
individuellem Verhalten. Doch für Empörung tümlich verzeichneten Bildern aus, die von
sorgen können auch ‚die Verhältnisse‘ im Sin- Ostdeutschland gemalt werden, um sich dann
ne einer bestimmten sozialen Formation, Lage dem grassierenden Rechtspopulismus zuzu-
oder Situation. wenden und zu fragen, wie aufgeklärte Milieus
Im Themenschwerpunkt Skandal und auf ihn reagieren. Er argumentiert dafür, den
Empörung geht es um die Frage, wie Empörung Status quo zu analysieren und das „Gefangen-
in den Bereichen Populärkultur, Politik und sein im Bestehenden“ zu überwinden. Ein ganz
Journalismus entsteht, das heißt, wie sie sozi- anderes Thema behandelt Ulrich Busch: Lud-
al hervorgebracht, gemacht, konstruiert wird. wig van Beethovens 250. Geburtstag ist für ihn
Die neun Beiträge analysieren aktuelle, zum ein willkommener Anlass darzulegen, warum
Teil aufsehenerregende und skandalöse Bei- Beethoven der Favorit der offiziellen DDR-
spiele, stellen aber auch grundsätzliche Fragen. Musikkultur war. An einer Fülle von Material
Diese betreffen nicht zuletzt die Auswirkungen zeigt er Spielarten, aber auch Grenzen der
digitaler Medien auf das, was man gemeinhin Beethoven-Verehrung in der DDR auf.
Öffentlichkeit nennt. In ihrer Einleitung erläu-
tern Marc Dietrich, Günter Mey und Martin
Seeliger, in welcher Verbindung Skandal und Thomas MüllerBerliner Debatte Initial 31 (2020) 2 3
Marc Dietrich, Günter Mey, Martin Seeliger
Skandal und Empörung – Analysen
zu Popkultur, Politik und Journalismus
Zur Einleitung
In der Grundtendenz zeichnen sich fast alle den USA wie Watergate oder Bill Clintons
Gesellschaften und Kulturen durch ein zähes Lewinsky-Affäre. In der alten Bundesrepublik
und wiederkehrendes Ringen um (Selbst-) sind sicher der Spion im Bundeskanzleramt
Verständigung, Ordnung, Grenzziehung und von Willy Brandt, die Barschel-Affäre („Water-
Macht aus. Geht es darum zu untersuchen, kantgate“) oder die CDU-Spendenaffäre anzu-
was Gesellschaften bewegt, dann besteht eine führen. Neben Politik und Journalismus (man
vielversprechende Option darin, gerade solche denke an die fingierten Hitler-Tagebücher, die
Ereignisse zu analysieren, bei denen die sozio- das Magazin „Stern“ Anfang der 1980er Jahre
kulturellen Aushandlungsprozesse abrupt und/ publik machte und die Jahrzehnte später ge-
oder intensiviert sichtbar werden. Letzteres ist spiegelt wurden durch die erfundenen Inter-
insbesondere in (teil-)öffentlichen Erregungs- views des Redakteurs Claas Relotius) ist beson-
phasen erkennbar, die gemeinhin als „Skandal“ ders der Kultursektor anfällig: die Aufregung
gelten. Ein besonderes Identifizierungsmerkmal in den 1950er Jahren um den Film „Die Sün-
für den Skandal liegt darin, dass er „Empörung“ derin“ wegen einer Nacktszene mit Hildegard
generiert. Letztere kann als eine Form von Knef, Marco Ferreris „Das große Fressen“ aus
Resonanz verstanden werden, die von ganz den 1970er Jahren, der durch filmisch explizi-
unterschiedlichen Akteur*innen und Gruppen te Darstellungen von ‚Orgien‘ provozierte, bis
in zeitlich unterschiedlicher Ausdehnung und hin zu den mannigfaltigen Skandalinszenie-
Intensität ausgehen kann. Es handelt sich bei rungen von Popstar Madonna (z. B. ihr Bildband
„Empörung“ aus unserer Sicht um eine Form „Sex“) – diese Liste ließe sich problemlos
von Anschlusskommunikation, die sich ten- weiterführen und auf andere Bereiche, wie etwa
denziell durch affektiv gefärbte Bezugnahmen Wissenschaft, ausdehnen (etwa die Plagiats-
sowie die Signalisierung von inhaltlicher Ma- vorfälle von Karl-Theodor zu Guttenberg oder
ximaldistanz oder Maximalzustimmung zur Annette Schavan).1 Gelegentlich – und hier
jeweiligen Thematik auszeichnet. Insofern ist dringen wir dann exemplarisch in das 21. Jahr-
es typisch für Skandale, dass sie bei den Be- hundert vor – reflektiert eine politische Inter-
troffenen und/oder Kommentierenden Dissens vention auch gleich ihr Anliegen im Titel: So
in verschiedenen Dimensionen erzeugen und verfasste der UN-Diplomat und ehemalige
auf komplexe Verschränkungen sozialer, kul- Kämpfer der französischen Resistance, Stépha-
tureller und psychologischer Faktoren verwei- ne Hessel, 2010 mit der Streitschrift „Indignez
sen. Vouz!“ (deutsch „Empört Euch!“) ein Manifest,
Skandale und Empörung, so lässt sich auf das die Legitimationsprobleme einer neolibe-
einer noch recht allgemeinen Ebene feststellen, ralen Wirtschaftsordnung zum Anlass für
durchziehen die Geschichte konstant. Schon politischen Protest erklärte – eine Aufforderung,
ein kursorischer Blick auf die zweite Hälfte des der in den folgenden Jahren zahlreiche Bewe-
letzten Jahrhunderts führt dies vor Augen: gungen und Initiativen, wie etwa das „Occupy
Nennen lassen sich große Polit-Ereignisse in Wallstreet Movement“ oder auch die spanischen4 Marc Dietrich, Günter Mey, Martin Seeliger
„Indignados“ (deutsch: „Die Empörten“), nach- spielerin Alyssa Milano – sexuelle Gewalt in
kommen sollten. der Filmbranche und darüber hinaus thema-
Festhalten lässt sich also, dass jede Zeit ihre tisierte. Gleichzeitig finden sich aber auch
spezifischen Skandale hat und sich diese ge- Anzeichen für eine neue Kultur der Skandali-
rade in der Pop(ulär)kultur, im Journalismus sierung und Empörung am anderen Ende des
oder der Politik ereignen. Dabei erscheint es politischen Spektrums, dort, wo der Aufstieg
so, dass es in den letzten Jahren etliche Skan- populistischer Inszenierung und Mobilisierung
dalisierungen gegeben hat. „Gefühlt“ mag bei fundiert ist. Vor allem die Präsidentschaft
dem einen oder anderen der Eindruck entstan- Donald Trumps hat gezeigt, wie die (gezielte)
den sein, dass dies für die Gegenwart besonders Überflutung des Diskurses mit skandalösen
prägend ist und im Grunde kaum eine Woche Beiträgen die rationale Auseinandersetzung,
ohne einen Skandal mit entsprechenden Em- auf der die öffentliche Entscheidungsfindung
pörungsäußerungen vergeht. Mit den „gefühl- in demokratischen Gesellschaften beruhen
ten“ Wahrheiten ist es bekanntlich jedoch so soll, erschwert. Hier entsteht bisweilen der
eine Sache. Zumindest das Gefühl trügt nicht Eindruck – man denke nur an den „Locker
völlig, dass die letzten Jahre besonders skan- Room-Talk“, die mit Spott versehene Nachah-
daldominiert waren und sich eine besondere mung eines Journalisten mit Behinderung oder
Form von „Erregungskultur“ (Pörksen 2018) die Rede von den „Shithole Countries“ –, dass
eingestellt hat. So hat die Etablierung der di- das, was für die eine Gruppe einen Skandal
gitalen sozialen Medien und der dadurch darstellt, lediglich den Wertekodex weiter
schneller und breitentauglich ermöglichten Teile der Bevölkerung abbildet. Insofern sind
(oft hitzigen) Anschlusskommunikation zu Skandale auch im Kontext von Teilöffentlich-
einer Art „Demokratisierung des Skandals“ keiten mit durchaus diametralen Wahrneh-
geführt. Letzteres zeigt sich dahingehend, dass mungsmustern zu betrachten. So ist „Polari-
Statements, Meldungen etc. in den sozialen sierung“ – als Effekt, der Skandale und Empö-
Netzwerken der unmittelbaren Publikumsdis- rungen sehr häufig begleitet – nicht zufällig
kussion zugeführt werden. Dort wird die ein wichtiges Stichwort für soziologische Ar-
Kommunikation oft verknappt und überpoin- beiten mit zeitdiagnostischer Absicht (z. B.
tierend geführt, was Skandalisierung potenzi- Koppetsch 2018).
ell begünstigt und „Empörungswellen“ wahr- In Rechnung zu stellen ist, dass „Empörung“
scheinlicher macht (die dann wiederum u. a. als eine Form politischer Resonanz in demo-
von den Medien als Skandale beobachtet kratischen Gesellschaften betrachtet werden
werden). Die Empörungsreaktionen selbst muss (vgl. Rosa 2016). Aus einer sozialwissen-
werden wiederum thematisiert, sie tendieren schaftlichen Perspektive verweist Empörung
ihrerseits dazu, Anschlusskommunikation zu auf den Aushandlungscharakter sozialer Ord-
initiieren und den Kommunikationsprozess nung. Dass solche Aushandlungen keineswegs
weiterhin zu dynamisieren. Dies muss allerdings harmonisch, sondern durchaus konfliktiv
nicht immer negative Konsequenzen haben. verlaufen, stellte bereits Georg Simmel (1908)
Gut sichtbar wird dies auf dem Feld der Iden- in seinem Text zum Streit als Form der Verge-
titäts-, Diversitäts- und Gleichstellungspolitik. sellschaftung heraus. Der Ort für die „öffent-
Dort zeichnen sich zunehmende Erfolge ab, liche Inszenierung von Dissens“ (Dubiel 1997:
die durch den wachsenden Einfluss eines 426) ist vom Blickpunkt der Demokratietheo-
Online-Aktivismus befördert werden, der rie, Politikwissenschaft und politischen Sozio-
gesellschaftliche Auseinandersetzungen um logie dann das Mediensystem.2 Dieses bildet
Verletzbarkeit und soziale Teilhabe mit Blick einen geeigneten Ansatzpunkt für die Analyse
auf Geschlecht, Sexualität, Ethnizität und und Rekonstruktion von Empörung, wobei
andere soziale Kategorien vorantreibt. Von sich bestimmte Gesellschaftsbereiche, mit
besonderer Bedeutung war hier die #MeToo- denen das Mediensystem unterschiedlich
Kampagne, die – prominent angeregt von der gekoppelt ist (vgl. Luhmann 1996), besonders
Bürgerrechtlerin Tarana Burke und der Schau- eignen.Skandal und Empörung. Zur Einleitung 5
Skandal und Empörung als Triebkräfte moderner Gesellschaften praktisch nicht mehr
der Ordnungsirritation? wegzudenken. Indem sie die eine soziale Grup-
pe in Verruf bringen, legitimieren sie die an-
Zweifelsohne kommt der Populärkultur in der dere. Skandale übernehmen soziologisch be-
kollektiven Selbstbeobachtung und Welter- trachtet wichtige Funktionen, die sich eben
schließung der Gesellschaft eine besondere auch systemerhaltend ausgestalten können:
Bedeutung zu. Fernsehserien, Spielfilme und Sie prägen Präferenzen, arrangieren Aufmerk-
weitere Produkte der Pop(ulär)kultur bilden samkeit und ordnen so „das komplexe Zusam-
einen festen Bestandteil der Alltagspraxis, sie menspiel zwischen öffentlicher Moral, medi-
sind „Generatoren und Transformatoren so- aler Inszenierung, Gesellschaft und Politik“
zialer Wirklichkeit“ (Peltzer, Keppler 2015: 13), (Burkhard 2006: 25). Wenn also der Skandal
insofern sie permanent auf gesellschaftliche ganz generell eine institutionalisierte Kommu-
Ordnungskategorien, Vorstellungen, Diskurse nikationsform des Politischen in modernen
und Problemlagen referieren und durch die Gesellschaften darstellt und besonders die
populäre Inszenierung (potenziell) auf die Kulturindustrie aus ökonomischen Motiven
Praxis der Akteur*innen und ihre Handlungs- von ihr Gebrauch macht, dann tragen gerade
orientierungen rückwirken können. Ganz im auch skandalträchtige pop(ulär)kulturelle
Einklang mit einer Grundannahme der kul- Produkte oder aufsehenerregende Ereignisse
turwissenschaftlichen Sozialtheorie (Knüttel, zur Reproduktion der institutionellen Ord-
Seeliger 2011) und den Cultural Studies (Diet- nungen bei. Sie provozieren dann möglicher-
rich, Seeliger 2018; Winter 2011) finden sich weise Irritationsphasen, schieben aber nicht
gerade in der Populärkultur zahlreiche Ereig- zwangsläufig Wandlungsprozesse an. Dies zeigt
nisse, Diskurse und Produkte, die soziale sich besonders, wenn Devianzphänomene an
Empörungen evozieren. Ob Empörungen und Individuen, nicht aber strukturbezogen, fest-
die zugrundeliegenden Skandale aber tatsäch- gemacht werden: So hat es trotz zahlreicher
lich materielle und institutionelle Wandlungs- Dopingfälle in den verschiedensten Sportarten
prozesse in Bezug auf soziale Fragen (etwa in Jahre gedauert, bis ein Bewusstsein für Sys-
der Steuergesetzgebung, der Klimapolitik oder temprobleme und die Notwendigkeit entspre-
in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung) initi- chender Strukturmaßnahmen (Ermittlungen,
ieren oder kulturelle Toleranzgrenzen (zum Umstrukturierung der Verfahren, personelle
Beispiel hinsichtlich provokativer Kunst und Konsequenzen) entstand.
Unterhaltung) verschieben, ist einerseits eine Allerdings ist gerade der populärkulturell
empirische Frage, der die Beitragenden ver- initiierte Skandal durchaus in der Lage, poli-
schiedentlich in diesem Themenschwerpunkt tische Diskussionen auszulösen, die dann
nachgehen, andererseits eine theoretische. So langfristige Strukturänderungen herbeiführen
ist dem Zusammenhang zwischen politischer (oder zumindest auf diese hindeuten): Der Fall
Skandalisierung und kulturindustrieller Pro- der erwähnten #MeToo-Kampagne zeigt aus
duktionslogik ein Doppelcharakter immanent: unserer Sicht bereits einen Wandel in der US-
Da beide – die Politik zum Zweck der Mobili- amerikanischen Filmindustrie und im öffent-
sierung und Legitimation und die Kulturin- lichen Bewusstsein hinsichtlich des Status und
dustrie zum Geldverdienen – auf spektakulä- der Behandlung von Frauen. Welche Beziehung
re Inszenierungen angewiesen sind, ist „die zur dominanten Ordnung ein Skandal aber
mediale Skandalisierung des Anderen“ (Burk- eingeht, ist, neben der Frage nach der Perspek-
hardt 2006: 16) als politische Strategie so alt tive des Einschätzenden, auch eine Frage der
wie die modernen Medien (und damit historisch Zeit: Bei der Analyse und Zuordnung von
mindestens bis zum Buchdruck zurückzuda- Skandalen und Empörungen kann sich immer
tieren). auch erweisen, dass (um dies rhetorisch zu
Als ein „Spiegel der Politik“ (Neckel, Eb- pointieren) Hoffnungen verfrüht waren.3
bighausen 1989: 11) sind Skandale als typische Skandale können also einerseits instrumen-
Form des Politischen aus der Öffentlichkeit talisiert und bewusst initiiert werden, auf der6 Marc Dietrich, Günter Mey, Martin Seeliger
anderen Seite haftet ihnen aber mit Blick auf rekonstruiert, wie sich die Erregung in ver-
Empörungsreaktionen auch sehr häufig ein schiedenen sozialen Feldern vollzieht. Die
unkalkulierbares Moment an. Dies zeigt sich Beispiele stammen dabei aus Populärkultur
besonders bei populärkulturellen Produkten (siehe hierzu die Beiträge von Balke, Eickel-
– sind sie der Auslöser, dann hängt dies auch mann, Fröhlich sowie Seeliger), Politik (siehe
mit ihrer grundsätzlichen Beschaffenheit zu- die Beiträge von Dieterich, Lim sowie von
sammen. So sind z. B. Spielfilme, Serien und Dimbath und Campen) und Journalismus
Computerspiele (wie besonders in den Cultu- (siehe die Beiträge von Jung sowie von Peltzer
ral Studies verhandelt) schlussendlich Identi- und Pilipets). Dabei wird auch deutlich, dass
fikationsangebote, die sich in ihrer Rezepti- derartige Zuordnungen eher idealtypisch sind:
onsqualität und potenziellen Aneignung seitens Zum Skandal – gerade unter Bedingungen der
der Akteur*innen kaum kontrollieren lassen gesellschaftlichen Mediatisierung und Digita-
(vgl. Winter 2006). Auch die vermeintlich lisierung – gehört es, dass er feldübergreifend
harmlosen (Serien-)Produkte können subver- Anschlusskommunikation erzielt, der politische
siv gelesen werden, wie dies bereits John Fiske Skandal also nicht nur in den unmittelbar
(1986) kenntlich gemacht hat. Festhalten lässt erwartbaren Bereichen „Politik“ und „Journa-
sich allerdings jenseits der angedeuteten Über- lismus“ zirkuliert, sondern auch populärkul-
legungen, dass der Skandal in der modernen turelle Resonanz erzeugt (Peltzer, Pilipets).
Gesellschaft zum etablierten Repertoire der Die Texte des Themenschwerpunkts schlie-
Selbstvergewisserung und Selbstbeobachtung ßen an ein Forschungsfeld an, das eine gewisse
gehört und er zu den herrschenden symboli- Tradition hat. Die eingehendere soziologische
schen Ordnungen verschiedene Verhältnisse Beschäftigung mit Skandal und Empörung
eingehen kann: Das Spektrum reicht von einer erfolgt vermehrt seit den 1980er Jahren. In
Minimalirritation, die folgenlos bleibt (ein dieser Zeit wurden Beiträge veröffentlicht, die
„Sturm im Wasserglas“, wie bei einem großen auch die aktuellen Perspektiven durchaus prä-
Teil der Boulevardberichterstattung), über gen: Zu nennen ist für den deutschsprachigen
einen partiellen kritischen Impuls, der in die Raum v. a. die „Anatomie des politischen
herrschende Ordnung schon wieder eingehegt Skandals“ – ein umfangreicher Sammelband
werden kann, bis hin zu einer fundamentalen von Rolf Ebbighausen und Sighard Neckel
Erschütterung, die einen substanziellen Wan- (1989). Letzterer hatte die Skandalsoziologie
del veranlasst. bereits ein paar Jahre zuvor (Neckel 1986)
Um derartige Referenzmodi und Relationen stärker auf die Agenda gesetzt. Dass die The-
skandalöser Produkte und Ereignisse in den matik gerade in den letzten Jahren wieder in-
Blick zu bekommen, ist der Topos der sozialen tensiver verfolgt wurde, hat insbesondere mit
Konstruktion von Empörung relevant. Seine den Arbeiten von Bernhard Pörksen (Bergmann,
Hinzunahme, besonders im Rahmen einer Pörksen 2009; Pörksen 2018; Pörksen, Detel
wissenssoziologischen Vorstellung von sozia- 2012, 2014) und Steffen Burkhardt (2006, 2015,
ler Wirklichkeit als immerzu fragiler, kontin- 2018) zu tun. Das soziologische Forschungsfeld
genter Ordnung, die sich in Legitimationskri- zu Skandal und Empörung besteht mittlerwei-
sen zu beweisen hat (vgl. Berger, Luckmann le aus einer Vielzahl heterogener Beiträge, es
1966/2009), ermöglicht es, das Zustandekom- arrangiert sich in relativ loser Form. Unter dem
men von Prozessen kollektiver Wahrnehmung Etikett der „Scandal Studies“4 finden sich z. B.
und Auseinandersetzung mit kontroversen funktionalistische Arbeiten, die Skandale mit
Themenstellungen im Schnittpunkt von poli- Blick auf die Aktualisierung normativer Mo-
tischer Öffentlichkeit und Populärkultur zu delle zur Koordination der Gesellschaft und
analysieren. Genau dies wird in den Beiträgen ihrer Mitglieder sehen (Burkhardt 2018), aber
dieses Themenschwerpunkts versucht. Im auch interaktionistische Ansätze, die „die dra-
Zentrum stehen medial vermittelte Formen maturgischen Grundstrukturen politischer
des Ausdrucks von und Anschlusses an sozio- Skandal-Inszenierungen“ (Hitzler 1989: 344)
kulturelle Erregung. Es wird beobachtet und untersuchen. Es werden hier also recht ver-Skandal und Empörung. Zur Einleitung 7
schiedene theoretische Provenienzen sichtbar. Ebenfalls der Populärkultur verschrieben
Dies gilt auch für die Beiträge in diesem The- ist Gregor Balkes Beitrag über die Sitcoms
menschwerpunkt, die von der diskurs- und „Seinfeld“ und „Curb Your Enthusiasm“. Seine
performativitätstheoretischen Perspektive Analyse zeigt anschaulich, dass Serien „Em-
(Eickelmann) über eine soziologische, filmge- pörung als soziales Phänomen inszenieren und
stützte Interaktionsanalyse (Campen, Dimbath) damit zugleich ironisch gebrochene Interpre-
bis hin zu Cultural Studies (Seeliger) und Mo- tationen von Empörungspraktiken bieten, ohne
ralsoziologie (Dieterich) ein breites Panorama dass die Zuschauenden einen emotionalen
aufspannen, das nicht nur für thematisch un- Überschuss an diesen Empörungen mittragen“
mittelbar Interessierte relevant sein könnte. (S. 47).
Lesbar sind die theoretisch mannigfaltigen und Dass das Unterhaltsame und Populäre in
empirisch unterschiedlich feinkörnigen Ana- der Thematik seiner Inszenierung oft der so-
lysen darüber hinaus als Anschlussoptionen zialen Skandalisierung bedarf, um authentisch
für zeitdiagnostisch orientierte (Kultur- und zu wirken, und die Fernsehserie ein exponier-
Medien-) Soziolog*innen und Interessenten ter Ort zur Gesellschaftsanalyse ist, wird auch
der Populärkultur. bei Martin Seeliger deutlich. Seine filmsozio-
logisch inspirierte Studie zu „4 Blocks“ erkennt
in der mehrfach prämierten Produktion eine
Die Beiträge des Schwerpunkts (populär)kulturelle Repräsentation von sozia-
len Konflikten und Delinquenz in der (Post-)
Die im Themenschwerpunkt versammelten Migrationsgesellschaft, wobei hierfür ein
Beiträge zur Analyse von Skandalen und Em- medialer Skandaldiskurs konstitutiv ist, der
pörungen verbindet eine Grundidee: Sie ver- sich in stigmatisierender Weise mit Clankri-
suchen das Gesellschaftliche und Politische minalität unter arabischen Großfamilien be-
von seinen symbolischen Repräsentationen fasst.
her zu verstehen (vgl. auch Hall 2000). Dabei Im Feld der Politik lokalisiert ist der Beitrag
werden unterschiedliche Gegenstände aus von Christine Campen und Oliver Dimbath.
unterschiedlichen sozialen Feldern ausgewählt. Auf methodisch innovative Weise ergründen
Gerrit Fröhlich und Jennifer Eickelmann sie den Zusammenhang von politischer Kultur
fokussieren mit Computerspielen Gegenstän- und Empörung und zeigen, dass die Darstellung
de der Populärkultur. Von zeitgenössischen von Empörung im politischen Kontext mimi-
oder historischen Aushandlungsprozessen sche Ausdrücke von Wut und Ekel sowie den
ausgehend, rekonstruieren sie Skandaldiskur- Einsatz von Gesten der Generierung von Auf-
se, die weit über die Gamer-Community hin- merksamkeit vereinigt.
ausreichen. Fröhlich identifiziert in der Gamer- Der Frage des Zusammenhalts in pluralen
Community wiederkehrende Skandalkonst- Gesellschaften widmet sich Manuel Dieterich.
ruktionen mit langer Tradition, die insbeson- Sein Text bietet eine kritische Auseinander-
dere um Wahrhaftigkeit und Authentizität setzung mit Empörungsphänomenen, die u. a.
kreisen, während Eickelmann eine nicht zu mit dem „Wutbürger“ assoziiert werden können.
überwindende Janusgesichtigkeit des Skanda- Seine theoretisch an Luhmann anschließende
lösen in Bezug auf sexualisierte, mediatisierte und auf einer qualitativen Forschung basieren-
Missachtung ausmacht. Beide Texte zeigen, de Studie fokussiert ein lokalpolitisches Ereig-
dass vermeintlich szeneinterne Auseinander- nis, das mit der skandalträchtigen Ansiedlung
setzungen um bestimmte Qualitäten und In- einer Anschlussunterbringung für Geflüchte-
szenierungen der Spiele zwangsläufig in einem te verknüpft ist. Die Beobachtungen zweiter
gesellschaftstheoretischen Kontext betrachtet Ordnung erfolgen hier vom Blickpunkt einer
werden müssen – sei es in Bezug auf gesell- Soziologie der Moral.
schaftlich etablierte Forderungen nach Au- Il-Tschung Lim geht dem zunächst vor allem
thentizität oder hinsichtlich umkämpfter in den USA thematisierten Phänomen der
Gendervorstellungen. Mikroaggressionen auf den Grund. Mikroag-8 Marc Dietrich, Günter Mey, Martin Seeliger
gressionen als „alltägliche, sowohl absichtlich Stichworten „Skandal“ und „Affäre“ keinerlei
als auch unbewusst kommunizierte Beleidi- Einträge, mithin erscheint es wie ein „weißer
gungen, die sich auf die Wahrnehmung von Fleck“ auf der Skandal-„Landkarte“.
2 Für einen integrativen Ansatz siehe den klassi-
abwertenden Kommentaren zur ethnischen schen Text von Habermas (1990).
Herkunft, Geschlecht, sexuellen Orientierung 3 Ereignisse wie der skandalisierte Vorschlag des
oder Konfessionszugehörigkeit von Personen Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert zu einem
beziehen“ (S. 87), wurden zuletzt auch in Bezug „demokratischen Sozialismus“, der die Verstaat-
auf die Debatten- und Meinungsäußerungs- lichung von Konzernen mitmarkierte, müssen
kultur an deutschen Hochschulen hitzig dis- erst zeigen, welchen „Impact“ sie entfalten (vgl.
Seeliger 2019).
kutiert. Lim knüpft hieran an, sondiert die 4 So veranstaltete eine Gruppe von Forscher*innen
verschiedenen (theoretischen) Positionen und im April 2016 etwa die „1st International Con-
fragt nach zukünftigen Perspektiven der De- ference in Scandalogy“ in Bamberg mit dem Ziel,
batte. die Skandalforschung im grenzüberschreitenden
Dem kulturellen und kulturpublizistischen Maßstab als Forschungszweig zu etablieren. Die
Umgang mit der Politpunkband „Feine Sahne Folgeveranstaltung „2nd International Confe-
Fischfilet“ widmet sich Simone Jung. In ihrem rence“ wurde 2018 ausgerichtet. Aufgrund der
Corona-Krise musste 2020 die „3rd-Conference“
auf das journalistische Feld gerichteten Beitrag verschoben werden. Bislang sind aus der Arbeit
setzt sie sich mit der Absage eines Konzerts der Bamberger Gruppe zwei Bände mit interna-
am Weimarer Bauhaus auseinander, die für tional renommierten Beiträger*innen hervorge-
breite Empörung gesorgt hatte. Anhand eines gangen (Haller, Michael 2018, 2020). Hinzuwei-
medien- und kultursoziologischen Zugangs sen ist auch auf die Jahrestagung der Kulturso-
zeigt sie, wie es neurechten Gruppierungen ziologie in Kassel 2019, die unter dem Titel
„Skandalkulturen – Kulturen der Skandalisierung“
zunehmend gelingt, ihre Semantiken im Me- stand.
diendiskurs salonfähig zu machen, wie sich die
Gleichsetzung von Links- und Rechtsextre-
mismus im allgemeinen Wahrnehmungshori- Literatur
zont zunehmend verstärkt und einer entspre-
chenden medialen Kommentierung den Bergmann, Jens; Pörksen, Bernhard (2009): Vorwort.
In: Dies. (Hg.): Skandal! Die Macht öffentlicher
rechten Strömungen Vorschub leistet. Empörung. Köln: Herbert von Halem, S. 7-12.
Anja Peltzer und Elena Pilipets schließlich Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1966/2009).
gehen auf die soziale Konstruktion von Empö- Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklich-
rung am Beispiel des „Ibiza-Skandals“ des keit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frank-
FPÖ-Politikers Heinz-Christian Strache ein. furt a. M.: Fischer.
Die Autorinnen rekonstruieren die Zirkulati- Burkhardt, Steffen (2006): Medienskandale. Zur
on des ‚Überwachungsvideos’ von Österreichs moralischen Sprengkraft öffentlicher Diskurse.
Köln: Herbert von Halem.
ehemaligem Vizekanzler und setzen dazu Burkhardt, Steffen (2015): Medienskandale. Zur
filmanalytische, digitale und visuelle Methoden moralischen Sprengkraft öffentlicher Diskurse.
ein. Festgestellt wird, ähnlich wie bei Eickel- Überarbeitete Neuauflage. Köln: Herbert von
mann, dass die Anschlusskommunikation an Halem.
das Video ambivalent ausfällt und sich mitun- Burkhardt, Steffen (2018): Scandals in the Network
ter genauso ironisch wie naiv verwirklicht. Society. In: Haller, André; Michael, Hendrik (Hg.):
Scandalogy. An Interdisciplinary Field. Köln:
Herbert von Halem, S. 18-44.
Dietrich, Marc; Seeliger, Martin (2018): Islamistischer
Anmerkungen Pop? Schlaglichter auf einen deutschen Skanda-
lisierungsdiskurs im Gangsta-Rap. In: Barz,
1 Eine eigene Abhandlung wäre es wert, einmal Heiner; Spenlen, Klaus (Hg.): Islam und Bildung.
genauer zu untersuchen, welche Skandale in der Wiesbaden: Springer VS, S. 129-140.
DDR (als „Antagonist“ zur BRD) oder der UdSSR Dubiel, Helmut (1997): Unversöhnlichkeit und De-
(als „Antipode“ zur USA) inklusive der dazuge- mokratie. In: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Was hält
hörigen Debatten rekonstruierbar sind. Auf den die Gesellschaft zusammen? Bundesrepublik
Seiten von Wikipedia finden sich unter den Deutschland: Auf dem Weg von der Konsens- zurSkandal und Empörung. Zur Einleitung 9
Konfliktgesellschaft. Band 2. Frankfurt a. M.: Neckel, Sighard; Ebbighausen, Rolf (1989): Einleitung.
Suhrkamp, S. 425-445. In: Ebbighausen, Rolf; Neckel, Sighard (Hg.):
Fiske, John (1986/2001): Fernsehen: Polysemie und Anatomie des politischen Skandals. Frankfurt
Popularität. In: Winter, Rainer; Mikos, Lothar a. M.: Suhrkamp, S. 7-13.
(Hg.): Die Fabrikation des Populären. Der John Peltzer, Anja; Keppler, Angela (2015): Die soziologi-
Fiske Reader. Bielefeld: transcript, S. 85-111. sche Film- und Fernsehanalyse. Eine Einführung.
Habermas, Jürgen (1990): Strukturwandel der Öf- Berlin. Oldenbourg.
fentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie Pörksen, Bernhard; Detel, Hanne (2012): Der entfes-
der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt a. M.: selte Skandal. Das Ende der Kontrolle im digita-
Suhrkamp. len Zeitalter. Köln: Herbert von Halem.
Hall, Stuart (2000): Cultural Studies. Ein politisches Pörksen, Bernd; Detel, Hanne (2014): Der entfessel-
Theorieprojekt. Ausgewählte Schriften 3. Ham- te Skandal. Empörung im digitalen Zeitalter. In:
burg: Argument. Der Bürger im Staat 64, H. 1, S. 28-35.
Haller, André; Michael, Hendrik (Hg.) (2018): Scan- Pörksen, Bernhard (2018): Die große Gereiztheit.
dalogy. An Interdisciplinary Field. Köln: Herbert Wege aus der kollektiven Erregung. München:
von Halem. Hanser.
Haller, André; Michael, Hendrik (Hg.) (2020): Scan- Rosa, Hartmut (2016): Resonanz. Eine Soziologie der
dalogy 2. Cultures of Scandals – Scandals in Weltbeziehung. Berlin: Suhrkamp.
Culture. Köln: Herbert von Halem. Seeliger, Martin (2019): Enteignung im Spannungs-
Hitzler, Ronald (1989): Skandal ist Ansichtssache. feld von Kapitalismus und Demokratie. In: Pop.
Zur Inszenierungslogik ritueller Spektakel in der Kultur und Kritik, H. 14, S. 84-90.
Politik. In: Ebbighausen, Rolf; Neckel, Sighard Simmel, Georg (1908): Der Streit. In: Ders.: Soziolo-
(Hg.): Anatomie des politischen Skandals. Frank- gie. Untersuchungen über die Formen der Ver-
furt a. M.: Suhrkamp, S. 334-354. gesellschaftung. Berlin: Duncker & Humblot,
Knüttel, Katharina; Seeliger, Martin (Hg.) (2011): S. 284-382.
Intersektionalität und Kulturindustrie. Zum Winter, Rainer (2006): Die Filmtheorie und die He-
Verhältnis sozialer Kategorien und kultureller rausforderung durch den „perversen Zuschauer“.
Repräsentationen. Bielefeld: transcript. Kontexte, Dekonstruktionen und Interpretatio-
Koppetsch, Cornelia (2018): Die Gesellschaft des nen. In: Mai, Manfred; Winter, Rainer (Hg.): Das
Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter. Kino der Gesellschaft – die Gesellschaft des
Bielefeld: transcript. Kinos. Interdisziplinäre Positionen, Analysen
Luhmann, Niklas (1996): Die Realität der Massen- und Zugänge. Köln: Herbert von Halem, S. 79-95.
medien. Opladen: Westdeutscher Verlag. Winter, Rainer (Hg.) (2011): Die Zukunft der Cultu-
Neckel, Sighard (1986): Das Stellhölzchen der Macht. ral Studies. Theorie, Kultur und Gesellschaft im
Zur Soziologie des politischen Skandals. In: 21. Jahrhundert. Bielefeld: transcript.
Leviathan 4, H. 4, S. 581-605.Sie können auch lesen