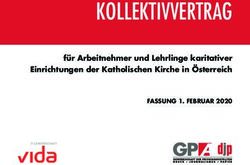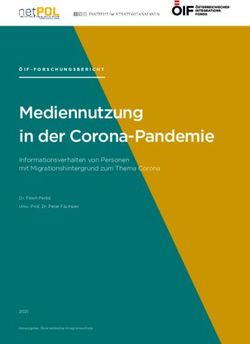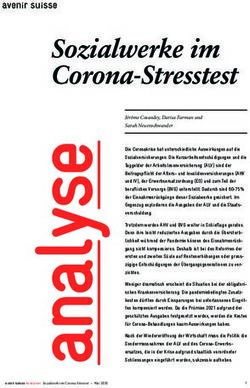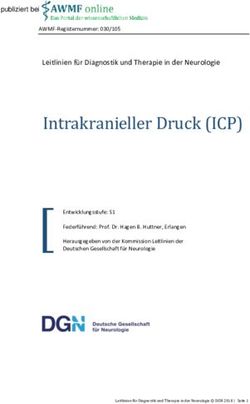Aktuelle Probleme der Kurzarbeit - Diplomarbeit - UNIPUB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Aktuelle Probleme der Kurzarbeit
Diplomarbeit
zur Erlangung des Grades einer Magistra der Rechtswissenschaften
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Karl-Franzens-Universität Graz
Eingereicht bei:
Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter Reissner
Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht
von
Sonja Reitbauer
Graz, Februar 2021Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................... V
1. Einleitung ............................................................................................................................ 1
2. Das Phänomen Kurzarbeit aus sozialwissenschaftlicher Sicht ...................................... 2
2.1 Kurzarbeit als Teil der Arbeitsmarktpolitik ......................................................... 2
2.2 Finanzierung ............................................................................................................. 3
2.3 COVID-19-Pandemie und die Auswirkungen auf die Kurzarbeit ...................... 4
3. Historische Entwicklung der Kurzarbeit ......................................................................... 7
4. Der Begriff der Kurzarbeit .............................................................................................. 10
4.1 Kurzarbeit aus arbeitszeitrechtlicher Sicht - Abgrenzung zur Teilzeitarbeit .. 11
4.1.1 Arbeitsrechtliche Einordnung....................................................................... 11
4.1.2 Sozialversicherungsrechtliche Betrachtung ................................................. 13
4.2 Weitere Alternativen zur Kurzarbeit ................................................................... 14
4.2.1 Karenzierung und Aussetzung des Arbeitsvertrags...................................... 14
4.2.2 Bildungskarenz/Bildungsteilzeit .................................................................. 15
4.2.3 Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgelts ............................................. 16
5. Arbeitsrechtliche Grundlegung der Kurzarbeit ............................................................ 17
5.1 Kurzarbeit aus leistungsstörungsrechtlicher Sicht ............................................. 17
5.2 Weisung des Arbeitgebers ..................................................................................... 18
5.3 Einzelvertragliche Vereinbarung ......................................................................... 19
5.3.1 Kurzarbeitsvorbehalte .................................................................................. 19
5.3.2 Einvernehmliche Änderung des Arbeitsvertrags .......................................... 22
5.3.3 Änderungskündigung ................................................................................... 23
5.4 Betriebsvereinbarung ............................................................................................ 24
5.4.1 Verkürzung der Arbeitszeit .......................................................................... 24
5.4.2 Begleitmaßnahmen ....................................................................................... 26
5.4.3 Umsetzung .................................................................................................... 29
IIIInhaltsverzeichnis
5.5 Kollektivvertrag ..................................................................................................... 31
6. Sozialpartnervereinbarung .............................................................................................. 33
6.1 Rechtliche Qualifikation ........................................................................................ 34
6.1.1 Einstufung als Kollektivvertrag.................................................................... 34
6.1.2 Einstufung als privatrechtlicher Vertrag sui generis .................................... 35
6.1.3 Einstufung als Vertrag mit obligatorischer Wirkung ................................... 35
6.2 Umsetzung der Sozialpartnervereinbarung auf betrieblicher Ebene ............... 36
7. Förderungen für Kurzarbeit ........................................................................................... 38
7.1 Bundesrichtlinie zur Kurzarbeitsbeihilfe ............................................................ 38
7.2 Kurzarbeitsbeihilfe ................................................................................................ 39
7.2.1 Rechtliche Qualifikation............................................................................... 40
7.2.2 Voraussetzungen .......................................................................................... 41
7.2.3 Förderungsberechtigte .................................................................................. 43
7.2.4 Förderungsverfahren .................................................................................... 44
7.2.5 Beendigung und Rückforderung .................................................................. 45
7.2.6 Kurzarbeitsunterstützung.............................................................................. 46
7.3 Qualifizierungsbeihilfe und -unterstützung ......................................................... 47
8. COVID-19-Kurzarbeit - Ausgewählte Problemstellungen ........................................... 49
8.1 Berechnung der Kurzarbeitsbeihilfe .................................................................... 50
8.2 Sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen ..................................................... 51
8.3 Dienstverhinderung wegen Krankheit ................................................................. 52
8.4 Urlaubs- und Zeitguthabenverbrauch ................................................................. 53
8.5 Mehrarbeit/Überstunden ....................................................................................... 55
8.6 Beendigung des Arbeitsverhältnisses während Kurzarbeit ............................... 56
8.7 Förderprüfung ........................................................................................................ 58
9. Conclusio/Schlussbemerkung .......................................................................................... 60
Literaturverzeichnis ............................................................................................................... 62
IVAbkürzungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
aA andere(r) Ansicht
AB Bericht eines Ausschusses
ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch JGS 946
Abs Absatz
AlVG 1949 Gesetz über die Arbeitslosenversicherung BGBl 1949/184
AlVG Arbeitslosenversicherungsgesetz BGBl 1977/609 (Wv)
AMFG Arbeitsmarktförderungsgesetz BGBl 1969/31
AMPFG Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz BGBl 1994/315
AMS Arbeitsmarktservice
AMSG Arbeitsmarktservicegesetz BGBl 1994/313
AngG Angestelltengesetz BGBl 1921/292
ArbVG Arbeitsverfassungsgesetz BGBl 1974/22
Art Artikel
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz BGBl 1955/189
AV Arbeitsvertrag
AVAVG Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
dRGBl I 1927, 32
AVRAG Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz BGBl 1993/459
AZG Arbeitszeitgesetz BGBl 1969/461
BAK Bundesarbeiterkammer
Bd Band
BGBl Bundesgesetzblatt
BlgNR Beilage/-n zu den stenographischen Protokollen des Nationalrats
BIP Bruttoinlandsprodukt
BM Bundesminister/in
BMAFJ Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend
VAbkürzungsverzeichnis
B-VG Bundes-Verfassungsgesetz StGBl 1920/450 idF 1929 BGBl 1930/1
(Wv)
bzw beziehungsweise
CFPG Bundesgesetz über die Prüfung von Förderungen des Bundes aufgrund
der COVID-19-Pandemie BGBl I 2020/44
COVID-19 Coronavirus-Krankheit-2019 (umgangssprachlich auch nur Corona
oder COVID)
COVID-19-G 1. COVID-19-Gesetz BGBl I 2020/12
2. COVID-19-Gesetz BGBl I 2020/16
3. COVID-19-Gesetz BGBl I 2020/23
COVID-Kurzarbeit- Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend
Obergrenzen-VO betreffend die finanzielle Obergrenze für die Bedeckung von Beihilfen
bei Kurzarbeit BGBl II 2020/132
dh das heißt
DRdA Das Recht der Arbeit
dRGBl deutsches Reichsgesetzblatt
DSGVO Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679
ecolex Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ErläutRV Erläuterungen zur Regierungsvorlage
etc et cetera
f und die folgende
ff und die folgenden
FS Festschrift
gem gemäß
grds grundsätzlich
GP Gesetzgebungsperiode
hA herrschende Ansicht
hL herrschende Lehre
hM herrschende Meinung
Hrsg Herausgeber
VIAbkürzungsverzeichnis
IA Initiativantrag
idF in der Fassung
idR in der Regel
inkl inklusive
insb insbesondere
infas Informationen aus dem Arbeits- und Sozialrecht
iS im Sinne
iSd im Sinne des
iVm in Verbindung mit
JGS Justizgesetzsammlung
JBl Juristische Blätter
Kap Kapitel
KUA Bundesrichtlinie Kurzarbeitsbeihilfe/Qualifizierungsbeihilfe (KUA)
und Beihilfe für Schulungskosten (SFK)
GZ: BGS/AMF/0722/9970/2018
KUA-COVID-19 Bundesrichtlinie Kurzarbeitsbeihilfe COVID-19
GZ: BGS/AMF/0702/9990/2020 bis BGS/AMF/0702/9998/2021
lit litera
LSD-BG Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz BGBl 2016/44
lt laut
MSchG Mutterschutzgesetz BGBl 1979/221 (Wv)
Nr Nummer
Ob Oberster Gerichtshof in Zivilsachen
ObA Oberster Gerichtshof in Arbeitsrechtssachen
OGH Oberster Gerichtshof
ÖJZ Österreichische Juristenzeitung
Pkt Punkt
rdb Rechtsdatenbank
RdW Österreichisches Recht der Wirtschaft
VIIAbkürzungsverzeichnis
RIS Rechtsinformationssystem des Bundes
RS Rechtssatz
Rz Randzahl/-ziffer
S Satz
SPV Sozialpartnervereinbarung (Corona-Kurzarbeit)
SPV-BV Sozialpartnervereinbarung (Corona-Kurzarbeit) -
mit Betriebsvereinbarung
SPV-EV Sozialpartnervereinbarung (Corona-Kurzarbeit) -
mit Einzelvereinbarung
StGB Strafgesetzbuch BGBl 1974/60
StGBl Staatsgesetzblatt
SZ Entscheidungen des OGH in Zivilrechtssachen
UrlG BG betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und die
Einführung einer Pflegefreistellung BGBl 1976/390
vgl vergleiche
VKG Väter-Karenzgesetz BGBl 1989/651
VO Verordnung
VwGH Verwaltungsgerichtshof
wbl Wirtschaftsrechtliche Blätter
Wv Wiederverlautbarung
Z Ziffer
ZAS Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht
zB zum Beispiel
ZellHB Zeller Handbuch
ZellKomm Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht, herausgegeben von
Neumayr/Reissner
VIIIEinleitung
1. Einleitung
Kurzarbeit hat sich in Österreich in wirtschaftlichen Krisensituationen immer wieder
bewährt. So wurde in der Vergangenheit beispielsweise von Unternehmen während
Notsituationen aufgrund von Hochwasserkatastrophen oder während der Weltwirtschaftskrise
in den Jahren 2008 bis 2010 vermehrt auf diese Maßnahme als Alternative zu Kündigungen
zurückgegriffen. Auch die noch immer andauernde COVID-19-Pandemie stellt viele
Unternehmer vor existentielle Herausforderungen. Um die Ausbreitung der Krankheit
möglichst einzudämmen, wurden gesundheitspolitische Maßnahmen getroffen, die jedoch
enorme wirtschaftliche Auswirkungen zur Folge hatten. Wie auch in anderen europäischen
Staaten wurde in Österreich versucht, mithilfe von niederschwelligen Corona-
Kurzarbeitsmodellen Unternehmer zu entlasten und massive Beschäftigungsrückgänge am
Arbeitsmarkt zu verhindern.1
Im Rahmen dieser Arbeit wird das Thema Kurzarbeit zunächst aus
sozialwissenschaftlicher Sicht beleuchtet. Im Hauptteil der Arbeit werden
rechtswissenschaftliche Grundsatzfragen zur Kurzarbeit und aktuelle Probleme in Bezugnahme
auf das COVID-19-Kurzarbeitsmodell behandelt.
Hinweise:
Aufgrund der im Rahmen dieser Arbeit behandelten Schnittstellenfragen von Zivil-,
Arbeits- und Sozialrecht und der in diesem Zusammenhang nicht wesentlichen begrifflichen
Unterscheidung für die rechtliche Beurteilung, sind die Begriffe Arbeitnehmer und Arbeitgeber
sowie Dienstnehmer und Dienstgeber synonym zu lesen.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit beziehen sich geschlechtsspezifische
Formulierungen stets in gleicher Weise auf Frauen und Männer.
1
Vgl Felten/Pfeil, Arbeitsrechtliche Auswirkungen der COVID-19-Gesetze – ausgewählte Probleme, DRdA
2020, 295, Auer-Mayer, COVID-19 und Kurzarbeit, CuRe 2020/20; Konle-Seidl, IAB-Forschungsbericht
4/2020, Kurzarbeit in Europa – Die Rettung in der aktuellen Corona-Krise? (10.2.2021).
1Das Phänomen Kurzarbeit aus sozialwissenschaftlicher Sicht
2. Das Phänomen Kurzarbeit aus sozialwissenschaftlicher Sicht
2.1 Kurzarbeit als Teil der Arbeitsmarktpolitik
Kurzarbeit ist ein arbeitsmarktpolitisches Instrument zur Aufrechterhaltung der
Vollbeschäftigung und Vermeidung von Arbeitslosigkeit. Arbeitgebern, die sich aufgrund von
externen Umständen in unvorhersehbaren und vorübergehenden wirtschaftlichen
Schwierigkeiten befinden, kann bei Einführung von Kurzarbeit eine staatliche Beihilfe gewährt
werden.2 Die Arbeitsmarktpolitik ist in Österreich Bundessache gem Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG.
Der zuständige Bundesminister (ab 2020: BM für Arbeit, Familie und Jugend) gibt
arbeitsmarktpolitische Ziele vor, die vom AMS in Eigenverantwortung umgesetzt werden (§ 1
AMFG iVm § 4 AMSG).3 Die gesetzlichen Regelungen dazu finden sich im
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG), im Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG), im
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (AMPFG) sowie im Arbeitsmarktförderungsgesetz
(AMFG).4
Das AMS ist ein aus der Hoheitsverwaltung des Bundes ausgegliedertes
Dienstleistungsunternehmen öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit iSd
§ 1 AMSG. Gem § 29 AMSG hat das AMS im Rahmen der Vollbeschäftigungspolitik der
Bundesregierung zur Verhütung und Beseitigung von Arbeitslosigkeit unter Wahrung sozialer
und ökonomischer Grundsätze im Sinne einer aktiven Arbeitsmarktpolitik […] die
Beschäftigung aller Personen, die auf dem österreichischen Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen, bestmöglich zu sichern.5
Auf Bundesebene sind der Verwaltungsrat (als paritätisch besetztes Gremium) und der
Vorstand des AMS (als geschäftsführendes Organ) für die Umsetzung der
arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben des BMAFJ verantwortlich (§ 4 AMSG).6 Die näheren
Voraussetzungen für die Gewährung von Beihilfen bei Kurzarbeit werden gem § 37b Abs 4
2
KUA, KUA-COVID-19 Pkt 1.
3
Bock-Schappelwein/Fuchs/Huemer/Mahringer/Konle-Seidl/Rhein, Aktive und passive Arbeitsmarktpolitik
in Österreich und Deutschland, 31 (15.1.2021).
4
Bock-Schappelwein/Fuchs/Huemer/Mahringer/Konle-Seidl/Rhein, Arbeitsmarktpolitik, 9.
5
Löschnigg, Arbeitsrecht13 (2017) Rz 14/080.
6
Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 14/082.
2Das Phänomen Kurzarbeit aus sozialwissenschaftlicher Sicht
und § 37b Abs 6 AMSG in Form einer Richtlinie vom Verwaltungsrat auf Vorschlag des
Vorstandes festgelegt.
In der Arbeitsmarktpolitik Österreichs spielt die Sozialpartnerschaft7 eine bedeutende
Rolle. Die Sozialpartner sind im Verwaltungsrat auf Bundesebene (vgl § 5 AMSG) sowie in
den Gremien auf regionaler und lokaler Ebene des AMS vertreten (Landesdirektorium,
Regionalbeirat).8 Die Vereinbarung auf Sozialpartnerebene zur Kurzarbeit ist eine wesentliche
Voraussetzung für die Gewährung von Kurzarbeits- bzw. Qualifizierungsbeihilfe9 (siehe
Abschnitt 6).
2.2 Finanzierung
Der Arbeitgeber wird durch die staatliche Förderung bei Kurzarbeit finanziell entlastet
und kann somit Arbeitsverhältnisse aufrechterhalten. Der Staat trägt zwar insgesamt die Kosten,
diese fallen aber vergleichsweise geringer aus als die Finanzierung der Arbeitslosigkeit.10
Die staatlichen Förderungen bei Kurzarbeit finanzieren sich vorwiegend aus den
Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Arbeitslosenversicherung, Mitteln aus dem
Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie weiteren bundesgesetzlich vorgesehenen Beiträgen
bzw. Einnahmen aus sonstigen zur Verfügung gestellten Mitteln gem § 1 Abs 1 und 2
AMPFG.11
Mit dem 1. COVID-19-G vom 15. März 2020 beschloss der Nationalrat eine Änderung
des § 13 AMPFG, wodurch die Obergrenze für Kurzarbeitsbeihilfen gem § 37b AMSG und
§ 37c AMSG im Jahr 2020 auf 400.000,00 Euro erhöht wurde. Mit dem 3. COVID-19-G vom
04.04.2020 erfolgte eine Anhebung dieser Grenze auf 1 Milliarde Euro und die Ergänzung einer
Verordnungsermächtigung, wodurch die Obergrenze per Verordnung (BM für Arbeit, Familie
7
Vgl § 120a Abs 1 B-VG; Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 12/001.
8
Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 14/082; Bock-Schappelwein/Fuchs/Huemer/Mahringer/Konle-Seidl/Rhein,
Arbeitsmarktpolitik, 11.
9
Vgl § 37b Abs 1 Z 3 und § 37c Abs 1 Z 3 AMSG.
10
Vgl Kucsera/Köppl-Turyna/Lorenz, Österreich in der Corona-Krise. Eine Bildgeschichte der Agenda
Austria: So leidet der Arbeitsmarkt unter Corona, 5 (15.1.2021).
11
Bock-Schappelwein/Fuchs/Huemer/Mahringer/Konle-Seidl/Rhein, Arbeitsmarktpolitik, 31.
3Das Phänomen Kurzarbeit aus sozialwissenschaftlicher Sicht
und Jugend im Einvernehmen mit BM für Finanzen) an die Erfordernisse zur Bewältigung der
Folgen der COVID-19-Krise angepasst werden kann.12
Durch die COVID-Kurzarbeit-Obergrenzen-VO wurde am 20. Mai 2020 für das Jahr
2020 die finanzielle Obergrenze mit zwölf Milliarden Euro13 festgesetzt, am 25. Jänner 2021
für das Jahr 2021 mit sieben Milliarden Euro14. Bis zum 15.12.2020 wurden
Kurzarbeitsbeihilfen in der Höhe von 9,5 Milliarden Euro genehmigt, davon wurden bis zu
diesem Zeitpunkt 5,5 Milliarden Euro tatsächlich ausbezahlt. Wie viel Geld tatsächlich für die
Kurzarbeitsmaßnahmen im Laufe der Coronapandemie benötigt werden, wird sich aber erst
zeigen.15
2.3 COVID-19-Pandemie und die Auswirkungen auf die Kurzarbeit
Die COVID-19-Pandemie veränderte den österreichischen Arbeitsmarkt schlagartig. Mit
den COVID-19-G vom 15.03.2020 und 21.03.2020 hat man auf die Situation schnell reagiert
und den Zugang zur Kurzarbeitsbeihilfe erleichtert. Sofort wurde durch § 37b Abs 7 AMSG
klargestellt, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie entstandene wirtschaftliche
Schwierigkeiten den vorübergehenden nicht saisonbedingten wirtschaftlichen Schwierigkeiten
gleichgestellt sind. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von „COVID-19-Kurzarbeit“
oder „Corona-Kurzarbeit“. Die daraufhin erlassene Bundesrichtlinie des AMS (KUA-COVID-
19) zur Kurzarbeitsbeihilfe wurde rückwirkend ab 01.03.2020 in Geltung gesetzt.16
Ab Beginn des Lockdowns am 16.03.2020 stiegen die Arbeitslosenzahlen extrem an. Am
15.03.2020 lag die Zahl noch bei rund 310.000, Ende März 2020 waren bereits mehr als eine
halbe Million Menschen arbeitslos. Mit 1. April 2020 hatten rund 15.300 Unternehmer für rund
154.000 Arbeitsplätze Kurzarbeitsbeihilfe beantragt. Ende April 2020, zu Ende des ersten
Lockdowns, waren rund 522.000 Personen arbeitslos vorgemerkt. Bis zu diesem Zeitpunkt
12
Parlamentsdirektion, Analyse des Budgetdienstes: Budgetvollzug Jänner bis November 2020 und COVID-
19-Berichterstattung, 70 (15.1.2021)
13
BGBl II 2020/219.
14
BGBl II 2021/31.
15
Parlamentsdirektion, Analyse des Budgetdienstes, 70.
16
Auer-Mayer, CuRe 2020/20.
4Das Phänomen Kurzarbeit aus sozialwissenschaftlicher Sicht
haben rund 100.000 Betriebe Anträge auf Kurzarbeitsbeihilfe für rund 1,25 Millionen
Arbeitnehmer gestellt. Die Zahl der tatsächlich abgerechneten Beschäftigten in Corona-
Kurzarbeit lag Ende April 2020 bei rund einer Million.17
Schätzungen des AMS zufolge wäre ohne Kurzarbeitsbeihilfe die Arbeitslosigkeit auf
über eine Million angestiegen. Die Situation hat sich über den Sommer 2020 zwar entspannt,
bedingt durch die weiteren Lockdowns steigen die Zahlen aber seit November 2020 wieder
kontinuierlich an.18
Grafik: Entwicklung der Personen in Kurzarbeit März bis Dezember 2020 (Quelle: AMS DataWarehouse, Datenstand
4.1.2021, geschätzte Werte für Dezember 2020)19
Mit 31.12.2020 waren rund 417.000 Personen in Kurzarbeit und rund 460.000 als
arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2020 bei 11,2 % (Eurostat-
Berechnung: 5,2%). Innerhalb des letzten Jahres kam es damit zu einem krisenbedingten
Anstieg der Arbeitslosigkeit von 2,7 %-Punkten gegenüber dem Jahr 2019 (Eurostat-
Berechnung: 0,9 %).20 Durch die Förderung der Kurzarbeit konnte eine noch viel drastischere
Entwicklung abgefedert werden. Berechnungen des AMS zufolge konnten im Jahr 2020 in
Österreich die Jobs von rund 1,2 Millionen Menschen gesichert werden.21
17
AMS Sonderauswertung, Abteilung für Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation (2.2.2021).
18
AMS, Spezialthema zum Arbeitsmarkt (01/2021), Kurzarbeit sichert nachhaltig Arbeitsplätze und Know-
how, 4 (10.2.2021).
19
AMS, Spezialthema zum Arbeitsmarkt (01/2021), Kurzarbeit sichert Arbeitsplätze, 4.
20
AMS Sonderauswertung (2.2.2021).
21
Vgl AMS, Spezialthema zum Arbeitsmarkt (01/2021), Kurzarbeit sichert Arbeitsplätze, 1.
5Das Phänomen Kurzarbeit aus sozialwissenschaftlicher Sicht
Während im Jahr 2020 für insgesamt rund 1,2 Millionen Personen eine
Kurzarbeitsbeihilfe abgerechnet wurde, befanden sich im Jahr davor nur rund 1.200
Beschäftigte in Kurzarbeit (20 Betriebe).22 Fast ein Viertel der Beschäftigten in Kurzarbeit im
Jahr 2020 war 50 Jahre oder älter, der Anteil der unter 25-Jährigen betrug 14 %.23 Die
Kurzarbeit wird von Frauen und Männern etwa im gleichen Ausmaß in Anspruch genommen.24
Das extreme Ausmaß der Krise wird auch im Vergleich zur Finanz- und Wirtschaftskrise
im Jahr 2009 deutlich. Damals verzeichnete das AMS rund 66.500 kurzarbeitende
Arbeitnehmer in rund 500 Unternehmen. Im Jahr 2010 waren es dann noch rund 23.700
Personen in rund 260 Betrieben. Nicht für alle zur Kurzarbeit angemeldeten Personen wurde
die Beihilfe auch tatsächlich in Anspruch genommen bzw. abgerechnet. Die Realisierungsquote
lag im Jahr 2009 bei 60 % und 2010 bei 58 %.25 Auch die Arbeitslosenzahlen waren damals
geringer: 2009 waren rund 260.000 und 2010 rund 250.000 Menschen von Arbeitslosigkeit
betroffen.26
22
AMS Sonderauswertung (2.2.2021).
23
APF-Team, Sektion Arbeitsmarkt, AMS-Förderungen und Beihilfen Dezember 2020
(22.1.2021).
24
AMS, Spezialthema zum Arbeitsmarkt (11/2020), Aspekte der Arbeitsmarktentwicklung in der COVID-
19-Krise unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede, 5
(10.12.2020)
25
Auer/Buzek, Kurzarbeit in Österreich 2009 und 2010, ELIS 2012.
26
AMS Sonderauswertung (2.2.2021).
6Historische Entwicklung der Kurzarbeit
3. Historische Entwicklung der Kurzarbeit
Nachfolgend wird die historische Entwicklung der gesetzlichen Bestimmungen zur
Kurzarbeit bzw. ihrer ersten Ansätze im Arbeitslosenversicherungsgesetz dargestellt.
Erste Bestrebungen in Hinblick auf eine österreichische Arbeitsmarktverwaltung gab es
bereits vor mehr als 100 Jahren. Kaiser Karl I. beauftragte 1917, noch während des Ersten
Weltkriegs, die Errichtung eines Ministeriums für soziale Fürsorge, das unter anderem für die
Arbeitsmarktverwaltung zuständig gemacht wurde.27
Nach dem ersten Weltkrieg kam es zu einer großen Aufwärtsentwicklung der gesamten
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik.28 Im Jahr 1920 wurde die Arbeitslosenversicherung nach dem
System der Pflichtversicherung in Österreich eingeführt. In § 32 des Gesetzes vom 24. März
1920 über die Arbeitslosenversicherung29 war erstmals ein der heutigen Form ähnliches
Konzept der Kurzarbeitsbeihilfe geregelt. Zur Vermeidung von Massenarbeitslosigkeit
aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Krieges konnten zwischen dem Staatsamt für soziale
Verwaltung, im Einvernehmen mit dem Staatsamt für Finanzen, Vereinbarungen zwischen
Unternehmerverbänden oder einzelnen Unternehmern getroffen werden. Arbeitgebern konnten
Teile der Löhne von Arbeitern, deren Arbeitsverhältnisse trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten
nicht aufgelöst wurden, aus der allgemeinen Arbeitslosenversicherung rückerstattet werden.30
Die V. Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz im Jahr 192231 ermöglichte in weiterer
Folge eine staatliche Beihilfe („Produktive Arbeitslosenfürsorge“) für die (volkswirtschaftlich
nützliche) Beschäftigung von Personen, die andernfalls eine Arbeitslosenunterstützung erhalten
hätten.32
27
Krempl in Krempl/Thaler (Hrsg), 100 Jahre Arbeitsmarktverwaltung (2017) 33 (37); Gutheil-Knopp-
Kirchwald, Vom K.K. Ministerium für soziale Fürsorge zum Bundesministerium für soziale Verwaltung:
Die Errichtung des Österreichischen Sozialministeriums (1998) 17.
28
Hammerl/Pigler, Die Arbeitslosenversicherung (1950) XII.
29
StGBl 1920/153.
30
Wolf/Potz/Krömer/Jöst/Stella/Hörmann/Holuschka/Scharf in Resch (Hrsg), Das Corona-Handbuch1.01 Kap
4 Rz 1 (Stand 15. 5. 2020, rdb.at); Resch, Die Arbeitslosenversicherung in Österreich2 (1932), 13.
31
StGBl 1922/534.
32
Resch, Die Arbeitslosenversicherung in Österreich2, 28; Hofmeister in Benöhr (Hrsg), Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung in der neueren deutschen Rechtsgeschichte (1991) 217 (232).
7Historische Entwicklung der Kurzarbeit
Im Jahr 1939 wurden in Österreich das Deutsche Arbeitslosenrecht und damit die
Bestimmungen über die Kurzarbeiterunterstützung iSd § 130 AVAVG eingeführt.33
Zu Beginn der Zweiten Republik wurde im Jahr 1946 mit dem
Arbeitslosenfürsorgegesetz34 versucht die Rechtslage von 1938 wiederherzustellen. Im Jahr
1949 wurden die ursprünglich reichsrechtlichen Bestimmungen zur Kurzarbeiterunterstützung
in das AlVG 1949 aufgenommen.35 Diese ersten gesetzlichen Regelungen zur Kurzarbeit in
Österreich in den §§ 34 bis 36 des AlVG 1949 hatten zum Ziel „die Freisetzung von
Arbeitskräften zu verhindern“. Unternehmer konnten in Krisenzeiten eine Entschädigung für
entstandene Entgeltausfälle beantragen, die diesen aus den Mitteln der
Arbeitslosenversicherung vom zuständigen Arbeitsamt rückerstattet wurde. Voraussetzung für
die Gewährung der Kurzarbeiterunterstützung war eine Sozialpartnervereinbarung, die gem
§ 34 Abs 5 AlVG 1949 vom Bundesministerium für soziale Verwaltung genehmigt werden
musste. Die Kurzarbeiterunterstützung wandelte sich damit von einer Leistung der
Arbeitslosenversicherung für den Einkommensausgleich bei „teilweiser Arbeitslosigkeit“ zu
einer Beihilfe als Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik zur Sicherung von Arbeitsplätzen
bzw. des Beschäftigtenstandes.36 Eine Durchführungsverordnung über die
Kurzarbeiterunterstützung wurde vom Bundesministerium für soziale Verwaltung im
Einvernehmen mit den Bundesministerien für Handel und Wiederaufbau und für Finanzen im
Jahr 1951 erlassen.37
Im Jahr 1969 wurden die gesetzlichen Bestimmungen zur Kurzarbeit vom AlVG fast
unverändert in das AMFG 1969 transferiert. Die Finanzierung der Beihilfe erfolgte jedoch
weiterhin aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung.38
Ursprünglich als Beihilfe für die Erhaltung von Arbeitsplätzen von Arbeitern konzipiert,
wurde - aufgrund der bereits langjährig gelebten Praxis der Gewährung der Beihilfe auch für
die Aufrechterhaltung von Angestelltenverhältnissen - im Jahr 1994 schließlich die
Bezeichnung der Unterstützungsleistung der Arbeitgeber an die Arbeitnehmer angepasst. Ab
33
Anordnung über Kurzarbeiterunterstützung im Lande Österreich dRGBl 1939 I, 46; Verordnung über
Kurzarbeiterunterstützung dRGBl 1939 I, 1850.
34
BGBl 1946/97.
35
Hammerl/Pigler, Die Arbeitslosenversicherung, XIV.
36
Mazal, Rechtsfragen der Einführung von Kurzarbeit, ZAS 1988, 83; ErläutRV 747 BlgNR 5. GP 18.
37
VO BGBl 1951/83.
38
Mazal, ZAS 1988, 83; ErläutRV 983 BlgNR 9. GP 16.
8Historische Entwicklung der Kurzarbeit
diesem Zeitpunkt sprach man nicht mehr von „Kurzarbeiterunterstützung“, sondern von
„Kurzarbeitsunterstützung“. Zudem wurde eine pauschale Abgeltung der Aufwendungen für
die Sozialversicherungsbeiträge vorgesehen.39
Mit dem AMSG im Jahr 1994 wurde die Durchführung der aktiven Arbeitsmarktpolitik
des Bundes aus der unmittelbaren staatlichen Verwaltung ausgegliedert und dem
„Arbeitsmarktservice“ (AMS) als Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Rechts mit
eigener Rechtspersönlichkeit iSd § 1 AMSG übertragen.40
Aufgrund der anhaltend schlechten Wirtschaftslage durch die weltweite Finanzkrise
wurden im Jahr 2009 weitere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gesetzt, um einen massiven
Beschäftigungsrückgang zu verhindern. Im Zuge der Umsetzung des
Beschäftigungsförderungsgesetzes 2009 wurden die gesetzlichen Bestimmungen zur
Kurzarbeit vom AMFG ins AMSG übergeführt und angepasst. Neu war die stärkere Einbindung
der Sozialpartner durch die Erstellung von Richtlinien des AMS (siehe Abschnitt 7.1).
Gleichzeitig wurde die Kurzarbeitsbeihilfe mit Qualifizierung geschaffen. In
Katastrophenfällen war eine Sozialpartnervereinbarung nicht mehr zwingend erforderlich.41
Als weiteren Beitrag zum Erhalt von Arbeitsplätzen wurde mit dem Arbeitsmarktpaket 2009
die Dauer der Kurzarbeitsbeihilfe auf insgesamt maximal 24 Monate verlängert und festgelegt,
dass ab dem siebenten Monat der Kurzarbeit auch die Dienstgeber-Sozialversicherungsbeiträge
zur Gänze vom AMS ersetzt werden.42
Ende 2016 einigte man sich darauf das vielfach bewährte Instrument der Kurzarbeit
unbefristet zu verlängern. Damit sollte sichergestellt werden, dass Betriebe und dazugehörige
Arbeitsplätze in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erhalten bleiben. Seitdem wurden die
Beiträge zur Sozialversicherung bei der Kurzarbeitsbeihilfe ab dem fünften Monat abgegolten,
bei der Qualifizierungsbeihilfe von Anfang an.43
39
AB 1671 BlgNR 18. GP 3.
40
AB 1555 BlgNR 18. GP 1.
41
IA 424/A BlgNR 24. GP 6.
42
BGBl I 2009/90; IA 679/A BlgNR 24. GP 9.
43
ErläutRV 1344 BlgNR 25. GP 1.
9Der Begriff der Kurzarbeit
4. Der Begriff der Kurzarbeit
Das österreichische Recht enthält keine Legaldefinition des Begriffes „Kurzarbeit“. Unter
Kurzarbeit versteht man im Allgemeinen eine Reduktion der Arbeitszeit unter entsprechender
Kürzung des Entgelts bei vorübergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten eines
Arbeitgebers. Ziel und Zweck ist der Erhalt von Arbeitsplätzen. Das wirtschaftliche Risiko
eines vorübergehenden Einbruchs der Auftragslage soll damit nicht auf die einzelnen
Arbeitnehmer überwälzt, sondern auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer und AMS umverteilt
werden.44
Die Kurzarbeit wird arbeitsmarktpolitisch durch die sogenannte Kurzarbeits- und
Qualifizierungsbeihilfe (bei Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitnehmer)
gefördert. Die Inanspruchnahme der Förderung ist keine Voraussetzung für die Kurzarbeit.
Möglich wäre beispielsweise auch eine befristete Teilzeit. In der Regel wird die staatliche
Beihilfe jedoch von den Arbeitgebern in Anspruch genommen.
Kurzarbeit hängt sehr stark vom Entgegenkommen des Arbeitgebers ab, bietet jedoch für
diesen vor allem den Vorteil, dass er gute Arbeitskräfte nicht kündigen muss. So kann
verhindert werden, dass über Jahre angeeignetes wichtiges Know-how verloren geht.45 Der
Arbeitnehmer hat den Vorteil vorerst nicht in die Arbeitslosigkeit zu rutschen und erhält bis zu
90 % des Entgelts weiter. Das Arbeitslosengeld beträgt vergleichsweise höchstens 60 % des
bisherigen Entgelts, sofern kein Anspruch auf Familienzuschläge besteht.46
44
Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/463f; Winter/Thomas, Kurzarbeit: Grundsatzfragen und geplante
Neuregelungen, ZAS 2009/10, 64 (65).
45
Vgl Auer-Mayer, Ausgewählte Fragen zur Kurzarbeit, ZAS 2020/36, 220.
46
Vgl § 21f AlVG; Hofer/Titelbach/Fink, IHS, Die österreichische Arbeitsmarktpolitik vor dem Hintergrund
der COVID-19-Krise, 15 (10.2.2021).
10Der Begriff der Kurzarbeit
4.1 Kurzarbeit aus arbeitszeitrechtlicher Sicht - Abgrenzung zur Teilzeitarbeit
4.1.1 Arbeitsrechtliche Einordnung
Bei Kurzarbeit handelt es sich um eine vorübergehende Verkürzung der Arbeitszeit aus
wirtschaftlichen Gründen. Der Begriff der Teilzeitarbeit wird in § 19d Abs 1 AZG definiert.
Wird eine Wochenarbeitszeit vereinbart, die im Durchschnitt die gesetzliche oder durch
kollektive Rechtsgestaltung festgelegte Normalarbeitszeit unterschreitet, spricht man aus
arbeitsrechtlicher Sicht von Teilzeitarbeit. Der Wortlaut schließt demnach nicht aus, Kurzarbeit
aus arbeitsrechtlicher Sicht als Teilzeitarbeit zu qualifizieren.47 In der Lehre herrscht
diesbezüglich jedoch Uneinigkeit. Auch wurde diese Frage durch den Gesetzgeber oder die
Rechtsprechung noch nicht abschließend geklärt.
Weitgehend wird die Ansicht vertreten, dass Kurzarbeit nicht mit Teilzeitarbeit
gleichzustellen ist. Begründend wird unter anderem auf den interimistischen Charakter von
Kurzarbeit im Vergleich zur Teilzeitarbeit, die unbefristet vereinbart werden kann, sowie auf
den nicht übertragbaren Schutzzweck des § 19d AZG auf die Kurzarbeit verwiesen.48
Zudem wird in den Materialien zu § 97 Abs 13 ArbVG49 Kurzarbeit der Teilzeitarbeit
gegenübergestellt. Drs50 leitet daraus ab, dass der Gesetzgeber davon ausging, dass es sich bei
Kurzarbeit um keine Teilzeitbeschäftigung handelt. Auch ist sie der Auffassung, dass der
Gesetzgeber bei Schaffung des § 19d AZG nicht an Kurzarbeit gedacht habe. Ihrer
Interpretation nach wäre Kurzarbeit nicht als Teilzeit einzustufen, sondern als Vollarbeitszeit
mit Ausfallstunden.51
Mosler52 argumentiert weiters mit dem Regelungszweck des § 19d AZG53, der im
Diskriminierungsschutz der Teilzeitbeschäftigten gegenüber den Vollzeitbeschäftigten liegt.
47
Mosler, Arbeitsrechtliche Probleme der Teilzeitbeschäftigung, DRdA 1999, 338 (341).
48
Auer-Mayer, ZAS 2020/36, 224; Schnorr, Rechtsfragen der Kurzarbeit, DRdA 1987/4, 261 (262); Resch,
Rechtsfragen der Teilzeitbeschäftigung, DRdA 1993, 97, Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/359.
49
ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 84.
50
Drs, Kurzarbeit, DRdA 2010, 203 (212).
51
Drs, DRdA 2010, 210.
52
Mosler, DRdA 1999, 341.
53
Vgl § 19d Abs 6 AZG.
11Der Begriff der Kurzarbeit
Von Kurzarbeit können nicht nur Teilzeit-, sondern auch Vollzeitbeschäftigte betroffen sein.
Dem hält Mosing54 entgegen, dass der Grund für die Arbeitszeitherabsetzung nur dann
entscheidend wäre, wenn der Gesetzgeber an diesen einen besonderen Schutz oder Anspruch
des Arbeitnehmers knüpft.55 Wie in der Praxis oft üblich werden nicht alle Arbeitnehmer eines
Unternehmens zur Kurzarbeit angemeldet. Mitarbeiter in Kurzarbeit könnten somit gegenüber
Mitarbeitern, die weiterhin vollzeitbeschäftigt sind, benachteiligt werden, wenn diese
beispielsweise bei Andauern einer Krisensituation nicht weiter beschäftigt werden können. In
Hinblick auf den Schutzzweck dieser Auslegung wäre Kurzarbeit aus arbeitsrechtlicher Sicht
als Teilzeitarbeit anzusehen.
Den Materialien zu § 19d Abs 1 AZG56 ist zu entnehmen, dass bei Vereinbarung einer
kürzeren Normalarbeitszeit iS einer einheitlichen Regelung für den gesamten Betrieb (zB in
Form einer Betriebsvereinbarung) keine Teilzeitarbeit vorliegt. Dieser Wortlaut spreche aus
Sicht von Auer-Mayer57 klar dagegen, dass bei der „festgelegten kürzeren Normalarbeitszeit“
auch an bloß kurzfristige Reduktionen wie zB die Kurzarbeit gedacht war. Eine
Betriebsvereinbarung nach § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG kann nur eine vorübergehende Verkürzung
(oder Verlängerung) der Arbeitszeit vorsehen. Eine Betriebsvereinbarung zur Festlegung einer
kürzeren Normalarbeitszeit für die gesamte Belegschaft kann demnach nicht gem § 97 Abs 1 Z
13 ArbVG, sondern nur aufgrund einer kollektivvertraglichen Ermächtigung abgeschlossen
werden. Der Tatbestand des § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG würde aber ohnehin schon gegen die
Annahme einer Teilzeitvereinbarung sprechen. Eine vorübergehende Verpflichtung zur
Überstunden- oder Mehrarbeit könnte ebenso wenig wie eine vorübergehende Reduktion der
Arbeitsstunden (aufgrund von Kurzarbeit) zu einer Änderung der Normalarbeitszeit führen.
Nach dieser Auslegung gebührt für Mehrleistungen im Rahmen der Kurzarbeit auch erst dann
ein Mehrarbeitszuschlag, wenn diese das ursprünglich vereinbarte Arbeitszeitausmaß
übersteigen. Dies könnte ansonsten zu dem Ergebnis führen, dass die kurzarbeitenden
Arbeitnehmer durch den Mehrarbeitszuschlag im Ergebnis mehr Geld bekommen würden als
bei Nichteinführung der Kurzarbeit.58
54
Mosing, COVID-19-Kurzarbeit, JAS 2020/02, 141 (143).
55
Vgl §§ 15h ff MSchG; §§ 8 ff VKG.
56
ErläutRV 141 BlgNR 23. GP 5.
57
Auer-Mayer, ZAS 2020/36, 224.
58
Drs, DRdA 2010, 213.
12Der Begriff der Kurzarbeit
Mosing59 vertritt hingegen die Sichtweise, eine Reduktion der Arbeitszeit – und somit
auch Kurzarbeit – aus arbeitsrechtlicher Sicht als Teilzeitarbeit zu qualifizieren. Bei Kurzarbeit
werde die Normalarbeitszeit temporär ausgesetzt. Demnach könne § 19d AZG angewendet
werden. Dies vor allem vor dem Hintergrund des Diskriminierungsschutzes dieser
Arbeitnehmergruppe gegenüber anderen Arbeitnehmern im selben Unternehmen, die jedoch
aufgrund eines anderen Kollektivvertrags oder Tätigkeitsbereichs nicht von Kurzarbeit
betroffen sind. Es wäre seiner Ansicht nach jedoch sinnvoll den Begriff der Kurzarbeit nur dann
zu verwenden, wenn daran auch die Gewährung von Kurzarbeitsbeihilfe geknüpft ist und es zu
keiner wesentlichen Entgeltschmälerung für den Arbeitnehmer kommt.
Im Ergebnis wird festgehalten, dass Kurzarbeit von Teilzeitarbeit zu differenzieren ist, da
sich beide Rechtsinstrumente hinsichtlich ihres Regelungszieles unterscheiden. Bei Kurzarbeit
handelt es sich um eine vorübergehende Arbeitszeitreduktion aufgrund von wirtschaftlichen
Schwierigkeiten, die vom Staat zeitlich begrenzt gefördert wird. Teilzeitarbeit kann unabhängig
von einer Förderungsmöglichkeit und zeitlich uneingeschränkt vereinbart werden,
beispielsweise auch dann, wenn dem Unternehmen Kurzarbeit zu aufwändig erscheint.60 Es
sprechen zwar gute Gründe dafür der Auslegung von Mosing zu folgen und § 19d AZG auch
bei Kurzarbeit anzuwenden, insbesondere in Hinblick auf den Diskriminierungsschutz im
Vergleich zu Vollzeitarbeitnehmern. Trotzdem ist Kurzarbeit deutlich von Teilzeitarbeit iSd
§ 19d AZG abzugrenzen, da dies sonst zu widersprüchlichen Ergebnissen führen würde,
insbesondere in Hinblick auf den Mehrarbeitszuschlag. Der Begriff „Kurzarbeit“ ist jedenfalls
immer nur dann zu verwenden, wenn tatsächlich Kurzarbeitsbeihilfe gewährt wird.
4.1.2 Sozialversicherungsrechtliche Betrachtung
Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht ist zwischen Kurz- und Teilzeitarbeit zu
unterscheiden. Bei Teilzeitbeschäftigten verringert sich die Beitragsgrundlage für die
Sozialversicherung. Bei Kurzarbeit wird die Beitragsgrundlage vor Einführung der Kurzarbeit
herangezogen.61
59
Mosing, JAS 2020/02, 144.
60
Gleißner in Reissner/Herzeg (Hrsg), Arbeits- und sozialrechtliche Strategien zur Krisenbewältigung Bd 3
(2010), 86.
61
Bleyer/Lindmayr/Sabara, Personalrecht & Betriebswichtiges: Sozialversicherung - Beitragsrecht20 (2020)
Rz 590.
13Der Begriff der Kurzarbeit
Geringfügig Beschäftigte sind von der Kurzarbeit ausgenommen, da bei diesen keine
Pflichtversicherung in der Arbeitslosenversicherung begründet wird. Übersteigt das Entgelt
eines Arbeitnehmers die sozialversicherungsrechtliche Geringfügigkeitsgrenze nicht, entsteht
nur eine Teilversicherung in der Unfallversicherung.
Kommt es durch eine kurzarbeitsbedingte Entgeltreduktion zu einer Unterschreitung der
Geringfügigkeitsgrenze, gilt weiterhin die Beitragsgrundlage vor Kurzarbeit und der
Dienstnehmer bleibt vollversichert (vgl. § 5 Abs 3 Z 1 ASVG).62
4.2 Weitere Alternativen zur Kurzarbeit
4.2.1 Karenzierung und Aussetzung des Arbeitsvertrags
Unter Karenzierung versteht man die zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
vereinbarte Freistellung von der Arbeit unter Entfall des Entgelts, wobei der Arbeitsvertrag
weiterhin aufrecht bleibt. In dieser Konstellation werden die Hauptpflichten aus dem
Arbeitsverhältnis (Arbeits- und Entgeltpflicht) ruhend gestellt, die Nebenpflichten (zB
Treuepflichten wie Konkurrenzverbot, Verschwiegenheitspflicht) bleiben jedoch aufrecht.63
Im Gegensatz kommt es bei einer Aussetzung zu einer Unterbrechung bzw. rechtlichen
Beendigung des Arbeitsverhältnisses – verbunden mit der Zusicherung des Arbeitgebers in
Zukunft ein neues Arbeitsverhältnis zu begründen. In der Praxis erfolgt die Beendigung meist
durch einvernehmliche Auflösung.64 Meist wird im Rahmen einer Aussetzungsvereinbarung
festgelegt, dass bestimmte Ansprüche, die mit der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses
verbunden sind (zB Abfertigungsansprüche), ins nachfolgende Arbeitsverhältnis übernommen
werden.65
62
Mosler in Mosler/Müller/Pfeil (Hrsg), Der SV-Komm § 5 ASVG Rz 56 (Stand 1.7.2020, rdb.at).
63
Pacic in Reissner/Neumayr (Hrsg), Zeller Handbuch Arbeitsvertrags-Klauseln2 (2019) Rz 28.03; OGH
27.5.2020, 8 ObA 41/20t, ARD 6715/4/2020 = PV-Info 2020 H 10, 16 (Rauch).
64
Rauch, Aussetzungsvereinbarungen und Wiedereinstellungszusage, PV-Info 2020/10, 16.
65
Reissner, Lern- und Übungsbuch Arbeitsrecht6 (2020) 166f.
14Der Begriff der Kurzarbeit
Die beiden Termini sind klar voneinander abzugrenzen. Entscheidend ist vor allem der
Zweck der Vereinbarung und die Absicht der Parteien.66 Die Absicht, den Bezug von
Arbeitslosengeld zu ermöglichen, die Abrechnung beendigungsabhängiger Ansprüche sowie
die „Beurkundung“ durch den Arbeitgeber (wie zB durch Dienstzeugnis oder die Abmeldung
von der Sozialversicherung) sind weitere Merkmale, die für die rechtliche Beendigung bzw.
Aussetzung sprechen.67 Die Karenzierung führt – anders als die Aussetzung – nicht zur
Arbeitslosigkeit. Arbeitslosengeld gebührt nur, wenn es zu einer rechtlichen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses kommt.68
Bei Kurzarbeit bleiben die Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis (Entgelt- und
Arbeitspflicht) weiterhin bestehen, diese werden nur für einen vorübergehenden Zeitraum
reduziert. Kurzarbeit bezweckt keine vollständige Ruhendstellung der Hauptpflichten und ist
zudem an die Gewährung von staatlichen Beihilfen geknüpft. Auch wenn ausnahmsweise
vorübergehend null Arbeitsstunden geleistet werden müssen, und dies de facto einer
vorübergehenden Karenzierung gleichkommt, ist eine komplette Gleichstellung von Kurzarbeit
mit Karenzierung nicht möglich, da mit diesen Rechtsinstituten jeweils unterschiedliche
Zwecke verfolgt werden.69
4.2.2 Bildungskarenz/Bildungsteilzeit
Die durch die Kurzarbeit ausfallende Arbeitszeit kann von den Arbeitnehmern auch für
Aus- und Weiterbildungen bzw. weitere Qualifizierungen genutzt werden. Alternativ zur
Kurzarbeit mit Qualifizierung (siehe Abschnitt 7.3) kann zum Zweck der Weiterbildung des
Arbeitnehmers auch eine Bildungskarenz iSd § 11 AVRAG gegen Entfall des Entgelts für
mindestens zwei bis maximal 12 Monate vereinbart werden. Voraussetzung ist, dass das
Arbeitsverhältnis bereits sechs Monate gedauert hat. Während der Bildungskarenz besteht
Anspruch auf Weiterbildungsgeld iSd § 26 AlVG in Höhe des Arbeitslosengeldes, sofern die
66
OGH 26.1.2010, 9 ObA 13/09s, wbl 2010/95 = PVInfo 2010 H 8, 33 (Gerhartl) = ARD 6108/4/2011
(Adamovic).
67
Gerhartl, Unterbrechung oder Karenzierung des Arbeitsverhältnisses, PV-Info 2010/8, 33.
68
Pacic in Reissner/Neumayr, ZellHB AV-Klauseln2 Rz 28.05.
69
Reissner in Resch (Hrsg), Karenzierung des Arbeitsvertrags (2012) 13 (31f); Schnorr, DRdA 1987/4, 262;
Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/744.
15Der Begriff der Kurzarbeit
arbeitslosenversicherungsrechtliche Anwartschaft erfüllt und der Nachweis der Teilnahme an
der Weiterbildungsmaßnahme erbracht wird.70
Alternativ steht auch eine Form der Teilzeitarbeit in Form der Bildungsteilzeit iSd § 11a
AVRAG zur Verfügung. Diese kann für mindestens 4 Monate, maximal 2 Jahre vereinbart
werden. Die Arbeitszeit kann in dieser Zeit um mindestens ein Viertel und maximal die Hälfte
der Normalarbeitszeit herabgesetzt werden. Während dieser Zeit besteht Anspruch auf
Bildungsteilzeitgeld iSd § 26a AlVG, sofern die arbeitslosenversicherungsrechtliche
Anwartschaft erfüllt und die Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme nachgewiesen wird.71
4.2.3 Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgelts
Auch eine Freistellung gegen Entfall des Entgelts iSd § 12 AVRAG wäre alternativ zur
Kurzarbeit denkbar. Diese kann für eine Dauer von mindestens sechs Monaten bis zu einem
Jahr vereinbart werden. Für den vereinbarten Zeitraum kann dem Arbeitnehmer
Weiterbildungsgeld iSd § 26 AlVG gewährt werden. Im Unterschied zur Bildungskarenz hat
der Arbeitnehmer aber keine Verpflichtung zur Weiterbildung. Weiterbildungsgeld kann aber
nur beansprucht werden, wenn der Arbeitgeber die Einstellung einer nicht nur geringfügig
beschäftigten Ersatzarbeitskraft, die zuvor Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen hat,
gegenüber dem AMS nachweist.72
70
Reissner, Arbeitsrecht6 169f.
71
Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/450f.
72
Mosing, Kombination von Weiterbildungs- und Arbeitslosengeld, ASoK 2020, 186 (190); Reissner, Lern-
und Übungsbuch Arbeitsrecht3 (2008) 169f; Pfeil in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 12 AVRAG
Rz 23 (Stand 1.1.2018, rdb.at).
16Arbeitsrechtliche Grundlegung der Kurzarbeit
5. Arbeitsrechtliche Grundlegung der Kurzarbeit
Bei Vorliegen eines Arbeitsvertrags iSd § 1151 ABGB steht typischerweise die
Arbeitspflicht des Arbeitnehmers der Entgeltverpflichtung des Arbeitgebers gegenüber.73 Die
Einführung von Kurzarbeit bezweckt eine Reduktion der Arbeitszeit und damit verbunden auch
des Entgelts. Dazu bedarf es einer entsprechenden arbeitsrechtlichen Grundlage. Nachfolgend
werden die verschiedenen arbeitsrechtlichen Möglichkeiten zur Einführung von Kurzarbeit
näher erläutert.
5.1 Kurzarbeit aus leistungsstörungsrechtlicher Sicht
Kann die Arbeitsleistung nicht erbracht oder vom Arbeitgeber entgegengenommen
werden, kommen grundsätzlich die allgemeinen schuldrechtlichen Regeln über die
Leistungsstörungen zur Anwendung. Daraus ergeben sich jedoch Konsequenzen, die mit dem
Wesen eines Arbeitsverhältnisses nicht vereinbar sind. Dies führte zur Entwicklung der sog
„Sphärentheorie“.74 Demnach ist zu unterscheiden, ob die Gründe für die Arbeitsverhinderung
der Sphäre des Arbeitgebers, des Arbeitnehmers oder der neutralen Sphäre zuzurechnen sind.
Kommt es zu einer Arbeitsverhinderung, die der Sphäre des Arbeitgebers zuzurechnen
ist und zeigt sich der Arbeitnehmer leistungsbereit, hat dieser Anspruch auf volle
Entgeltfortzahlung auf Basis der Normalarbeitszeit nach § 1155 ABGB.75
Dies gilt auch für den Fall von Kurzarbeit, wenn der Arbeitgeber von wirtschaftlichen
Schwierigkeiten betroffen ist, die nicht von ihm beeinflussbar sind. Ohne entsprechende
arbeitsrechtliche Vereinbarung bzw. Abbedingung des § 1155 ABGB, hat der Arbeitnehmer
(auch für die im Rahmen einer Kurzarbeit entfallende Arbeitsleistung) Anspruch auf volle
Entgeltfortzahlung.76
73
Reissner in Reissner/Neumayr (Hrsg), Zeller Handbuch Arbeitsvertrags-Klauseln2 (2019) Rz 49.08.
74
Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 6/563.
75
Reissner in Reissner/Neumayr, ZellHB AV-Klauseln2 Rz 49.02.
76
Auer-Mayer, ZAS 2020/36, 225f.
17Arbeitsrechtliche Grundlegung der Kurzarbeit
Nur wenn das die Arbeitsverhinderung auslösende Ereignis so umfassend ist, dass es
neben dem Betrieb auch die Allgemeinheit betrifft (zB Naturkatastrophen, Krieg), gebührt
keine Entgeltfortzahlung (neutrale Sphäre).77
Die Corona-Pandemie erfüllt grundsätzlich die Voraussetzungen für eines in die neutrale
Sphäre fallenden Ereignisses, vor allem in Hinblick auf die coronabedingten Betretungsverbote
während der Corona-Lockdowns. Mit dem 2. COVID-19-G hat der Gesetzgeber jedoch durch
§ 1155 Abs 3 ABGB klargestellt, dass diese Einschränkungen der Sphäre des Arbeitgebers
zuzurechnen sind und der Arbeitnehmer somit Anspruch auf (volle) Entgeltfortzahlung hat.78
Für den Fall von Kurzarbeit ist nach Ansicht von Auer-Mayer79 § 1155 Abs 3 ABGB aber so
zu interpretieren, dass der Entgeltfortzahlungsanspruch – auch bei Betriebsschließungen –
(teilweise) vertraglich abbedungen werden kann. Man könne ihrer Meinung nach davon
ausgehen, dass der Gesetzgeber weiterhin Kurzarbeit (nicht nur bei voller Entgeltfortzahlung)
ermöglichen wollte.
5.2 Weisung des Arbeitgebers
Der Arbeitnehmer unterliegt betreffend Arbeitsumfang und -verrichtung den Weisungen
des Arbeitgebers. Beim Weisungsrecht (Direktionsrecht) handelt es sich nach hA um ein
einseitiges Gestaltungsrecht in Form einer einseitigen Willenserklärung des Arbeitgebers, das
innerhalb des durch den Arbeitsvertrag vorgegebenen Rahmens, in Berücksichtigung der
allgemeinen Schranken der Rechtsordnung, ausgeübt werden kann.80 Im Stufenbau der
Arbeitsrechtsordnung steht die Weisung hierarchisch unter dem Arbeitsvertrag.81
Fraglich ist, ob der Arbeitgeber mittels Weisung Kurzarbeit einführen kann.
Grundsätzlich sind materielle Arbeitsbedingungen wie Entgelt, Inhalt und Ausmaß der
Arbeitsleistung dem Weisungsrecht des Arbeitgebers entzogen und deshalb arbeitsvertraglich
77
Reissner in Reissner/Neumayr, ZellHB AV-Klauseln2 Rz 49.02f.
78
Rauch, Die Dienstverhinderung durch eine Pandemie, ASoK 2020, 301 (303).
79
Auer-Mayer, ZAS 2020/36, 225.
80
Reissner, Arbeitsrecht6 153; Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 3/010.
81
Reissner/Neumayr in Reissner/Neumayr (Hrsg), Zeller Handbuch Arbeitsvertrags-Klauseln2 (2019) Rz
0.96.
18Arbeitsrechtliche Grundlegung der Kurzarbeit
zu vereinbaren.82 Nach Ansicht des OGH83 ist eine einseitige Anordnung einer
Arbeitszeitverkürzung unter entsprechender Auswirkung auf das Entgelt nicht möglich. Der
Arbeitgeber könnte zwar im Rahmen der gesetzlichen und kollektivvertraglichen Regelungen
einseitig die Arbeitszeit reduzieren, der Arbeitnehmer hätte aber gem § 1155 ABGB Anspruch
auf Entgeltfortzahlung in bisher vereinbarter Höhe, wenn er leistungsbereit ist und dadurch an
der Arbeitsleistung aus Gründen, die in der Sphäre des Arbeitgebers liegen, gehindert worden
ist.84 § 1155 ABGB kann nur mittels Vereinbarung abbedungen werden und benötigt deshalb
die ausdrückliche Zustimmung des Arbeitnehmers.85
Fehlt eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage oder auch ein ausdrücklicher Vorbehalt,
dem der Arbeitnehmer frei von Willensmängeln zugestimmt hat, so stellt die Weisung des
Arbeitgebers kein geeignetes Mittel dar, um Kurzarbeit einzuführen und somit den
Entgeltanspruch der betroffenen Arbeitnehmer zu verkürzen.86
5.3 Einzelvertragliche Vereinbarung
5.3.1 Kurzarbeitsvorbehalte
Ein Änderungsvorbehalt in einem Arbeitsvertrag räumt dem Arbeitgeber die Befugnis
ein, einseitig in Ansprüche des Arbeitnehmers – auch verschlechternd – einzugreifen.
Zunächst stellt sich die Frage, ob ein Änderungsvorbehalt in Hinblick auf den
Entgeltfortzahlungsanspruch zulässig wäre. Der Entgeltfortzahlungsanspruch iSd § 1155
ABGB kann gem § 1164 ABGB vertraglich abbedungen werden. Eine abweichende
einzelvertragliche Vereinbarung oder ein Änderungsvorbehalt im Arbeitsvertrag ist allerdings
am Sittenwidrigkeitskorrektiv des § 879 ABGB zu messen, da das wirtschaftliche Risiko nicht
auf den Arbeitnehmer überwälzt werden darf. Demnach ist eine Vereinbarung, die gerade
82
Löschnigg, Arbeitsrecht13 Rz 11/079.
83
OGH 26.1.2018, 8 ObA 38/17x, ÖJZ EvBl-LS 2018/72, 470 (Rohrer) = PVInfo 2018/6, 8 (Rauch).
84
Schnorr, DRdA 1987/4, 263.
85
Mazal, ZAS 1988, 83; Mosing, JAS 2020/02, 154.
86
Rauch, Kann das arbeitsvertragliche Stundenausmaß vom Arbeitgeber einseitig reduziert werden?, PV-Info
2018/6, 8 (9); Winter/Thomas, ZAS 2009/10, 71.
19Arbeitsrechtliche Grundlegung der Kurzarbeit
darauf abzielt die Entgeltfortzahlungspflicht nach § 1155 ABGB auszuhebeln bzw. das
Unternehmerrisiko auf den Arbeitnehmer zu überwälzen, als nichtig anzusehen.87
In Anbetracht des Zwecks der Kurzarbeit Arbeitsverhältnisse in Krisenzeiten möglichst
aufrecht zu erhalten, entspricht eine gänzliche oder teilweise Abbedingung des § 1155 ABGB
in Arbeitsverträgen aber auch den Arbeitnehmerinteressen. Ein Arbeitgeber könnte andernfalls
eher zu Kündigungen geneigt sein. Der Arbeitnehmer erhält weiters eine finanzielle
Unterstützung für die entfallenden Arbeitsstunden. Sittenwidrigkeit kann demzufolge
ausgeschlossen werden.88
Eine (teilweise) Abbedingung des § 1155 ABGB für außergewöhnliche Ereignisse, die
vom Arbeitgeber nicht beeinflussbar sind bzw. auf die er sich nicht ausreichend vorbereiten
kann, wird zudem als zulässig erachtet.89 Auch die zeitliche Begrenzung des Anspruchs bei
Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen Gründen wird als zulässig befunden.90
Die vertragliche Abbedingung muss jedenfalls iSd § 869 ABGB klar und ausreichend
bestimmt formuliert werden.91 Der Arbeitgeber hat lt OGH die Regelungsbefugnis nach
„billigem Ermessen“ und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben auszuüben.92 Eine
verschlechternde Leistungsveränderung muss somit verhältnismäßig und angemessen sein.93
Dazu ist eine Interessensabwägung vorzunehmen94 und der arbeitsrechtliche
Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten.95
Ein Änderungsvorbehalt, der darauf gerichtet ist, die Entgeltfortzahlung bei Vorliegen
von vorübergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wie im Fall von Kurzarbeit,
87
Schnorr, DRdA 1987/4, 263; Auer-Mayer, ZAS 2020/36, 225; OGH 27.1.1987, 14 Ob 224/86, Wbl
1987,100; Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 1155 ABGB Rz 6 (Stand 1.1.2018, rdb.at).
88
Wolf/Potz/Krömer/Jöst/Stella/Hörmann/Holuschka/Scharf in Resch, Corona-HB1.01 Kap 4 Rz 33; Krejci in
Rummel (Hrsg), ABGB3 § 1155 ABGB Rz 1 (Stand 1.1.2000, rdb.at).
89
Reissner in Reissner/Neumayr, ZellHB AV-Klauseln2 Rz 49.30;
90
Gerhartl, Arbeitsausfall aus Gründen in der Arbeitgeber-Sphäre, ARD 2018/6626, 5.
91
Reissner in Reissner/Neumayr, ZellHB AV-Klauseln2 Rz 49.32.
92
Kietaibl, Flexibilisierungsmöglichkeiten im Arbeitsverhältnis, ASoK 2008, 370 (377); Aichberger-Beig,
Zur Abdingbarkeit des Entgeltanspruchs für Zeiten der Nichtbeschäftigung, ZAS 2018/13, 69 (71); Mair
in Reissner/Neumayr (Hrsg), Zeller Handbuch Arbeitsvertrags-Klauseln2 (2019) Rz 46.25.
93
Vgl OGH 2.9.1987, 9 ObA 58/87, WBl 1988, 56.
94
Mair in Reissner/Neumayr, ZellHB AV-Klauseln2 Rz 46.33.
95
Mair in Reissner/Neumayr, ZellHB AV-Klauseln2 Rz 46.36; Rebhahn in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 §
1155 ABGB Rz 6.
20Sie können auch lesen