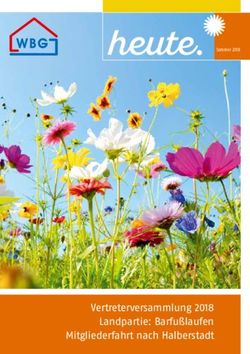APO-IT: Arbeitsprozessorientierte Weiterbildung in der IT-Branche
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
APO-IT: Arbeitsprozessorientierte
Weiterbildung in der IT-Branche
Schlussbericht
Irmhild Rogalla,
in Zusammenarbeit mit Johannes Einhaus, Josh Beier, Jörg Caumanns,
Stefan Grunwald, Katja Manski, Walter Mattauch und Matthias Rohs,
mit einem Beitrag von Dr. Michael Ehrke (IG Metall) und Karlheinz Müller
(ZVEI)
Berlin, 30. Juni 2005
1Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung: Arbeitsprozessorientierte Weiterbildung in der IT-Branche.......................3
2 Referenzprojekte................................................................................................................6
3 Didaktisches Strukturkonzept zur arbeitsprozessorientierten Weiterbildung...........11
4 Umsetzungen als Pilotprojekte.......................................................................................15
5 E-Learning und Infrastrukturen...................................................................................... 20
6 Personalzertifizierung..................................................................................................... 26
7 Europäische Einbindung..................................................................................................30
8 Zusammenfassung und zukünftige Entwicklungslinien...............................................33
9 Arbeitsprozessorientierte Kompetenzentwicklung als Basis einer modernen
Fachkräfteentwicklung im IT-Bereich (Dr. Michael Ehrke und Karlheinz Müller)......... 36
10 Daten und Fakten ......................................................................................................... 42
Materialien (auf CD-ROM)
21 Einleitung: Arbeitsprozessorientierte Weiterbildung in der
IT-Branche
In der beruflichen Bildung findet ein Paradigmenwechsel hin zur Prozess-
orientierung statt, der mit dem IT-Weiterbildungssystem (als formalem
Rahmen) das erste Mal konsequent für eine ganze Branche umgesetzt
wurde. Das Projekt „Arbeitsprozessorientierte Weiterbildung in der IT-
Branche (APO-IT)“ hat dafür das Strukturkonzept und die Inhalte
geschaffen.
Das Projekt wurde innerhalb des Programms „Neue Medien in der Bildung –
Berufliche Bildung“ gefördert vom BMBF, betreut vom Projektträger
DLR/PT-NMB und getragen von den Sozialpartnern, namentlich von
BITKOM, ZVEI, ver.di und der IG Metall.
Bereits während der Projektlaufzeit sind kontinuierlich viele Ergebnisse
veröffentlicht worden. Dieser Abschlussbericht wird stattdessen aus der
Perspektive des Projekts Entwicklungslinien aufzeigen und sich
insbesondere dem Aspekt „Nachhaltigkeit“ widmen:
• Worin bestehen die hauptsächlichen Ergebnisse des APO-IT-Projekts?
• Wie und an welchen Stellen kann auf Basis dieser Ergebnisse weiterge-
arbeitet werden?
• Welche offenen Fragen gibt es?
Eine wissenschaftliche Auswertung und Einordnung des Projekts ist nicht
geplant. Diese wurde und wird unter spezifischen Aspekten an anderer
Stelle geleistet1.
Der Bericht richtet sich an ein einschlägig informiertes Fachpublikum und
bietet keine Einführung in das Konzept der arbeitsprozessorientierten
Weiterbildung oder das IT-Weiterbildungssystem.
Das Projekt „Arbeitsprozessorientierte Weiterbildung in der IT-Branche
(APO-IT)“ gliederte sich in fünf Abschnitte:
I: „Definitionsphase des APO-IT-Projekts“
(01.01.2000 – 30.06.2000)
II: „APO-IT: Konzeption und Umsetzung von Referenzprojekten“
(01.07.2000 – 30.09.2002)
III: „APO-IT: Ausarbeitung von Profilbeschreibungen“
(01.07.2001 – 30.09.2001)
1
Vgl. die vollständige Literaturliste auf der zu diesem Bericht gehörigen CD-ROM.
3IV: „APO-IT: Konzeption und Organisation des BMBF Fachkongresses
„IT-Weiterbildung mit System” am 05./06. März 2002“
(01.11.2001 – 31.03.2002)
Die Abschnitte III und IV stellten dabei zusätzliche große Arbeitspakete dar,
die den zweiten Projektabschnitt ergänzten.
V: „APO-IT: Konsolidierung, Umsetzung und Verbreitung“
(01.10.2002 – 30.09.2004)
Nach der Definitionsphase2 wurden in APO-IT II die Grundlagen der
weiteren Entwicklung gelegt: Erste Referenzprojekte und die Methodik der
Referenzprojekterstellung wurden entwickelt, die konzeptionellen Grund-
lagen arbeitsprozessorientierter Weiterbildung erarbeitet, erste Umsetzun-
gen in der Praxis durchgeführt sowie die strukturellen Voraussetzungen für
die Verwertung der Projektergebnisse, die Zertifizierung und die E-Learning-
Infrastruktur geschaffen.
Ergänzt wurden diese Aktivitäten durch zwei zusätzliche Projektabschnitte:
Im Sommer 2001 wurden für die Vereinbarung der Sozialpartner3, in der
erstmalig die 29 IT-Spezialistenprofile beschrieben wurden, die Profil-
beschreibungen erarbeitet. Von November 2001 an wurde innerhalb des
APO-IT-Projekts der Fachkongress „IT-Weiterbildung mit System“ des
BMBF vorbereitet, der im März 2002 mit 600 Teilnehmern in Berlin stattfand.
In APO-IT V wurden die erfolgreichen Arbeiten aus den vorhergehenden
Phasen fortgesetzt: Für alle 35 Profile des IT-Weiterbildungssystems
wurden Referenzprojekte erarbeitet, weitere Umsetzungen wurden durch-
geführt, die technischen Entwicklungen abgeschlossen, das IT-Weiter-
bildungssystem und die Ergebnisse des APO-IT-Projekts in die Diskussion
auf europäischer Ebene eingebracht und die Zertifizierungsstelle Cert-IT
gegründet.
Das APO-IT-Projekt und seine Ergebnisse sind Anknüpfungspunkt für eine
Vielzahl weiterer Projekte:
• In mehreren Bundesländern (u. a. Thüringen, Baden-Württemberg,
Bayern, Hamburg, Niedersachsen) wurden und werden arbeitsprozess-
orientierte Qualifizierungen im IT-Weiterbildungssystem erprobt.
2
Der Projektabschlussbericht wurde im Juli 2000 vorgelegt. Walter, R. u. a.: „Projektabschlussbericht:
Definitionsphase des Projekts Arbeitsprozessorientierte Weiterbildung in der IT-Branche“. Berlin,
14.07.2000.
3
Vereinbarung über die Spezialisten-Profile im Rahmen des Verfahrens zur Ordnung der IT-Weiterbildung
vom 14. Februar 2002. Veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 105a vom 12. Juni 2002.
4• Im Rahmen der so genannten „Content-Ausschreibung“ des BMBF
werden in insgesamt elf Projekten E-Learning-Inhalte für das IT-Weiter-
bildungssystem erstellt.
• Zahlreiche Initiativen und Projekte für die IT-Branche haben das IT-
Weiterbildungssystem bzw. das Konzept der arbeitsprozessorientierten
Weiterbildung aufgenommen, unterstützen es und führen es weiter. Dazu
gehören u. a. KIBNET, LOVE-IT PLUS und ProIT Hessen.
Nachfolgend werden die wichtigsten Themen und Ergebnisse des APO-IT-
Projekts vorgestellt. Einzelne Arbeitsschritte werden nicht aufgelistet. Auch
die Aufwände sind bereits in den halbjährlichen Zwischenberichten
gerechtfertigt worden.
Wesentliche Ergebnisse des APO-IT-Projekts sind:
• die Referenzprojekte für alle 35 Profile des IT-Weiterbildungssystems,
• das didaktische Strukturkonzept zur arbeitsprozessorientierten
Weiterbildung,
• Pilotprojekte, in denen mit unterschiedlichen Leitfragen und in
verschiedenen Konstellationen Weiterbildungen durchgeführt wurden,
• Infrastrukturen und Konzepte für arbeitsprozessintegriertes E-Learning,
• strukturelle Grundlagen für die Personalzertifizierung im IT-Weiter-
bildungssystem und auf dieser Basis die Gründung der Zertifizierungs-
stelle Cert-IT,
• die Einbindung des IT-Weiterbildungssystems und der Ergebnisse des
APO-IT-Projekts in Gremien und Strukturen auf europäischer Ebene.
Das Konzept der arbeitsprozessorientierten Weiterbildung bildet die Basis
für eine moderne Fachkräfte-Entwicklung: Unternehmen sind aufgrund
steigender Anforderungen und dynamischer Technologie-Entwicklung
immer stärker auf angemessene Konzepte für lebenslanges Lernen und
betriebliche wie berufliche Qualifizierung angewiesen. Das Konzept einer
arbeitsprozessorientierten Weiterbildung bietet mit seinen beiden essen-
ziellen Bestandteilen der Prozessorientierung und der Integration von
Arbeiten und Lernen hierfür zukunftsweisende Ansätze.
52 Referenzprojekte
Wesentliches Ergebnis des APO-IT-Projekts sind die 35 Referenzprojekte
für die Profile des IT-Weiterbildungssystems.
Inhaltliche Beschreibung des Arbeitsbereichs
In den Referenzprojekten werden die IT-Spezialisten und IT-Professionals
durch ihre typischen Arbeitsprozesse und Tätigkeiten charakterisiert. Jedes
Referenzprojekt beruht auf mindestens einem realen, für das jeweilige Profil
typischen Projekt und der Erfahrung fachkompetenter Experten. Jedes
Referenzprojekt enthält:
• den für das Profil charakteristischen, zusammenfassenden Referenz-
prozess,
• die zum Referenzprozess gehörenden Teilprozesse, die die Tätigkeiten
ausführlich darstellen,
• die zu den jeweiligen Prozessen gehörenden Kompetenzfelder, die
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, Methoden und Werkzeuge beinhalten,
• ein illustrierendes Beispiel.
Referenzprojekte als Curricula zu verwenden ist eine der Grundideen des
APO-IT-Projekts (vgl. Kapitel 3 „Didaktisches Strukturkonzept zur arbeits-
prozessorientierten Weiterbildung“). Ebenso ist die Methode zur Erstellung
der Referenzprojekte hier entwickelt worden. Die Referenzprojekte und
insbesondere die Referenzprozesse setzen das Paradigma des Business
(Re-)Engineering und der damit verbundenen Orientierung der Unter-
nehmen an Geschäftsprozessen in Berufsrollen um.
Klassische Berufsbilder sind u. a. durch das Objekt der Tätigkeit, die
charakteristischen Aufgaben und Arbeitsmittel sowie den Funktionsbereich
der Tätigkeit gekennzeichnet. Darüber hinaus gibt es bei den prozess-
orientierten Profilen aus dem APO-IT-Projekt eine enge Verbindung
zwischen den wertschöpfenden Geschäftsprozessen der Unternehmen und
den Arbeitsprozessen der Fachkräfte. Dabei werden die Organisation der
Unternehmen entlang von Prozessketten ebenso berücksichtigt wie die
Zusammenfassung von unterschiedlichen Aufgaben (z. B. technischer,
ökonomischer und kundenbezogener Art) in einer Funktion und die in
modernen Unternehmen ausgeweiteten Verantwortungsbereiche der
Fachkräfte.
Prozessorientierte Strukturierung bietet große Vorteile: Da die Prozesse
relativ dauerhaft sind, ziehen sie sich wie ein roter Faden durch den
dynamischen technischen und technologischen Wandel. Weil die Referenz-
6und die Teilprozesse relativ abstrakt modelliert und die Kompetenzen auf
der Metaebene formuliert sind, sind vielfältige Ausgestaltungen in der
beruflichen und unternehmerischen Realität möglich. Für die Qualifizierung
lassen sich so mit Hilfe der Referenzprozesse reale Projekte identifizieren,
die trotz ihrer individuellen Ausprägung vergleichbare Anforderungen
enthalten.
Von 2000 bis 2002 wurde das APO-IT-Projekt parallel zum vom Bundes-
institut für Berufsbildung (BIBB) im Auftrag des BMBF betriebenen
Vorhaben „Neuordnung in der IT-Weiterbildung“ durchgeführt. Die Experten
des Fachbeirats des Ordnungsverfahrens haben die Ebenen des IT-Weiter-
bildungssystems und die Grundzüge der 29 Spezialisten und sechs
Professional-Profile festgelegt. Die weitere inhaltliche Ausgestaltung erfolgte
im APO-IT-Projekt.
Nachdem in APO-IT I auf der Basis von Stellenmarktanalysen erste Profil-
vorschläge erarbeitet worden waren, wurde in APO-IT II die Methodik der
Erarbeitung und Darstellung der Referenzprojekte an ersten Profilen (u. a.
Network Administrator und Database Developer) erprobt und verfeinert.
Dabei entstanden u. a.:
• die Methodik zur Erarbeitung von Referenzprojekten anhand von realen
Projekten aus der Praxis gemeinsam mit unterschiedlichen Experten,
• die für Arbeitsprozesse angemessene Art der Modellierung in Form von
Ereignis-Prozess-Ketten, wie sie in den Referenzprojekten und dem
Level-2-Dokument verwendet wird,
• der formale Rahmen der Darstellung für alle 35 Referenzprojekte.
Mit Hilfe dieses formalen und methodischen Handwerkszeugs wurden bis
zum Abschluss von APO-IT V dann alle 35 Referenzprojekte fertiggestellt.
In APO-IT II, III und V wurden auch wesentliche Strukturelemente für das IT-
Weiterbildungssystem erarbeitet. So entstanden u. a.:
• die Systematik der IT-Spezialisten, der so genannte „IT-Prozess“, der es
ermöglicht, die IT-Spezialisten sinnvoll in einem Gesamtprozess einzu-
ordnen, voneinander abzugrenzen und ihre Schnittstellen festzulegen,
• die für die Ebenen der operativen und strategischen Professionals kenn-
zeichnenden Tätigkeiten und Prozesse. Für die operativen Professionals
handelt es sich um die Planung und Durchführung ihrer jeweils profil-
spezifischen Projekte sowie die Durchführung projektübergreifender
Planungs- und Führungsaufgaben im Laufe der Geschäftsperiode. Die
Referenzprozesse der strategischen Professionals sind das gestaltende
und das regelmäßige strategische Management.
7An der Erarbeitung der Referenzprojekte waren fast 30 Projektmitarbeiterin-
nen und -mitarbeiter, etwa 60 Unternehmens- und Bildungspartner sowie
unzählige Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft beteiligt.
Anknüpfungspunkte für andere Projekte und für die Verwertung
Die Referenzprojekte bilden gemeinsam mit dem didaktischen Struktur-
konzept der arbeitsprozessorientierten Weiterbildung die fachlich-inhaltliche
Basis der anderen Arbeitspakete des APO-IT-Projekts.
Sie sind außerdem Grundlage und Anknüpfungspunkt für eine Vielzahl
weiterer Aktivitäten:
• Die Projekte im Rahmen der noch laufenden „Content-Ausschreibung“
(Neue Medien in der Bildung: Vorhaben zur Entwicklung und zum Einsatz
multimedialer Lehr- und Lernsoftware in der IT-Weiterbildung, vgl. Kapitel
5 „E-Learning und Infrastrukturen“) verwenden die Referenzprojekte als
Basis für die entwickelten Lehreinheiten.
• Für die Verbindung des IT-Weiterbildungssystems mit dem Hochschul-
system dienen die Referenzprojekte als Basis für den Kompetenz-
nachweis aus der beruflichen Bildung. Dieser „Brückenschlag“ wird
zukünftig auf breiter Basis erprobt werden.
• Für die Zertifizierung (vgl. Kapitel 6 „Personalzertifizierung“) und die
Verbreitung des IT-Weiterbildungssystems sind die Profile und Referenz-
projekte inhaltlicher Anknüpfungspunkt, so. u. a. für KIBNET
(Spezialistenmodul, Karriereplanungsmodul) und LOVE-IT PLUS.
• Das IT-Weiterbildungssystem ist auch für andere Branchen und
Bereiche, so z. B. Multimedia4, ein attraktives Vorbild für die Ordnung
beruflicher Fort- und Weiterbildung.
Veröffentlichte Projektergebnisse
Zu den veröffentlichten Projektergebnissen gehören u. a.:
• die Referenzprojekte für die 29 IT-Spezialisten – Administrator, Advisor,
Coordinator, Software Developer, Solution Developer und Technician –,
4
„Das APO-IT-Konzept einer arbeitsplatzorientierten und personenzertifizierten Weiterbildung ist als Lernform
hochinnovativ [...] Hinweise aus der Medienwirtschaft zeigen, dass das zunächst ausschließlich für IT Berufe
entwickelte Modell der arbeitsprozessorientierten Weiterbildung auch in anderen Branchen und Berufsgruppen
eine Zukunft hat. [...] Besonders interessiert an einer analogen Regelung zeigt sich die Multimediawirtschaft,
vertreten durch den Deutschen Multimedia Verband (dmmv). Im Frühjahr 2003 hat sich der Arbeitskreis Aus- und
Weiterbildung des dmmv einstimmig für eine aktive Mitwirkung in einschlägigen Gremien sowie an einer
Erweiterung des APO-IT-Modells ausgesprochen. Mit der Erarbeitung entsprechender Profile für alle drei Ebenen
(Spezialisten, operative und strategische Professionals) wurde im dmmv-Arbeitskreis bereits begonnen. Es ist
abzusehen, dass auch andere Branchen und Berufsgruppen dieses erfolgreiche Modell aufgreifen werden.“ Aus:
Michel, L. P. (2004): MMB-Expertise: Status quo und Zukunftsperspektiven von E-Learning in Deutschland. Essen.
8die vier operativen und zwei strategischen Professsionals, verfügbar auf
der beiliegenden CD-ROM sowie im Internet unter
http://www.apo-it.de/html/materialien/referenzprojekte.html,
• Die Spezialisten im IT-Weiterbildungssystem – Profile und Prozesse (so
genanntes Level-2-Dokument, vgl. Kapitel 6 „Personalzertifizierung“),
verfügbar auf der beiliegenden CD-ROM sowie im Internet unter
http://www.apo-it.de/html/materialien/referenzprojekte.html,
• Rogalla, I., Grunwald, S., Einhaus, J. (2002): Spagat zwischen Praxis
und Curriculum: Die Entwicklung arbeitsprozessorientierter Referenz-
projekte für die Profile des IT-Weiterbildungssystems. In: Mattauch, W.,
Caumanns, J. (Hrsg.): Innovationen in der IT-Weiterbildung. S. 179-187.
Bielefeld: Bertelsmann.
• Rogalla, I. (2002): Der IT-Prozess: Die Systematik der Spezialistenprofile
im neuen IT-Weiterbildungssystem. In: Cramer, G., Kiepe, K. (Hrsg.):
Jahrbuch Ausbildungspraxis 2003. Köln: Fachverlag Deutscher
Wirtschaftsdienst.
Auf den Projektergebnissen bauen u. a. folgende Bücher auf:
• Rogalla, I., Witt-Schleuer, D. (2004): IT-Weiterbildung mit System. Das
Praxishandbuch. Hannover: Heise.
• De Boer, R., Willker, W. (2002): IT-Weiterbildung mit Erfolg.
Kariereplaner für IT-Fachkräfte. Bremen: Medien-Institut.
Offene Fragen
Die Referenzprojekte, ihre Entwicklungsmethodik und die im Projekt
verwendete Prozesssystematik sind im APO-IT-Projekt entwickelt und
erstmalig erprobt worden. Aus diesem innovativen Ansatz erwachsen
diverse Fragen, die zukünftig zu bearbeiten sind:
• Mit dem IT-Prozess und den Referenzprozessen gibt es eine erste
prozessorientierte Systematik für Arbeitsprozesse. Klassisch sind Lehr-
und Bildungsinhalte aber fachsystematisch und hierarchisch (vom
Allgemeinen zum Speziellen oder umgekehrt) strukturiert. Möglichkeiten
der sinnvollen Verbindung beider Systematiken werden noch gesucht.
• Die Zusammenfassung von Kompetenzen zu Kompetenzfeldern, ihre
Anbindung an Prozesse und ihre Beschreibung auf einer relativ
abstrakten Ebene ist ebenfalls eine Neuentwicklung des APO-IT-
Projekts. Hier fehlt es insbesondere noch an Methoden zur
Konkretisierung in den jeweiligen individuellen Qualifizierungsprojekten.
9• Zu untersuchen ist noch, welche Aspekte der entwickelten Prozess-
Systematiken spezifisch für den IT-Bereich sind und welche sich auf
andere, ggf. auch nicht IT-nahe, Bereiche übertragen lassen.
• Ein formal-organisatorisches Problem ist ebenfalls noch ungelöst: Auch
wenn die Referenzprojekte und die in ihnen dargestellten Prozesse relativ
dauerhaft sind, ist trotzdem ein regelmäßiges Update im Hinblick auf
technologische Fragen und andere Innovationen notwendig. Wie und von
wem dieses Update geleistet wird, ist derzeit ungeklärt (vgl. auch Kapitel
6 „Personalzertifizierung“). Zur Qualitätssicherung des IT-Weiterbildungs-
systems, zur Aufrecherhaltung der Aktualität und zur Sicherung des
Anwendungsbezugs der Referenzprozesse ist ein regelmäßiges Update
aber dringend geboten.
103 Didaktisches Strukturkonzept zur arbeitsprozess-
orientierten Weiterbildung
Durch die Orientierung an Arbeitsprozessen Lernen und Arbeiten zu
verbinden ist Ergebnis der konzeptionellen Grundlagenarbeit im APO-IT-
Projekt.
Inhaltliche Beschreibung des Arbeitsbereichs
An mehreren Stellen des APO-IT-Projekts drückt sich eine konsequente
Prozessorientierung als Hauptmerkmal aus:
• Die Curricula basieren auf realen Projekten und Arbeitsprozessen (vgl.
Kapitel 2 „Referenzprojekte“).
• Im didaktischen Strukturkonzept wird hergeleitet, wieso es in innovativen
Branchen sinnvoll ist, Lernen und Arbeiten eng zu verbinden und welche
Konsequenzen sich daraus für den Lernprozess ergeben.
• In den Umsetzungen lernen Weiterzubildende tatsächlich in ihren Arbeits-
prozessen (vgl. Kapitel 4 „Umsetzungen als Pilotprojekte“).
Das didaktische Strukturkonzept der arbeitsprozessorientierten Weiter-
bildung wurde speziell für den IT-Bereich entwickelt. Dieser zeichnet sich
durch eine wenig ausgeprägte berufliche Strukturierung, eine hohe Zahl an
Quereinsteigern, dynamische Technologie- und Technikentwicklungen
sowie die Selbstverständlichkeit informellen Lernens aus.
Ziel jeder Qualifizierung muss der Erwerb und die Förderung beruflicher
Handlungskompetenz sein. Für die Integration von Arbeiten und Lernen
wurden im didaktischen Strukturkonzept daher bestimmte Leitlinien
festgelegt. Das Lernen erfolgt:
• in realen Projekten,
• selbst gesteuert, zugleich aber
• mit personeller Unterstützung und
• reflektiert.
Arbeitsprozessorientierte Weiterbildung beinhaltet also einen Bruch mit
bisherigen Vorgehensweisen und Paradigmen: Der Lernende mit seinen
individuellen Voraussetzungen, seinen Zielen und Rahmenbedingungen
steht im Mittelpunkt. Es geht nicht um die Vermittlung eines festgelegten
Wissenskanons oder abstrakter Schlüsselkompetenzen, die aus ihrem
Anwendungskontext gelöst sind. Vielmehr sind der Erwerb und weitere
Aufbau von reflexiver Handlungskompetenz des Einzelnen im sich
11wandelnden beruflichen Umfeld wesentliche Ziele. Damit wandeln sich auch
die Rollen von Lernenden und Lehrenden. Lernende sind aufgefordert,
anhand realer Projekte aus ihrem Arbeitsumfeld ihr Lernen – in Zielen,
Inhalten und Ablauf – weitgehend selbst zu steuern. Die Rolle des
„Lehrenden“ wandelt sich vom Instrukteur zum Unterstützer und Begleiter
der Lernprozesse. Durch das didaktische Strukturkonzept arbeitsprozess-
orientierter Weiterbildung werden hohe Anforderungen an die Lernenden
gestellt. Sie erhalten aber auch entsprechende Unterstützung: Neben den
Referenzprojekten als curricularer Grundlage stehen ihnen Fachberater und
Lernprozessbegleiter zur Verfügung. Ein fachlicher Berater unterstützt den
Lernenden bei fachlichen Fragen, gerade dann, wenn diese unternehmens-
spezifisch sind oder einen Experten erfordern.
Die Lernprozessbegleitung hat sich im Rahmen des APO-IT-Projekts als
wesentlich für den Erfolg der Lernprozesse und damit der Weiterbildung
herausgestellt. Die zu Projektbeginn in den konzeptionellen Grundlagen
ursprünglich vorgesehene Rolle des „Coach“ hat sich durch die praktischen
Erfahrungen bei der Erprobung des Konzepts (vgl. Kapitel 4 „Umsetzungen
als Pilotprojekte“) immer mehr zu der eines Lernprozessbegleiters
entwickelt. Während Coaching sich auf die Berufsrolle des Gecoachten und
die damit zusammenhängenden Inhalte und Anliegen bezieht, ist die
Lernprozessbegleitung stärker eine Lernberatung, die den Lernenden in
seiner Weiterbildung, z. B. in der Selbststeuerung oder beim Dokumen-
tieren, unterstützt. Beiden Konzepten gemeinsam ist der begleitende
Ansatz: individuelle Beratung auf der Basis gegenseitiger Akzeptanz,
Unterstützung bei der Entwicklung eigener Vorgehensweisen und
Lösungen, Förderung von Selbstwahrnehmung und -reflexion sowie Hilfe
zur Selbsthilfe. Mit der Lernprozessbegleitung wurde im APO-IT-Projekt ein
pädagogisches Konzept aufgegriffen und speziell im IT-Bereich sowie für
die arbeitsprozessorientierte Weiterbildung angewendet. Es hat der
Weiterbildungslandschaft bereits eine Reihe von Impulsen gegeben und
wird derzeit in unterschiedlichen Kontexten diskutiert und weiterentwickelt.
Arbeitsprozessorientierte Weiterbildung erzielt nachhaltige Erfolge:
Weiterzubildende erwerben Handlungskompetenz in ihrem beruflichen
Umfeld. Sie lernen, selbst zu lernen, d. h. zu erkennen, an welchen Punkten
sie ihre Kompetenzen erweitern müssen, zu beurteilen, auf welche Weise
sie das am besten tun, und zu reflektieren, was sie gelernt haben. Durch
arbeitsprozessorientierte Weiterbildung werden nicht nur fachliche (IT-spezi-
fische) und fachübergreifende (z. B. betriebswirtschaftliche) Kenntnisse und
Fähigkeiten erworben. Da in realen Projekten und Prozessen gelernt wird,
werden in der Regel vollständige Arbeitshandlungen durchgeführt, d. h.
neben dem Durchführen gehören auch Planen und Kontrollieren zu den
Aufgaben. Auf diese Weise werden auch spezifische Schlüsselkompetenzen
12erworben, da reale Projekte auch für eher technisch orientierte IT-
Spezialisten Kundenkontakt, Präsentation von Konzepten und Ergebnissen
sowie Arbeiten im Team bedeuten.
In Bezug auf die konkreten Umsetzungsmöglichkeiten erweist sich das
Strukturkonzept der arbeitsprozessorientierten Weiterbildung als flexibel.
Einen Einblick geben die im Rahmen des APO-IT-Projekts durchgeführten
Pilotumsetzungen (vgl. Kapitel 4 „Umsetzungen als Pilotprojekte“).
Veröffentlichte Projektergebnisse
Einzelheiten zum Strukturkonzept arbeitsprozessorientierter Weiterbildung
und zur Lernprozessbegleitung sind folgenden Veröffentlichungen zu
entnehmen:
• Rohs, M. (2004): Der didaktisch-methodische Ansatz der Arbeitsprozess-
orientierten Weiterbildung in der IT-Branche. In: Dehnbostel, P., Lang, M.
(Hrsg.): Innovationen und Tendenzen der betrieblichen Berufsbildung.
S. 187 - 198. Stuttgart: Franz Steiner.
• Rohs, M., Käpplinger, B. (Hrsg.) (2004): Lernberatung in der beruflich-
betrieblichen Bildung. Konzepte und Praxisbeispiele für die Umsetzung.
Münster: Waxmann.
• Mattauch, W., Büchele, U., Damian, F. (2003): Weiterbildungsmethoden
zur Integration von Arbeiten und Lernen im Unternehmen. In: Mattauch,
W., Caumanns, J. (Hrsg.): Innovationen der IT-Weiterbildung. Bielefeld:
Bertelsmann.
• Rohs, M. (Hrsg.) (2002): Arbeitsprozessintegriertes Lernen. Neue
Ansätze für die berufliche Bildung. Münster: Waxmann.
• Rohs, M., Mattauch, W. (2001): Konzeptionelle Grundlagen der arbeits-
prozessorientierten Weiterbildung in der IT-Branche. Berlin: ISST-Bericht
59/01.
Offene Fragen
Inzwischen ist das Konzept arbeitsprozessorientierter Weiterbildung über
den IT-Bereich hinaus bekannt. Es wird (auch unabhängig vom APO-IT-
Projekt) in vielfältigen Kontexten verwendet. Da es sich um ein Struktur-
konzept handelt, sind die unterschiedlichsten Ausgestaltungen denkbar. Als
zentrales Element arbeitsprozessorientierter Weiterbildung hat sich die
Lernprozessbegleitung erwiesen, was zu einer Reihe offener Fragen führt:
• Welche Elemente sind für Lernprozessbegleitung elementar und
unverzichtbar?
• Was unterscheidet Lernprozessbegleitung von Coaching, welche
Ähnlichkeiten gibt es?
13• Welche Voraussetzungen muss demnach eine Person mitbringen, die im
Bereich der Lernprozessbegleitung tätig werden möchte? Welche
Ausbildung ist hierfür notwendig?
• Wie wird die Qualität der Lernprozessbegleitung gesichert?
144 Umsetzungen als Pilotprojekte
Die Pilotumsetzungen im Rahmen des APO-IT-Projekts haben gezeigt, dass
arbeitsprozessorientierte Weiterbildung eine für Mitarbeiter und Vorgesetzte
gleichermaßen attraktive Form des Lernens ist.
Inhaltliche Beschreibung des Arbeitsbereichs
In der betrieblichen Praxis wurden arbeitsprozessorientierte Weiterbildungen
unter unterschiedlichen Realisierungsbedingungen erfolgreich durchgeführt.
Die eingesetzten Referenzprojekte, vor allem aber die grundsätzliche Idee
der Referenzprojekte als Struktur für das Lernen in der Arbeit wurden durch
die Umsetzungen bestätigt. Die inhaltliche und wissenschaftliche Begleitung
der Pilotumsetzungen war dabei sehr vielfältig. Das Konzept der arbeits-
prozessorientierten Weiterbildung wurde durch die Anforderungen der
verschiedenen Partner konkretisiert und weiterentwickelt. Es entstanden
unterschiedliche Praxishilfen, wie Leitfäden, Rollenbeschreibungen, Check-
listen, Beispielplanungen usw. Aktuelle Erfahrungen der Akteure in den
unterschiedlichen Umsetzungen wurden aufgenommen, verdichtet und in
der APO-Community verbreitet (u. a. im Rahmen der regelmäßig im Herbst
veranstalteten APO-Kongresse des Fraunhofer ISST sowie in zahlreichen
Publikationen). Die Diskussionsergebnisse wurden schließlich wieder in die
Praxis der Pilotumsetzungen zurückgespielt.
Die erste Pilotumsetzung war die Aufstiegsfortbildung zum Network
Administrator mit der Deutschen Telekom (Mai 2001 – März 2002). Sie
wurde im Rahmen des APO-IT-Projekts gemeinsam mit der Gesellschaft für
Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung (GAB München) betreut.
Ergebnisse dieser Umsetzung waren u. a.:
• die erste exemplarische Vorstellung vom Ablauf einer arbeitsprozess-
orientierten Weiterbildung in der Praxis und
• die Beschreibung der verschieden Rollen und Aufgaben bei der
Betreuung der Teilnehmer (Lernprozessbegleitung, Fachberatung, Rolle
des Vorgesetzten, Rolle von Bildungsdienstleistern).
Die Umsetzung wurde mit dem Weiterbildungsinnovationspreis 2002 des
BIBB ausgezeichnet.
Die weiteren Umsetzungen im Rahmen des APO-IT-Projekts lieferten den
Nachweis, dass das grundsätzliche Konzept flexibel in unterschiedlichen
betrieblichen Kontexten eingesetzt werden kann. Gleichzeitig wurden durch
spezielle Fragestellungen die Grenzen des Konzepts ausgetestet:
15• Umsetzung zu verschiedenen Spezialistenprofilen mit Siemens
Professional Education (Juni 2002 – Oktober 2003):
In dieser Pilotumsetzung fand keine Festlegung auf ein bestimmtes
Spezialistenprofil statt. Es wurde auch keine Teilnehmergruppe im
traditionellen Sinne gebildet. Stattdessen wurden im Unternehmen zwei
Prozesse vorangetrieben: In der Bildungsabteilung wurden Kapazitäten
für die Betreuung von Teilnehmern ausgebildet, in den verschiedenen
Fachabteilungen am Standort Berlin dazu parallel Teilnehmer akquiriert.
Teilnehmer konnten dann zu beliebigen Zeiten (abhängig von ihren
jeweiligen Qualifizierungsprojekten) in die Weiterbildung einsteigen. In
einem gemeinsamen Gespräch mit dem Vorgesetzten (und unter
Einbeziehung eines Lernprozessbegleiters) wählten sie ein Profil, das
ihrem Bildungsbedarf am besten entsprach.
Ein Ergebnis dieser Pilotumsetzung war: Das Konzept der arbeits-
prozessorientierten Weiterbildung erlaubt es, eine hohe Individualisierung
(sowohl zeitlicher als auch inhaltlicher Natur) vorzunehmen. Weiterhin
wurde deutlich, dass der Verzicht auf die Teilnehmergruppe zu neuen
Herausforderungen in Bezug auf die Administration und Motivation aller
Beteiligten führt.
• Umsetzung zum IT Project Coordinator mit der Kölsch & Altmann GmbH
(August 2002 – Dezember 2003):
Bei dieser Umsetzung in einem kleinen Softwareentwicklungs- und
Beratungsunternehmen übernahm einer der Geschäftsführer sämtliche
Begleitungsrollen für einen seiner Mitarbeiter. Die Weiterbildung war in
den alltäglichen Ablauf des Unternehmens integriert, knüpfte unmittelbar
an die bisherigen Lernerfahrungen des Mitarbeiters an und nutzte die in
anderen Personalentwicklungsmaßnahmen üblichen Instrumente (u. a.
Weiterbildungszeiten, interne Qualifizierungsprojekte, Fachgespräche).
Die Umsetzung hat die besonderen Herausforderungen aufgezeigt, die
sich aus einer Häufung der im Konzept der arbeitsprozessorientierten
Weiterbildung vorgesehenen Rollen bei einer Person ergeben. Zudem
hat sie nachgewiesen, dass in kleinen und mittleren Unternehmen mit
einer gut entwickelten Lernkultur das Konzept der arbeitsprozess-
orientierten Weiterbildung unmittelbar integrierbar ist. Daneben wurde die
Bedeutung des Vorgesetzten für das Lernen in der Arbeit, insbesondere
im Hinblick auf die Gewährleistung lernförderlicher Rahmenbedingungen,
aufgezeigt.
• Arbeitsprozessorientierte Fortbildung bei der MGI METRO Group
Information Technology GmbH auf der Ebene der Operativen
Professionals (November 2003 – März 2005):
16Erstmalig wurde hier das auf der Spezialistenebene erfolgreich erprobte
Konzept der arbeitsprozessorientierten Weiterbildung auf die Ebenen der
Professionals übertragen. In dieser Umsetzung wurden zum einen das
Konzept einer Lernprozessbegleitung auf Ebene der Professionals
erprobt, zum anderen neuartige Unterstützungsinstrumente, wie z. B. ein
Lerntagebuch, eingesetzt. Die Umsetzung unterstützte die weitere
Vernetzung der Mitarbeiter im Unternehmen, was als Hinweis auf die
enge Verbindung von Personal- und Organisationsentwicklung in der
arbeitsprozessorientierten Weiterbildung verstanden werden kann.
Zusätzlich zur tatsächlichen Weiterbildung von Teilnehmern wurden auch
die vor- und nachgelagerten Phasen (strategische Entscheidung im
Unternehmen, Konzeption, Planung und Vorbereitung der Weiterbildung,
Auswertung) begleitet. Zielgruppe der Beratung waren insbesondere die
jeweiligen Organisatoren der Weiterbildung in den Umsetzungen:
Vorgesetzte und Mitarbeiter von Bildungsdienstleistern. Damit sind zugleich
zwei unterschiedliche Organisationsentwicklungsprozesse angesprochen:
• Vorgesetzte müssen sich mit ihrer Rolle als „dezentrale Personal-
entwickler“ auseinandersetzen und die damit verbundenen Aufgaben
wahrnehmen.
• Bildungsdienstleister (sowohl externe Weiterbildungseinrichtungen als
auch interne Personalentwicklungs- und Bildungsabteilungen) müssen
sich auf ihre neue Rolle als Unterstützer des Lernens in der Arbeit
einstellen und unternehmensspezifisch ausgestalten.
Eine weitere spezielle Zielgruppe der Umsetzungen waren die Lernprozess-
begleiter. Sie wurden in ihrer Rolle geschult und während der jeweiligen
Pilotumsetzungen begleitet. Durch die kontinuierliche Arbeit mit den Lern-
prozessbegleitern konnten der Verlauf und die Qualität der Weiterbildung
gesichert werden. Zudem waren die Lernprozessbegleiter wegen ihres
unmittelbaren Kontakts mit den Teilnehmern hilfreiche Diskussionspartner
bei der Weiterentwicklung des Konzepts der arbeitsprozessorientierten
Weiterbildung (vgl. Kapitel 3 „Didaktisches Strukturkonzept zur arbeits-
prozessorientierten Weiterbildung“). Parallel zur Begleitung der Lern-
prozessbegleiter in einzelnen Umsetzungen wurden im Rahmen des APO-
IT-Projekts übergreifende „Lernprozessbegleitertreffen“ organisiert und
durchgeführt, die auf einen gegenseitigen Erfahrungsaustausch und
Vernetzung untereinander abzielten. Die Treffen dienten auch dazu, dass
die Praktiker untereinander ein gemeinsames Verständnis ihrer neuen
Aufgabe erarbeiteten.
Dokumentation der Projektergebnisse
• Manski, K., Mattauch, W., Einhaus, J., Loroff, C., Rohs, M. (2005):
Erfahrungen mit der Arbeitsprozessorientierten Weiterbildung in der IT-
17Branche (APO-IT) – Praxis der Pilotumsetzungen. Erscheint in: Loroff,
C., Manski, K., Mattauch, W., Schmidt, M. (Hrsg.): Arbeitsprozess-
orientierte Weiterbildung. Lernprozesse gestalten – Kompetenzen
entwickeln. Münster u. a.: Waxmann.
• Loroff, C., Manski, K. (in Vorbereitung, 2005): Teilnehmer einer APO-
Weiterbildung zum IT-Spezialisten. Heft 10 der APO-IT-Heftreihe.
• Manski, K., Mattauch, W. (in Vorbereitung, 2005): Organisation einer
Arbeitsprozessorientierten Weiterbildung. Heft 3 der APO-IT-Heftreihe.
• Rohs, M., Manski, K. (in Vorbereitung, 2005): APO und Personal-/
Organisationsentwicklung. Heft 2 der APO-IT-Heftreihe.
• Rohs, M., Damian, F., Walter, R., Hüttner, J. (in Vorbereitung, 2005):
Evaluation der Arbeitsprozessorientierten Weiterbildung. Eine Fallstudie
im Rahmen der Weiterbildung zum Operativen IT-Professional. Berlin:
ISST-Bericht.
• Einhaus, J., Loroff, C. (2004): Praxiserfahrungen aus der Lernprozess-
begleitung in Umsetzungsprojekten der IT-Weiterbildung. In: Rohs, M.,
Käpplinger, B. (Hrsg.): Lernberatung in der beruflichen Bildung. Konzepte
und Praxisbeispiele. S. 159 – 176. Münster u. a.: Waxmann.
• Mattauch, W., Caumanns, J. (Hrsg.) (2003): Innovationen der IT-Weiter-
bildung. Bielefeld: Bertelsmann.
Anknüpfungspunkte für andere Projekte
Die Pilotumsetzungen des APO-IT-Projekts wurden in enger Abstimmung
mit den so genannten APO-Länderprojekten (Umsetzungen in diversen
Bundesländern, u. a. Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern) durch-
geführt. So konnte das Erfahrungsspektrum erheblich erweitert werden.
Weitere Erprobungen des Konzepts der arbeitsprozessorientierten Weiter-
bildung auf Basis der im APO-IT-Projekt geleisteten Entwicklungsarbeiten
finden u. a. im Rahmen von ITAQU, KomNetz und APO-IT-Niedersachsen
statt.
Offene Fragen
Mit den Pilotumsetzungen wurden mögliche Wege zur Realisierung der
APO-Ideen aufgezeigt. Auf Grund des großen Erfahrungsspektrums kann
insbesondere auf der Spezialistenebene der Anspruch erhoben werden,
nachhaltige Lösungen entwickelt zu haben. Auf den Professionalebenen
müssen sich die APO-Ideen und -Instrumente noch weiter bewähren.
Dennoch bestehen auch auf der Spezialistenebene im Detail noch
Erfahrungslücken, die in zukünftigen Umsetzungen geschlossen werden
müssen (z. B. Möglichkeiten zur Sicherung lernförderlicher Rahmen-
18bedingungen, Zusammenspiel von Vorgesetztem und Bildungsdienstleister,
Bedeutung der Teilnehmergruppe beim Lernen im Arbeitsprozess, Nutzung
des Instruments der Qualifizierungsvereinbarung, Unterstützung der
fachlichen Berater in ihrer Aufgabe). Erfahrungen aus weiteren
Umsetzungen werden das Konzept in diesen und anderen Punkten weiter
spezifizieren. Letztendlich muss aber jeder Bildungsverantwortliche seinen
APO-Weg finden. Dass das grundsätzliche Strukturkonzept hierfür die
nötige Offenheit und Flexibilität bietet, haben die Pilotumsetzungen nach-
drücklich erwiesen. Offen ist allerdings, wie zukünftig die vielfältigen
Erfahrungen, die in den Unternehmen gemacht werden, gesichert und
reflektiert werden sollen, damit das Konzept und die Community sukzessive
von diesen Erfahrungen profitieren können.
Darüber hinaus ergeben sich aus den Erfahrungen der Pilotumsetzungen
zwei wichtige Anschlussfragen, deren Beantwortung über eine reine
Spezifizierung des Konzepts hinausgehen und eher auf dessen Erweiterung
zielen:
• Wie können über arbeitsprozessorientierte Weiterbildungen individuelle
Qualifizierungen besser mit übergeordneten Personalentwicklungs- und
Organisationsentwicklungsprozessen verzahnt werden?
• Welche Wege müssen beschritten werden, um eine fruchtbare
Verbindung von individueller arbeitsprozessorientierter Weiterbildung und
unternehmensweitem Wissensmanagement zu erreichen?
195 E-Learning und Infrastrukturen
Selbstorganisiertes Lernen am Arbeitsplatz, wie es vom Konzept arbeits-
prozessorientierter Weiterbildung gefordert und unterstützt wird, legt den
Einsatz computergestützten Lernens nahe.
Inhaltliche Beschreibung des Arbeitsbereichs
Im Rahmen des APO-IT-Projekts wurde das gesamte Spektrum computer-
gestützter Lern- und Unterstützungsmöglichkeiten von elektronischen
Instruktionsmedien über kooperatives Lernen und Wissensmanagement bis
hin zu flexibel einsetzbaren Infrastrukturkomponenten (z. B. Portale)
betrachtet. Hierbei zeigte sich, dass unterschiedliche Betrachtungsweisen
zu unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen führen:
• Aus Sicht der Unternehmen ist die Verwertung des in Weiterbildungen
gewonnenen „Wissens“ im Kontext existierender oder zu schaffender
Wissensmanagement- und Wissensproduktions-Infrastrukturen von
besonderer Bedeutung.
• Aus Sicht fachlich unterstützender Weiterbildner (insbesondere in KMU-
Szenarien) ist die Bereitstellung von elektronischen Lernmaterialien, d. h.
eine Instruktionsunterstützung durch neue Medien, von besonderem
Interesse.
• Aus Sicht der Lernprozessbegleiter und der fachlichen Berater ist eine
Unterstützung der Begleitprozesse (vor allem der Dokumentation) und
eine Förderung kooperativer, virtueller Lernformen wichtig.
• Aus Sicht der Teilnehmer sind vor allem die Verfügbarkeit von problem-
lösend ausgerichteten Informationsbausteinen und die Vernetzung mit
anderen Teilnehmern zu verbessern.
Der Schwerpunkt der Arbeiten lag vor allem auf der Unterstützung von
Weiterbildnern, insbesondere im Sinne der in Teilen zeitgleich mit dem
APO-IT-Projekt laufenden „Content-Ausschreibung“ des BMBF5. Die
ebenfalls sehr wichtigen Aspekte der Integration von Lernen und Wissens-
management sowie der Unterstützung von Lernprozessbegleitern wurden in
den Pilotumsetzungen verankert bzw. schwerpunktmäßig in APO-Länder-
projekte (vgl. auch Kapitel 4 „Umsetzungen als Pilotprojekte“) eingebracht.
Über den gesamten Verlauf des APO-IT-Projekts hinweg wurde die Frage
nach den Charakteristika von E-Learning-Medien für die arbeitsprozess-
orientierte Weiterbildung diskutiert. Dabei haben sich die folgenden
Eigenschaften als wünschenswert erwiesen:
5
Diese Projekte werden im Mai 2005 ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen.
20• die Unterstützung prozessorientierter Gliederungs- und Navigations-
strukturen,
• die Einbindung von Aufgaben und Problemstellungen, die ein
eigenständiges Lernen anstoßen können,
• die Betonung methodischer Aspekte in dem Sinne, dass nicht eine
Lösung vorgegeben, sondern ein Lösungsweg aufgezeigt wird,
• die intensive Nutzung interaktiver Elemente, um Sachverhalte plastisch
zu machen, den Lernenden in eine aktive Rolle zu bringen und eine
selbstständige Auseinandersetzung mit den Inhalten zu motivieren.
Ziel des APO-IT-Projekts im Bereich E-Learning war es, für die im Rahmen
der „Content-Ausschreibung“ des BMBF geförderten Projekte geeignete
Bausteine bereitzustellen, die es diesen Projekten erlauben würden, sich
weitgehend losgelöst von technischen Fragestellungen auf die Produktion
von Lernmedien zu konzentrieren. Zu diesen Bausteinen gehören der
APO-Pilot als neue Metapher für die Strukturierung von Lerninhalten, ein
spezielles Konformitäts- und Qualitätssiegel für E-Learning-Materialien
sowie der Prototyp eines Portals für die Vermarktung dieser Materialien.
Mit dem APO-Pilot wurde versucht, die Idee der Prozessorientierung auf die
Strukturierung von Lernumgebungen zu übertragen. Das Ergebnis sind
profilspezifische Umgebungen, in denen Lernmedien und Unterstützungs-
materialien nicht fachsystematisch, sondern entlang von Referenz- und
Teilprozessen strukturiert sind. Die Navigation findet über die auch in den
Referenzprojekten (vgl. Kapitel 2 „Referenzprojekte“) enthaltenen Ereignis-
Prozess-Ketten statt.
21Abbildung 1: Screenshot APO-Pilot
Zielsetzung des APO-Pilot war es vor allem, eine neue Metapher der
Strukturierung von Lerninhalten einzuführen und zu verbreiten. Diese war
erfolgreich: Mittlerweile haben eine ganze Reihe von E-Learning-Projekten
und -Anbietern Portale aufgebaut, die die grundsätzliche Struktur und
bisweilen sogar das Erscheinungsbild des APO-Pilot aufgreifen.
Im Rahmen der „Content-Ausschreibung“ des BMBF zeigte sich ein
Bedürfnis der Weiterbildner nach einem speziellen Konformitäts- und
Qualitätssiegel zur Qualitätssicherung der Lernmaterialien. Die mit einer
derartigen Signatur verbundenen technischen Probleme wurden im Rahmen
des APO-IT-Projekts gelöst: Die APO-Signatur verwendet ein asymme-
trisches Verschlüsselungsverfahren, mit dem die Integrität von Metadaten
garantiert wird. Gleichzeitig ermöglicht dieses Verfahren, einen fälschungs-
sicheren Kommentar in die Metadaten einzufügen. Zur Unterstützung des
22zukünftigen Signaturanbieters wurden Werkzeuge zum Erstellen,
Entschlüsseln und Verifizieren von Signaturen implementiert.
In dem ersten Prototyp des Portals zur Vermarktung der entstehenden
Lernmaterialien ist die technologische Basis für ein weitgehend geschäfts-
modellunabhängiges Konzept umgesetzt worden.
Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Screenshot des Portalausschnitts
zum Profil des Multimedia-Entwicklers.
Abbildung 2: APO-Content-Portal
Im Einzelnen wurden im Themenfeld E-Learning die folgenden konkreten
Ergebnisse erzielt:
• APO-Piloten für alle Spezialistenprofile
• Technische Lösungen wie
23• Methodik und Werkzeuge zur Signierung APO-konformer
Lernmedien
• Taxonomien zur inhaltlichen Klassifizierung von Lernmedien
• Werkzeuge zur Unterstützung der Prozessdokumentation
• XSL-Skripte zur Extraktion von einzelnen Informationsblöcken aus
den Referenzprojekten der jeweiligen Profile und aus dem so
genannten Level-2-Dokument
• Anpassung des LOM-Standards auf die Besonderheiten von
Lernmedien für eine arbeitsprozessorientierte Weiterbildung
• Prototyp eines Portals zur Sammlung und Verwertung von APO-
konformen Lernmedien
Daneben wurden vom Fraunhofer ISST diverse Workshops mit unterschied-
lichen Themenstellungen zur Unterstützung der Projekte aus der „Content-
Ausschreibung“ des BMBF organisiert und moderiert. Zusätzlich wurde die
Ausarbeitung eines konsensfähigen Geschäftsmodells durch Fragebögen,
zusammenfassende Berichte und die Einbringung eigener Konzeptpapiere
unterstützt.
Veröffentlichte Projektergebnisse
Zu E-Learning-Aspekten einer arbeitsprozessorientierten Weiterbildung
wurden folgende Publikationen veröffentlicht:
• Mattauch, W., Caumanns, J. (in Vorbereitung, 2005): E-Learning in der
arbeitsprozessorientierten Weiterbildung. Heft 4 der APO-IT-Heftreihe.
• Mattauch, W., Schmidt, M. (2005) : E-Learning in der Arbeitsprozess-
orientierten Weiterbildung. In: Breitner, H. (Hrsg.): Einsatzkonzepte und
Geschäftsmodelle für E-Learning (in Vorbereitung).
• Wendt, A., Caumanns, J. (Hrsg.) (2003): E-Learning in der Arbeits-
prozessorientierten Weiterbildung. Münster u. a.: Waxmann.
• Fuchs-Kittowski, F., Walter, R. (2002): Prozessorientierte Technik-
unterstützung für arbeitsprozessorientierte Weiterbildungen. In: Herczeg,
M., Oberquelle, H., Prinz, W. (Hrsg.): Mensch und Computer 2002 – Vom
interaktiven Werkzeug zu kooperativen Arbeits- und Lernwelten.
S. 275-284. Stuttgart: Teubner.
• Caumanns, J. (2002): E-Learning im Kontext arbeitsprozessorientierter
Weiterbildung. In: Mattauch, W., Caumanns, J. (Hrsg.): Innovationen in
der IT-Weiterbildung. S. 141 – 147. Bielefeld: Bertelsmann.
24Offene Fragen
Die E-Learning-Aktivitäten des APO-IT-Projekts sind in weiten Teilen eine
Umsetzung und Anwendung der im ebenfalls BMBF-geförderten Projekt
„Teachware on Demand“ entwickelten Technologien und Konzepte. Ebenso
wie die Ergebnisse des Teachware-Projekts deuten auch die im APO-IT-
Projekt mit dem Einsatz von E-Learning gesammelten Erfahrungen darauf
hin, dass der Einsatzkontext der beruflichen Bildung andere Methoden und
Ansatzpunkte des E-Learning erfordert als das „klassische“ Virtualisieren
existierender Lehrmaterialien.
Insbesondere durch die Erfahrungen mit E-Learning in den Pilotumset-
zungen (vgl. Kapitel 4 „Umsetzungen als Pilotprojekte“) und die Analyse der
ersten Ergebnisse der Projekte aus der „Content-Ausschreibung“ des BMBF
wurde innerhalb des Projektteams die vor 20 Jahren entwickelte Idee des
„Computers als kognitives Werkzeug“ als viel versprechender Ansatz
diskutiert:
• Fördert der Computer als kognitives Werkzeug die Akzeptanz des selbst
gesteuerten E-Learnings?
• Trägt die so verstärkte und veränderte Nutzung des PCs zur Netzwerk-
bildung und zum wirklichen Austausch unter Lernenden bei?
• Lassen sich mit Hilfe dieses Werkzeugansatzes prozessorientierte Lern-
medien in einer „neuen“ Art, die das Instruktionsparadigma endgültig
hinter sich lässt, gestalten?
• Mit IMS Learning Design existiert seit Kurzem eine Spezifikation, mit der
sich nicht nur Lernziele und -inhalte, sondern vor allem Lernprozesse
formal beschreiben lassen. Kann eine Modellierung von typischen APO-
Lernprozessen die bislang fehlende Brücke zwischen informellen Lern-
prozessen und formal beschriebenen E-Learning-Einheiten schaffen?
256 Personalzertifizierung
Die Einführung der Personalzertifizierung in die berufliche Bildung ist eine
der wesentlichen Neuerungen des IT-Weiterbildungssystems.
Inhaltliche Beschreibung des Arbeitsbereichs
Die Verzahnung von Personalzertifizierung mit öffentlich-rechtlichen
Abschlüssen ist in der deutschen Bildungslandschaft bisher einmalig:
• Eingangsvoraussetzung für die Zertifizierung im Spezialistenbereich des
IT-Weiterbildungssystems ist entweder ein Berufsabschluss im IT-
Bereich oder ein sonstiger Berufsabschluss verbunden mit mindestens
einjähriger Berufserfahrung im IT-Bereich oder eine mindestens
vierjährige, einschlägige Berufserfahrung.
• Die Profile der Spezialistenebene und ihre privatwirtschaftliche
Zertifizierung sind in der „Vereinbarung über die Spezialistenprofile im
Rahmen des Verfahrens zur Ordnung der IT-Weiterbildung“ der
Sozialpartner festgelegt. IT-Spezialisten unterliegen dem Verfahren der
Personalzertifizierung gemäß der international gültigen Norm DIN EN
ISO/IEC 17024.
• Die Spezialistenzertifizierung ist ihrerseits in der Regel Voraussetzung für
eine Qualifizierung im Bereich der IT-Professionals, die mit einer
öffentlich-rechtlichen Prüfung vor einer Industrie- und Handelskammer
abgeschlossen wird.
Inhaltliche Flexibilität und schnellere Umsetzung sind wesentliche Vorteile
der privatwirtschaftlichen Zertifizierung: Die Sozialpartner haben sich darauf
verständigt, die Aktualität der IT-Spezialistenprofile jährlich zu überprüfen.
Einigen sich die Experten des IT-Sektorkomitees auf Änderungen der
Spezialistenprofile, so müssen diese Änderungen von den Zertifizierungs-
stellen umgesetzt werden. Auf diese Weise werden die durch fachliche Tiefe
geprägten Spezialistenprofile den sich ändernden Anforderungen des
dynamischen IT-Bereichs gerecht.
Im APO-IT-Projekt wurden die Grundlagen für prozessorientierte
Prüfverfahren der IT-Spezialisten entwickelt und die notwendigen
organisatorischen Strukturen geschaffen bzw. mit Leben gefüllt:
• Personalzertifizierung ist eine anerkannte Methode zur Beurteilung von
Fachkräften. Die internationale Norm DIN EN ISO/IEC 17024 gibt den
Rahmen für die Qualitätssicherung der Akkreditierung, Zertifizierung und
Prüfung der Fachkräfte vor. Für die Spezialisten im IT-Weiterbildungs-
system wurde im APO-IT-Projekt ein Prüfungsverfahren entwickelt, das
26sowohl dieser Norm als auch den Anforderungen und Spezifika
arbeitsprozessorientierter Weiterbildung gerecht wird. Im Wesentlichen
beruht dieses Verfahren darauf, dass ein zukünftiger IT-Spezialist ein
reales Projekt, das den Anforderungen der Referenzprojekte bzw. dem
daraus abgeleiteten Level-2-Dokument entspricht, durchführt und
dokumentiert. Die vom zukünftigen IT-Spezialisten erstellte
Dokumentation wird von einem erfahrenen Experten begutachtet. Bei
einem positiven Ergebnis findet das Zertifizierungsverfahren mit einer
Präsentation und einem Fachgespräch seinen Abschluss.
• Die Ausgabe von Zertifikaten und damit die Kompetenzbestätigung der
IT-Spezialisten kann nur in privatwirtschaftlich organisierten
Zertifizierungsverfahren erfolgen. In Deutschland gibt es solche
Verfahren bereits seit über zehn Jahren in einigen speziellen Bereichen,
z. B. für den „Schweißerschein“. Für den IT-Bereich mussten neue
Zertifizierungsstellen und entsprechende Akkreditierungsmöglichkeiten
geschaffen werden.
Seit 1991 gibt es in Deutschland etablierte Akkreditierungsstrukturen mit
einem dahinter stehenden Akkreditierungssystem, in dem eine Akkredi-
tierungsstelle die Kompetenz einer Zertifizierungsstelle formell anerkennt.
Die Trägergemeinschaft für Akkreditierung (TGA), ist eine in Eigen-
verantwortung der Wirtschaft für die Wirtschaft gegründete Gesellschaft.
Die TGA beherbergt mehrere fachspezifisch agierende Sektorkomitees,
die wiederum die speziellen Akkreditierungsstellen unter sich bündeln.
Zertifizierungsstellen für die IT-Spezialisten müssen demnach von der
TGA für die Zertifizierung der IT-Spezialisten zugelassen sein. Im
September 2001 wurde von der TGA beschlossen, ein Sektorkomitee für
den IT-Bereich einzusetzen. Es wurde mit IT-Experten aus der Wirtschaft
besetzt. Das Sektorkomitee hat im März 2002 seine Arbeit
aufgenommen. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Eckpunkte für die
Personalzertifizierung der IT-Spezialisten wurde es aus dem APO-IT-
Projekt heraus unterstützt. So sind insbesondere große Teile des für die
Zertifizierung grundlegenden, so genannten Normativen Dokuments
sowie das Level-2-Dokument mit den Referenzprozessen der 29 IT-
Spezialisten im Rahmen des APO-IT-Projekts erarbeitet worden.
• Aus dem APO-IT-Projekt heraus konnte im September 2003 die erste
Zertifizierungsstelle für die IT-Spezialisten erfolgreich den Betrieb
aufnehmen: Cert-IT – Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung
der IT Weiterbildung mbH wurde von der Fraunhofer-Gesellschaft in
Kooperation mit den Sozialpartnern BITKOM, ZVEI, ver.di und IG Metall
sowie der Gesellschaft für Informatik (GI) gegründet. Cert-IT führt
Personalzertifizierungen für alle 29 IT-Spezialisten durch und beteiligt
sich aktiv an der Weiterentwicklung des IT-Weiterbildungssystems.
27Veröffentlichte Projektergebnisse
Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Prüfungsverfahren und dem
Aufbau sowohl der Zertifizierungsstrukturen als auch von Cert-IT sind u. a.
folgende Veröffentlichungen entstanden:
• Grunwald, S. (2003): Zertifizierung prozessorientierter Kompetenzent-
wicklung. In: Wendt, A., Caumanns, J. (Hrsg.): Arbeitsprozessorientierte
Weiterbildung und E-Learning. S. 127-138. Münster u.a.: Waxmann.
• Grunwald, S. (2002): Zertifizierung arbeitsprozessorientierter
Weiterbildung. In: Rohs, M. (Hrsg.): Arbeitsprozessorientiertes Lernen.
S. 165-179. Münster u. a.: Waxmann.
• Die Spezialisten im IT-Weiterbildungssystem – Profile und Prozesse (so
genanntes Level-2-Dokument), verfügbar auf der beiliegenden CD-ROM
sowie im Internet unter
http://www.apo-it.de/html/materialien/referenzprojekte.html:
• Version 2, Stand: Juli 2004
• Version 1, Stand: Oktober 2002
Auf den Projektergebnissen baut u. a. folgendes Buch auf:
• Grunwald, S., Freitag, Th., Witt-Schleuer, D. (2004): Zertifizierung im
IT-Weiterbildungssystem. Das Prüfungshandbuch. Hannover: Heise.
Offene Fragen
Die Personalzertifizierung und alle damit inhaltlich, formal und organisa-
torisch in Verbindung stehenden Aspekte spielen für das IT-Weiterbildungs-
system eine entscheidende Rolle. In diesem Bereich mussten durch die
Akkreditierung und ihre Restriktionen viele Aspekte der ursprünglichen
Projektplanung geändert werden. Insgesamt stellen der Aufbau und die
Etablierung von Cert-IT als der ersten Personalzertifizierungsstelle der IT-
Spezialisten und die Verzahnung öffentlich-rechtlicher mit privatwirt-
schaftlichen Strukturen einen unbestreitbaren Erfolg dar.
Eine wesentliche Frage muss jedoch als derzeit noch nicht hinreichend
geklärt gelten: Wie wird das Update der IT-Spezialistenprofile gesichert? Im
Auftrag von KIBNET wurde ein Feedback-Modul konzipiert und realisiert,
das die Darstellung der Referenzprozesse der IT-Spezialisten im Internet
und die Eingabe von gezieltem Feedback zu Aktualisierungs- und
Änderungsbedarfen für eine breite Öffentlichkeit ermöglicht. Die
regelmäßige Überprüfung der Referenzprozesse der IT-Spezialisten ist ein
wesentliches Merkmal des IT-Weiterbildungssystems. Nur so kann auf die
Anforderungen des dynamischen IT-Bereichs angemessen reagiert werden.
Die jährliche Überprüfung durch die Sozialpartner und die regelmäßige
28Sie können auch lesen