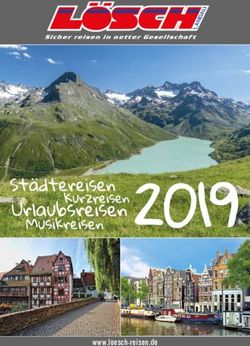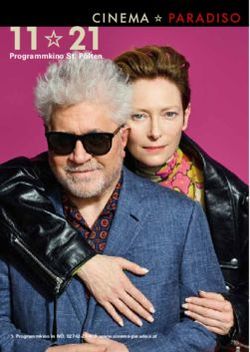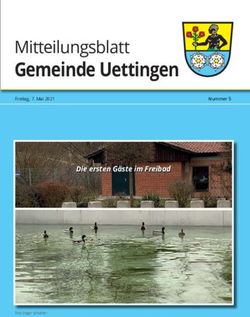April - Juli 2019 Haus des Deutschen Ostens
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Veranstaltungsübersicht
April Seite
2. A P R I L 2 0 1 9 , 1 8 . 0 0 U H R 21
Ausstellungseröffnung
„Wolfgang Niesner: Stadt – Land – Mensch“
4. A P R I L 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R 24
Vortrag
Reisen in die Vergangenheit? Westdeutsche
Fahrten nach Polen 1970 – 1990
11. A P R I L 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R 38
Termine
Konzert
Opernwettbewerb „Gabriela Beňačková“
mit jungen Talenten
19. A P R I L 2 0 1 9 , 1 4 . 3 0 U H R 46
Traditionen
Gottesdienst mit Hl. Abendmahl nach der
alten schlesischen Liturgie
29. A P R I L 2 0 1 9 , 0 8 . 3 0 – 1 8 . 0 0 U H R 30
Tagesexkursion
Napoleons Enkel, bayerische Herzöge und
Cousins des Zaren: Bayerisch-russische
Verbindungen im Kloster Seeon,
19. – 20. JahrhundertMai Seite
7. M A I 2 0 1 9 , 1 8 . 0 0 U H R 21
Begleitprogramm zur aktuellen
Ausstellung
Kuratorenführung mit Friederike Niesner
9. M A I 2 0 1 9 , 1 5 . 0 0 U H R 44
Erzählcafé
Prof. Dr. Andreas Otto Weber im Gespräch mi t …
Dr. des. Lilia Antipow
9. M A I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R 36
Lesung
„Abstufungen dreier Nuancen von Grau“ (2019)
von Kristiane Kondrat (Augsburg)
21. M A I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R 12
Programmreihe
„Versailles, Trianon, Brest-Litowsk“/
Eröffnungsvortrag
‚Versailles‘ und die Neuordnung Europas
1919 – 1920
28. M A I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R 14
Programmreihe
„Versailles, Trianon, Brest-Litowsk“/
Podiumsdiskussion
Der Frieden von Brest-Litowsk und die
Nationalstaatsgründungen in Osteuropa
nach dem Ersten WeltkriegVeranstaltungsübersicht
Juni Seite
6. J U N I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R 26
Vortrag
Das Rätsel der Turmschädel: Die Bajuwaren
und der Osten
25. J U N I 2 0 1 9 , 1 8 . 0 0 U H R 23
Ausstellungseröffnung
„‚Wolfskinder‘ – Auf dem Brotweg von
Ostpreußen nach Litauen 1945 – 1948“
Termine
26. JUNI BIS 30. J U N I 2 0 1 9 32
Studienreise
Wein und Krönungen, Naturschönheiten
und Barock – Eine Reise nach Pressburg
und Südmähren
Juli Seite
4. J U L I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R 16
Programmreihe
„Versailles, Trianon, Brest-Litowsk“/
Vortrag
Ein Dialog der Taubstummen: Die Gründung der
Tschechoslowakei und die deutsche Minderheit
9. J U L I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R 18
Programmreihe
„Versailles, Trianon, Brest-Litowsk“/
Buchpräsentation
„Der vergessene Weltkrieg. Europas
Osten 1912 – 1923“ (2018) von
Włodzimierz Borodziej und Maciej Górny
11. J U L I 2 0 1 9 , 1 5 . 0 0 U H R 45
Erzählcafé
Dr. Renate von Walter im Gespräch mit …
Wolfgang van Elst16. J U L I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R 28
Zeitzeugengespräch
Charlotte Knobloch privat
18. JULI 2019, 19.00 UHR
Buchpräsentation und Konzert 40
„Verwobene Kulturen im Baltikum – Zwei
Musikgeschichten in Lettland von 1700 bis
1945“ (2018) von Kristina Wuss
22. J U L I 2 0 1 9 , 0 9 . 4 5 – 1 5 . 3 0 U H R 34
Tagesexkursion
Erinnerungsort Badehaus Waldram
Externe Veranstaltungen Seite
7. M A I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R 48
HDO in Bayern / Lesung
„Wiesenstein“ (2018) von Hans Pleschinski
IN STRAUBING
20. J U N I 2 0 1 9 , 1 8 . 0 0 U H R 52
HDO in Europa / Ausstellung
„Kann Spuren von Heimat enthalten“
IN RUMÄNIEN
21. J U L I 2 0 1 9 50
HDO in Bayern / Ausstellung
„Mitgenommen – Heimat in Dingen“
I N W O L F R AT S H A U S E N - W A L D R A MEditorial
Die Friedensverträge nach
dem Ersten Weltkrieg verän
derten nicht nur die Landkar
ten Europas, besonders in
dessen östlichem Teil. Die
Neugründungen von National
staaten vom Baltikum bis nach
Jugoslawien hatten auch
Folgen für die zahlreichen
nationalen Minderheiten der
Großregion. Es folgten weite
Editorial
EDITORIAL
re Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen.
Gemeinsam mit dem Institut für deutsche Kultur und
Geschichte Südosteuropas an der LMU München gehen
6 wir in diesem und im nächsten Jahr im Rahmen der
Programmreihe „Versailles, Trianon, Brest-Litowsk:
Das lange Ende des Ersten Weltkriegs und das
östliche Europa“ diesen Folgen nach. Die Internetseite
www.daslangeendevon1918.de wird alle Veranstaltungen
enthalten und Sie im Detail informieren.
Neben dieser Themenreihe haben wir aber noch
viele weitere interessante Veranstaltungen im Pro
gramm, wie unsere Ausstellung „Wolfgang Niesner –
Stadt, Land, Mensch“, die wir am 2. April eröffnen.
In Kooperation mit der Botschaft der Republik
Litauen zeigen wir dann vom 26. Juni bis 16. August
die Ausstellung „Wolfskinder. Auf dem Brotweg von
Ostpreußen nach Litauen 1945 – 1948“. Zur Ausstel
lungseröffnung erwarten wir den Botschafter Litauens,
S.E. Darius Semaška, im HDO.
Besonders empfehlen möchte ich Ihnen am 16. Juli
das Zeitzeugengespräch „Charlotte Knobloch privat“,
in dem die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemein
de München und Oberbayern von den vielen Facetten
ihres Lebens erzählen wird: von ihrem Einsatz für das
jüdische Gemeindezentrum ebenso wie von ihren Beob
achtungen zum Umgang der angestammten bayerischen
Bevölkerung mit den Heimatvertriebenen. Bitte melden
Sie sich dazu rechtzeitig an!Außerdem stehen Vorträge und Buchpräsentationen
zu anderen Themen auf dem Programm. Am 4. April
nimmt uns die Soziologin Dr. Corinna Felsch (Uni
Gießen) auf „Reisen in die Vergangenheit? Westdeut-
sche Fahrten nach Polen 1970 – 1990“ mit und spürt
dabei unter anderem den Heimatreisen von Vertriebe
nen nach.
Am 9. Mai liest die 1938 in Reschitz/Reșiţa im Bana
ter Bergland geborene Kristiane Kondrat aus ihrem
ersten und nun endlich wieder neu aufgelegten Roman
„Abstufungen dreier Nuancen von Grau“ und spricht
EDITORIAL
mit dem Verleger Thomas Zehender über dieses Werk.
Den Abend veranstalten wir mit dem Institut für deut
sche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU
München. 7
Am 6. Juni können Sie mit mir tief ins frühe Mittel
alter eintauchen, wenn ich den Beziehungen der Baju
waren zu ihren östlichen Nachbarn folge.
Besonders freue ich mich bereits auf die zwei Kon
zerte in unserem Programm, auf unsere Tagesfahrt
auf den Spuren bayerisch-russischer Beziehungen
im Kloster Seeon sowie auf unsere Studienreise in die
Slowakei und nach Südmähren, die wir gemeinsam mit
der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen anbieten.
Ich würde mich freuen, wenn ich Sie zu möglichst
vielen dieser interessanten Veranstaltungen begrüßen
könnte!
Ihr
Professor Dr. Andreas Otto Weber
Direktor des Hauses des Deutschen Ostens, MünchenVeranstaltungen
Programmreihe: Versailles, Trianon, Brest-
Veranstal- Litowsk: Das lange Ende des Ersten Weltkrieges
und das östliche Europa
https://daslangeendevon1918.de/
→ Infolge des Ersten Weltkrieges, der Russischen Revo
lution und der innenpolitischen Entwicklungen in
den Großreichen Russland, Deutschland und Öster
reich-Ungarn trat der Prozess der Nationalstaatsbil
V E R A N S TA LT U N G E N
dung im östlichen Europa 1918 in seine entscheiden
de Phase. Die territorialen, politischen und völker
rechtlichen Regelungen des Friedensvertrages von
Brest-Litowsk (vom 3. März 1918) sowie der Pariser
Vorortverträge – von Versailles mit Deutschland (vom
tungen 8 28. Juni 1919), von Saint-Germain mit Österreich
(vom 10. September 1919) und von Trianon mit
Ungarn (vom 4. Juni 1920) – setzten entscheidende
Wegmarken bei der Bildung souveräner National
staaten in Polen, Finnland, den baltischen Ländern,
der Ukraine, der Tschechoslowakei und auf dem
Balkan. Die neuen Nationalstaaten blieben Nationali
tätenstaaten. Sie waren einer imperialen Politik nicht
abgeneigt, stellten Territorialforderungen, die weit
über das Bestreben hinausgingen, die neuen natio
nalstaatlichen Grenzen in Übereinstimmung mit den
ethnischen beziehungsweise sprachlich-kulturellen
Grenzen ihrer namensgebenden Nation zu bringen.
Die ost- und südosteuropäischen Gesellschaften
erlebten eine Welle der Nationalisierung, die über
die Intellektuellenmilieus und die Großstädte hinaus
auf weite Bevölkerungsschichten übergriff.
Von der neuen politischen Grenzziehung und
den nationalstaatlichen Entwicklungen waren auch
8,3 Millionen Deutsche betroffen, die nach 1918/1920
ihren Status als Angehörige einer Mehrheitsnation
verloren und nun als „nationale Minderheit“ in
dreizehn europäischen Ländern der Region lebten.
Das Spannungsverhältnis zwischen den National
staatsbildungen und der ethnisch-kulturellen und
politischen Selbstbestimmung der Minderheiten,
zwischen ethnischen Homogenisierungsversuchender Titularnationen und Minderheiten, die auf ihrer
eigenen ethnischen Identität beharrten, prägte die
innenpolitischen Entwicklungen der ost-, ostmittel-
und südosteuropäischen Staaten in der Zwischen
kriegszeit. „Nationalismus“ und „Revisionismus“
setzten sie unter Dauerdruck. Das System von Min
derheitenschutzverträgen zeigte als völkerrechtli
cher Rechtsschutzmechanismus nicht die erwartete
Wirkung.
Die Pariser Vorortverträge bewegten über die
1920er Jahre hinweg die öffentlichen Gemüter im
V E R A N S TA LT U N G E N
Deutschen Reich, im neu gegründeten Staat Öster
reich und in Ungarn. Man sah darin eine Gefahr für
den Fortbestand der eigenen Rumpfstaaten und
Nationen und zog die Zweck- und Rechtmäßigkeit
der neuen Grenzziehungen in Schlesien, in Böhmen
und Mähren und anderorts in Zweifel. Unter der 9
deutschen Bevölkerung dieser Gebiete war die ableh
nende Haltung gegenüber den Pariser Vorortverträ
gen ebenfalls nicht zu übersehen. Diese Stimmungen
wurden zum Nährboden der politischen Revisionis
men der 1920er und 1930er Jahre.
Die Programmreihe „Versailles, Trianon, Brest-
Litowsk: Das lange Ende des Ersten Weltkrieges und
das östliche Europa“, die das Haus des Deutschen
Der Friedensvertrag von Versailles, 28. Juni 1919. UnterschriftenseiteOstens in Kooperation mit dem Institut für deut
sche Kultur und Geschichte Südosteuropas
(IKGS) an der LMU München 2019–2020 veran
staltet, nimmt diese komplexen und vielseitigen
Probleme der Zwischenkriegszeit in Polen, der
Tschechoslowakei, Ungarn und Rumänien in den
Blick. Prominente Historiker aus dem In- und
Ausland setzen sich in Einzelvorträgen und Podi
umsdiskussionen mit der Bedeutung der Frie
densverträge des Ersten Weltkrieges für die
Neuordnung im östlichen Europa, mit dem völ
V E R A N S TA LT U N G E N
kerrechtlichen System des Minderheitenschutzes
sowie mit der politisch folgenreichen Rezeption
der Pariser Vorortsbeschlüsse im Deutschen
Reich und in anderen ehemaligen Großreichen
auseinander.
10 Den Auftakt zu dieser Reihe gibt einer der
führenden Historiker Deutschlands, Professor
Dr. Dr. h.c. mult. Horst Möller, mit dem Vortrag
„‚Versailles‘ und die Neuordnung Europas
1919 – 1920“.
Der Friedensvertrag von Brest-LitowskDiesem Überblick folgt am 28. Mai ein Podiums
gespräch zum Thema „Der Frieden von Brest-
Litowsk und die Nationalstaatsgründungen in
Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg“ mit Pro
fessor Dr. Helmut Altrichter, einem der besten
Kenner der Geschichte des östlichen Europa.
Am 4. Juli widmet sich der renommierte Pra
ger Historiker Professor Dr. Jaroslav Kučera dem
Thema „Ein Dialog der Taubstummen: Die Grün-
dung der Tschechoslowakei und die deutsche
Minderheit“; die Vortragsveranstaltung findet in
V E R A N S TA LT U N G E N
Kooperation mit dem Tschechischem Zentrum
sowie mit dem Generalkonsulat der Tschechischen
Republik und dem Generalkonsulat der Slowaki
schen Republik in München statt.
Am 9. Juli folgt dann die Buchpräsentation
„Der vergessene Weltkrieg. Europas Osten 11
1912 – 1923“ mit einem der führenden Historiker
Polens, Professor Dr. Włodzimierz Borodziej (War
schau), und seinem Co-Autor, Professor Dr. Maciej
Górny (Warschau), zu der wir gemeinsam mit dem
Generalkonsulat der Republik Polen in München
einladen.
In Kooperation mit:D I E N S TA G , 2 1 . M A I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R
Programmreihe
‚Versailles‘ und die Neuordnung
Europas 1919 – 1920
Eröffnungsvortrag
Referent: Professor Dr. Dr. h.c. mult. Horst Möller, München
→ Die Pariser Vorortverträge waren die bislang
letzten Friedensverträge, die den größten Teil Eu
ropas betrafen. Anders als viele vorausgehende,
V E R A N S TA LT U N G E N
multilaterale Friedensverträge hatten sie nicht
das Ziel, die Vorkriegsordnung wiederherzustel
len, sondern bezweckten eine auf dem Nationali
tätsprinzip beruhende neue Staatenordnung, die
auch die Demokratisierung dieser Staaten ge
12 währleisten sollte. Das Ende mehrerer Großrei
che führte zur Neu- oder Wiedergründung von
Staaten und änderte mit den Friedensverträgen
die Machtbalance zwischen den bisherigen Groß
mächten. Die ursprüngliche Zielsetzung wurde
aber nur partiell realisiert; so blieb beispielswei
se der Minderheitenschutz ein europäisches
Problem. Die Mängel dieser Friedensordnung
bewirkten immer wieder bi- oder multilaterale
europäische Krisen. Kein Staat war durch die
Friedensverträge tatsächlich zufrieden gestellt.
Diese Krisenanfälligkeit führte schon bald zur
Prognose neuer Kriege.
Der Vortrag behandelt in längerer histori
scher Perspektive Inhalte, Formen und Probleme
der in den Pariser Vorortverträgen konzipierten
Friedensordnung und ihre Konsequenzen.
Im Anschluss findet ein kleiner Empfang statt.↪ Professor Dr. Dr. h.c. mult. Horst Möller
(geb. 1943 in Breslau) gilt als einer der renommierten
Neuzeithistoriker Deutschlands. 1989 – 1992 war er Direk-
tor des Deutschen Historischen Instituts (DHI) Paris,
1992 – 2011 Direktor des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ)
München-Berlin. Von 1982 – 1989 lehrte Möller als Ordina-
rius für Neuere Geschichte an der Universität Erlangen-
Nürnberg, 1996 – 2011 als Professor für Neuere und
Neueste Geschichte an der LMU München. Er ist Verfasser
von zahlreichen Publikationen zur europäischen Aufklä-
rung, zur Geschichte der Weimarer Republik, zum Europa
V E R A N S TA LT U N G E N
in der Zwischenkriegszeit, zum Nationalsozialismus und
zur Nachkriegszeit. 2015 erschien von ihm eine Biographie
von Franz Josef Strauß. Horst Möller ist führendes Mitglied
zahlreicher wissenschaftlicher Kommissionen, 1997 – 2014
war er deutscher Co-Vorsitzender der Gemeinsamen
deutsch-russischen Kommission für die Erforschung der 13
jüngeren Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen.D I E N S TA G , 2 8 . M A I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R
Programmreihe
Der Frieden von Brest-Litowsk und die
Nationalstaatsgründungen in Osteuropa
nach dem Ersten Weltkrieg
Podiumsdiskussion
Teilnehmer: Professor Dr. Helmut Altrichter, Erlangen-Nürnberg,
Dr. des. Lilia Antipow, Haus des Deutschen Ostens, München
→ Die Vertreter Sowjetrusslands sowie Deutsch
V E R A N S TA LT U N G E N
lands (und seiner Verbündeten), die sich seit
Anfang Dezember 1918 am Verhandlungstisch in
Brest-Litowsk gegenüber saßen, hätten kaum
unterschiedlicher sein können: Aristokraten und
Generäle auf der einen, bekennende Revolutionä
14 re und ehemalige Terroristen auf der anderen
Seite. Ein Kernproblem war von Anfang an das
Selbstbestimmungsrecht der Völker. Selbst wenn
sich beide Seiten dazu bekannten, verfolgten sie
damit doch ganz unterschiedliche Ziele. Die
Bolschewiki hatten das Selbstbestimmungsrecht
nach der Oktoberrevolution propagiert, um da
mit für die eigene Sache zu werben (ohne die
Absicht, sich bedingungslos daran zu halten); die
Vertreter aus Berlin strebten die Bildung eines
Gürtels „deutschfreundlicher“ Staaten in Osteu
ropa an, der den deutschen Einfluss in der Regi
on (und darüber hinaus) sichern sollte. Auch
wenn sich beider Hoffnungen nicht erfüllten: mit
dem ausgehandelten Friedensvertrag verzichte
ten die Bolschewiki auf die ehedem zum Russi
schen Reich gehörenden finnischen, baltischen,
polnischen und ukrainischen Gebiete – ein erster
Schritt zur staatlichen Neuordnung Ostmittel-
und Südosteuropas 1918 – 1919.↪ Professor Dr. Helmut Altrichter (geb. 1945 in
Alt-Moletein, Mähren/heute Tschechien) war 1985–1990
Professor für Neuere und Osteuropäische Geschichte an
der Universität Augsburg und 1990 – 2012 Inhaber des
Lehrstuhls für Osteuropäische Geschichte an der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg. Als Vorsitzender leitete er den
wissenschaftlichen Beirat des Instituts für Zeitgeschichte
(München-Berlin), des Geisteswissenschaftlichen Zent-
rums für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (Leipzig),
des Herder-Instituts (Marburg) sowie des Deutschen
Historischen Instituts (Moskau). Von Helmut Altrichter
V E R A N S TA LT U N G E N
liegen u.a. vor: Die Bauern von Tver. Vom Leben auf dem
russischen Dorfe zwischen Revolution und Kollektivierung
(1984); Kleine Geschichte der Sowjetunion 1917 – 1991
(1993/2013); Rußland 1917. Ein Land auf der Suche
nach sich selbst (1997/2017); Geschichte Europas im
20. Jahrhundert (zusammen mit Walther L. Bernecker, 15
2004); Rußland 1989. Der Untergang des sowjetischen
Imperiums (2009); Stalin. Der Herr des Terrors. Eine
Biografie (2018).D O N N E R S TA G , 4 . J U L I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R
Programmreihe
Ein Dialog der Taubstummen: Die Gründung
der Tschechoslowakei und die deutsche
Minderheit, Vortrag
Referent: Professor Dr. Jaroslav Kučera, Karls-Universität Prag
→ Mit dem Zerfall des Habsburgerreiches am Ende
des Ersten Weltkriegs entstanden in Mittelosteu
ropa mehrere neue Staaten. Eine der ersten
V E R A N S TA LT U N G E N
Staatsgründungen war die der Tschechoslowakei.
Bereits am 28. Oktober 1918 wurde in Prag der
Tschechoslowakische Staat ausgerufen. Im No
vember wurde Tomáš Garrigue Masaryk dessen
erster Präsident. Tschechen und Slowaken bilde
16 ten mit rund 65% der Bevölkerung die Mehrheit
im neuen Staat. Daneben lebten in der Ersten
Tschechoslowakischen Republik auch rund drei
Millionen Deutsche (mit einem Bevölkerungsan
teil von rund 23%).
Wie kam es zur Entstehung der Tschechoslo
wakei, welche Rolle spielten ihre Vertreter bei
den Friedensverhandlungen nach dem Ersten
Weltkrieg? Welche Auswirkungen hatte die
Staatsgründung auf das deutsch-tschechische
Verhältnis und besonders auf das Verhältnis
deutschsprachiger und tschechischsprachiger
Bürger im neuen Staat? Inwieweit war die deut
sche Minderheit am Aufbau des neues Staates
beteiligt und welche Minderheitenrechte galten?
Diese und weitere Fragen werden im Vortrag
erörtert.
Bild rechte Seite: Manifestation am St.-Wenzels-Denkmal in
Prag anlässlich der Proklamation der Tschechoslowakischen
Republik am 28. Oktober 1918↪ Professor Dr. Jaroslav Kučera
(geb. 1955 in Prag) ist Professor für Zeitgeschichte an der
Karls-Universität in Prag. 2000 – 2001 war er Mercator-
Gastprofessor der DFG an der Humboldt-Universität zu
Berlin. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die
Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit und die
deutsch-tschechischen Beziehungen. Von Jaroslav Kučera
liegen vor: Minderheit im Nationalstaat. Die Sprachenfrage
in den tschechisch-deutschen Beziehungen 1918 –1938
(1999); „Der Hai wird nie wieder so stark sein“. Tschecho-
V E R A N S TA LT U N G E N
slowakische Deutschenlandpolitik 1945 – 1948 (2001);
Von der „Rüstkammer des Reiches“ zum „Maschinenwerk
des Sozialismus“. Wirtschaftslenkung in Böhmen und
Mähren 1938 bis 1953 (zus. mit J. Balcar, 2013).
17
In Kooperation mit:D I E N S TA G , 9 . J U L I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R
Programmreihe
Der vergessene Weltkrieg. Europas Osten
1912 – 1923, Buchpräsentation
Grußwort: Carolina Trautner, Staatssekretärin im Bayerischen
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
Referenten: Professor Dr. Włodzimierz Borodziej, Historisches
Institut der Universität Warschau, Professor Dr. Maciej Górny,
Deutsches Historisches Institut (DHI) Warschau
V E R A N S TA LT U N G E N
→ Die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg ist noch
immer geprägt vom Stellungskrieg und den
Materialschlachten an der Westfront. Die Ereig
nisse und Tragödien im östlichen Europa treten
dahinter oft zurück. Die Autoren Włodzimierz
Borodziej und Maciej Gorny versuchen nun,
18
diesen „vergessenen Weltkrieg“ im europäischen
Osten ins Bewusstsein zu rücken. Schon ihr
zeitlicher Ansatz ist dabei ein anderer als bei
bisherigen Publikationen zum Ersten Weltkrieg.
Der erste Band betrachtet die Zeit von 1912 bis
1916 unter dem Titel „Imperien“ und beginnt mit
dem ersten Balkankrieg 1912. Der zweite Band
reicht unter dem Titel „Nationen“ von 1917 bis
1923 und geht damit über die Pariser Friedens
verhandlungen hinaus.
„Borodziej und Górny erzählen detailreich,
sie beleuchten die Rolle der Eisenbahn ebenso
genau wie die machtpolitische Bedeutung vonUhrzeit und Kalender […]. ‚Der vergessene Krieg‘
hat wissenschaftlichen Anspruch und richtet sich
zugleich an ein breiteres Publikum.“ (Deutsch
landfunk Kultur)
↪ Professor Dr. Włodzimierz Borodziej (geb. 1956),
Professor am Historischen Institut der Universität Warschau,
ist einer der bedeutenden Zeithistoriker Polens.
1999 – 2002 war er Prorektor der Universität Warschau,
2010 – 2016 einer der beiden Leiter des Imre Kertész Kolleg
an der Universität Jena, 1998 – 2011 Mitherausgeber der
V E R A N S TA LT U N G E N
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. Włodzimierz
Borodziej hat zahlreiche Veröffentlichungen zur polnischen
Geschichte und zu deutsch-polnischen Themen vorgelegt,
darunter: Der Warschauer Aufstand 1944 (2001);
Geschichte Polens im 20. Jahrhundert (2010).
19
↪ Professor Dr. Maciej Górny (geb. 1976) ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut
Warschau und Professor am Historischen Institut der
Polnischen Akademie der Wissenschaften. Von Maciej
Górny liegen u.a. vor: Die Wahrheit ist auf unserer Seite.
Nation, Marxismus und Geschichte im Ostblock (2011);
Deutsch-polnische Erinnerungsorte (Bd. 3 und 4,
2011 – 2013); Science embattled – Eastern European
Intellectuals and the Great War (2018).
In Kooperation mit:3. APRIL BIS 14. JUNI 2019
Ausstellung
Wolfgang Niesner: Stadt – Land – Mensch
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (werktags) 10.00 bis 20.00 Uhr
→ „Wolfgang Niesner stellte sich in seinem umfang
reichen Werk […] lebenslang dem Zwiegespräch
mit der Natur, mit dem real Sichtbaren. Er war
ein Zeichner höchsten Grades, gleich ob er aufs
Papier oder in die Druckplatte zeichnete. Land
V E R A N S TA LT U N G E N
schaften, Stadtlandschaften, immer auch mit
dem Blick auf den Menschen, der gleichfalls ein
Schwerpunkt seines Schaffens war. In zahlrei
chen Selbstbildnissen hat er sein Ich erfasst.
Seine Kunst war auch seine Waffe, mit der er sich
gegen die für ihn bedrohliche Unkultur in der
20
Architektur der Trabantenstädte wehrte.“ (Curt
Visel)
Wolfgang Niesner (geb. 1925 in Freudenthal/
Mährisch-Schlesien, heute Tschechien; gest.
1994 in München) war als Zeichner und Grafiker
ein genauer und prüfender Beobachter seiner
Umgebung. Die Ausstellung „Stadt – Land –
Mensch“ gibt einen umfassenden Einblick in sein
vielfältiges Schaffen. Einen Schwerpunkt bilden
seine kritischen Darstellungen der Münchner
Trabantenstadt Neuperlach, wo er seit 1971 lebte
und wo sich sein Atelier mit der Druckwerkstatt
befand. Mit Stift und Pinsel verfolgte Niesner die
Entwicklung dieses Stadtteils: „Die haben schnel
ler gebaut, als ich zeichnen konnte.“ Dabei setzte
er sich nicht nur mit Architekturgebilden ausein
ander, sondern wurde dadurch auch zu weiteren
Reflexionen über die Gegenwart angestoßen.
Weitere Themen der Ausstellung sind: Nies
ners Reisen nach Irland, Kanada, Sylt, Cornwall
und Paris, seine satirischen und grotesken Sche
renschnitte sowie seine Selbstbildnisse.
→ Kuratorin der Ausstellung ist
Friederike Niesner.D I E N S TA G , 2 . A P R I L 2 0 1 9 , 1 8 . 0 0 U H R
Eröffnungsveranstaltung
→ Zur Ausstellungseröffnung spricht Friederike
Niesner (München), Ehefrau und Nachlassver
walterin des Malers.
D I E N S TA G , 7 . M A I 2 0 1 9 , 1 8 . 0 0 U H R
Begleitprogramm
Kuratorenführung mit Friederike Niesner
V E R A N S TA LT U N G E N
→ Anmeldung telefonisch unter 089/44 99 93-0
oder per E-Mail unter poststelle@hdo.bayern.de
erforderlich
21
Wolfgang Niesner, Planung, 197826. JUNI BIS 16. AUGUST 2019
Ausstellung
„Wolfskinder“ – Auf dem Brotweg von
Ostpreußen nach Litauen 1945 – 1948
Ausstellung des Litauischen Zentrums für die Erforschung von
Genozid und Widerstand
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (werktags)
10.00 bis 20.00 Uhr, im August 10.00 bis 18.00 Uhr
→ „Wolfskinder“ – so nannte man ostpreußische
V E R A N S TA LT U N G E N
Kinder, die in den letzten Kriegstagen des Zwei
ten Weltkriegs elternlos wurden und auf sich
allein gestellt waren. Viele von ihnen flüchteten
ins benachbarte Litauen, wo sie bei Bauern un
terkamen. Zu ihrem eigenen Schutz mussten sie
oft litauische Vor- und Nachnamen annehmen
22
und ihre deutsche Muttersprache verheimlichen.
Einige der früheren „Wolfskinder“ leben noch
heute in Litauen und sind dort heimisch gewor
den. Andere fanden – vor allem nach der Wende
in den 1990er Jahren – ihre verlorene Familie
wieder und kamen als Spätaussiedler nach
Deutschland.
Die Ausstellung zeigt die Geschichte der
„Wolfskinder“ anhand von Berichten ehemaliger
Betroffener, Familienfotos, Dokumenten und Kar
ten. Auf mehreren Bildschirmen sind zudem
zwölf Interviews mit ehemaligen „Wolfskindern“
zu sehen. Die Ausstellung ist zweisprachig,
deutsch und litauisch.
Dokumente für die Ausstellung stellten das
Museum für die Opfer des Genozids beim Zent
rum für Erforschung von Genozid und Wider
stand der litauischen Bevölkerung (Vilnius), das
Hugo-Scheu-Museum (Šilutė), das Litauische
Zentrale Staatsarchiv (Vilnius), das Litauische
Sonderarchiv (Vilnius), das Bundesarchiv (Berlin),
die Landsmannschaft Ostpreußen e. V. (Hamburg),
das Bildarchiv Ostpreußen (Hamburg) sowie Fa
milien ehemaliger „Wolfskinder“ zur Verfügung.
Die Ausstellung wurde mit Unterstützung der
Botschaft der Republik Litauen in der Bundesrepublik Deutschland, des Vereins „Edelweiß –
Wolfskinder“ (Litauen) sowie der Organisation
„Kriegskinder“ (Gransee) realisiert. Sie wird u.a.
aus Mitteln der Regierung der Republik Litauen
gefördert.
D I E N S TA G , 2 5 . J U N I 2 0 1 9 , 1 8 . 0 0 U H R
Eröffnungsveranstaltung
→ Grußwort: S.E. Darius Jonas Semaška, Botschafter der
Republik Litauen in der Bundesrepublik Deutschland
V E R A N S TA LT U N G E N
23
Kinder deutscher Vertriebener
In Kooperation mit:
Litauisches Zentrum
für die Erforschung von
Genozid und WiderstandD O N N E R S TA G , 4 . A P R I L 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R
Vortrag
Reisen in die Vergangenheit? Westdeutsche
Fahrten nach Polen 1970 – 1990
Referentin: Dr. Corinna Felsch, Justus-Liebig-Universität Gießen
→ In den vergangenen siebzig Jahren fanden zahl
lose Heimatreisen von Vertriebenen und ihren
Angehörigen aus der Bundesrepublik Deutsch
land in die ehemaligen deutschen Ostgebiete
V E R A N S TA LT U N G E N
statt. Diese Reisen, die in mittlerweile polnische
Gebiete gingen, nahmen mit dem Abschluss des
sogenannten Warschauer Vertrags im Dezember
1970 und der nachfolgenden Aufnahme diploma
tischer Beziehungen zwischen beiden Ländern
enorm zu. Sie waren in den 1970er und 1980er
24
Jahren Fahrten in ein sozialistisches Nachbar
land und zugleich – häufig in erster Linie – Rei
sen in die Vergangenheit.
Im Vortrag wird auf der Grundlage vieler
privater Reiseberichte der Frage nachgegangen,
welche Bilder der Vergangenheit die Reisenden,
als sie sich auf den Weg machten, mitbrachten
und mit welchen Geschichtsbildern sie in Polen
konfrontiert wurden. Welche Bedeutung hatten
Deutsche Reisende in Polen, 70er Jahrediese Geschichtsbilder während des Aufenthalts
in Polen und inwieweit kam es zwischen den
Heimatreisenden und der polnischen Bevölke
rung zu einem Austausch über die Vergangen
heit?
V E R A N S TA LT U N G E N
25
↪ Dr. Corinna Felsch
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Koordinatorin des
Integrierten Graduiertenkollegs im Sonderforschungsbe-
reich „Dynamiken der Sicherheit“ an der Universität Gie-
ßen/Universität Marburg. 2008 – 2009 war sie Mitarbeiterin
der Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung
der Geschichte des Auswärtigen Amts in der Zeit des
Nationalsozialismus und in der frühen Bundesrepublik.
2013 promovierte Corinna Felsch an der Universität Mar-
burg mit einer Arbeit über „Reisen in die Vergangenheit?
Bedeutung und Veränderung von Geschichtswahrnehmun-
gen bei Reisen nach Polen (1970 – 1990)“.D O N N E R S TA G , 6 . J U N I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R
Vortrag
Das Rätsel der Turmschädel:
Die Bajuwaren und der Osten
Referent: Professor Dr. Andreas Otto Weber,
Direktor des Hauses des Deutschen Ostens, München
→ Seit Jahrhunderten wird über die Herkunft der
Bajuwaren gerätselt. Um 680 setzte der Mönch
Jonas aus dem italienischen Kloster Bobbio die
V E R A N S TA LT U N G E N
Baiern mit den keltischen Bojern gleich, für
einen rheinischen Mönch um 1080 waren sie
Einwanderer aus Armenien, eine Deutung, die
bis in das 19. Jahrhundert in verschiedenen
Varianten weitergesponnen wurde. Auch eine
Herkunft aus Böhmen wurde immer wieder
26
diskutiert, besonders seitdem man in Friedenhain
bei Straubing und in Přešťovice/Prestowitz in
Böhmen eine spezifische Keramik entdeckte und
als Beleg einer Einwanderungsbewegung von Ost
nach West interpretierte. Inzwischen wird diese
Theorie in der Wissenschaft nicht mehr geteilt.
Dennoch finden sich im archäologischen Fundgut
zahlreiche Hinweise auf enge Kontakte der frühen
Baiern in verschiedene Regionen weit östlich ihres
Siedlungsgebietes und ihres im 6. Jahrhundert
entstandenen Herzogtums.
Schädel einer OstgotinV E R A N S TA LT U N G E N
27
Andreas Otto Weber
Der Brauch, die Schädel junger Mädchen zu
bandagieren und dadurch zu Turmschädeln
wachsen zu lassen, war bei den Hunnen und
später bei den im Balkan siedelnden Ostgoten
verbreitet, findet sich aber auch in zahlreichen
frühmittelalterlichen Gräbern in Bayern. Auch
die frühe Politik der bairischen Herzöge hat viele
Bezüge in östliche Nachbarregionen, war das
Herzogtum doch der östlichste Teil des Franken
reiches.
Der Vortrag skizziert die aktuellen archäolo
gischen und sprachgeschichtlichen Befunde und
geht den Kontakten und Konflikten der Baiern
mit Slawen, Awaren und Böhmen im frühen
Mittelalter bis zur Eroberung des Awarenreiches
durch Karl den Großen nach.D I E N S TA G , 1 6 . J U L I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R
Zeitzeugengespräch
Charlotte Knobloch privat
Teilnehmer: Dr. h.c. Charlotte Knobloch, Präsidentin der
Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern;
Christian Knauer, Landesvorsitzender des BdV Bayern;
Professor Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des Hauses des
Deutschen Ostens, München
→ Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde
V E R A N S TA LT U N G E N
München und Oberbayern und Ehrenbürgerin der
Stadt München, Dr. h.c. Charlotte Knobloch, zählt
zu den bekanntesten Persönlichkeiten Deutsch
lands. Als Kind von einer Katholikin in einem
fränkischen Dorf versteckt, entkam sie der Verfol
gung der Juden durch die Nationalsozialisten und
28
konnte 1945 mit ihrem Vater, der die Shoah als
Zwangsarbeiter überlebt hatte, nach München
zurückkehren. Als junger Mensch erlebte sie den
Wiederaufbau ihrer zerstörten Heimatstadt, den
Wiederbeginn jüdischen Gemeindelebens und
auch die Aufnahme von Flüchtlingen und Heimat
vertriebenen. 1985 wurde sie Präsidentin der
Israelitischen Kultusgemeinde München und
Oberbayern, später war sie außerdem Vizepräsi
dentin des Jüdischen Weltkongresses und Präsi
dentin des Zentralrats der Juden in Deutschland.
2010 erhielt sie die höchste zivile Auszeichnung
der Bundesrepublik Deutschland, das Große Ver
dienstkreuz mit Stern.
Im Gespräch mit dem Landesvorsitzenden
des BdV, Christian Knauer, und dem Direktor des
HDO, Professor Dr. Andreas Otto Weber, erzählt
sie von den vielen Facetten ihres Lebens, vom
Einsatz für das jüdische Gemeindezentrum eben
so wie von ihren Beobachtungen zum Umgang
der angestammten bayerischen Bevölkerung mit
den Heimatvertriebenen.V E R A N S TA LT U N G E N
29
→ Begrenzte Teilnehmerzahl
→ Anmeldung telefonisch unter 089/44 99 93-0
oder per E-Mail unter poststelle@hdo.bayern.de
erforderlich
In Kooperation mit:M O N TA G , 2 9 . A P R I L 2 0 1 9 , 0 8 . 3 0 – 1 8 . 0 0 U H R
Tagesexkursion
Napoleons Enkel, bayerische Herzöge
und Cousins des Zaren: Bayerisch-russische
Verbindungen im Kloster Seeon,
19. – 20. Jahrhundert
Leitung: Professor Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des Hauses
des Deutschen Ostens, München
Anmeldungsschluss: 15. April 2019
V E R A N S TA LT U N G E N
Eine Veranstaltung auf Initiative des Vereins der Förderer des
Hauses des Deutschen Ostens e.V., München
→ Im ehemaligen Benediktinerkloster Seeon im
oberbayerischen Landkreis Traunstein laufen
Hauptstränge der Geschichte des deutsch-russi
30 schen Adels zusammen. 994 von Benediktinern
gegründet, wurde Kloster Seeon 1803 säkula
risiert. 1852 ging die Anlage in den Besitz der
Amélie von Leuchtenberg über, einer Tochter von
Napoleons Adoptivsohn Eugène de Beauharnais
und Prinzessin Auguste von Bayern, Tochter des
bayerischen Königs Max I. 1873 begann die
„russische Geschichte“ des ehemaligen Benedik
tinerklosters: 1873 wurde es von Herzog Niko
laus von Leuchtenberg (1843 – 1891) käuflich
erworben. Bis 1934 blieb der Großteil der Anlage
im Familienbesitz.
Die russische Linie des Hauses Leuchtenberg
wurde 1839 durch die Heirat von Herzog Maxi
milian von Leuchtenberg (1817 – 1852) mit der
Großfürstin Maria Romanowa (1819 – 1876), einer
Tochter des russischen Zaren Nikolaus I., be
gründet. Die „russischen Leuchtenbergs“ galten
als eines der einflussreichsten und vermögends
ten Adelsgeschlechter des Zarenreiches. Sie
gehörten zum Kreis der Zarenfamilie: Maximili
ans Sohn, Nikolaus von Leuchtenberg, war als
Cousin des Zaren Alexander III. einer seiner
engsten Freunde. Die Leuchtenbergs profilierten
sich im Armeedienst, in den Geschichts- und
Naturwissenschaften.Unter Nikolaus von Leuchtenberg und seinen
Söhnen Nikolaus und Georg wurde Seeon zu
einer der vielen Residenzen der hochadeligen
Familie, die hier auf großem Fuß lebte, Bälle und
andere Festivitäten veranstaltete, zu denen die
Prominenz aus aller Herren Länder zusammen
kam. In den 1920er Jahren war das ehemalige
Kloster nicht nur Familiensitz, sondern auch eine
Begegnungsstätte der russischen Emigranten
monarchistischer Provenienz. Die „russische
Geschichte“ von Seeon endete 1953 mit dem
V E R A N S TA LT U N G E N
Tod von Georgs Gattin, Herzogin Olga.
→ Teilnehmerbeitrag: 30 Euro pro Person
→ Bitte überweisen Sie den Teilnehmerbeitrag
an Fa. Rapp Busreisen:
31
IBAN DE 7872 0691 1901 0048 9905;
BIC GENODEF1ICH
→ Abfahrtszeit: 08.30 Uhr
Abfahrtsort: München, Zentraler Omnibusbahn-
hof an der Hackerbrücke (zu erreichen mit allen
S-Bahnen und Tram 16/17)
→ Anmeldung per Post unter: Rapp Busreisen,
Maienweg 26, 89358 Kammeltal-Ettenbeuren
Per Fax unter: 08223 - 905 11
Per E-Mail unter: info@rapp-busreisen.de
Georg und Nikolaus von Leuchtenberg (4. und 5. v.l.) und
Zar Nikolaus II. (3. v.r.)26. JUNI BIS 30. JUNI 2019
Studienreise
Wein und Krönungen, Naturschönheiten
und Barock – Eine Reise nach Pressburg
und Südmähren
Leitung: Professor Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des Hauses
des Deutschen Ostens, München; Dr. Zuzana Finger, Heimatpfle-
gerin der Sudetendeutschen, München
→ Znaim/Znojmo in Südmähren ist nicht nur für
V E R A N S TA LT U N G E N
die Znaimer Gurke berühmt. Die Stadt liegt auch
inmitten eines bekannten Weingebiets. Bei einer
Weinprobe lernen die Reiseteilnehmer diese
Kulturlandschaft geschmacklich kennen und
werden in die Geschichte des regionalen Wein
32 baus eingeführt. Anschließend besuchen sie die
Südmährische Galerie (Retz), deren Sammlung
das künstlerische Kulturerbe Südmährens
beherbergt. Auf ihren Ausstellungsflächen sind
bedeutende Künstler vertreten, die hier geboren
wurden oder ihre Wirkungsstätte hatten.
Eine beeindruckende Natur bietet sich den
Reiseteilnehmern im Nationalpark Thayatal im
Grenzgebiet zwischen Tschechien und Öster
reich. Geprägt ist diese Landschaft durch die
Thaya, einen Nebenfluss der March.
Seit 1996 gehört das Kulturareal um das
barocke Valtice und das neugotische Lednice
(Feldsberg und Eisgrub) nicht nur zum
UNESCO-Weltkulturerbe, sondern auch zu den
beliebtesten touristischen Attraktionen Südmäh
rens. Ein Tag der Reise ist dem Besuch der bei
den Park- und Schlossanlagen gewidmet.
Zum Abschluss der Reise geht es nach Press
burg/Bratislava. Jedes Jahr am letzten Juniwochen
ende steht die Hauptstadt der Slowakei ganz im
Zeichen der sogenannten Krönungsfeierlichkei
ten. Das Historienspektakel findet in Pressburg
zum Gedenken an die dortigen 18 Krönungen von
ungarischen Königen und insbesondere an die
Krönung von Maria Theresia 1741 statt.→ Reisepreis: ca. 460 Euro pro Person (inkl.
4 Übernachtungen mit Halbpension im DZ)
→ Ein ausführliches Reiseprogramm sowie weitere
Informationen zur Anmeldung können Sie
telefonisch unter 089 / 44 99 93 - 0 oder per
E-Mail an poststelle@hdo.bayern.de anfordern.
V E R A N S TA LT U N G E N
33
Schloss Lednice
Burg Bratislava
In Kooperation mit: Rapp Busreisen (Kammeltal-Ettenbeuren)
undM O N TA G , 2 2 . J U L I 2 0 1 9 , 0 9 . 4 5 – 1 5 . 3 0 U H R
Tagesexkursion
Erinnerungsort Badehaus Waldram
Leitung: Professor Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des Hauses
des Deutschen Ostens, München
Eine Veranstaltung auf Initiative des Vereins der Förderer des
Hauses des Deutschen Ostens e.V., München
→ Das ehemalige Badehaus im Wolfratshauser
Stadtteil Waldram vereinigt mehrere Erinne
V E R A N S TA LT U N G E N
rungsorte in einem Gebäude. Ab 1940 errichteten
die Nationalsozialisten im Wolfratshauser Forst
eine Mustersiedlung für Rüstungsarbeiter. Gegen
Ende des Zweiten Weltkrieges führte dort einer
der Todesmärsche aus den NS-Konzentrations
lagern vorbei. Nach 1945 wurde der damals noch
34
Föhrenwald genannte Ort zu einem Aufnahme
lager für jüdische Displaced Persons (DPs). Ab
1956 folgten ihnen als Siedler die meist katholi
schen Heimatvertriebenen, die unter anderem
aus dem Sudetenland und aus Schlesien kamen.
Der Ortsteil heißt seitdem Waldram.
Diese vielseitige Geschichte des Ortes behan
delt die Dauerausstellung im Badehaus Waldram.
Nach einer exklusiven Führung durch die Aus
stellung wird die Tagesfahrt durch einen thema
tischen Rundgang durch Waldram abgerundet.
→ Teilnehmerbeitrag: 20 Euro pro Person
(inkl. Mittagessen), zahlbar bar am Tag
der Veranstaltung
→ Eigene Anreise nach Wolfratshausen-Waldram,
die z.B. mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich
ist:
08.33 Uhr ab München Hbf, S7 Richtung
Wolfratshausen
09.14 Uhr Ankunft in Wolfratshausen
09.21 Uhr Weiterfahrt mit Bus 370 Richtung
Stein, Geretsried bis Haltestelle Waldram,
von dort etwa 350m zu Fuß→ Treffpunkt: 09.45 Uhr, Badehaus Waldram,
Kolpingplatz 1, 82515 Wolfratshausen
→ Anmeldung telefonisch unter 089/449993-0 oder
per E-Mail an poststelle@hdo.bayern.de
erforderlich bis 17. Juli 2019
V E R A N S TA LT U N G E N
35
Denkmal in Föhrenwald/Wolfratshausen-Waldram (1998),
Künstler: Ernst GrünwaldD O N N E R S TA G , 9 . M A I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R
Lesung
„Abstufungen dreier Nuancen von Grau“
(2019)
Referentin: Kristiane Kondrat (Augsburg)
Moderation: Thomas Zehender,
Verlagsinhaber danube books (Ulm)
→ Eine junge Frau befindet sich auf der Flucht, fühlt
sich verfolgt und in die Enge getrieben. Überall
V E R A N S TA LT U N G E N
stößt sie auf Menschen, die sie als Bedrohung
wahrnimmt. Allmählich bekommt sie jedoch ihre
Angst in den Griff, schließlich befreit sie sich
davon. Diese Geschichte einer Traumatisierung
und ihrer Überwindung erzählt die Autorin vor
dem Hintergrund ihrer Lebenserfahrung während
36
der kommunistischen Diktatur in Rumänien.
Der Roman gehört zur sogenannten „Schub
ladenliteratur“, die in Ceauşescus Staat nicht
erscheinen durfte. Das Manuskript kam auf
Umwegen nach Deutschland und wurde hier
1977 zum ersten Mal veröffentlicht. Im März 2019
wird „Abstufungen dreier Nuancen von Grau“ vom
Verlag danube books neu herausgegeben.V E R A N S TA LT U N G E N
37
↪ Kristiane Kondrat (eigentlich Aloisia Bohn, geb. 1938 in
Reschitz/Reșița, Banat, Rumänien) studierte Germanistik
und Rumänistik in Temeswar/Timișoara (Rumänien). An-
schließend arbeitete sie als Deutschlehrerin und Redakteu-
rin. Seit 1973 lebt die Autorin in Deutschland. Hier war sie
u.a. für die Süddeutsche Zeitung und andere Medien frei
beruflich tätig und legte einige Erzähl- und Lyrikbände vor.
„Die Zeit- und Haltlosigkeit, von der dieser
Roman sich nährt und die er vermittelt, aber
auch die sich selbst nicht in den Mittelpunkt
stellende, poetische Stilistik des Textes machen
ihn zu einem zeitlosen Roman.“ (Christina Rossi)
In Kooperation mit:D O N N E R S TA G , 1 1 . A P R I L 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R
Konzert
Opernwettbewerb „Gabriela Beňačková“
mit jungen Talenten
→ Der internationale Gesangswettbewerb „Gabriela
Beňačková“, benannt nach der legendären tsche
chischen Sopranistin, ist ein Prestigeereignis,
das in München Tradition hat. In der ersten
Runde des Wettbewerbs präsentieren junge
V E R A N S TA LT U N G E N
Teilnehmer ihr Können und interpretieren
Opernarien von Weltrang.
Die preisgekrönte Sopranistin Gabriela
Beňačková ist eine der international bekanntes
ten Opernsängerinnen, regelmäßig zu Gast in
den großen Opernhäusern der Welt, so etwa im
38
Royal Opera House in Covent Garden London, in
der Usher Hall in Edinburgh oder in der Metro
politan Opera in New York. Sie ist nicht nur
Namensgeberin des Wettbewerbs, sondern auch
Präsidentin und Vorsitzende der Jury. Diese
wählt in der ersten Runde die 30 besten Sänger
aus, die nun im Oktober in Jihlava/Iglau im Semi
finale und in der finalen Runde antreten dürfen.
Für diesen Wettbewerb, der zu den größten
zeitgenössischen Opernwettbewerben der Welt
zählt, bewerben sich jährlich hunderte junge
Sängerinnen und Sänger aus allen Ländern.
Die erste Runde mit Klavierbegleitung findet in
Metropolen wie Wien, Budapest, München, War
schau, Moskau, Budapest, Ljubljana, Gotha oder
Prag statt. Das Konzert am 11. April gehört zu
dieser ersten Runde des Wettbewerbs.
→ Anmeldung telefonisch unter 089/44 99 93-0
oder per E-Mail unter poststelle@hdo.bayern.de
erforderlichIn Kooperation mit:
D O N N E R S TA G , 1 8 . J U L I 2 0 1 9 , 1 9 . 0 0 U H R
Buchpräsentation und Konzert
„Verwobene Kulturen im Baltikum –
Zwei Musikgeschichten in Lettland von
1700 bis 1945“ (2018)
Referentin: Dr. Kristina Wuss
Künstler: Annette Lubosch (Mezzosopran); Olaf Haye (Bariton und
Sprecher); Sandro Schmalzl (Tenor); Roland Albrecht (Bassbari-
ton); Peter Clemente (Violine); Elena Arnovskaya (Klavier);
V E R A N S TA LT U N G E N
Lettischer Chor „Laima“ (Leitung: Linards Kalniņš).
Veranstaltungsort: Johannissaal, Schloss Nymphenburg 1,
80638 München
→ Was haben der Beethoven-Freund Carl Amenda,
der Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz, die
40
Pianistin Clara Schumann und der Dirigent Bru
no Walter mit Lettland zu tun? Dieser Frage geht
die Studie „Verwobene Kulturen im Baltikum“
(2018) von Kristina Wuss nach. Mit erzähleri
scher Eleganz und einem Gespür für die kultur
historischen Besonderheiten der jeweiligen
Epoche beschreibt sie, wie die Leistungen deut
scher Kultur, insbesondere der Musik, auf die
eigenständige Kraft des lettischen Dainas-
Schatzes trafen und aus dieser Begegnung des
Ungleichzeitigen, des Archaischen und Moder
nen, neue Formen der lettischen Musiktradition
entstanden. Die lettischen Dainas – kurze Lieder
und Volksgedichte, die von älteren Sprachschich
ten des Lettischen und der Mythologie der Letten
geprägt sind, bilden einen wichtigen Bezugs
punkt ihrer nationalen Identität und gehören
heute zum Weltkulturerbe. Im 18. Jahrhundert
machten sich Johann Gottfried Herder und
deutsche Pastoren in Livland um die Sammlung
der Dainas verdient.
Die Buchpräsentation wird durch Konzertein
lagen mit Werken von Richard Wagner, Richard
Strauss und Münchner Komponisten der Gegen
wart sowie durch die inzwischen zur Klassik
gewordenen lettischen Chorlieder erweitert.V E R A N S TA LT U N G E N
41
↪ Dr. Kristina Wuss ist eine deutsch-lettische Regisseu-
rin des Opern- und Musiktheaters. Ihre Regiearbeiten
führten sie u.a. nach Berlin, Hong Kong und Seoul, Moskau
und München. In Lettland inszenierte sie an der Lettischen
Nationaloper und am Neuen Theater Riga.
↪ Annette Lubosch (Mezzosopranistin und Schauspiele-
rin) wurde nach ihrem Studium in Wien und München an
den Bregenzer Festspielen, den Tiroler Festspielen Erl, den
Bad Hersfelder Festspielen, am Bayerischen Staatsschau-
spiel sowie an der Philharmonie Berlin und an der Philhar-
monie München engagiert.
↪ Sandro Schmalzl (Tenor) war nach seinem Studienab-
schluss 2012 u.a. als Tenorsolist in der mehrfach ausge-
zeichneten Inszenierung „Die Räuber“ von Ulrich Rasche
am Bayerischen Staatsschauspiel sowie in zahlreichen
Konzerten und Oratorien zu erleben.↪ Olaf Haye (Bariton) war nach seinem Studium in Ham-
burg an der Volksoper Wien, der Oper Köln, der Komischen
Oper Berlin, im La Monnaie Brüssel und an der Oper Leipzig
engagiert. Seit vielen Jahren gehört er zum festen Ensem
ble der Theater Kiel und Dortmund sowie der Wuppertaler
Bühnen. Olaf Haye ist Preisträger des Richard-Strauss-
Wettbewerbs (München).
↪ Roland Albrecht (Bassbariton) wurde nach Gesangs-
ausbildung in München und Prag für Opernproduktionen
in München und Memmingen sowie an Opernhäusern in
V E R A N S TA LT U N G E N
Irland engagiert. Gleichzeitig gibt er Auftritte bei Lieder-
abenden und Konzerten geistlicher Musik.
↪ Peter Clemente (Violine) studierte an den Musikhoch-
schulen in München und Saarbrücken. Als Solist gewann er
42 zahlreiche Preise, so z.B. beim Bundeswettbewerb „Jugend
musiziert“ und beim Internationalen Violinwettbewerb
„Michelangelo Abbado“ 1992 in Sondrio (Italien). Seit
1996 ist Peter Clemente Konzertmeister und Solist der
„Münchner Kammersolisten“. 1986 gründete er das „Cle-
mente Trio“, mit dem er in der Alten Oper Frankfurt, im
Der Lettische Chor „Laima“Concertgebouw Amsterdam, im Musikverein Wien und in
der Carnegie Hall in New York sowie bei weltberühmten
Musikfestivals wie den Festwochen in Luzern auftrat.
↪ Elena Arnovskaya (Klavier) erhielt ihre Ausbildung an
der Tschaikowski-Musikschule (Tscheljabinsk). Danach
leitete sie eine Klasse für Liedbegleitung, war Korrepetito-
rin an der Tschaikowski-Musikhochschule (Sankt Peters-
burg), am Glinka-Opernhaus und wirkte als Solistin der
Tscheljabinsker Philharmonie. Seit 2006 lebt sie in Mün-
chen und tritt als Begleiterin von Sängern und Instrumenta-
V E R A N S TA LT U N G E N
listen auf.
↪ Der Lettische Chor „Laima“ (München) wurde 2017
gegründet und pflegt sowohl lettisches als auch europäi-
sches Repertoire. Der Chor war seitdem sowohl in München
(u. a. beim Tag der Laienmusik 2018 im Gasteig) als auch 43
andernorts wie z. B. bei den Lettischen Kulturtagen in
Esslingen und Roosendaal (Niederlanden), im Rahmen von
Terra Choralis in Zürich zu erleben. Chorleiter ist Linards
Kalniņš.
→ Eintrittskarte erforderlich, erhältlich im HDO
ab 3. Juni 2019 zu den BürozeitenD O N N E R S TA G , 9 . M A I 2 0 1 9 , 1 5 . 0 0 U H R
Erzählcafé
Prof. Dr. Andreas Otto Weber im Gespräch mit …
Dr. des. Lilia Antipow
Eintritt: 5 Euro (inkl. Kaffee und ein Stück Kuchen)
Veranstaltungsort: Gaststätte „Zum Alten Bezirksamt“ im HDO
↪ Lilia Antipow wurde 1970 in Nowokusnezk (Russland)
geboren. 1990 reiste sie mit ihrer Familie in die Bundes
V E R A N S TA LT U N G E N
republik aus. Sie studierte Slawistik, Osteuropäische
Geschichte und Buch- und Bibliothekswissenschaft in
Erlangen und promovierte an der Universität Bamberg mit
einer Studie über den russischen Schriftsteller und reform-
kommunistischen Literaturpolitiker Aleksandr Tvardovskij
44 (1910 – 1971). Als Historikerin, Filmkuratorin und Überset-
zerin war sie an der Realisierung von Projekten und Aus-
stellungen sowie an der Organisation von Symposien und
Workshops beteiligt, wie z.B. an der Universität Erlangen-
Nürnberg, am Memorium Nürnberger Prozesse und am
Filmhaus (beide Nürnberg). Von Lilia Antipow liegen zahl-
reiche Publikationen zur jüdischen und russischen Litera-
tur- und Filmgeschichte, zur Geschichte des russischen
Theaters, zum Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess
sowie zur Geschichte und Ethnographie der Deutschen aus
Russland vor. Im Haus des Deutschen Osten leitet sie seit
September 2018 das Sachgebiet Medien-, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit und die Bibliothek.D O N N E R S TA G , 1 1 . J U L I 2 0 1 9 , 1 5 . 0 0 U H R
Erzählcafé
Dr. Renate von Walter im Gespräch mit …
Wolfgang van Elst
Eintritt: 5 Euro (inkl. Kaffee und ein Stück Kuchen)
Veranstaltungsort: Gaststätte „Zum Alten Bezirksamt“ im HDO
↪ Wolfgang van Elst ist Holzschnitzer, Bildhauer und
Leiter der Holzbildhauerschule in Oberammergau. Er wurde
V E R A N S TA LT U N G E N
1962 in Unterammergau geboren, wohin sein Vater, eben-
falls Holzschnitzer, als Flüchtling gekommen war. Wolfgang
van Elst absolvierte selbst eine Lehre an der Bildhauer-
schule in Oberammergau und studierte an der Akademie
der Bildenden Künste in München. Er war Meisterschüler
bei Hubertus von Pilgrim und hat zahlreiche Ausstellungen
45
im In- und Ausland realisiert.F R E I TA G , 1 9 . A P R I L 2 0 1 9 , 1 4 . 3 0 U H R
Traditionen
Gottesdienst mit Hl. Abendmahl nach
der alten schlesischen Liturgie
Ort: Magdalenenkirche, Ohlauer Strasse 16,
80997 München-Moosach
Veranstalter: Gemeinschaft evangelischer Schlesier
→ Die Reformation verbreitete sich in Schlesien seit
dem 16. Jahrhundert, die deutsche Bevölkerung
V E R A N S TA LT U N G E N
der Region wurde mehrheitlich evangelisch. Zwar
musste die evangelische Kirche im Zuge der
Gegenreformation Rückschläge erleiden, nach
dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, erst recht
nach dem Anschluss Schlesiens an Preußen im
18. Jahrhundert wurden jedoch alle Beschrän
46
kungen in der Glaubensausübung für Luthers
Anhänger aufgehoben. Anfang des 19. Jahrhun
derts erhielt die Universität Breslau als erste
akademische Anstalt in Schlesien eine evange
lische theologische Fakultät.
Nach Kriegsende 1945 und der darauf folgen
den Vertreibung hielten evangelische Schlesier,
die in den Westen kamen, an den Kirchenritualen
ihrer Heimat fest. Dazu gehörte die alte schlesi
sche Liturgie. Im Unterschied zu anderen litur
gischen Ordnungen der evangelischen Kirche
setzt sie den Akzent auf die aktive Beteiligung der
Gläubigen am Gottesdienst. Eine große Rolle
spielt dabei das Gebet, das von der Gemeinde im
Chor gesungen wird. Die schlesische Liturgie
verwendet außerdem ihre eigenen Gesangbücher,
deren Liedbestand sich im Laufe der Jahrhunder
te mehrfach änderte. Die ältesten Lieder, die
bereits über 400 Jahre alt sind, gehen auf die
schlesischen Dichter Christian Knorr von Rosen
roth und Johann Heermann zurück. In musika
lischer Hinsicht steht die schlesische Liturgie
der katholischen und orthodoxen Kirchenmusik
nahe. Sie präsentiert somit ein Stück lebendigerV E R A N S TA LT U N G E N
47
Liebfrauenkirche, Liegnitz/Legnica (Niederschlesien)
Geschichte der evangelischen Kirche in dieser
Region. Der Gottesdienst wird von Pfarrer i. R.
Klaus Lobisch gehalten.Sie können auch lesen