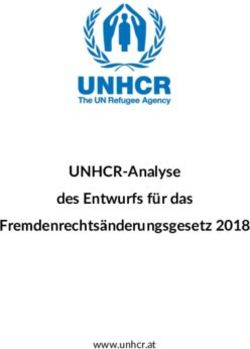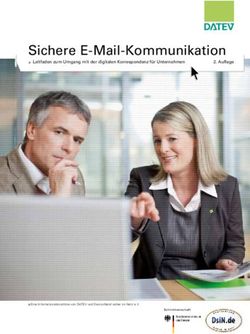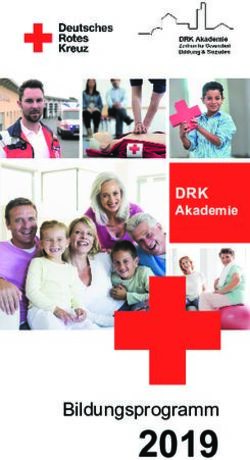BALTIC PIPE - DEUTSCHER TEIL DER OSTSEE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TÄTIGKEIT - ESPOO-KONVENTION ART. 3 - Baltic Pipe Project
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Adressat GAZ-SYSTEM S.A. Dokumententyp Information über die geplante Tätigkeit Datum 12. Januar 2018 Dokument Nr BALTIC PIPE - DEUTSCHER TEIL DER OSTSEE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TÄTIGKEIT – ESPOO-KONVENTION ART. 3
BALTIC PIPE - DEUTSCHER TEIL DER OSTSEE
INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TÄTIGKEIT – ESPOO-KONVENTION ART. 3
Revision 0
Datum 12. Januar 2018
Erstellt von MAJH/JRV
Geprüft von SSB/METW/STR
Genehmigt von CFJ
Beschreibung Anhang zur Benachrichtigung gemäß Espoo-Konvention für die Baltic Pipe –
Deutschland an die betroffenen Vertragsparteien
Ramboll
Hannemanns Allé 53
2300 Copenhagen S
Denmark
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.comBaltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee I
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
INHALT
1. Informationen über die geplante Tätigkeit und
Informationen über die räumliche und zeitliche
Ausdehnung der geplanten Tätigkeit 1
1.1 Projektbeschreibung 1
1.1.1 Allgemeines 1
1.1.2 Pipeline-Trasse und Anlandungsoptionen 3
1.1.3 Bestandserfassungen als Grundlage für die Ermittlung der
Vorzugstrasse 4
1.1.4 Bauarbeiten Offshore 5
1.1.5 Korrekturmaßnahmen am Meeresboden zum Schutz der
Pipeline 7
1.1.6 Baumaßnahmen im Bereich der Anlandungen 11
1.1.7 Vorbetrieb 15
1.1.8 Inbetriebnahme 15
1.1.9 Betrieb 15
1.1.10 Außerbetriebnahme 16
2. Erwartete UmweltAuswirkungen und vorgeschlagene
Minderung maßnahmen 16
2.1 UVP-METHODIK 21
2.1.1 Empfindlichkeit der Ressourcen und Rezeptoren 22
2.1.2 Charakter, Art und Reversibilität der Auswirkung 22
2.1.3 Intensität, Umfang und Dauer einer Auswirkung 23
2.1.4 Erheblichkeit der Auswirkungen 24
2.2 Natura 2000 Gebiete 25
l:\10-projekte\1100020161_baltic-pipe\9 espoo\03 translation\bp-1450-0003-de-0 information on the proposed activity - espoo convention art. 3.docx
l:\10-projekte\1100020161_baltic-pipe\9 espoo\03 translation\bp-1450-0003-de-0 information on the proposed activity - espoo convention art. 3.docx
2.3 Arten von gemeinschaftlichem Interesse 26
3. Literatur 27Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 1 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
1. INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TÄTIGKEIT UND
INFORMATIONEN ÜBER DIE RÄUMLICHE UND ZEITLICHE
AUSDEHNUNG DER GEPLANTEN TÄTIGKEIT
Die vorliegende Espoo-Benachrichtigung wurde im Auftrag von GAZ-SYSTEM S.A. für das Projekt
der geplanten Offshore-Gaspipeline Baltic Pipe erstellt.
Diese Espoo-Benachrichtigung bezieht sich auf den in der Ostsee gelegenen Abschnitt, in dem die
Baltic Pipe zwischen Dänemark und Polen verläuft. Die Offshore-Pipeline verläuft durch die Küs-
tengewässer Dänemarks und Polens sowie, in Abhängigkeit von der abschließenden Entscheidung
über den Trassenverlauf, entweder durch die deutsche oder die schwedische ausschließliche Wirt-
schaftszone (AWZ) in der Ostsee.
Das Projekt Baltic Pipe wird als Joint Venture von den Unternehmen GAZ-SYSTEM S.A. und Ener-
ginet.dk entwickelt, wobei GAZ-SYSTEM S.A. für den die Ostsee betreffenden Teil des Projektes
verantwortlich ist. Energinet.dk wiederum ist zuständig für den Teil von der Anlandung in Däne-
mark bei Faxe bis zur Verbindung mit dem norwegischen Gassystem in der Nordsee.
Das Projekt ist ein sogenanntes „Vorhaben von gemeinsamem Interesse“ (engl. Projects of Com-
mon Interest, PCI), das für die Realisierung des europäischen Energiebinnenmarktes und die Ver-
wirklichung der energiepolitischen Ziele der EU in Bezug auf bezahlbare, sichere und nachhaltige
Energie von wesentlicher Bedeutung ist. PCIs können z.B. aus beschleunigter Planung und Geneh-
migungserteilung Nutzen ziehen.
Gemäß dem Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden
Rahmen vom 25. Februar 1991 ist eine grenzüberschreitende Auswirkung „jede Auswirkung –
nicht nur globaler Art – innerhalb eines Gebiets unter der Hoheitsgewalt einer Vertragspartei in-
folge einer geplanten Tätigkeit, deren natürlicher Ursprung sich ganz oder teilweise in einem Ge-
biet unter der Hoheitsgewalt einer anderen Vertragspartei befindet.“
Da das Vorhaben gemäß Anhang I zur Espoo-Konvention, Nr. 8 als „Öl- und Gaspipeline großen
Durchmessers“ einzustufen ist, hat die Ursprungspartei sicherzustellen, dass betroffene Vertrags-
parteien über eine geplante Tätigkeit, die voraussichtlich erhebliche nachteilige grenzüberschrei-
tende Auswirkungen hat, informiert werden.
Ursprungspartei sind eine oder mehrere Vertragsparteien des Übereinkommens, in deren Hoheits-
bereich eine geplante Tätigkeit durchgeführt werden soll, in diesem Fall Dänemark, Schweden,
Deutschland und Polen.
Die kürzesten Abstände der geplanten Trassen zu einem der übrigen Ostsee-Anrainerländer betra-
gen mehr als 230 km.
1.1 Projektbeschreibung
1.1.1 Allgemeines
Das Baltic Pipe Projekt ist als Kooperation zwischen GAZ-SYSTEM S.A., dem polnischen Gas-Über-
tragungsnetzbetreiber, und Energinet.dk, dem dänischen Übertragungsnetzbetreiber für Erdgas
und Strom. Das Projekt ist als Vorhaben von gemeinsamem Interesse anerkannt und in der ent-
sprechenden Unionsliste aufgeführt.Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 2 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Die Baltic Pipe ist ein strategisches Gasinfrastrukturprojekt, dessen Ziel es ist, einen neuen Korri-
dor zur Gasversorgung für den europäischen Markt zu schaffen. Dieses Infrastrukturprojekt soll
den Transport von Gas aus den norwegischen Gasfeldern in der Nordsee zu den dänischen und
polnischen Märkten sowie zu Kunden in den Nachbarländern ermöglichen. Bei Bedarf kann Gas in
umgekehrter Richtung aus Polen zu den dänischen und schwedischen Märkten transportiert wer-
den. Die Offshore-Pipeline zwischen Dänemark und Polen ist ein wichtiger Teil des Gesamtprojek-
tes Baltic Pipe.
Das Baltic Pipe Projekt besteht aus fünf Hauptbestandteilen (s. Abbildung 1-1:):
• In der Nordsee (Länge 120 km) ist eine neue Gaspipeline von den norwegischen Offshore-Gas-
feldern zur dänischen Küste geplant. Die neue Pipeline schließt an die existierende Gaspipeline
Europipe II an, die Norwegen und Deutschland verbindet.
• In Dänemark ist eine neue ca. 220 km lange Gaspipeline geplant, die sich von Jütland über Fü-
nen nach Süd-Ost Seeland erstreckt.
• An der dänischen Küste in Seeland ist eine neue Verdichterstation geplant (Compressor Station
Zealand).
• Zwischen Dänemark und Polen ist eine neue Offshore-Pipeline für den bidirektionalen Gas-
transport geplant. Diese Offshore-Pipeline ist Gegenstand des vorliegenden Scoping-Berichtes.
In Polen ist die Infrastruktur zum Empfang von Gas aus Dänemark auszubauen.
Die Inbetriebnahme der Gaspipeline ist für das Jahr 2022 geplant.
Abbildung 1-1: Übersicht der fünf Hauptkomponenten des Baltic Pipe Projekts
Die Baltic Pipe wird über eine Kapazität von bis zu 10 Milliarden m³ pro Jahr nach Polen und bis zu
3 Milliarden m³ pro Jahr nach Dänemark und Schweden verfügen. Die Pipeline ist für eine Lebens-
dauer von 50 Jahren ausgelegt.Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 3 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Die Hauptziele des Baltic Pipe Projektes sind die Stärkung der Diversifizierung der Versorgung mit
Erdgas, die Verbesserung der Marktintegration, die Angleichung der Preise und die Erhöhung der
Versorgungssicherheit primär in Polen und Dänemark sowie sekundär in Schweden, in Zentral-
und Osteuropa (engl. Central and Eastern Europe, CEE) und der Baltischen Region.
Aus diesen Gründen wurde das Projekt Baltic Pipe von der Europäischen Kommission als „Vorha-
ben von gemeinsamem Interesse“ anerkannt und im Jahr 2013 erstmals in die entsprechende
Liste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse aufgenommen. Das Projekt ist in der „delegier-
ten“ Verordnung zur Änderung der EU-Verordnung Nr. 347/2013 vom 23.11.2017 enthalten, was
seine regionale Bedeutung für den EU-Energiesektor unterstreicht. "Baltic Pipe" ist als Projekt Nr.
8.3 in der Unionsliste von Projekten von gemeinsamem Interesse (Anhang VII, (8), 8.3) aufge-
führt.
Das Projekt trägt zu einer weiteren Stärkung des europäischen Energie-Binnenmarktes bei, indem
und die von der EU formulierten energiepolitischen Ziele für bezahlbare, sichere und nachhaltige
Energie erreicht werden.
1.1.2 Pipeline-Trasse und Anlandungsoptionen
Die Offshore-Pipeline von Dänemark nach Polen hat eine Länge von 250 bis 580 km mit zwei Opti-
onen für die Anlandung in Dänemark in der Bucht von Faxe (Faxe Nord, Faxe Süd) und drei Optio-
nen für die Anlandung in Polen (Niechorze, Rogowo, Gaski). Die Trassen in der Ostsee einschließ-
lich der möglichen Querungen der deutschen und schwedischen ausschließlichen Wirtschaftszone
(AWZ) sind in Abbildung 1-2 dargestellt.
Es werden zwei Trassenoptionen durch die Ostsee untersucht, eine quert die schwedische und die
andere die deutsche AWZ. Bei beiden Optionen werden eine Trasse (schwarze Linie in Abbildung
1-2) und eine Alternativtrasse (grüne Linie in Abbildung 1-2) berücksichtigt. Die Pipeline wird
keine Küstengewässer in Schweden und Deutschland queren.
Abbildung 1-2: Trassenvarianten der Baltic Pipe Offshore-Pipeline durch die OstseeBaltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 4 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Basierend auf den Ergebnissen einer Machbarkeitsstudie wurden unterschiedliche Trassenvarian-
ten im Rahmen einer Konzeptstudie untersucht und optimiert. Die Optimierung der Trassen er-
folgte unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher, umweltfachlicher und genehmigungs-
rechtlicher Kriterien entsprechend den im DNV Code für Offshore Pipeline Design, DNV OS-F101
/1/ festgelegten Kriterien. Dabei wurden folgende Ziele verfolgt:
• Minimierung der Gesamtlänge der Pipeline; dies führt zu geringeren Beschaffungskosten und
maximiert die Betriebsleistung des Rohrleitungssystems.
• Minimierung der Inanspruchnahme von Flachwasserbereichen, in denen spezielle Installations-
schiffe/Schuten für die Installation der Offshore-Pipeline erforderlich sind.
• Vermeidung von Gebieten besonderer Bedeutung. Hierzu zählen:
– Schutzgebiete;
– Gebiete mit empfindlicher Flora und Fauna;
– Gebiete mit Kulturgütern usw.
• Vermeidung von Flächen, die für die Errichtung von Windparks vorgesehen sind; Wenn für die
Errichtung von Windparks vorgesehene Flächen gekreuzt werden, sind weitere Untersuchungen
und Abstimmungen mit den für die Raumordnung zuständigen Stellen erforderlich.
• Vermeidung von Gebieten mit bestehender Infrastruktur, wie z. B. Windparks usw.
• Vermeidung von Gebieten, in denen die Installation und der Betrieb der Pipeline zu Konflikten
mit anderen marinen Nutzungen führen kann. Hierzu zählen:
– Gebiete für die Fischerei;
– Gebiete für die Rohstoffgewinnung;
– Militärisch genutzte Gebiete;
– geplante Offshore-Windparks;
– Ankerplätze für die Schifffahrt (Reeden).
• Minimierung von Wechselwirkungen mit bestehenden Rohrleitungen, Kabeln, Wracks und Hin-
dernissen
• Minimierung von Bereichen mit ungeeigneten Meeresbodenbedingungen und/oder nicht ausrei-
chenden Meerestiefen. Diese können sowohl die Stabilität der Pipeline ungünstig beeinflussen
als auch das Herstellen des Grabens zum Verlegen der Pipeline im Meeresboden behindern.
• Minimierung der Überlagerung mit Schifffahrtswegen. Dies minimiert das Risiko durch Anker-
wurf sowie durch sinkende oder auf Grund gelaufene Schiffe usw.
1.1.3 Bestandserfassungen als Grundlage für die Ermittlung der Vorzugstrasse
Um eine Grundlage für die Entscheidung über die Vorzugstrasse zu schaffen, werden geophysikali-
sche, geotechnische und ökologische Untersuchungen aller in Abbildung 1-2 dargestellten Korri-
dore durchgeführt (Beginn: Oktober 2017). Die Ergebnisse der Untersuchungen bilden auch die
Grundlage für die detaillierte technische Planung der Pipeline.
Die geophysikalischen Untersuchungen umfassen Echolotvermessungen (Bathymetrie), Side Scan
Sonar (Seitensichtsonar), Magnetometer-Messungen und hochfrequente seismische Untersuchun-
gen der obersten 10 m des Meeresbodens. Die Untersuchungen werden in einem 500 bis 1.000 m
breiten Korridor um die Mittellinie der jeweiligen Trassenalternative durchgeführt. Die Ergebnisse
werden zur Optimierung der endgültigen Trassierung verwendet.
Die geotechnischen Untersuchungen umfassen CPT-Messungen (engl. Cone Penetration Test,
Drucksondierung) und Vibrocore-Sedimentprobenentnahmen entlang der Trassenalternativen.Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 5 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Die Umweltuntersuchungen einschließlich des Monitorings der nachfolgend aufgeführten Umwelt-
parameter werden verwendet, um die verfügbaren Grundlagendaten zu ergänzen:
• Wasserchemie und Sedimentchemie;
• Phytobenthos und Habitate;
• Makrozoobenthos;
• Fische;
• Vögel;
• Meeressäugetiere.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden mit den Ergebnissen der geotechnischen und geo-
physikalischen Untersuchungen einen Teil der Grundlagen für die Erstellung der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) für die Baltic Pipe Offshore-Pipeline bilden. Der Untersuchungsrahmen wird
den rechtlichen Anforderungen und Standards in den beteiligten Ländern entsprechen und kann
daher länderspezifisch variieren.
1.1.4 Bauarbeiten Offshore
1.1.4.1 Design Codes und Standards
Die Offshore-Pipeline in polnischen, deutschen, schwedischen und dänischen Gewässern wird ge-
mäß den zum Projektstart aktuellsten Ausgaben des DNV-Offshore-Standards F101 Submarine
Pipeline Systems /1/ sowie weiterer, bei den Behörden bereits vorhandener oder während des Ab-
stimmungsprozess veröffentlichter nationalen Anforderungen geplant. Insbesondere werden die in
Tabelle 1-1 aufgeführten Standards, Leitfäden und Designrichtlinien bei der Planung der Baltic
Pipe Offshore-Pipeline umgesetzt.
Tabelle 1-1: Anwendbare Standards und Richtlinien
Thema Code Referenz
Wanddicke DNV-OS-F101 /1/
Material der Leitungsrohre DNV-OS-F101 /1/
Innenbeschichtung ISO 15741.2 /2/
Außenbeschichtung DNV RP-F106 /3/
Kathodenschutz DNVGL-RP-F103 /4/
Pipelinestabilität DNVGL–RP-F109 /5/
Einfluss des Schleppnetzbestandteils DNVGL–RP-F111 /6/
Freie Spannweite DNV–RP-C203 and DNVGL-RP-F105 /7/ und /8/
Risikomanagement DNV-RP-F107 and DNV-OS-F101 /1/ und /9/
1.1.4.2 Lieferung der Rohre, Beschichtung und Anoden
Der längsnahtgeschweißte Rohrleitungsstahl wird in speziellen Rohrwerken hergestellt und in
12,2 m (40 ') langen Abschnitten geliefert. Dies ist die üblicherweise für Offshore-Pipelines ver-
wendete Rohrleitungslänge, die an die Ausrüstung zur Verlegung der Rohre angepasst ist. Die
Rohrverbindungen werden in dem Rohrwerk oder in einer speziellen Anlage zur Rohrbeschichtung
mit einer Innenbeschichtung zur Reduzierung des Widerstandes bei der Gasdurchleitung (0,1 mm
Epoxidanstrich) und einer äußeren Korrosionsschutzbeschichtung (3,5°mm 3-Schicht-PE) verse-
hen. Die Betonummantelung wird in einem – möglicherweise separaten – Rohrummantelungswerk
aufgebracht. Um das spätere Zusammenschweißen der Rohre (Rundschweißen) zu erleichtern,Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 6 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
werden die Beschichtungen an den Rohrverbindungsenden zurückgeschnitten, typischerweise um
240 mm für die Korrosionsschutzbeschichtung und 340 mm für die Betonummantelung.
Die Opferanoden werden von den Herstellern in der erforderlichen Anzahl zum Ummantelungs-
werk geliefert, wo sie vor der Betonummantelung auf den vor Korrosion zu schützenden Rohrver-
bindungen montiert werden.
Die fertigen Rohrverbindungen werden im Rohrummantelungswerk gelagert, bis sie für die Verle-
gung benötigt werden. Wenn das Ummantelungswerk weiter entfernt ist, wird das für die Verle-
gung zuständige Unternehmen möglicherweise mehrere Zwischenlager in der Nähe des jeweiligen
Einsatzgebietes der Verlegeschiffe einrichten.
1.1.4.3 Rohrverlegung Offshore
Die Verlegung der Rohre für die 36-Zoll-Gastransportleitung erfolgt voraussichtlich mit dem S-
Lay-Verfahren. In Tabelle 1-2 ist das Verlegeverfahren exemplarisch dargestellt.
Tabelle 1-2: Pipeline-Installation mit dem S-Lay-Verfahren
An Bord des Verlegeschiffs werden die einzelnen beschichteten Rohre zu einem durchgehenden
Rohrstrang zusammengesetzt und verschweißt. Der Rohrstrang wird anschließend über einen am
Verlegeschiff angebrachten Stinger (Ausleger) in einer S-förmigen Kurve auf den Meeresboden
abgelassen. Die kritischen Stellen während der Rohrverlegung sind die Überbiegung am Stinger
und die Durchbiegung am Aufsetzpunkt. Die Überbiegespannungen werden durch eine auf die
Verhältnisse abgestimmte Konfiguration des Stingers gesteuert, während ein Knicken im BereichBaltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 7 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
der Durchbiegung am Aufsetzpunkt (engl. sag bend) durch Erzeugen einer Spannung in der Rohr-
leitung verhindert wird.
Das Verlegeschiff bewegt sich beim Verlegen der Pipeline an den Ankern ziehend vorwärts, wobei
die Anker regelmäßig durch Ankerziehschlepper (engl. anchor handling vessel) versetzt werden.
Alternativ kann das Verlegeschiff mit einem dynamischen Positionierungssystem (DPS) und leis-
tungsstarken Bugstrahlanlagen ausgestattet sein, um die Position zu halten und sich langsam vor-
wärts zu bewegen.
1.1.5 Korrekturmaßnahmen am Meeresboden zum Schutz der Pipeline
1.1.5.1 Einleitung
Der Schutz der Pipeline erfolgt einerseits in mechanischer Form durch die oben beschriebenen Be-
schichtungen und Ummantelungen bei der Herstellung der Rohre und andererseits mittels Eingra-
ben der Pipeline in den Meeresboden (Trenching) sowie durch das Unterfüttern oder Überdecken
der Pipeline mit Gesteinsmaterial.
Für die Baltic Pipe Offshore-Pipeline werden hinsichtlich der Korrekturmaßnahmen am Meeresbo-
den folgende Definitionen verwendet:
• Eingraben: Verlegen der Pipeline im Meeresboden durch die mechanische Herstellung eines
Grabens. Dies kann entweder durch Einsatz von Tieflöffelbaggern auf Pontons (Wassertiefe bis
6 m) oder durch das Eingraben nach der Verlegung (Wassertiefe über 6 m) mit Hilfe von Pflü-
gen, Kettenfräsen oder Hochdruck-Wasserstrahl erfolgen.
• Künstliche Verfüllung: Nachträgliches (d. h. nach Verlegen der Pipeline im Graben) Verfüllen
des Grabens mit Meeresbodenmaterialien und/oder mit Material aus anderen Quellen;
• Natürliche Verfüllung: Nach dem Verlegen der Pipeline füllt sich der Graben aufgrund des
natürlichen Sedimenttransports in dem Gebiet;
• Steinschüttungen: Aufbringen von Gestein und Kies auf dem Meeresboden mittels Fallrohr
zum Stützen oder zur Abdeckung (Schutz) der Pipeline.
Im Allgemeinen sind folgende Veränderungen des natürlichen Meeresbodens erforderlich:
• Sedimententnahme zur Verbesserung der Eigenschaften des Untergrundes, um beispielsweise
ein Versinken der Pipeline in weichen Sedimenten zu verhindern;
• Eingraben zur Reduzierung der Lasten durch Wellen und Strömungen;
• Schutz bestehender Rohrleitungen oder Kabel im Bereich von Kreuzungen;
• Vorhalten von Fundamenten für spezielle Konstruktionen;
• Reduzierung freier Durchhänge zur Reduzierung von Biegespannungen;
• Glätten des Rohrleitungsprofils, um die Länge freier Durchhänge zu verringern oder um Kon-
taktdruck zu vermeiden, der die Beschichtung beschädigen oder den Rohrstahl eindrücken
könnte.
In einigen Abschnitten der Pipelinetrasse sind Korrekturen am Meeresboden geplant, um die Sta-
bilität sicherzustellen und die Pipeline vor Beschädigungen zu schützen. Die Bereiche, in denen
Korrekturen am Meeresboden erforderlich sind, werden auf der Grundlage von Stabilitätsanalysen
sowie von quantitativen Risikobewertungen unter Berücksichtigung der Wassertiefen, der lokalen
Beschaffenheit des Meeresbodens, der Schiffsverkehrsdichte usw. identifiziert.
Bei Wassertiefen von weniger als 20 Meter ist das Eingraben zum Schutz der Pipeline vorgesehen.
Das Eingraben (Trenching) ist die bevorzugte Methode zur Stabilisierung einer Pipeline gegen
übermäßige hydrodynamische Belastung (vor allem in seichten Gewässern) und als Schutz vorBaltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 8 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Einwirkungen durch Dritte, Schleppnetzfischerei und Schiffsanker. Im Zusammenhang mit dem
Eingraben kann ein künstliches Verfüllen ergänzend erforderlich sein. Beim Eingraben sollte eine
Überdeckung von 1,0°m hergestellt werden.
1.1.5.2 Eingraben in Wassertiefen von weniger als 6 m (Tieflöffelbagger)
In einer Wassertiefe von weniger als 6 m wird mit einem Tieflöffelbagger auf einem Stelzen-pon-
ton gearbeitet. Ein Beispiel für diese Arbeitsweise ist in Tabelle 1-3 dargestellt.
Tabelle 1-3: Typischer Tieflöffelbagger für den Aushub im flachen Wasser (Wassertiefe < 6 m)
Bei dieser Methode wird der Graben hergestellt, bevor die Pipeline verlegt wird. Die seitlichen Bö-
schungen haben eine Neigung von 1 : 10 (s. Abbildung 1-3).
Abbildung 1-3; Skizze eines mit einem Tieflöffelbagger ausgehobenen GrabensBaltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 9 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
1.1.5.3 Eingraben bei Wassertiefen von 6 bis 20 m
Bei Wassertiefen von weniger als 20 Meter ist das nachträgliche Eingraben (Trenching) zum
Schutz der Pipeline vorgesehen. Das Trenching ist die bevorzugte Methode zur Stabilisierung einer
Pipeline gegen übermäßige hydrodynamische Belastung (z. B. durch Wellen, Strömungen) insbe-
sondere in Gewässerabschnitten mit geringen Wassertiefen sowie zum Schutz vor Einwirkungen
durch Dritte, Schleppnetzfischerei und Schiffsanker. Im Zusammenhang mit dem Eingraben kann
eine künstliche Verfüllung ergänzend erforderlich sein. Es empfiehlt sich, im Zuge des Trenchings
eine Überdeckung von 1,0 m herzustellen.
Das Eingraben nach Verlegen der Pipeline ist die einfachste Lösung. Für das Trenching kommen
Einspülgeräte, die mithilfe von Düsen Wasser mit hohem Druck in den Meeresboden einspritzen.
Dabei wird ein Graben in den Meeresboden gefräst und die Sedimente des Meeresbodens werden
aufwirbelt. Das Trenching kann auch mittels mechanischer Schneidvorrichtungen erfolgen. Dabei
wird der Graben entweder mithilfe eines Kettenschneiders oder durch Einpflügen, das ähnlich wie
bei einem Ackerpflug funktioniert, erfolgen.
Einspülschlitten oder mechanische Schneidevorrichtungen sind üblicherweise Geräte, die auf Ket-
ten langsam über den Meeresboden fahren. Die Geräte sind mit einem Gewicht von 50 bis 150
Tonnen sehr schwer. Die maximale Eingrabungstiefe beträgt 3,5 m.
Mechanische Trenching-Systeme benutzen Schneidevorrichtungen oder eine Kombination aus
Schneidevorrichtung und Einspülgerät (s. Abbildung 1-4).
Abbildung 1-4: Mechanisches Trechnching-System – Deep Ocean T3200
In Abbildung 1-5 ist das Verfahrens des Trenching mit einem Einspülschlitten skizziert und in Ab-
bildung 1-6 ist ein typischer Querschnitt für diese Verfahren dargestellt. In Abhängigkeit von dem
gewählten Verfahren, der Sedimentbeschaffenheit usw. beträgt die Breite des Grabens 5 bis 20
Meter.Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 10 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Abbildung 1-5: Skizze des nachträglichen Eingrabens mittels Einspülverfahren
Abbildung 1-6: Skizze eines typischen Querschnittes einer eingegrabenen Pipeline
1.1.5.4 Steinschüttungen
Steinschüttungen sollen mithilfe von dynamisch positionierten Spezialschiffen, sogenannten „Fall
Pipe Vessels“ (FPV), auf dem Meeresboden aufgebracht werden Abbildung 1-7.Es handelt sich um
selbstfahrende Schiffe, die mit einem flexiblen Fallrohr ausgestattet sind, das unter dem Schiff im
Wasser abgesenkt werden kann.Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 11 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Abbildung 1-7: Aufbringen einer Steinschüttung mithilfe einer Fall Pipe Vessel
1.1.5.5 Kreuzung vorhandener Infrastruktur (Rohrleitungen und Kabel)
Die Trassenalternativen der Baltic Pipe Offshore-Pipeline kreuzen an verschiedenen Stellen beste-
hende Pipelines, Telekommunikations- und Stromkabel am Meeresboden der Ostsee. Die zu que-
renden Infrastrukturen werden auf Grundlage der von den zuständigen Behörden in Dänemark,
Schweden, Deutschland und Polen zur Verfügung gestellten Informationen identifiziert.
Vor dem Bau der Offshore-Pipeline werden Vereinbarungen mit allen beteiligten Eigentümern der
zu kreuzenden Infrastruktur getroffen. Die genaue Position der Kreuzungen wird durch detaillierte
geophysikalische Untersuchungen ermittelt.
Für jede Kreuzung wird eine detaillierte Planung des Kreuzungsbauwerks erstellt. Die Planung der
Konstruktion wird auf den Ergebnissen der durchgeführten Offshore-Untersuchungen basieren und
Hinweise für die Platzierung von Steinschüttungen liefern. In den für die Planung zu erstellenden
Zeichnungen wird dargestellt, ob die Kreuzungsbauwerke mit Schotter oder Betonmatratzen/-
stützen ausgeführt werden.
1.1.6 Baumaßnahmen im Bereich der Anlandungen
1.1.6.1 Allgemeines
Für die Anlandungen der Baltic Pipe Offshore-Pipeline werden typischerweise folgende Bauweisen
zur Anwendung kommen:
• Bottom-Pulling
• Horizontalbohrungen
• Microtunneling.
Die natürliche und die sozioökonomische Umwelt am Anlandungsort bestimmen die Auswahl einer
der drei Optionen, die nachfolgend näher beschrieben werden. In jedem der Fälle wird ein Verle-
geschiff mit geringem Tiefgang so nahe wie möglich an der Küstenlinie stationiert (typischerweise
in Wassertiefen von 5 bis 6 m). Üblicherweise werden in Bereichen mit derartigen Wassertiefen –Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 12 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
wie bei der übrigen Offshore-Verlegung – die auf dem Verlegschiff zusammengeschweißten Rohr-
verbindungen durch einen offenen Graben, ein Bohrloch oder einen ausgekleideten Mikrotunnel an
Land gezogen (shore pull). Wenn eine geeignete Fläche zur Verfügung steht, ist es auch möglich,
die Pipeline an Land zu verschweißen und auf das Verlegeschiff zu ziehen (offshore pull). Insbe-
sondere beim Microtunneling wird in der Regel von einer landseitigen Baugrube ausgegangen, so
dass ein Offshore-Pull nicht zweckmäßig ist.
Beim Bottom-Pulling wird die zu verlegende Pipeline auf dem Meeresboden liegend an Land gezo-
gen. Es ist die bevorzugte Methode für Anlandungen in Bereichen, in denen die oberflächennahen
Sedimente von sandigen oder kiesigen Substraten geprägt sind, und in denen aus umwelt- und
naturschutzfachlicher Sicht oder aufgrund von Drittbetroffenheiten keine Einwände gegen einen
(temporären) Graben durch die Brandungszone und den Strandbereich bestehen. Horizontalboh-
rungen oder Mikrotunnel werden ausgeführt, um bestimmte Hindernisse am Anlandungsort
(Sanddünen, Klippen, Schienen, Straßen, Umweltbeschränkungen usw.) zu umgehen. Während
Mikrotunnel in jedem Substrat, einschließlich losem Sand oder Kies, angelegt werden können,
sind Horizontalbohrungen am besten in Bereichen mit homogenem Ton geeignet, wurden aber
auch erfolgreich in festem Gestein durchgeführt. Unabhängig von der Bauweise kann es wirt-
schaftlicher sein, wasserseitig einen Zugangsgraben für das Verlegeschiff auszuheben, um die
Zugdistanz zu verkürzen.
1.1.6.2 Bottom Pulling
Beim sogenannten Bottom-Pulling wird eine Zugstation an der landseitigen Baustelle installiert,
die in der Regel aus zwei parallelen Seilwinden besteht. Die Seilwinden sind mit einem Rückhalte-
anker verbunden, der als Spundwand ausgeführt sein kann. In der Brandungszone wird ein Gra-
ben ausgehoben, der ggf. von einem Spundwanddamm geschützt wird. Die Tiefe des Grabens
muss ausreichend sein, um sicherzustellen, dass die Pipeline nicht durch saisonale oder langfris-
tige Veränderungen der Meeresbodenoberfläche freigelegt wird. Die Seile der Winden werden über
Umlenkrollen mit dem Zugseil verbunden, das von dem am offshore-seitigen Ende des Grabens
stationierten Verlegeschiff eingezogen wurde. Auf dem Verlegeschiff wird das Zugseil mit einem
Zugkopf verbunden, der an die erste Rohrverbindung angeschweißt ist. Die auf dem Schiff produ-
zierten Rohrsegmente werden zu einem Punkt oberhalb der Hochwassermarke gezogen, wo die
erste trockene Schweißnaht hergestellt wird, mit der die Offshore-Pipeline mit dem Onshore-Ab-
schnitt verbunden wird. Ein typischer Aufbau der Anlandungsstelle ist in Abbildung 1-8 dargestellt.
Um die Reibung und damit die erforderliche Zugkraft zu reduzieren, kann die Rohrleitung mit Auf-
triebselementen versehen werden, insbesondere bei größeren Abständen zum Verlegeschiff.
Abbildung 1-8: Bottom Pulling mit typischen Aufbau einer Anladungsbaustelle (Shore Pull)Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 13 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Nachdem die Pipeline an Land gezogen wurde, wird der Kofferdamm (falls vorhanden) entfernt
und der Graben wieder verfüllt. Nachdem die Offshore-Pipeline mit dem Onshore-Abschnitt ver-
bunden wurde, erfolgt die Wiederherstellung des Anlandungsbereichs entsprechend der behördli-
chen Festlegungen.
1.1.6.3 Horizontalbohrungen
Horizontalbohrungen (engl. Horizontal Directional Drilling, HDD) ist eine Technik, die bei der Er-
kundung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen angewendet wird. Der Bohrkopf am Ende des
ursprünglich vertikalen Bohrstrangs wird seitwärts in eine horizontale Richtung umgelenkt, so
dass ein großer und flacher Bereich eines Reservoirs von einer einzelnen Produktionsplattform er-
fasst werden kann. Im Zusammenhang mit der Pipeline-Installation wird der Ausdruck für eine In-
stallation methode verwendet, bei der der vorgefertigte Rohrstrang durch ein Bohrloch gezogen
wird, das durch einen gerichteten Bohrstrang im Boden hergestellt wird. Das Verfahren ist sche-
matisch in Abbildung 1-9 dargestellt.
Abbildung 1-9: Hauptarbeitsschritte des Horizontalbohrens (Horizontal Directional Drilling)
Quelle: https://www.phrikolat.de/index.php/grundlagen-hdd
Von dem Eintrittspunkt ausgehend wird mit dem Bohrgerät eine Pilotbohrung ausgeführt. Der
Bohrkopf wird durch eine über das Bohrgestänge zugeführte Bentonit-Bohrspülung hydraulisch
angetrieben. Die Bentonit-Bohrspülung transportiert das Bohrgut ab und füllt das Bohrloch hinter
dem Bohrkopf, so dass der Bohrkanal stabilisiert wird. Der Bohrkopf ist durch ein Drehgelenk mit
dem nicht rotierenden Bohrgestänge verbunden. Der Durchmesser des Schneidkopfs ist größer als
der des Bohrgestänges, das zu einem Bohrstrang verbunden ist. Mit Vordringen des Bohrmeißels
im Boden werden Bohrgestänge und Bohrstrang verlängert.
Typische Durchmesser sind 63 mm (2 ½") für den Pilotstrang und 125 mm (5") für den
Bohrstrang, mit Reibahlen von 350°mm (14 "), 600° mm (24") und 1050 mm (42 "). Im Ergebnis
wird ein Bohrloch hinterlassen, das groß genug ist, um eine 36"-Pipeline aufzunehmen.Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 14 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Die Einsatzmöglichkeiten des HDD-Verfahrens hängen von dem Baugrund ab, wobei die Methode
für nicht-kohäsive Substrate (Sand, Kies und Geröll) ungeeignet ist. Die am besten geeigneten
Substrate sind relativ homogener Ton oder weiches Gestein (Schiefer, Kalkstein, Sandstein), wo-
bei Horizontalbohrungen auch in festem Gestein (Granit, Basalt) durchgeführt werden.
Beim HDD-Verfahren sind keine Baumaßnahmen zwischen der Start- und Zielbaugrube erforder-
lich. Es wird daher bevorzugt eingesetzt, um dicht bebaute oder ökologisch sensible Uferbereiche
zu queren. Selbst wenn derartige Einschränkungen nicht vorhanden sind, ist das HDD-Verfahren
eine infrage kommende Alternative zum Queren einer Steilküste durch einen tiefen Graben.
1.1.6.4 Microtunnelling
Microtunneling ist eine Alternative zum HDD, bei der nicht nur ein Bohrloch für die Pipeline herge-
stellt, sondern auch ein verkleideter Tunnel installiert wird. Dieser Tunnel kann danach auch an-
dere Leitungen aufnehmen, wie z.B. Glasfaserkabel. Das Bohrloch wird mit einer konventionellen
Tunnelbohrmaschine (TBM) mit einem vollflächig rotierenden Bohrkopf hergestellt. Hinter dem
Bohrkopf (Vortrieb maschine) werden Vortriebsrohrelemente aus Beton eingepresst, die eine dau-
erhafte Tunnelauskleidung bilden. Die hierfür erforderlichen Kräfte werden entweder durch eine
Rückverankerung oder eine in der Baugrube installierte Spundwand erreicht (s. Abbildung 1-10).
Eine im Inneren des Mikrotunnels installierte Messenger-Leitung wird von dem am Ende des Tun-
nels stationierten Verlegeschiff aufgenommen und mit dem Zugseil verbunden. Anschließend wird
die Pipeline mithilfe einer Onshore-Winde eingezogen. Nach dem Einziehen kann ein Betonstopfen
im Tunnel installiert werden, um das Eindringen von Salzwasser ins Inland zu verhindern.
Die maximal mögliche Länge eines Microtunnels beträgt ca. 1.500 m.
Abbildung 1-10: Prinzip des MicrotunnelingBaltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 15 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
1.1.7 Vorbetrieb
Vor der Inbetriebnahme der Pipeline wird ein Vorbetrieb durchgeführt. Im Rahmen des Vorbe-
triebs erfolgt eine Überprüfung der Intaktheit des Rohrleitungssystems, bevor es in Betrieb ge-
nommen wird.
Im Zuge des Vorbetriebs ist eine Druckprüfung durchzuführen, die mittels Hydrotest erfolgen
kann. In diesem Fall wird die Pipeline mit Meerwasser geflutet, das anschließend unter Druck ge-
setzt wird. Nach dem Hydrotest wird das Wasser wieder ins Meer geleitet. Die Einleitung erfolgt in
der Nähe der Anlandungsbereiche und wird im grenzüberschreitenden Kontext nicht relevant sein.
Bei Durchführung eines Hydrotests kann es erforderlich sein, das Meerwasser mit Sauerstoffbin-
demitteln und/oder Bioziden zu behandeln, um Korrosionsschäden in der Pipeline zu verhindern.
Falls aus technischen Gründen Chemikalien erforderlich sind, werden möglichst umweltverträgli-
che Substanzen eingesetzt. Zudem wird ein Einsatz von Chemikalien nur nach Genehmigung
durch die zuständigen nationalen Behörden erfolgen.
Anstelle des Hydrotests können zur Überprüfung der Intaktheit der Pipeline auch andere Techni-
ken angewendet werden, die keine Verwendung von Wasser erfordern (z. B. Trockentest, Kon-
trolle der Schweißarbeiten und der Rohrverlegung).
Im Rahmen des Vorbetriebs werden mit aufwändiger Messtechnik ausgestattete Molche und Mess-
schieber durch die Pipeline geleitet, um sicherzustellen, dass keine Anomalien in der Rohrwand
vorhanden sind, die langfristig zu Störungen führen oder den Durchgang von Reinigungs- oder Ar-
beitsmolchen behindern könnten. Im Anschluss an die Messungen wird die Pipeline mithilfe von
speziellen mit Bürsten und Wischvorrichtungen ausgestatteten Molchen gereinigt.
1.1.8 Inbetriebnahme
Bei der Inbetriebnahme erfolgt das erstmalige Befüllen der Pipeline mit Gas. Sie umfasst alle Maß-
nahmen nach Abschluss des Vorbetriebs bis zum Zeitpunkt, an dem die Pipeline für die Durchlei-
tung von Gas bereit ist.
Nach dem Vorbetrieb wird die Pipeline mit trockener Luft gefüllt. Um die Entstehung eines explosi-
ven Gemisches aus Luft und trockenem Erdgas zu vermeiden, wird die Pipeline mit Stickstoff
(Inertgas) gefüllt, der als Puffer zwischen Luft und Erdgas fungiert. Unmittelbar nach der Stick-
stoffeinleitung gelangt Erdgas in die Anlage.
Um die Pipeline auf den Betrieb vorzubereiten, werden die Gase an die Atmosphäre abgegeben -
zuerst die Luft, dann der Stickstoff. Das im Zuge der Gasinjektion eingeleitete Inertgas wird an
einem sicheren Ort kontrolliert in die Atmosphäre abgegeben.
1.1.9 Betrieb
Die erwartete Lebensdauer der Pipeline beträgt 50 Jahre. In diesem Zeitraum wird der Gastrans-
port ständig überwacht und es werden planmäßig und außerplanmäßig Kontrollen und Wartungs-
arbeiten durchgeführt.
Während des Pipelinebetriebs werden technische Arbeiten durchgeführt, um die Intaktheit der
Pipeline sicherzustellen, insbesondere zur Aufrechterhaltung des richtigen Betriebsdrucks und zur
Sicherung der Infrastruktur.Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 16 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Diese Aktivitäten umfassen geotechnische Untersuchungen zur Kontrolle der Intaktheit der Pipe-
line und des umgebenden Meeresbodens. Außerdem werden Molche zur Überwachung der Wand-
dicke und der möglichen Korrosion an der Pipeline eingesetzt.
Die Überwachung des Gastransports wird von einer Leitzentrale durchgeführt, deren Standort zu
einem späteren Zeitpunkt des Projekts festgelegt wird.
1.1.10 Außerbetriebnahme
Nach dem Ende der Betriebszeit wird die Pipeline außer Betrieb genommen. Die Baltic Pipe ist für
einen Zeitraum von mindestens 50 Jahren ausgelegt, wobei die Lebensdauer der Pipelines unter
bestimmten Umständen über 50 Jahre hinaus verlängert werden könnte. Die technologischen
Möglichkeiten und die bevorzugten Verfahren zur Stilllegung von Offshore-Pipelines können sich
während der Betriebszeit von Baltic Pipe ändern.
Daher wird das Programm zur Außerbetriebnahme zum Ende der Betriebsphase entwickelt. Es
spiegelt dann das technische Know-how wieder, das während der Betriebsdauer der Pipelines ge-
wonnen wurde. Das Programm zur Außerbetriebnahme wird im Einvernehmen mit den zuständi-
gen nationalen Behörden und entsprechend den gesetzlichen Anforderungen zum Zeitpunkt der
Stilllegung entwickelt.
2. ERWARTETE UMWELTAUSWIRKUNGEN UND
VORGESCHLAGENE MINDERUNG MAßNAHMEN
Grenzüberschreitende Auswirkungen können bei allen Umweltrezeptoren auftreten, sowohl in Ge-
bieten der Ursprungsparteien als auch in Gebieten der betroffenen Vertragsparteien außerhalb des
Projekts (in anderen Ländern als Dänemark, Schweden, Deutschland und Polen) oder zwischen
den Ursprungsparteien.
Rezeptoren und Ressourcen, die möglicherweise betroffen sein können und die im Rahmen des
UVP-Scopings identifiziert werden können, sind in Tabelle 2-1 dargestellt.
Tabelle 2-1: Relevante Rezeptoren der Baltic Pipe Offshore-Pipeline
Physikalisch-chemische Umwelt Biologische Umwelt Sozioökonomische Umwelt
• Bathymetrie • Plankton • Schifffahrt und Schifffahrtswege
• Hydrographie und Wasserqualität • Lebensräume (Habitate) • Kommerzielle Fischerei
• Oberflächensedimente und Schad- • Benthische Flora and Fauna • Archäologie (Kulturerbe)
stoffe • Fische • Mensch
• Klima und Luft • Marine Säugetiere • Touri mus und Freizeit
• Schallbelastungen • Meeresvögel • Leitungen, Pipelines und Windparks
• Zugvögel • Rohstoffgewinnungsstätten
• Wandernde Fledermäuse • Übungsplätze der Bundeswehr
• Schutzgebiete/Natura 2000 • Munitionsbelastete Flächen
• Monitoring-Stationen und Umweltfor-
schungsgebiete
• Gebiete Onshore • Gebiete Onshore • Gebiete Onshore
Geologische Besonderheiten, Pflanzen und natürliche Lebens- Archäologie
Landschaft und Grundwasser räume Mensch
Wirbellose Tiere Touri mus und Freizeit
Arten des Anhangs IV der FFH-
RL
Brutvögel
Schutzgebiete/Natura 2000Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 17 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
In Tabelle 2-2 sind die möglichen grenzüberschreitenden Auswirkungen dargestellt und in Bezug
auf ihre Merkmale (z. B. beeinflusste Rezeptoren und betroffene Gebiete) beschrieben. Mögliche
grenzüberschreitende Auswirkungen in Bezug auf Natura 2000-Gebiete und streng geschützte Ar-
ten (Anhang IV der FHH-RL) werden in Abschnitt 2.2 und 2.3 entsprechend beschrieben.
Zur Vermeidung und Minderung von Auswirkungen kommen folgende Maßnahmen einzeln oder in
Kombination infrage:
• Trassenoptimierungen
• Reduzierung und Minimierung der Bauaktivitäten soweit erforderlich, z. B. kreuzen und über-
queren der empfindlichen Bereiche
• Planung der Bauaktivitäten unter Berücksichtigung von empfindlichen Zeiträumen für Vögel,
Meeressäugetiere usw.
• Umweltaktionsplan für den Umgang mit Umweltfragen
Die erforderlichen Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen werden im Verlauf des Projektes und
mit Vorliegen von Ergebnissen der Umweltuntersuchungen entwickelt und konkretisiert.
Es sei darauf hingewiesen, dass die erforderlichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen der
nachfolgend am Beispiel von Munitionsfunden erläuterten Grundphilosophie umgesetzt werden:
1. Vermeidung durch Verlegung der Pipeline
2. Wenn eine Verlegung der Pipeline nicht möglich ist, wird die Munition vorschriftsmäßig in an-
gemessener und kontrollierter Weise geräumt, einschließlich der Beachtung und Durchfüh-
rung von Minderungsmaßnahmen, um Auswirkungen zu reduzieren oder zu vermeiden. Die
Munitionsräumung wird als unerwartetes Ereignis/Risiko behandelt.
Tabelle 2-2: Eigenschaften möglicher grenzüberschreitender Auswirkungen
Mögliche Auswirkungen Eigenschaften und Rezeptoren
Bauphase
Störung des Meeresbodens Rezeptoren:
Lebensräume (Habitate), benthische Flora and Fauna
Merkmale der Auswirkungen:
Aufgrund der Pipelineverlegung und des Anker-Handlings (Ziehen
und Versetzen der Anker) sind lokal Störungen oder Verluste der
Meeresbodenhabitate oder von benthischer Flora und Fauna zu er-
warten.
Scoping:
Grenzüberschreitende Auswirkungen durch Störungen oder Verluste
von Habitaten oder von benthischer Flora und Fauna sind nicht zu
erwarten.
Freisetzung von Sedimenten und Er- Rezeptoren:
höhung der Schwebstoffkonzentration Wasserqualität, Oberflächensedimente, alle biologischen Rezeptoren
und der Tourismus (Badegewässerqualität).
Merkmale der Auswirkungen:
Grundsätzlich ist im Gebiet von Bauarbeiten ein Anstieg der
Schwebstoffkonzentrationen zu erwarten. Dieser Anstieg wird sich
auf ein Gebiet von maximal 1 bis 2 km rechts und links der Pipeline
beschränken. In Ausnahmefällen (z. B. Sturmereignisse) können
sich die geringen durch Baumaßnahmen bedingten Erhöhungen der
Schwebstoffkonzentrationen (weniger als 10 - 15 mg/l) weiter aus-
dehnen. Die Dauer der Konzentrationserhöhung wird innerhalb von
Stunden abklingen und wird sehr kurz bis kurz nachweisbar sein.
Auswirkung können aus erhöhter Trübung resultieren, die zu verrin-
gerter Lichtverfügbarkeit (Auswirkungen auf die Flora) und reduzier-Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 18 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Mögliche Auswirkungen Eigenschaften und Rezeptoren
ter Sichttiefe (Auswirkungen auf Fauna und Tourismus) sowie zu Be-
einträchtigungen der Lebensfähigkeit von Fischeiern usw. führen
können.
Scoping:
Die Schwebstoffkonzentrationen werden keine erheblich nachteiligen
grenzüberschreitenden Auswirkungen auf Umweltparameter für be-
troffene Vertragsparteien außerhalb der Ursprungsparteien haben.
Grenzüberschreitende Auswirkungen zwischen den Ursprungspar-
teien sind nicht auszuschließen und werden im Espoo-Bericht unter
Zugrundelegung der UVP-Methodik (s. Abschnitt 2.1) beschrieben
und bewertet.
Freisetzung von Schadstoffen in Ver- Rezeptoren:
bindung mit Sedimentfreisetzung Wasserqualität, alle biologischen Rezeptoren.
Merkmale der Auswirkungen:
Die Freisetzung von Schadstoffen resultiert aus der Resuspension
von Sedimenten. Die Ausbreitung sedimentgebundener Schadstoffe
wird sich hauptsächlich auf das Gebiet der Bauarbeiten beschränken
und einen Bereich von maximal 1 - 2 km zu beiden Seiten der Pipe-
line betreffen. In einigen Fällen (z. B. bei Sturmereignisse) können
in Abhängigkeit von dem Schadstoff niedrigen Konzentrationserhö-
hungen nachweisbar sein, die innerhalb von Stunden abklingen. Die
Dauer einer möglichen Auswirkung ist sehr kurz bis kurz.
Als vorhabenbedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen der
Wasserqualität, ein Schadstoffeintrag in die Fauna o. ä. möglich.
Scoping:
Schadstoffe werden keine nachteiligen grenzüberschreitenden Aus-
wirkungen auf Umweltparameter für die betroffenen Vertragspar-
teien außerhalb der Ursprungsparteien haben. Grenzüberschreitende
Auswirkungen zwischen den Ursprungsparteien sind nicht auszu-
schließen und werden im Espoo-Bericht unter Zugrundelegung der
UVP-Methodik (s. Abschnitt 2.1) beschrieben und bewertet.
Sedimentation Rezeptoren:
Wassertiefe (Bathymetrie), Oberflächensedimente, benthische Flora
and Fauna, Fische und Meeresbodenhabitate.
Merkmale der Auswirkungen:
Vorhabenbedingte Sedimentation ist nur in unmittelbaren Nähe der
Pipeline in einer Mächtigkeit von 2 bis 3 mm zu erwarten.
Auswirkungen können aus der Überdeckung von Flora, Fauna und
Habitat-Strukturen resultieren.
Scoping:
Die Sedimentation wird keine nachteiligen grenzüberschreitenden
Auswirkungen für die betroffenen Vertragsparteien außerhalb der
Ursprungsparteien haben. Grenzüberschreitende Auswirkungen zwi-
schen den Ursprungsparteien sind nicht auszuschließen und werden
im Espoo-Bericht unter Zugrundelegung der UVP-Methodik (s. Ab-
schnitt 2.1) beschrieben und bewertet.
Unterwasserschall Rezeptoren:
Meeressäuger und Fische.
Merkmale der Auswirkungen:
In Abhängig von den Baumaßnahmen und der Hintergrundbelastung
kann sich Unterwasserschall sehr weit ausbreiten. Die Schallausbrei-
tung hängt von dem physikalisch-chemischen Umfeld (Wassertiefe,
Meeresbodenbedingungen, Salzgehalt etc.) ab. Die Unterwasser-
schallausbreitung bei Bauarbeiten im südlichen und westlichen Be-
reichen der Ostsee wird in einer Entfernung von 25 bis 30 km von
der Quelle (Steinschüttungen) voraussichtlich unterhalb des Hinter-
grundwerts von 100 dB re 1 μPa liegen /11/. Die erhöhten Unter-
wasserschallpegel werden sofort nach dem Ende der Baumaßnahme
enden.
Ob Auswirkungen zu erwarten sind, hängt von den Rezeptoren ab.
Meeressäuger gehören zu den empfindlichsten Tieren in Bezug auf
Unterwasserschall. Auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Er-Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 19 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Mögliche Auswirkungen Eigenschaften und Rezeptoren
kenntnisse über Schwellenwerte hinsichtlich physischer Auswirkun-
gen auf Meeressäuger und von Erfahrungen aus ähnlichen Projekten
wird erwartet, dass die Auswirkungen auf die Hörfähigkeit (vorüber-
gehender Hörverlust /12/) durch Bauarbeiten am Meeresboden auf
weniger als 100° m von der Baustelle (/11/) begrenzt sind. Verhal-
tensänderungen können über einen längeren Zeitraum auftreten. Da
die Bauarbeiten zeitlich begrenzt sind, wird es aufgrund von Unter-
wasserschall sind keine erheblich nachteiligen grenzüberschreiten-
den Auswirkungen zu erwarten.
Scoping:
Unterwasserschall von den Bauarbeiten werden keine erheblich
nachteiligen, grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die betroffe-
nen Vertragsparteien außerhalb der Ursprungsparteien haben.
Grenzüberschreitende Auswirkungen zwischen den Ursprungspar-
teien sind nicht auszuschließen und werden im Espoo-Bericht unter
Zugrundelegung der UVP-Methodik (s. Abschnitt 2.1) beschrieben
und bewertet.
Störungen (z. B. durch die Anwesen- Rezeptoren:
heit von Schiffen sowie die Emission Vögel, Tourismus und Menschen.
von Schall und Licht der Schiffe)
Merkmale der Auswirkungen:
Störungen durch die Anwesenheit der Schiffe, Luftschall und Licht
sind auf die Gebiete in Nähe der Baustelle begrenzt.
Die Auswirkungen auf die marine Umwelt beschränken sich auf Vö-
gel. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die größte für Vö-
gel beobachtete Fluchtdistanz etwa 2 km beträgt (Trauerente /10/).
Die Auswirkungen werden vorübergehend sein, da Bauarbeiten nur
für eine kurze Zeit an einem bestimmten Standort stattfinden. Aus-
wirkungen in Küstennähe können potenziell auf Menschen und Tou-
rismus betreffen, diese werden nicht grenzüberschreitend sein.
Scoping:
Störungen von Bauarbeiten werden keine erheblich nachteiligen
grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die betroffenen Vertrags-
parteien außerhalb der Ursprungsparteien haben. Grenzüberschrei-
tende Auswirkungen zwischen den Ursprungsparteien sind nicht
auszuschließen und werden im Espoo-Bericht unter Zugrundelegung
der UVP-Methodik (s. Abschnitt 2.1) beschrieben und bewertet.
Sicherheitszonen um die Konstrukti- Rezeptoren:
onsschiffe Schiffsverkehr, kommerzielle Fischerei.
Merkmale der Auswirkungen:
Sperrzonen oder Sicherheitszonen um Bauschiffe herum können den
Schiffsverkehr und Fischereischiffe stören. Die Auswirkungen wer-
den voraussichtlich Stunden bis Tage dauern und sind daher tempo-
rär. Die Sicherheitszonen hängen von der Schiffsgröße und -aktivität
ab, werden aber voraussichtlich weniger als 3 km betragen.
Scoping:
Sicherheitszonen um die Bauschiffe herum werden keine erheblich
nachteiligen grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die betroffe-
nen Vertragsparteien außerhalb der Ursprungsdateien haben.
Grenzüberschreitende Auswirkungen zwischen den Ursprungspar-
teien sind nicht auszuschließen und werden im Espoo-Bericht unter
Zugrundelegung der UVP-Methodik (s. Abschnitt 2.1) beschrieben
und bewertet.
Emissionen von Luftschadstoffen und Rezeptoren:
Treibhausgasen Klima und Luft
Merkmale der Auswirkungen:
Emissionen von Luftschadstoffen (z. B. SOx, NOx etc.) werden durch
die Bauaktivitäten auftreten und wirken sich lokal (< 100 m), wo-
hingegen Treibhausgase globalere Auswirkung haben können und
das Klima beeinflussen. In Anbetracht der relativ kurzen Bauphase
und des geringen vorhabenbedingten Eintrags von Treibhausgasen
im Gebiet der Ostsee werden lediglich geringen Auswirkungen auf
die Luftqualität und die Belastung mit Treibhausgasen erwartet.Baltic pipe - Deutscher Teil der Ostsee Seite 20 / 27
Informationen über die geplante Tätigkeit – Espoo-Konvention Art. 3
Mögliche Auswirkungen Eigenschaften und Rezeptoren
Scoping:
Es werden Berechnungen der baubedingten Treibhausgas-Emissio-
nen einschließlich einer Abschätzung der globalen und damit grenz-
überschreitenden Auswirkungen durchgeführt. Nach dem derzeitigen
Kenntnisstand sind keine erheblich nachteiligen grenzüberschreiten-
den Auswirkungen zu erwarten.
Betriebsphase
Vorhandensein der Pipeline und physi- Rezeptoren:
kalische Strukturen des Meeresbodens Hydrographie, kommerzielle Fischerei.
Merkmale der Auswirkungen:
Die Pipeline kann theoretisch eine Barrierewirkung für den Was-
seraustausch in der Ostsee erzeugen. Da die Pipeline in ihrer Instal-
lationshöhe begrenzt ist und in vielen Bereichen in den Meeresboden
einsinken wird, sind signifikante Änderungen der Hydrographie nicht
zu erwarten.
Es ist allen betroffenen Vertragsparteien erlaubt, innerhalb der AWZ
zu fischen. Die kommerzielle Fischerei kann durch Hindernisse auf
dem Meeresboden (Pipeline oder Steinschüttungen), in denen
Schleppnetze steckenbleiben könnten, beeinträchtigt werden.
Dadurch könnten die Fischer gezwungen sein, andere Fanggebiete
aufzusuchen. In Bereichen mit Wassertiefen von weniger als 20° m
wird die Pipeline nachträglich eingegraben und wird insofern kein
Hindernis für die Fischerei darstellen. Es ist hervorzuheben, dass
das Vorhaben die Fischressourcen nicht verändern wird.
Scoping:
Veränderungen in der Hydrographie durch die Pipeline werden keine
erheblich nachteiligen grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die
betroffenen Vertragsparteien oder auf die Ursprungsparteien haben.
Da die Auswirkungen auf die kommerzielle Fischerei begrenzt sein
werden und der Fischbestand nicht verändert wird, werden die Pipe-
line und die Veränderungen der Beschaffenheit des Meeresbodens
voraussichtlich keine erheblich negativen grenzüberschreitenden
Auswirkungen auf die kommerzielle Fischerei haben.
Sicherheitszonen um die Wartungs- Rezeptoren:
schiffe Schiffsverkehr, kommerzielle Fischerei.
Merkmale der Auswirkungen:
Sperrzonen oder Sicherheitszonen um Wartungsschiffe herum kön-
nen den Schiffsverkehr und die Fischereischiffe stören. Die Auswir-
kungen werden voraussichtlich Stunden bis Tage dauern und sind
daher vorübergehend. Die Sicherheitszonen hängen von der
Schiffsgröße und -aktivität ab, werden aber voraussichtlich weniger
als 3 km betragen.
Scoping:
Sicherheitszonen um die Wartungsschiffe herum werden keine er-
heblich nachteiligen grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die
betroffenen Vertragsparteien außerhalb der Ursprungsdateien ha-
ben. Grenzüberschreitende Auswirkungen zwischen den Ursprungs-
parteien sind nicht auszuschließen und werden im Espoo-Bericht un-
ter Zugrundelegung der UVP-Methodik (s. Abschnitt 2.1) beschrie-
ben und bewertet.
Die möglichen grenzüberschreitenden Auswirkungen zwischen Ursprungsparteien und betroffenen
Vertragsparteien (auch betroffene Vertragsparteien, die gleichzeitig Ursprungsparteien sind) sind
in der Tabelle 2-3 dargestellt.Sie können auch lesen