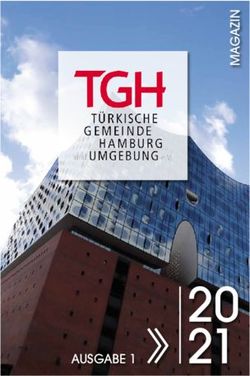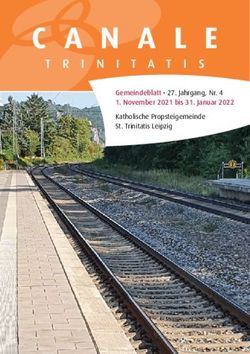Bemerkungen zu dem Versuch der Etablierung eines Erhaltungsbestandes von Pulsatilla pratensis ssp. nigricans im FND "Zechstein" Radebeul
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
BERICHTE DER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT DER OBERLAUSITZ
Band 28 Görlitz 2020 Seite 121–136
Bemerkungen zu dem Versuch der Etablierung
eines Erhaltungsbestandes von Pulsatilla pratensis
ssp. nigricans im FND „Zechstein“ Radebeul
Von BIRGIT ZÖPHEL und THOMAS PFEIFFER
Zusammenfassung
Der Bestand von Pulsatilla pratensis [L.] Mill. ssp. nigricans [Störck] Zamels brach in den ver-
gangenen 10 Jahren so stark ein, dass gegenwärtig nur noch ein im Landkreis Meißen gelegener
Standort mit weniger als 20 Pflanzen bekannt ist. Ab 2011 wurden aus diesem Grund Versuche zur
Etablierung eines Erhaltungsbestandes an einem ehemaligen Standort in der Lößnitz (Stadt Rade-
beul, im FND „Zechstein“) unternommen. Selbstgewähltes Ziel war es, zunächst die genetischen
Ressourcen der Reste der sächsischen Elbtalpopulation für die Dauer einer Generation zu sichern.
Die Versuche erfolgten parallel zu einem langjährigen Arterhaltungsprojekt des Umweltkreises
Wurzen im Ketzerbachtal. Unter Verwendung von Früchten der letzten Restpopulation konnte bei
jährlicher kontinuierlicher Auspflanzung über 8 Jahre inzwischen ein Bestand von 209 Individuen
aufgebaut und damit die Zielgröße von 200 Individuen erreicht werden. Aus den Erfahrungen der
Versuchsjahre ergeben sich folgende Faktoren als begünstigend oder entscheidend für die erfolg-
reiche Etablierung: ein Keimungsansatz nach Stratifizierung vorjähriger Früchte oder unbehandel-
ter Früchte direkt zum Zeitpunkt der Samenreife, die Verwendung einer speziellen basenreichen
handelsüblichen Kakteenerde als Anzuchtsubstrat, eine halbjährige Voranzucht unter Freilandbe-
dingungen in Töpfen, eine kurzrasige, exponierte Ausbringungsstelle und vor allem eine ausrei-
chende Bewässerung in den ersten drei Standjahren der Individuen. In diesem Artikel werden die
Methoden und ersten Ergebnisse der Versuche vorgestellt.
Abstract
Comments on the attempt to establish a conservation stock of
Pulsatilla pratensis ssp. nigricans in FND “Zechstein” Radebeul
The increasingly rapid decline of the population of Pulsatilla pratensis [L.] Mill. ssp. nigricans
[Störck] Zamels in Saxony during the last 10 years results in a current stock of less than 20
autochthone individuals. In 2011, we thus decided to establish a cultivation in a natural habitat of the
species at a location in the Lößnitz (commune Radebeul) to save the genetic ressources of the species.
Our approach built on experience gained through a previous long-time project of the Umweltkreis
Wurzen supporting the population of the species in the Ketzerbachtal near Lommatzsch. Using fruits
of the last autochthone plants for continuous planting over 8 years, resulted of 209 largely flowering
plants in 2019, thus reaching the target number of about 200 plants. In accordance with previous
findings we found the following protocol successful with respect to final establishment: germination
after stratification or immediately after harvest, pre-cultivation in a special commercial cactus potting
soil mixture, in situ-planting of well developed pre-cultivated plants, availability of a suitable site
with short vegetation and low vegetation cover and especially sufficient water supply during the first
three years after planting. In this paper we report the methods and first results of our measures.
Keywords: Conservation culture, FND Zechstein, Saxony.
121© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
1 Einleitung 1997 kontinuierlich betriebenen Populations-
stützungsvorhaben zur selben Art im Ketzer-
Von den aus Sachsen ehemals bekannten drei bachtal zurückgegriffen werden konnte. Das
Vertretern der Gattung Pulsatilla sind im Jahr Vorhaben am Zechstein in Radebeul fand in Ab-
2020 die Wiesenkuhschelle (Pulsatilla praten- stimmung mit dem Sächsischen Landesamt für
sis [L.] Mill. ssp. nigricans [Störck] Zamels) Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und mit
und die Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla Unterstützung der unteren Naturschutzbehörde
vulgaris Mill.) mit jeweils einem autochthonen statt. In diesem Artikel wird die Methodik und
Standort noch vorhanden, während die Früh- der bisher erreichte Stand dargestellt.
lings-Kuhschelle (Pulsatilla vernalis [L.] Mill.)
bereits ausgestorben ist (Hardtke & Ihl 2000).
Insbesondere die jahrzehntelangen Bemühun-
gen zum Erhalt der Gewöhnlichen Kuhschelle 2 Situation von Pulsatilla pratensis
an ihrem einzigen sächsischen Bestand durch ssp. nigricans in Sachsen
Klaus Zeibig in dem heutigen NSG „Wachtel- und im FND „Zechstein“
berg-Mühlbachtal“ waren Anstoß für die Be-
mühungen um die Wiesenkuhschelle am Zech- Pulsatilla pratensis wird in Sachsen der Unter-
stein. Vergleichbare Maßnahmen erschienen art nigricans zugeordnet (Gutte et al. 2013).
erforderlich, nachdem auch der ehemals große Insgesamt ist der Subspezies-Komplex nicht
Bestand der Wiesenkuhschelle im Elbhügelland endgültig bearbeitet, so unter anderem in Hin-
bei Meißen nach Verlusten zweier Vorkommen blick auf die Abgrenzung gegen P. pratensis
seit 2011 auf ein einziges bekanntes autochtho- ssp. bohemica (Skalický 1985). Die nächs-
nes Reliktvorkommen mit weniger als 20 Ex- ten Vorkommen von Pulsatilla pratensis ssp.
emplaren zurückgegangen war. Eine so kleine nigricans liegen in Südbrandenburg östlich
Population wird ungeachtet aller Bemühungen von Dahme/Mark, am Rand der Dübener Hei-
auf Dauer nicht bestehen, weil die Pflanzen mit de in Sachsen-Anhalt (Förster & Harzbäcker
hoher Wahrscheinlichkeit an dem auf einem ex- 2015). Im Böhmischen Mittelgebirge zwischen
trem exponierten Felssporn gelegenen Standort Ústi n. L. und Bílina schließt Pulsatilla praten-
nicht mehr erfolgreich reproduzieren können. sis ssp. bohemica an (Machová & Kubát 2004,
Seit längerem gibt es daher Überlegungen, ei- http://quick.florabase.cz).
nen Bestand autochthoner Wiesenkuhschellen Pulsatilla pratensis ist als Kaltzeit-Relikt der
zu etablieren, der die Erhaltung des genetischen spätglazialen Offenlandflora anzusehen (Hem
Potenzials der Elbtalpopulation in ausreichen- pel 2010). Ihr Areal ist baltisch-pontisch-pan-
der Individuenzahl und unter Standortbedingun- nonisch und weist eine hohe kontinentale Bin-
gen, die denen der letzten natürlichen Vorkom- dung auf. Die deutschen Vorkommen werden
men zumindest noch weitgehend nahekommen, bereits als zum westlichen Arealrand gehörend
zumindest für den Zeitraum der nächsten ca. 20 eingestuft (Richter & Schulz 2016). Pulsatil-
Jahre sichert. Die Voraussetzungen für dieses la pratensis ssp. nigricans gehört in Sachsen
Unterfangen erschienen im FND „Zechstein“ zum pontisch-zentralasiatischen Florenelement
in Radebeul wegen des bestehenden Flächen- (Hempel 2010) und hatte, soweit bekannt, his-
schutzes als flächenhaftes Naturdenkmal, der torisch ein Zentrum im wärmegetönten Elbhü-
vorhandenen Einhegung der Fläche, der Vege- gelland mit weiteren zerstreuten Vorkommen
tationsstruktur des Standortes sowie auf Grund auf den Elbniederterrassen zwischen Riesa und
des Umstandes, dass es sich um einen historisch Torgau (u. a. Weise 1935) sowie bei Großen-
bekannten Standort handelt, in besonderem hain, Dahlen, Taucha und Hartha-Waldheim
Maße gegeben. Entscheidend für die Standort- im Tief- und Hügelland (Richter & Schulz
wahl und die unten diskutierten Ergebnisse war 2016). Wünsche (1899) gibt die Art „im Dresd-
jedoch letztlich die für die Verfasser günstige ner und Leipziger Kreise zerstreut“ an. Der
Erreichbarkeit des Standortes in Hinblick auf Schwerpunkt der Lebensräume liegt, soweit
die Betreuung. Als zusätzlich günstig erwies dokumentiert, in kontinentalen Sand- und Fel-
sich, dass auf die Erfahrungen des Naturschutz- strockenrasen und bodensauren Eichenwäldern
vereins Umweltkreis Wurzen aus einem seit (Hartke & Ihl 2000).
122© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
Die Art ist in Sachsen seit längerem akut thone Pulsatilla pratensis ssp. nigricans handel-
vom Aussterben bedroht (Schulz 2013). Sach- te, denn Dr. F. Müller (TUD) konnte die Pflan-
senweit waren bereits 1950 70 % der Bestände zen als hybride gärtnerische Zuchtsorten mit An-
erloschen (Richter & Schulz 2016). Im Elb- teilen von Pulsatilla vulgaris charakterisieren.
hügelland waren 1978 45 von 49 dokumentier- Gleichwohl existierte im Bereich des Zech
ten Vorkommen erloschen, die meisten durch steins bis mindestens 1977 ein autochthones
Umnutzung oder Überbauung der Standor- Vorkommen von Pulsatilla pratensis ssp. nig-
te (Hardtke 1978). Seitens des Sächsischen ricans (Hardtke 1978). Der Verlust der letzten
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Pflanze am Zechstein hatte nach mündlicher
Geologie wurden zum Schutz der Art, für die Überlieferung einen örtlichen Naturschützer
Sachsen eine hohe Verantwortlichkeit hat, fol- veranlasst, in den 1980er Jahren den Standort
gende Maßnahmen vorgeschlagen (Richter & wieder „aufzupflanzen“. Die Herkunft und Art-
Schulz 2016): Erhaltung der Standorte, Re- zugehörigkeit dieser Ersatzpflanzung ist leider
vitalisierung der Restpopulation(en), Anlage nicht dokumentiert. Als Anfang der 1990er
von ex-situ-Beständen. Eine ex-situ-Erhal Jahre eine weißblühende Pflanze am Zechstein
tungskultur vom Standort Winkwitz, Knorre auftrat, wurde diese durch die Arbeitsgemein-
besteht in Sachsen im Botanischen Garten schaft Sächsischer Botaniker entfernt. Ob es
Dresden, Außenstelle Boselgarten. noch spätere Pflanzungen gegeben hat, ist of-
Aktuell ist noch ein autochthones Vor fen. Wahrscheinlich gehen die 2010 existen-
kommen der Art mit weniger als zwanzig Pflan ten Exemplare auf die Anpflanzungen in den
zen am Knorrefelsen bei Meißen bekannt, das 1980er Jahren zurück. Sie blühten regelmäßig,
durch vollständig fehlende Naturverjüngung Verjüngung bzw. eine Zunahme des Bestandes
gekennzeichnet und durch Verkehrssicherungs wurde jedoch nicht beobachtet.
maßnahmen und Vandalismus gefährdet ist. Der für das hier beschriebene Projekt ge-
2011 wurde das letzte autochthone Einzelpflan- wählte Auspflanzungs-Standort ist mit lückiger
zenvorkommen im Ketzerbachtal (FND Ponti- (Halb-)trockenrasen-Vegetation über saurem
scher Florenhang) durch Ausgraben vernichtet. Gesteinsverwitterungsboden mit basenreiche-
Der Standort der nunmehr letzten Restpopulati- ren Mikrostandorten den Standorten der letzten
on ist ungeeignet für eine Revitalisierung durch beiden Vorkommen ähnlich.
Rückpflanzung. Durch den Umweltkreis Wur-
zen werden seit 1997 Populationsstützungs-
maßnahmen (Auspflanzung, Betreuung) aus
der Herkunft Knorre und Herkunft Piskowitz 3 Das FND „Zechstein“
an Standorten im Ketzerbachtal vorgenommen
(u. a. Förster & Harzbäcker 2015). Angrenzend an die Weinbergslage Zechstein
Der Bestandsrückgang von Pulsatilla auf Zitzschewiger Flur der Stadt Radebeul
pratensis ssp. nigricans hat in Sachsen die befindet sich ein Geländesporn, über den eine
Schwelle zum Erlöschen der Art in autochtho- Grenzmauer verläuft. Auf dem steilen und
nen Beständen erreicht. 2019 wurden erstmals flachgründigen Ost- und dem tiefgründigeren
keine Blüten an den Altpflanzen des derzeiti- und teils terrassierten SW-Hang hat sich eine
gen Reliktstandortes festgestellt, möglicher- artenreiche Flora und Fauna der trockenwar-
weise infolge mehrjährigen Trockenstresses. men Standorte des Elbhügellandes mit konti-
Anhaltende Bestandsrückgänge werden auch nental geprägten Halbtrockenrasen in besonde-
aus Nordböhmen (Doc. RNDr. K. Kubát rer Fülle erhalten (Hardtke 2012). Besondere
per E-Mail am 24.4.2019), Südbrandenburg Schätze der Vegetation sind die Bestände der
(Dr. H. Illig mdl. am 3.5.2019) und Nordbran- gefährdeten Arten Anthericum ramosum, Phle-
denburg (Gall et al. 2015) berichtet. um phleoides, Helianthemum nummularium,
Im FND „Zechstein“ bestand bis in die Peucedanum cervaria, Geranium sanguineum,
letzten Jahre ein kleines Vorkommen von Carex humilis und Scabiosa columbaria. Die
5 Küchenschellen. Recherchen und eine genau- Insektenfauna ist artenreich und umfasst auf-
ere Betrachtung der vorhandenen Pflanzen im grund der Wirtspflanzenbindung seltene Arten
Jahr 2010 ergab, dass es sich nicht um autoch- wie den Fetthenne-Bläuling (Scolitantides ori-
123© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
on; Adam 2013), Thymian-Spitzmausrüssler Die Pflanzstandorte befinden sich am WSW-
(Squamapion hoffmanni) und die Ritterwanze exponierten Teil des Sporns. Pflanzbereich 1
(Lygaeus equestris). 1989 wurde das Biotop befindet sich an einer nur mäßig geneigten Stel-
als Flächennaturdenkmal MEI 054 „Zech- le mit fast geschlossener Vegetationsdecke und
stein“ unter Schutz gestellt und mit der Verord- höherem Anteil an Saumarten, Pflanzbereich 2
nung des Landkreises Meißen vom 10.3.2015 an einem sehr steilen Abschnitt mit lückigerer
(SächsGVBl. Nr. 6 vom 29.4.2015, S. 301) auf und stärker von Trockenrasenelementen ge-
einen 0,33 ha großen Hangabschnitt erweitert prägten Vegetation. Die Pflanzbereiche haben
und rechtsangepasst. eine Größe von jeweils ca. 4 × 10 m.
Den geologischen Untergrund bildet an der An beiden Stellen ist über stark verwittertem
Oberfläche stark verwitterter Syenit, der teils und kluftreichem Syenit ein grusiger Ranker
von basenreicheren Gangbildungen durch- ausgebildet, der Tiefgründigkeiten von 5–20 cm
setzt ist. Das anstehende Gestein wird auch erreicht. Aus der Bodenlösung wurden in Misch
als tektonisch beanspruchter Coswiger Granit proben über den Gesamtstandort in 1 N KCl-
bezeichnet (Mohnike et al. 2001). Der Boden Lösung pH-Werte von 3,67 und 4,45 ermittelt.
ist als flachgründiger Ranker (5–10 cm Boden) Die Vegetation bilden artenreiche, vom Rau-
oder in den terrassierten Bereichen als Rigosol blättrigen Schaf-Schwingel (Festuca brevipila)
(mind. 30–60 cm Boden) ausgebildet und ins- dominierte Silikat-Trockenrasen. Sie enthalten
gesamt schuttreich und insbesondere in den Elemente verschiedener Vegetationstypen, so
oberen Abschnitten von kleinräumig wech- unter anderem
selnder Tiefgründigkeit. Es handelt sich um • Arten der trockenwarmen Säume des V Ge-
einen sauren Gesteinsverwitterungsboden mit ranion sanguinei R. Tx. 1961 wie Geranium
basenreicheren Kluftfüllungen (J. Blau briefl. sanguineum, Vincetoxicum hirundinaria,
am 3.9.2014). Trifolium medium, Polygonatum odoratum,
Der örtliche Naturschutz und die Arbeits • Arten der Felsfluren, Silikat- und Sandtroc-
gemeinschaft Sächsischer Botaniker haben sich kenrasen der K Sedo-Scleranthetea (Br.-Bl.
von Anfang an für die Erhaltung des überregi- 1955) wie Sedum rupestre, Holosteum um-
onal bedeutsamen Trockenstandortes engagiert. bellatum, Dianthus carthusianorum,
Durch natürliche Sukzession verlorengegange- • Arten der Sandtrockenrasen (O Festuco-
ne Offenbiotope im unteren Hangbereich wur- Sedetalia R. Tx. 1951) mit Festuca brevipi-
den 2005 in Regie des BUND Radebeul auf- la, Thymus pulegioides,
wändig freigestellt. In den Folgejahren wurde • Arten der basenreichen Trocken- und Halb-
der obere Teil jährlich einmalig gemäht. 2013 trockenrasen (K Festuco-Brometea Br.-Bl.
konnte im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme et R. Tx. 1943) wie Phleum phleoides,
ein weiterer Hangabschnitt tiefgründig von der Carex humilis,
fortschreitenden Fliederverbuschung befreit • Arten der kontinentalen Trocken- und
werden und ist seit 2014 in die jährliche Pflege Halbtrockenrasen (V Festucetalia valesia-
einbezogen. Die Mahd erfolgt im Spätsommer cae Br.-Bl. et R. Tx. 1943) wie Scabiosa
mit der Motorsense und das Schnittgut wird ab- ochroleuca, Peucedanum oreoselinum, Ga-
transportiert. Die Pflanzbereiche wurden dabei lium glaucum, Anthemis tinctoria neben
regelmäßig von der Biotoppflege ausgenom- • Arten der submediterranen Trockenrasen
men und von Hand geschnitten. basiphytischer Standorte (V Xerobromion
Br.-Bl. et Moor 1938) Moravec in Holub
et al. 1967 und V Mesobromion Br.-Bl. et
Moor 1938) wie Anthericum ramosum.
4 Etablierung des Bestandes Vegetationskundlich ist die Zuordnung nicht
4.1 Standort und Vegetation eindeutig (Schubert et al. 1995). Die Vege-
tation der Pflanzbereiche ist in Tab. 1 doku-
Der Zechstein liegt am östlichen Rand des Rade- mentiert, die Nomenklatur richtet sich nach
beuler Elbtals auf einem ehemaligen Weinberg. Rothmaler, Kritischer Band, 11. Aufl. (Müller
Unmittelbar angrenzend wird auf Flächen der et al. 2016).
Winzergenossenschaft Meißen Wein angebaut.
124© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
Tab. 1: Vegetationsaufnahmen der beiden Pflanzbereiche. Deckungsgrade entsprechend r: 1 Individuen (Ind.),© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
Datum 3.6.17 3.6.17
Bezeichnung Pflanzbereich 1 Pflanzbereich 2
Standort Oberhang konvex Oberhang konvex
Boden Ranker Syenitgrus Ranker Syenitgrus
Exposition WSW WSW
Inklination 10,00 % 30,00 %
Größe (m) 2×8 2×8
D % Summe 85 70
D % Krautschicht 70 55
D % Moosschicht 50 35
D % Streuschicht 10 5
% offener Boden 15 25
Anzahl Arten Krautschicht 30 31
Festuca pallens . 1
Jasione montana . 1
Vulpia myuros . 1m
Potentilla neumanniana . 1
Polygonatum odoratum . +
Anthemis tinctoria . +
Turritis glabra . +
Hypericum perforatum . +
Echium vulgare . r
Hieracium lachenalii . r
Rumex acetosella . +
Rosa canina 1 r
Euonymus europaeus + .
Acer campestre r .
Syringa vulgaris . +
Rubus spec. . +
4.2 Herkünfte wurde bei der Ernte darauf geachtet, möglichst
Samen aller dreijährigen und älteren Indivi-
Alle am Standort Zechstein ausgebrachten duen zu verwenden. Die Gründe lagen in der
Pflanzen entstammen der Herkunft (Hk) Wink- Kontrolle von eventuellen Bastardierungen
witz, Knorre. Anzuchten aus den Herkünften am Standort der F1-Generation und der Über-
Piskowitz und Prositz konnten trotz Bemü- legung, insbesondere am Standort etablierte
hungen aufgrund des Ausfalls der letzten Jung- Pflanzen zur Vermehrung zu bringen.
pflanzen dieser Herkünfte beim Umweltkreis
Wurzen nicht mehr mit einbezogen werden.
Vom schwer zugänglichen Wildstandort wur- 4.3 Anzucht
den möglichst alle Individuen beerntet und
das Erntegut jahrweise getrennt nach Pflanzen Die Anzuchten für die ersten Auspflanzungen
unter Einbeziehung aller Individuen in die An- 2011 und 2012 wurden durch den Umweltkreis
zucht genommen. Ab 2015 wurde auch die F1- Wurzen vorgenommen. Die Aussaat erfolgte un-
Generation der Hk Winkwitz, Knorre aus den mittelbar nach der Ernte auf lehmiger Gartener-
Pflanzungen am Zechstein einbezogen. Hier de, welche mit Substrat vom Herkunftsstandort
126© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
gemischt wurde, im Freiland in 15 cm tiefen tiv basenreiche handelsübliche Kakteenerde
Kästen. Die Jungpflanzen verblieben bis zur (Hausmarke Dehner) verwendet (pH 6,0).
Auspflanzung im Herbst in den Aussaatkästen. Die Keimung erfolgte bei Zimmertemperatur
Für die folgenden Anzuchten wurde den Emp- (18–20 °C) unter lichtdurchlässiger Abdeckung
fehlungen von Kewitsch (2007) gefolgt. Die nach ca. 14 Tagen bis zu 21 Tagen. Nach wei-
Früchte wurden reif (Beginn des Ausstreuens) teren 14 Tagen war bei den ersten Pflanzen das
oder fast reif (endgültige Fruchtgröße erreicht, Dreiblattstadium erreicht.
Früchte noch grün und festhaftend) geerntet. Im Stadium von je einem Folgeblatt wur-
Die Früchte wurden im Anschluss trocken und den die Pflanzen in Pflanztöpfe (10 × 10 cm)
dunkel bei Zimmertemperatur gelagert. pikiert und ohne Folienabdeckung bei Zim-
Im Februar des Folgejahres erfolgte eine mertemperatur weiterkultiviert. Ab 2014
14-tägige Stratifizierung (tags Kühlschrank wurden die Jungpflanzen im Stadium von
+4 °C, nachts Gefrierschrank -8 °C) oder aus- ca. 3 Folgeblättern in ein schattiertes Freiland-
schließlich Gefrierschrank (-8 °C). Anschlie- zelt (Pflanzgarten des Umweltzentrums Dres-
ßend wurden die Früchte auf feuchtem Kü- den) überführt und unter Freilandbedingungen
chenpapier 2 Tage vorgequollen, bevor sie in bis zum Herbst weiterkultiviert.
Aussaattöpfe überführt wurden (je 3 Früchte Aus diesem Ansatztyp wurden ab 2015 jähr-
pro Topf). Als Substrat wurde nach mehre- lich größere Zahlen im Oktober ausgepflanzt
ren Versuchen mit anderen Ansaaten rela- (s. Tab. 2)
Tab. 2: Übersicht über Pflanzungen und Bestand am Standort Zechstein.
Datum Pflanzung (Individuen) Bestand (Individuen)
Pflanzbereich 1 Pflanzbereich 2 Summe Pflanzbereich 1 Pflanzbereich 2 Summe
12.11.2011 10 10 10 10
01.04.2012 0 9 9
06.06.2012 3 3 13 13
18.11.2012 21 21 33 33
22.04.2013 0 22 22
30.10.2013 0 24 24
05.03.2014 0 27 27
16.09.2014 0 29 29
04.05.2015 17 17 46 46
24.10.2015 10 45 55 53 45 98
01.04.2016 0 50 45 95
05.10.2016 32 32 48 77 125
25.05.2017 0 48 70 118
13.09.2017 15 15 45 80 125
19.04.2018 0 44 84 128
04.10.2018 19 20 39 61 99 160
06.04.2019 0 59 100 159
24.08.2019 0 59 88 147
04.10.2019 44 28 72 100 111 211
01.04.2020 0 99 110 209
Summe 124 140 264
127© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
Abb. 1: Frisch gepflanztes Exemplar Oktober 2017. Abb. 2: Ergänzungspflanzung Oktober 2019.
Foto: B. Zöphel Foto: B. Zöphel
2015 und 2016 wurde zusätzlich ein Teil der 2 g Wurzelaktivator von Neudorf ausgebracht.
frisch beernteten Samen unmittelbar nach Ernte Die Pflanzlöcher wurden vor und nach erfolg-
auf Kakteenerde ausgesät. Aus diesem Ansatz ter Pflanzung eingeschwemmt. Die Pflanz-
wurden 2015 17 Keimpflanzen bereits im Mai, stellen wurden zum besseren Wiederauffinden
2016 32 Jungpflanzen im Oktober desselben und zur Kennzeichnung der Kohorten mit far-
Jahres ausgepflanzt. big gekennzeichneten Holzstäbchen markiert
(Abb. 1, 2).
Anfang Juni 2012 und 2013 wurden frisch
4.4 Auspflanzung, geerntete Samen an 3 bzw. 6 vorbereiteten Stel-
in-situ-Keimversuche len (je ein Fruchtstand) direkt auf dem Boden
ausgebracht. Zur Verhinderung der vollständi-
Insgesamt wurden in acht Pflanzungen zwischen gen Austrocknung wurden die Aussaatstellen
2011 und 2019 264 Individuen ausgepflanzt, mit durchsichtigen Plastikschalen abgedeckt.
244 davon als Herbstpflanzung vorgezogener An keiner der Stellen konnte eine Keimung be-
Individuen jeweils im Oktober (s. Tab. 2). obachtet werden.
Am 6.6.2012 wurden drei Pulks Keimlinge
aus Sofortanzucht ausgebracht, welche in der
Folge zur Vereinfachung als ein Individuum 4.5 Pflanzpflege
(belegte Pflanzstelle) gezählt wurden.
Die Auspflanzung erfolgte bis Mai 2015 Besonderes Augenmerk wurde auf das Wässern
ausschließlich in Pflanzbereich 1 (im oberen der Jungpflanzen im ersten bis dritten Standjahr
Teil des FND), ab Oktober 2015 wurde ein gerichtet.
zweiter Pflanzbereich neu hinzugenommen. Im Verlauf der Jahre zeigte sich folgendes
Ab 2018 wurden Ergänzungspflanzungen in Vorgehen als erforderlich (und auf Grund der
beiden Pflanzbereichen durchgeführt. Lage des Pflanzortes nach Feierabend gerade
Die Individuen wurden einzeln oder in noch realisierbar): Im Frühjahr wurde nach
Trupps in die bestehende Vegetation gepflanzt. der ersten Trockenphase von ca. einer Woche
Als Pflanzstellen wurden vorher Bereiche mit mit dem Gießen aller Pflanzen der drei jüngs-
hohem Feinbodenanteil, mittlerer Tiefgrün- ten Kohorten begonnen. Spätestens im Som-
digkeit und lückiger Vegetation ausgewählt. mer wurde bei Temperaturen über 25 °C und
An den Pflanzstellen wurde der Boden ca. dreitägigem Niederschlagsausfall vorbeugend
10–15 cm tief gelockert. Alle Pflanzstellen er- mit dem regelmäßigen Gießen begonnen. Die
hielten eine im Durchmesser ca. 2–3 cm starke Pflanzen erhielten bis zum nächsten Nieder-
Lehm/Ton-Kugel zur Verbesserung der Wasser- schlag alle zwei Tage Wasser. In Hitzeperio-
bindung. Zusätzlich wurde pro Pflanzstelle ca. den ab Ende Juni bis in die erste Augustdekade
128© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
5 Ergebnisse
5.1 Keimung und Voranzucht
Die Keimung nach Stratifizierung setzte durch-
schnittlich nach 14 Tagen ein und zog sich über
weitere zwei bis drei Wochen hin. Die Keim-
raten schwankten von Jahr zu Jahr sehr stark.
Soweit die Mutterpflanzen bei der Aussaat ge-
trennt wurden, zeigte sich eine einzelne Mut-
terpflanze vom Standort Knorre als besonders
keimstark, während von anderen Mutterpflan-
zen keine bzw. sehr wenige Keimlinge auflie-
fen. Die besten Keimungsergebnisse wurden
Abb. 3: Beschattung und Austrocknungsschutz mit der Kakteenerde (Hausmarke Dehner,
27.8.2016. Foto: B. Zöphel pH-Wert 6,0) mit Werten zwischen 30 % und
52,5 %, erreicht. Bei zum Teil parallel ausge-
führten Aussaaten auf Erden mit höherem Hu-
wurde täglich gegossen. Pro Gießgang wurden musanteil lag der Aussaaterfolg unter 10 %.
ungefähr 10 l auf 30 Pflanzen aufgewendet und Die Keimlingsverluste bis zum 3-Blattstadi-
die Pflanzen direkt angegossen. Besonders bei um inklusive der Verluste beim Pikieren lagen
hoher Einstrahlung und Wind trocknet im gru- mit jährlichen Schwankungen unter ca. 5 %. Ab
sigen Syenitverwitterungsmaterial die obere dem 3-Blatt-Stadium starben nur noch verein-
Bodenschicht sehr rasch vollständig aus. Um zelt Pflanzen ab.
dem entgegenzuwirken, wurde der Boden um In der weiteren Voranzucht unter Frei
die Jungpflanzen teilweise zusätzlich locker mit landbedingungen überschritten die Verluste in
Grasschnitt ausgelegt. An Hochsommertagen keinem Jahr mehr als 10 % des in die Kultivie-
mit sehr starker Einstrahlung wurde ein regel- rung gegebenen Materials.
rechtes Verbrennen insbesondere der einjähri- Aussaaten unmittelbar nach der Ernte im
gen Jungpflanzen beobachtet. Deshalb wurden Frühjahr erfolgten in zwei Jahren. Dieses Ver-
ab 2014 bei entsprechenden Wetterlagen die fahren wurde insbesondere dann angewendet,
Pflanzen der zuletzt ausgepflanzten Kohorte wenn die Ergebnisse der Aussaat aus der Vor-
sowie im Ausnahmefall besonders gestresste jahresernte nach Stratifikation unbefriedigend
ältere Exemplare zeitweise beschattet. Hierzu waren. Mit beiden Ansätzen konnten bei Ver-
dienten mittig geteilte Pflanzgefäße für Wasser- wendung des gleichen Substrats vergleichbare
pflanzen aus Plastik (Abb. 3). Diese Schattie- Keimraten erzielt werden. Allerdings standen
rung war nach unserer Ansicht eine wesentliche den Jungpflanzen, welche aus der Ernte des
Komponente für die guten Anwuchsraten am Auspflanzjahres gezogen wurden, gegenüber
Standort. Das Gießen wurde grundsätzlich be- denen, welche aus der Ernte des Vorjahres ge-
gonnen, bevor die Pflanzen deutliche Trocken- zogen wurden, 1–2 Monate weniger Aufwuchs-
stressmerkmale zeigten. zeit bis zur Auspflanzung zur Verfügung.
4.6 Nicht-autochthone Pulsatilla spec. 5.2 Bestandsentwicklung
Alle Pulsatilla vulgaris-Exemplare bzw. Hybri- Der letzte dokumentierte Bestand umfasste am
den/Kultivare wurden am 4.5.2015 vollständig 1.4.2020 insgesamt 209 Individuen von Pulsa-
entfernt. Zwischen 2011 und 2015 wurden die tilla pratensis ssp. nigricans. Er resultiert aus
Blüten der Kultivare zur Verhinderung von Hy- acht Pflanzungen (s. u.) und setzt sich aus Indi-
bridisierung in der Knospe entfernt. viduen mit Bestandsaltern zwischen einem hal-
ben Jahr und neun Jahren zusammen (s. Tab. 2
und Abb. 4). Im Bestand wachsen Individuen
aus allen Pflanzjahren. Die Etablierungsrate
129© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
Abb. 4: Zeitpunkt und Anzahl gepflanzter Individuen und Entwicklung des Gesamtbestands.
beträgt über den Gesamtzeitraum bis Herbst gangenen Pflanzen wurden deshalb ein weiteres
2018 76,6 %. Der letzte Auspflanztermin blieb Jahr mit bewässert.
unberücksichtigt, um den Wert nicht zu verzer- Hinsichtlich der Überlebensraten im ers-
ren. ten Jahr konnten bisher zwischen den beiden
Die höchsten Abgänge wurden jeweils im Pflanzbereichen keine deutlichen Unterschiede
ersten Sommer nach Auspflanzung verzeichnet. festgestellt werden.
Die Verluste über das jeweils erste Standjahr la- Ein 2012 vorgenommener Versuch, frische
gen, soweit nachvollziehbar, zwischen 0 % und Samen am Standort auf vorbereiteten Stellen
33 % bei einem Mittelwert von 13 %. Die bei (gelockerter und aufgerauter Oberboden) zur
Auspflanzung kümmerlich gewachsenen Pflan- Keimung zu bringen, hatte trotz Wässerung und
zen mit geringer Wurzelentwicklung waren Abdeckung der Keimstellen keinen Erfolg.
stärker betroffen als kräftig entwickelte Exem- Von im Frühjahr 2012 im 1-Blatt-Stadium
plare mit starker Durchwurzelung des Ballens. ausgebrachten Sämlingen sind auch 2019 noch
Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, Pflanzen an zwei von drei Stellen vorhanden.
dass bei einzelnen Pflanzen die Hauptwurzel Diese verharren jedoch seit dem zweiten Stand-
bei der Auspflanzung beschädigt wurde. jahr in Kümmerwuchs mit 1–3 Fiederblättchen.
Pflanzen, welche das erste Jahr überstan- Prädation spielt am Standort eine unter-
den hatten, gingen nur noch selten verloren – geordnete Rolle. Vereinzelt wurden Exempla-
hauptsächlich vermutlich durch Prädation oder re „ausgegraben“ oder durch Grabung, wahr-
Beschädigung durch Wildtiere, seltener durch scheinlich durch Füchse, beschädigt. Dies be-
Vertrocknen. Einzelne Kümmerexemplare gin- traf jedoch nur je 1–3 Individuen pro Jahr, vor-
gen jedoch auch noch nach mehreren Jahren rangig in frischen Pflanzstellen. Blattfraß durch
Standzeit ein. Ölkäfer (Meloe spec.), die in den Populationen
Mehrfach, so 2013–2015 und 2017–2018, im Ketzerbachtal zum Teil erhebliche Schäden
wurde festgestellt, dass an Pflanzstellen, an verursachen (M. Braune mdl. am 20.4.2018,
denen keine Pflanze (Spross mit oder ohne M. Förster per E-Mail am 29.5.2017), gibt es
Blätter) mehr erkennbar war, zu einem darauf- am Standort Zechstein wegen des Fehlens der
folgenden Termin die Pflanzen wieder ausge- Arten nicht.
trieben hatten. Beobachtet wurde das sowohl Generative Vermehrung kann bisher am
bei Pflanzen, die im Frühjahr nicht erschienen Standort nur in einem Fall (ein Sämling in der
und im Herbst nach spätem Austrieb entwickelt Nähe einer Altpflanze) vermutet werden, ob-
waren, aber auch bei Pflanzen, die im Herbst wohl seit 2014 jeweils einige Blütenstängel
verschwunden waren und im Frühjahr wieder mindestens dreijähriger Individuen belassen
austrieben. Pflanzstellen mit scheinbar einge- wurden.
130© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
5.3 Vitalität und Blüherfolg ser Kohorte haben kräftige Stöcke entwickelt
und bilden regelmäßig reiche Rosetten mit
Die individuelle Vitalität der Pflanzen zeig- > 8 Fiederblättern (teilweise bis zu 25) aus. Eini-
te eine sehr weite Spannbreite. Es kann nicht ge verharren jedoch als kümmernde Rosetten mit
sicher nachvollzogen werden, ob dies stärker 4–8 jährlichen Blättern.
vom konkreten Pflanzstandort oder von der je- In warmen Sommern erfolgte das Einziehen
weiligen Mutterpflanze abhängig ist. Vermutet der Rosetten bereits ab Juli, in feuchten Som-
wird ein Einfluss beider Faktoren. Im ersten mern erst sehr viel später. Vollständig eingezo-
Sommer nach Pflanzung waren im Durch- gene Pflanzen wurden zumeist Ende Oktober
schnitt drei Laubblätter ausgebildet und der beobachtet.
Rosettendurchmesser betrug ca. 10–15 cm. In 2012 als Keimlinge ausgepflanzte Indivi-
jedem Pflanzfolgejahr zeigte jedoch eine grö- duen verharrten im Kümmerwuchs und haben
ßere Anzahl der Pflanzen eine eingeschränkte auch nach 5 Standjahren nur 1–3 Blättchen
Wüchsigkeit mit 2–3 Laubblättern und Roset- in einer© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
An den Jungpflanzen wurden im ersten und welt, Landwirtschaft und Geologie (u. a. Rich
zweiten Standjahr die Blüten entfernt. Dies ter & Schulz 2016). Nach den IUCN-Kriterien
diente der vegetativen Kräftigung der Pflan- (IUCN 2013) ist das Vorgehen als Wiederan-
zen und verhinderte zugleich eine Kreuzbe- siedlungsmaßnahme innerhalb des bekannten
stäubung, solange die Kultivare/Hybriden am Verbreitungsgebietes der Meta-Population des
Standort noch nicht entfernt waren. Ab dem sächsischen Elbtals zu bewerten. Derzeit deu-
dritten Standjahr, bei sehr kräftigen Exempla- ten die Beobachtungen jedoch nicht darauf hin,
ren im Ausnahmefall auch bereits im zweiten, dass sich die Art am Standort selbständig in
wurde die Blüte zugelassen (Abb. 5). größerem Umfang generativ regeneriert.
Die Pflanzen blühten ab dem dritten Jahr- Insofern wird die Aufgabe zunächst wei-
gang regelmäßig und fast vollständig. Die An- terhin darin gesehen, eine genetische Reserve
zahl der ausgebildeten Blüten pro Rosette be- unter den konkreten natürlichen Standortbe-
trug 1–7, im Durchschnitt 2. dingungen noch erhaltener Halbtrocken- und
Trockenrasen im Elbhügelland aufzubauen
und zu bewahren. Von einer reetablierten Po-
5.4 Artidentität pulation kann erst gesprochen werden, wenn
natürliche populationserhaltende generative
Die Individuen der Nachzuchten weisen die Verjüngung stattfindet (u. a. Monks et al. 2012,
typische Morphologie von Pulsatilla praten- Richter & Grätz 2018). Dazu müssen unseres
sis ssp. nigricans auf. In zwei Ausnahmefällen Erachtens angesichts des hohen Aufwandes zur
wurden vorsorglich Pflanzen wegen abwei Etablierung eines Bestandes nutzbare Optimal-
chender Morphologie (Blütenform) entfernt. standorte für die Art zur Verfügung stehen.
Es ist offensichtlich, dass die sächsischen
Restpopulationen sich nur an Stellen hal-
ten konnten, welche nicht landwirtschaftlich
6 Diskussion nutzbar und besonders nährstoffarm waren
und in deren engerem Umfeld außer gele
Die Nachzucht und Auspflanzung von Be- gentlicher (extensiver) Beweidung keine land
ständen vom Aussterben bedrohter Arten zur wirtschaftliche Nutzung stattgefunden hat. Die
Auffrischung oder Erhaltung der genetischen letzten drei Vorkommen (alle im Landkreis
Ressourcen und Einrichtung lebensfähiger Be- Meißen) fanden sich auf flachgründigen Fels
stände ist inzwischen etablierte Methode des standorten, teils mit einer Lößauflage. Auf na-
Naturschutzes (u. a. Abeli & Dixon 2016, Ras türliche Verjüngung gab es in den letzten Jahr-
cle et al. 2018) und wird auch in Sachsen prak- zehnten (nach dem Zweiten Weltkrieg) keine
tiziert (u. a. Richter & Schulz 2016, Zwiebel Hinweise.
2018). Wegen des hohen Aufwandes und des Nach Ansicht der Autoren stellen diese
nicht unstrittigen Eingreifens des Menschen Standorte ökologisch überwiegend keine Op-
in die, wenn auch anthropogen verursachten, timalhabitate für Pulsatilla pratensis dar. Ver-
Rückgangsprozesse kommt sie jedoch nur in mutet werden lückige und kurzrasige kontinen-
Ausnahmefällen, bei Vorhandensein geeigne- tale Sand- und lückige Halbtrockenrasen auf
ter Standorte und Beachtung der ökologischen tiefgründigeren, mindestens leicht basischen
und populationsbiologischen Arteigenschaften Sanden oder Löß als typische Habitate der Art.
in Betracht (u. a. Godefroid et al. 2016). Die Dies sind Vegetationstypen, welche in Sachsen
Entscheidung, hier einen ehemaligen Altstand- im Tief- und Hügelland nur noch punktuell,
ort zur Anlage einer in-situ-Erhaltungskultur etwa auf sehr mageren Extensivweiden, auftre-
für die nächste Generation zu nutzen, erfolgte ten. Solche besser geeigneten Standorte, wel-
angesichts des akuten Aussterbeprozesses der che zugleich langfristig gesichert und leicht zu
Art in Sachsen und angesichts der großen Be- betreuen sind, standen zu Projektbeginn nicht
mühungen mit leider nur geringen Erfolgen an und zwischenzeitlich auch nur in sehr begrenz-
den bekannten Standorten im Ketzerbachtal. tem Umfang zur Verfügung.
Wir folgen hier den Empfehlungen zur Arter- Die Wiesenkuhschelle (Pulsatilla praten-
haltung des Sächsischen Landesamtes für Um- sis) ist eine Art, für die in etlichen deutschen
132© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
Bundesländern und in europäischen Nachbar 2018) konnte jedoch nicht erreicht werden, weil
ländern entsprechende populationsstützende der Ausgangsbestand bereits unter 20 Pflanzen
Vorhaben durch Rückpflanzung, teils mit gu- lag. Da Keimung an natürlichen Standorten
tem Erfolg, bestehen. Projekte dazu gibt es schwierig und offensichtlich an Gunstjahre
unter anderem in Brandenburg unter Führung gebunden ist und auch wenig Ausgangsmateri-
des NABU in der Uckermark (Gall et al. al zur Verfügung steht, ist die Pflanzung einer
2015), Thüringen (Kienberg et al. 2013), Berlin Erhaltungspopulation hier das Mittel der Wahl
(Dr. E. Zippel mdl. am 28.6.2019), Schleswig- (Richter & Grätz 2018).
Holstein (Rickert & Drews 2009), in Kärnten Die Anzucht erfolgte in anderen Vorhaben
(Österreich) bei Steinkogel (Keusch 2017). Die (Gall et al. 2015, Förster & Harzbäcker
genannten Vorhaben beziehen sich auf die Sub- 2015) aus direkt nach der Ernte in Topfkultur
spezies nigricans. In Sachsen liegen langjähri- im Freiland ausgesäten Samen. Sowohl Aussaat
ge Erfahrungen aus den Projekten des Umwelt- unmittelbar nach der Ernte (Rickert & Drews
kreises Wurzen an drei Standorten im Ketzer- 2009) als auch Aussaat nach Stratifikation im
bachtal (u. a. Förster & Harzbäcker 2015) und folgenden Frühjahr führen offenbar innerhalb
aus einem Vorhaben der Arbeitsgemeinschaft einer Saison zu auspflanzfähigen kräftigen Ex-
Sächsischer Botaniker Anfang der 1990er Jah- emplaren. Die auf basenreicher Kakteenerde
re (Prof. Dr. H.-J. Hardtke mdl. am 17.6.2016) vorgenommenen Anzuchten weisen vergleichs-
vor. Ein sehr ähnliches Erhaltungsprojekt führt weise hohe Keimerfolge auf (vgl. Bochenkova
derzeit die Walter-Meusel-Stiftung für Pul- et al. 2015), während auf humoser, nährstoffrei-
satilla vulgaris Mill. im NSG „Wachtelberg- cher Anzuchterde die Keimung fast vollständig
Mühlbergtal“ durch (Walter-Meusel-Stiftung ausblieb. Als Ursachen hierfür kommen sowohl
Chemnitz 2018). zu hohe Stickstoffgehalte (Bochenkova et al.
Unsere Zielanzahl für den Erhaltungsbestand 2015) als auch zu niedrige Basengehalte in Be-
am Zechstein liegt bei 200 Individuen. Diese tracht. Für den Keimungserfolg werden auch
Zielgröße basiert auf den Angaben aus ver- Zusammenhänge mit der jahrweise möglicher-
gleichbaren Artenschutzprojekten (u. a. Fach weise schwankenden Fitness des Samenmate-
stelle Naturschutz Kanton Zürich 2004) und rials sowie der Konstitution einzelner Mutter-
allgemeinen Qualitätsstandards für Erhaltungs- pflanzen vermutet.
kulturen (Lauterbach et al. 2015). Richter & Trockenstress und Austrocknung wird ge-
Grätz (2018) empfehlen das Ausbringen von nerell als größtes Verlustrisiko in den ersten
250 Individuen bzw. das Erzielen eines Be- Standjahren betrachtet (Kienberg et al. 2013,
standes von 100 Individuen in der generativen Gall et al. 2015, Rickert & Drews 2009).
Phase. Die Anzahl soll zudem die Wahrschein- Auch in unserem Projekt führen die Autoren
lichkeit erhöhen, dass möglichst mehrere Ab- den überwiegenden Anteil der Verluste auf
kömmlinge aller Mutterpflanzen überleben und Vertrocknen der Feinwurzeln zurück. Zur Mi-
so die genetische Diversität des Ausgangsma- nimierung wurden in anderen Vorhaben beson-
terials weitgehend erhalten bleibt. Für die Er- ders tiefe Anzuchttöpfe für eine ausgeprägte
mittlung einer MVP (minimal viable populati- Tiefenwurzelentwicklung bei der Anzucht ver-
on) sind in der Regel umfangreiche Kenntnisse wendet (Becker et al. 2016, Rickert & Drews
zur Art und Berechnungsmodelle erforderlich, 2009) oder Schattenplätze für die Ausbringung
die für Pulsatilla pratensis ssp. nigricans nicht bevorzugt (Gall et al. 2015). Eine Bewässe-
vorliegen. Nach Erreichen einer Bestandsgrö- rung ist an abgelegenen Standorten schwierig
ße von > 200 Pflanzen im Jahr 2019 soll in den durchführbar. Die Rückpflanzungen im Ketzer-
Folgejahren notfalls durch Nachpflanzungen bachtal werden in Trockenphasen wöchentlich
der Bestand stabil gehalten werden. bewässert (Förster & Harzbäcker 2015), in
Das begrenzte genetische Ausgangsmaterial ausgeprägten Trockenphasen sehen das die Au-
der Wildpopulation wurde so vollständig wie toren als nicht ausreichend an.
möglich verwendet und bis auf ein Jahr wurden Unser Grundprinzip war, den geschilderten
stets Früchte des Wildvorkommens verwendet. Schwierigkeiten bei der dauerhaften Etablie-
Die empfohlene Herkunftsindividuenzahl von rung der Jungpflanzen bewusst mit gärtneri-
50 (Lauterbach et al. 2015, Richter & Grätz schen Maßnahmen am Ausbringungsstandort
133© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
in den ersten drei Jahren nach der Pflanzung anzusehen, jedoch nicht optimal. Günstig sind
entgegen zu wirken. Den Erfahrungen nach ist offenbar insbesondere basenreiche (lehmige)
es entscheidend, das vollständige Austrocknen Sande oder sandige Lehme ansonsten geringer
der Wurzelballen zu verhindern, solange die Nährstoffversorgung und mit geringem Hu-
sich bildende Pfahlwurzel keine Bodenfeuch- musgehaltes (Gall et al. 2015, Dr. E. Zippel
tigkeit speichernde Schichten gefunden hat. mdl. am 28.6.2019). Eine mittlere Basensätti-
Auf der anderen Seite wurde befürchtet, damit gung und ein pH > 5 werden als essentiell ange-
eine (zu) starke „Komfort-Bewässerung“ zu sehen (Gall et al. 2015).
riskieren, welche ggf. die Feinwurzelbildung Aufgrund der Beseitigung der Kultivare vom
der Pflanzen in die austrocknungsgefährdeten Standort und der Verhinderung gemeinsamer
oberflächennahen Bereiche lenkt. Im Zweifel Blüte ist eine Hybridisierung am Standort aus-
erfolgte stets eine Wässerung. zuschließen. Ob eine Hybridisierung mit im
Zur Minimierung jahrweise hohen Verlust Umkreis von 200 m gärtnerisch kultivierten
risikos und aufgrund des beschränkten Aus Pulsatilla-Kultivaren (vgl. Zimmermann 2007)
gangsmaterials wurde eine kontinuierliche Auf dauerhaft ausgeschlossen werden kann, ist
pflanzung des Bestandes über mehrere Jahre nicht absehbar. Der Bestand muss daher spätes-
vorgenommen. tens nach generativer Vermehrung und Nutzung
Die Anwuchserfolge waren am Zechstein mit der F1-Generation zur Nachzucht regelmäßig
76 % eher hoch. Aus Projekten ohne Bewässe- auf morphologisch abweichende Individuen
rung werden für die Art je nach Standort An- geprüft werden. Im Zweifelsfall sind diese zu
wuchserfolge von unter 20 % bis über 90 % be- entnehmen.
richtet (Kienberg et al. 2013, Gall et al. 2015, Das Projekt am Standort soll insoweit fort-
Dr. E. Zippel mdl. am 28.6.2019). Dass Indi- geführt werden, als dass die Zielbestandsgröße
viduen bei Trockenstress vorzeitig einziehen durch Nachpflanzungen erhalten werden soll
und im Folgejahr wieder erscheinen können, und das Monitoring weitergeführt wird. Da-
bestätigen u. a. Rickert & Drews (2009). Das rüber hinaus ist geplant, an einem weiteren
Verlustgeschehen wurde unseres Erachtens im Standort im Umfeld ehemaliger Vorkommen
Wesentlichen davon bestimmt, ob Jungpflan- im Meißner Raum einen weiteren Bestand nach
zen an einen geeigneten Individualstandort ge diesem Muster aufzubauen. Der Bedarf, die
pflanzt werden. An Standorten, an denen eine Jungpflanzen in den ersten drei Standjahren re-
Jungpflanze verloren ging, waren auch Ver- gelmäßig zu gießen und die bisher ausbleiben-
suche einer Nachpflanzung nicht erfolgreich. de generative Regeneration verdeutlichen, dass
Daher wurden die letzten Pflanzungen überwie- es sich zunächst nur um Erhaltungsbestände der
gend verdichtend an erfolgreichen Standorten genetischen Ressourcen unter möglichst natur-
durchgeführt. nahen Bedingungen und sehr wahrscheinlich
Generative Vermehrung in Anpflanzungen nicht um die Etablierung vitaler Populationen
ist von einem Dünenstandort in Berlin bekannt handeln wird.
(Dr. E. Zippel mdl. am 28.6.2019). Das mehr-
jährige Ausbleiben von generativer Vermeh-
rung ist bei mehrjährigen Grünlandarten nicht
selten (Albrecht et al. 2018), insbesondere, 7 Dank
wenn spezielle Bedingungen, wie günstige
Niederschlagsverhältnisse für Keimung und Unser Dank gilt vor allem der Winzer
die kritische Keimlingsphase, erforderlich sind. genossenschaft Meißen für die Koope-
Die äußerst geringe in-situ-Keimung von Pul- ration bei der Erhaltung des Standortes,
satilla pratensis bestätigen u. a. Bochenková dem Botanischen Garten Dresden, Frau
et al. (2012). Geeignete Keimstellen sind in der Dr. Barbara Ditsch und Frau Helga Petzold,
lückigen Vegetation am Maßnahmenstandort für wesentliche Hinweise zur Kultivierung
vorhanden. und Voranzucht, dem Umweltzentrum Dres-
Die Standortbedingungen am Zechstein in den, Frau Silvana Eger, für sehr erfolgreiche
Radebeul sind in Bezug auf Bodenstruktur, Zwischenkultivierungen seit 2015, Dr. Chris-
Begleitvegetation und Boden-pH als geeignet tian Müller für jahrelange engagierte Organi-
134© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
sation und Herrn Frank Mühlberg für die Aus- Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich (2004):
führung der Landschaftspflege im FND, Herrn Artenschutzmaßnahmen für gefährdete Farn- und
Alfred Niese für die Betreuung des FND, Herrn Blütenpflanzen im Kanton Zürich, Aktionsplan
Matthias Förster vom Umweltkreis Wurzen für Gewöhnliche Küchenschelle (Pulsatilla
Hinweise zur Pflanzung und die Bereitstellung vulgaris): 27 S.
der Pflanzen 2011 und 2012, der BUND-Gruppe Förster, M. & G. Harzbäcker (2015): Bestands-
Radebeul, insbesondere Frau Brigitte Heyduck stützende Artenschutzmaßnahmen für die Wiesen-
und Herrn Henry Nitzsche, für vorangegange- kuhschelle (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) im
ne Entbuschungsmaßnahmen und die zeitwei- Landkreis Meißen. Abschlussbericht zum Förder-
se Mitwirkung bei der Anwuchspflege, Herrn zeitraum 2011–2014. – Unveröff. Bericht: 13 S.
Dr. Frank Müller für fachliche Hinweise zur Gall, B., U. Kietsch, T. Volpers & N. Bukowsky
Artbestimmung und Frau Dr. Elke Zippel für (2015): Maßnahmen zur Förderung ausgewählter
Anregungen zum Management. Darüber hin- Verantwortungsarten in der Uckermark ein
aus danken wir Herrn Prof. Hans-Jürgen Hard- schließlich Monitoring. – Naturschutz und Land
tke, Herrn Dr. Hubert Illig, Herrn Jan Blau und schaftspflege in Brandenburg 24, 2: 30–44
Herrn Dr. Peter Kneis für fachliche Hinweise. Godefroid, S., S. Le Pajolec & F. Van Rossum
(2016): Pre-translocation considerations in rare
plant reintroductions: implications for designing
protocols. – Plant Ecology 217: 169–182
8 Literatur Gutte, P., H.-J. Hardtke & P. A. Schmidt (2013):
Die Flora Sachsens und angrenzender Gebiete. –
Abeli, T. & K. Dixon (2016): Translocation ecology: Quelle & Meyer Verlag; Wiebelsheim: 983 S.
the role of ecological sciences in plant transloca- Hardtke, H.-J. (1978): Die Verbreitung der Wiesen-
tion. – Plant Ecology 217: 123–125 Küchenschelle (Pulsatilla pratensis) im Elbhügel-
Adam, M. (2013): Tagfalterkartierung im Rahmen land und Maßnahmen zu ihrer Erhaltung. – Mit-
des Tagfalter-Monitoring Deutschland 2008 – teilungen der Arbeitsgemeinschaft Sächsischer
2014, Bericht 2013. – Unveröff. Bericht: 2 S. Botaniker 4, 2: 26–32
Albrecht, M. A., O. L. Osazuwa-Peters, Hardtke, H.-J. (2012): Der Zechstein – Weinberg
J. Maschinski, T. J. Bell, M. L. Bowles, und Flächennaturdenkmal. – Mitteilungen des
W. W. Brumback, J. Duquesnel, M. Kunz, Landesvereins Sächsischer Heimatschutz e. V.,
J. Lange, K. A. McCue, A. K. Mc Eachern, Heft 1: 20–22
S. Murray, P. Olwell, N. B. Pavlovic, Hardtke, H.-J. & A. Ihl (2000): Atlas der Farn- und
C. L. Peterson & S. J. Wright (2018): Effects of Samenpflanzen Sachsens. – Sächsisches Lan-
life history and reproduction on recruitment time desamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Ma-
lags in reintroductions of rare plants. – Conserva- terialien zu Naturschutz und Landschaftspflege;
tion Biology 33, 3: 601–611 Dresden: 806 S.
Becker, T., O. Kienberg & L. Thill (2016): Wieder- Hempel, W. (2010): Die Pflanzenwelt Sachsens von
ansiedlung seltener Pflanzenarten in Steppenrasen der Späteiszeit bis zur Gegenwart. – Weißdorn-
in Thüringen – Einflüsse der Quellpopulation und Verlag; Jena: 248 S.
des Zielhabitats auf den Wiederansiedlungserfolg. IUCN (2013): IUCN Guidelines for reintroductions
– Vortrag am 1.9.2016 in Dresden-Pillnitz: Fach- and other conservation translocations. Version
kolloquium „Strategien – Methoden – Ergebnisse 1.0. – IUCN Species Survival Commission (ed.);
von Artenhilfsmaßnahmen im Offenland“. Gland, Switzerland: 72 S.
Bochenková, M., M. Hejcman & P. Karlik (2012): Keusch, C. (2017): Revitalisierung der Halb
Effect of plant community on recruitment of trockenrasen am Steinkogel. – Arbeitsbericht,
Pulsatilla pratensis in dry grassland. – Scientia unveröff. Manuskript: 2 S.
Agriculturae Bohemica 43, 4: 127–133 Kewitsch, T. (2007): Populationsdynamik und Wie-
Bochenková, M., P. Karlik & M. Hejcman (2015): deransiedlungserfolg von Pulsatilla pratensis (L.)
Effect of nitrogen, appendage removal, locality and MILL. unter unterschiedlichen Habitatbedingun-
year on seed germination of the endangered dry gen – Voruntersuchungen für ein Artenhilfspro-
grassland species Pulsatilla pratensis (L.) Mill. – gramm. – Dipl.-Arbeit, Univ. Greifswald: 102 S.
Propagation of Ornamental Plants 15, 4: 154–162
135© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de
ISSN 0941-0627
Kienberg, O., L. Thill & T. Becker (2013): Wie- wählter Arten in Sachsen. – Sächsisches Landes-
deransiedlung von Astragalus exscapus, Scor- amt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
zonera purpurea und Pulsatilla pratensis subsp. (Hrsg.); Dresden: 408 S.
nigricans in Steppenrasen in Thüringen – erste Rickert, B.-H. & H. Drews (2009): Ein erster Schritt
Ergebnisse eines laufenden Projektes. In: Baum zu einem Populationsmanagement für Pulsatilla
bach, H., S. Pfützenreuter (Red.): Steppen pratensis (L.) Mill. in Schleswig-Holstein? – Kie-
lebensräume Europas – Gefährdung, Erhaltungs- ler Notizen zur Pflanzenkunde 36, 2: 37–41
maßnahmen und Schutz. – Thüringer Ministerium Schubert, R., W. Hilbig & S. Klotz (1995): Be-
für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Natur- stimmungsbuch der Pflanzengesellschaften Mit-
schutz (Hrsg.); Tagungsband, Erfurt: 373–383 tel- und Nordostdeutschlands. – Gustav-Fischer-
Lauterbach, D., P. Borgmann, J. Daumann, Verlag; Jena, Stuttgart: 403 S.
A.-L. Kuppinger, D. Listl, A. Martens, P. Nick, Schulz, D. (2013): Rote Liste und Artenliste Sach-
S. Oevermann, P. Poschlod, A. Radkowitsch, sens – Farn- und Gefäßpflanzen. – Sächsisches
C. Reisch, A.-D. Stevens, C. Straubinger, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und
S. Zachgo, E. Zippel, E. & M. Burkart (2015): Geologie (Hrsg.); Dresden: 310 S.
Allgemeine Qualitätsstandards für Erhaltungskul- Skalický, V. (1985): Taxonomische und nomenkla-
turen gefährdeter Wildpflanzen. – Gärtnerisch- torische Bemerkungen zu Gattungen Aconitum L.
Botanischer Brief 200, 2015/2: 24 S. und Pulsatilla Mill. – Preslia 57: 135–143
Machová, I. & K. Kubát (2004): Zvláště chráněné Walter-Meusel-Stiftung Chemnitz (2018): Die
a ohrožené druhy rostlin Ústecka. – Academia, Kuhschelle Pulsatilla vulgaris in Sachsen. – Falt-
nakladadelství AV ČR, Praha: 220 S. blatt im Rahmen der Veröffentlichung zum För-
Mohnicke, M., M. Kurze & M. Tichomirowa (2001): dervorhabens EPLR: 2 S.
Petrogenese und Altersstellung der Gesteine des Weise, P. (1935): O schöne Heimat! – Unsere Hei-
„Coswiger Komplexes“ (Elbzone). – Zeitschrift mat: Beilage Riesaer Tageblatt 8, 18; 1 S.
für Geologische Wissenschaften, Berlin, 29, Wünsche, O. (1899): Die Pflanzen des Königreichs
5/6: 505–519 (http://quick.florabase.cz/ vom Sachsen und der angrenzenden Gegenden. 8. Aufl.
15.7.2017) – Verlag B. G. Teubner; Leipzig: 447 S.
Monks, L., D. Coats, T. Bell & M. Bowles (2012): Zimmermann, F. (2007): Rechtliche und fachliche
Determining Success Criteria for Re-Introduc- Grundlagen für das Ansiedeln von Pflanzen und
tions of Threatened Long-Lived Plants. – In: Aussetzen von Tieren. – Naturschutz und Land-
Maschinski, J. & K. E. Haskins (ed.): Plant Re- schaftspflege in Brandenburg 16, 3: 92–93
introduction in a Changing Climate: Promises Zwiebel, L. (2018): Vermehrung und Wieder
and Perils. – Island Press; Washington, Covelo, ansiedlung gefährdeter Pflanzenarten in der
London: 189–208 Oberlausitz. – Berichte der Naturforschenden
Müller, F., Ch. M. Ritz, E. Welk & K. Wesche Gesellschaft der Oberlausitz 26: 45–58
(Hrsg.) (2016): Rothmaler – Exkursionsflora von
Deutschland. Gefäßpflanzen: Kritischer Ergänzu-
ngsband. 11. Aufl. – Springer-Verlag; Berlin, Anschriften der Verfasser
Heidelberg: 221 S.
Rascle, P., F. Bioret, S. Magnanon, E. Glemarec, Birgit Zöphel
C. Gautier, Y. Guillevi & S. Gallet (2018): Gröbastr. 12
Identification of success factors for the reintroduc- 01445 Radebeul
tion of the critically endangered species Eryngium E-Mail: bzoephel@web.de
viviparum J. Gay (Apiaceae). – Ecological Engi-
Thomas Pfeiffer
neering 122: 112–119
Sagarder Weg 8,
Richter, F. & Ch. Grätz (2018): Leitfaden zur
01109 Dresden
Wiederansiedlung und Populationsstützung von
E-Mail: tp1956@web.de
Pflanzen in Sachsen. – Schriftenreihe des Landes-
amtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
2018, 1: 61 S.
Manuskripteingang 25.3.2020
Richter, F. & D. Schulz (2016): Farn- und Samen-
Manuskriptannahme 7.5.2020
pflanzen – Bestandssituation und Schutz ausge-
Erschienen 17.12.2020
136Sie können auch lesen