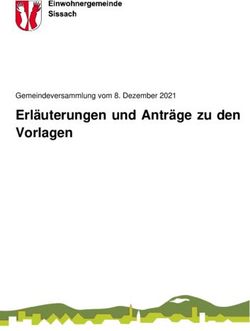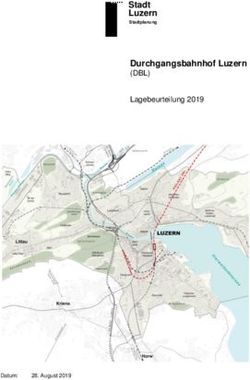Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen Gesamtbericht
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen Gesamtbericht Stand 02.03.2023 Auftraggeber: Bezirksamt Hamburg-Nord Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt Abteilung Landschaftsplanung Kümmellstraße 6 20249 Hamburg Auftragnehmer: Neue Große Bergstraße 20 22767 Hamburg
Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
3.6 Reptilien .............................................................................................................................. 67
3.6.1 Methode .............................................................................................................................. 67
3.6.2 Ergebnisse ........................................................................................................................... 67
3.6.3 Bewertung und Empfehlungen zur Rahmenplanung .......................................................... 69
3.7 Nachtkerzenschwärmer ...................................................................................................... 69
3.7.1 Methode .............................................................................................................................. 69
3.7.2 Ergebnisse ........................................................................................................................... 69
3.7.3 Bewertung und Empfehlungen zur Rahmenplanung .......................................................... 72
3.8 Scharlachkäfer ..................................................................................................................... 72
3.8.1 Methode .............................................................................................................................. 73
3.8.2 Ergebnisse ........................................................................................................................... 73
3.8.3 Bewertung und Empfehlungen zur Rahmenplanung .......................................................... 76
3.9 Weitere Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie - Potenzialabschätzung................... 77
4. Zusammenfassende Bewertung zur Rahmenplanung ....................................................... 77
5. Zusammenfassung .......................................................................................................... 79
6. Literatur, Quellen ........................................................................................................... 80
Seite 2Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Artenliste Vögel, inkl. Bestands- und Statusangaben sowie Brutgilde. ......................... 21
Tabelle 2: Begehungstermine Habitatstrukturerfassung und Detektor-Begehungen.................... 32
Tabelle 3: Nachgewiesene Fledermausarten. ................................................................................. 36
Tabelle 4: Ergebnisse der Fledermauserfassung an den einzelnen Horchboxen. .......................... 37
Tabelle 5: Begehungstermine Amphibien mit Witterungsdaten. ................................................... 47
Tabelle 6: Gesamtergebnis der Amphibienuntersuchung der Gewässerbereiche im UG. ............. 51
Tabelle 7: Funde anwandernder Amphibien insg., differenziert in Teilbereiche. .......................... 53
Tabelle 8: Erfasste Kaulquappen in Molchfallen im RHB. ............................................................... 53
Tabelle 9: Witterung an den Kartierterminen der Libellenerfassung 2022. ................................... 58
Tabelle 10: Abundanzklassen gemäß Schutzgemeinschaft Libellen Baden-Württemberg. ............. 59
Tabelle 11: Verhaltenscodes zur Ableitung einer möglichen Bodenständigkeit. ............................. 59
Tabelle 12: Verhaltensweisen von Libellen zur Beurteilung der Reproduktion. .............................. 59
Tabelle 13: Gesamtergebnis der Libellenkartierung 2022 – Nachweise an den
Untersuchungsstrecken US I bis US IV. ........................................................................ 60
Tabelle 14: Ergebnisse der Libellenkartierung US I – Status und Bestand 2022. ............................. 61
Tabelle 15: Ergebnisse der Libellenkartierung US II – Status und Bestand 2022. ............................ 63
Tabelle 16: Ergebnisse der Libellenkartierung US III – Status und Bestand 2022. ........................... 65
Tabelle 17: Ergebnisse der Libellenkartierung US IV – Status und Bestand 2022. ........................... 66
Tabelle 18: Vorkommenspotenzial der in Hamburg nachgewiesenen Reptilienarten im UG. ......... 68
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Untersuchungsgebiet für die Bestandserhebungen Fauna und Biotoptypen....................... 5
Abb. 2: Karte des Untersuchungsgebiets mit der Einteilung in Teilgebiete und Teilbereiche. ......... 6
Abb. 3: Biotoptypen im UG. ............................................................................................................. 15
Abb. 4: Gesetzlich geschützte Biotope im UG. ................................................................................ 17
Abb. 5: Lage der Standorte der Horchboxen im UG. ....................................................................... 33
Abb. 6: Begehungs-Strecke. ............................................................................................................. 34
Abb. 7: Aktivitätsschwerpunkte für Fledermäuse im UG. ............................................................... 44
Abb. 8: Lage der Molchfallen im RHB. ............................................................................................. 48
Abb. 9: Lage der Untersuchungsbereiche (UB) 1 bis 5 zur Amphibienerfassung. ........................... 49
Abb. 10: Wanderbewegungen von Erdkröten und Grasfröschen im UG. ......................................... 54
Abb. 11: Untersuchungsstrecken (US) zur Libellenerfassung. ........................................................... 58
Abb. 12: Untersuchte Bestände von Wirtspflanzen des Nachtkerzenschwärmers. .......................... 70
Abb. 13: Untersuchte Standorte mit Gehölzen der Weichholzarten. ............................................... 74
Anhangsverzeichnis
Anhang 1: Karte: Biotoptypen im UG Format A3
Anhang 2: 5 Karten: Ergebnisse Brutvogel-Revierkartierung Format A3
1 Tabelle: Ergebnisse Brutvogel-Reviere häufige Arten Format A3
Anhang 3: 2 Karten: Ergebnisse Fledermauserfassung Format A3
Seite 3Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
1. Anlass und Aufgabenstellung
Für ein Gebiet am Diekmoor in Langenhorn erstellt das Bezirksamt Hamburg-Nord einen
städtebaulichen Rahmenplan für eine mögliche zukünftige wohnbauliche Nutzung.
Zur Schaffung einer Bewertungsgrundlage für mögliche Auswirkungen der Planung auf den Bestand an
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten sowie auf den Biotopbestand wurden Bestandserhebungen im
Untersuchungsgebiet durchgeführt.
Mit den Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen wurde das Büro Bartels Umweltplanung,
Dipl.-Biologe Torsten Bartels, Hamburg, im Dezember 2021 beauftragt.
Die Bestandserhebungen umfassen zum einen eine Biotoptypenkartierung für das
Untersuchungsgebiet (UG).
Zu den Tierartengruppen Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien und Libellen wurden
Bestandserhebungen über Felderfassungen durchgeführt. Für Bereiche im UG, die für die
Durchführung der Erfassungen nicht zugänglich waren, wurde die Datenerhebung durch
Potenzialanalysen ergänzt. Dabei wird auf Grundlage der Habitatstruktur im Gebiet und der
bestehenden Verbreitungsdaten der Arten das Vorkommenspotenzial für die jeweiligen Arten im UG
ermittelt.
Entsprechende Potenzialanalysen wurden auch zu den Artengruppen Reptilien sowie zu den
Insektenarten Nachtkerzenschwärmer und Scharlachkäfer durchgeführt. Dazu werden zuvor potenziell
geeignete Habitate im UG erfasst und untersucht.
Die Lage und die Abgrenzung des UG sind in Abb. 1 dargestellt.
Die örtlichen Erfassungen wurden im März 2022 begonnen und im September 2022 abgeschlossen.
Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der Erfassungen und Untersuchungen zur Fauna und
zum Biotopbestand dargestellt und bewertet. Zur städtebaulichen Rahmenplanung werden
Empfehlungen gegeben, wie mögliche Beeinträchtigungen für die Fauna und den Biotopbestand
möglichst vermieden oder vermindert werden können.
2. Lage und Gliederung des Untersuchungsgebietes
Das Untersuchungsgebiet für die Arten- und Biotopkartierung liegt nordwestlich der U-Bahnstation
Langenhorn Nord. Es wird folgendermaßen begrenzt:
• Im Osten von den auf einem Damm verlaufenden Gleisen der U-Bahnlinie U1,
• im Süden durch die Straße Foorthkamp,
• im Westen durch die Langenhorner Chaussee, das Gewerbegebiet Oehleckerring, den
nördlichen Teil der Ursula-de-Boor-Straße und den nördlichen Teil des Beckermannwegs sowie
• im Norden durch die Wohnbebauung entlang der Theodor-Fahr-Straße und den
Neubergerweg.
Das Untersuchungsgebiet (UG) hat eine Flächengröße von etwa 70 ha.
Der überwiegende Flächenanteil des UGs wird von Kleingärten der insgesamt fünf Kleingartenvereine
eingenommen. Im Westen des UG liegen Sportanlagen örtlicher Sportvereine.
Das UG wird von dem überwiegend begradigten Fließgewässer Bornbach in etwa Nordost-Südwest-
Ausrichtung durchflossen. Im zentralen Bereich liegt eine als Regenwasser-Rückhaltebecken (RHB)
bezeichnete Erweiterung des Fließgewässers. In diese mündet außerdem ein offener, in Ost-West-
Ausrichtung verlaufendes, grabenartiges Fließgewässer.
Im Bereich des Fließgewässers nördlich des RHB liegen Sumpfbereiche, Röhrichte und ein Moorwald.
Am östlichen Rand des UG liegt Weidegrünland. Einzelbaumbestand, Waldbestände und Knicks sind
prägende Elemente im UG.
Seite 4Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Im Norden und Süden befindet sich Wohnbebauung entlang der Straßen „Neubergerweg“ bzw.
„Foorthkamp“.
Das Diekmoor als ehemaliges Moorgebiet wurde ursprünglich von dem damals unregulierten
Bornbach durchflossen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Diekmoor ein Schuttberg angehäuft
und der Bornbach in einen begradigten Verlauf um den Schuttberg herum verlegt. Der Bornbach wird
heute auch als Diekmoorgraben bezeichnet. Zulaufende Gräben tragen ebenfalls diese Bezeichnung.
Die Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes sind in Abb. 1 dargestellt.
Abb. 1: Untersuchungsgebiet für die Bestandserhebungen Fauna und Biotoptypen.
Seite 5Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Gliederung des Untersuchungsgebietes
Zur räumlichen Differenzierung wird das Untersuchungsgebiet in drei Teilgebiete und darin in weitere
Teilbereiche gegliedert (Abb. 2). Die Gliederung in drei Teilgebiete war für die Brutvogel-Kartierung
erforderlich, die von drei Kartierenden zeitgleich durchgeführt wurde. Aber auch für weitere
Artengruppen ist eine Ergebnis-Darstellung anhand dieser Gliederung sinnvoll, die daher hier eingangs
zunächst allgemein dargestellt wird.
Abb. 2: Karte des Untersuchungsgebiets mit der Einteilung in Teilgebiete und Teilbereiche.
Seite 6Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Teilgebiet 1 = orange, Unterteilung in 5 Teilflächen A – E:
1-A = Reihenhaus-Siedlung im Norden des UG
1-B = Kleingartenverein (KGV) 460 „Fasanenmoor“ - Bereich Nord
1-C = Moorwald
1-D = KGV 457 „Am Weinberg“
1-E = KGV 459 „Diekmoor II“
Teilgebiet 2 = violett, Unterteilung in 3 Teilflächen A – C:
2-A = KGV 462 „Diekmoor III“ - Bereich nördlich Bornbach
2-B = KGV 401 „Diekmoor I“ und KGV 462 „Diekmoor III“ Bereich südlich Bornbach
2-C = Wohnsiedlung im Süden des UG
Teilgebiet 3 = grün, Unterteilung in 3 Teilflächen A – C:
3-A = KGV 460 „Fasanenmoor“ – Bereich Süd
3-B = Sportplätze
3-C = Regenwasser-Rückhaltebecken (RHB) und angrenzende Waldflächen
3. Untersuchungen und Erfassungen
3.1 Biotoptypen
3.1.1 Methode
Der Bestand an Biotoptypen im Untersuchungsgebiet (UG) wurde durch örtliche Begehungen am
03.06.2022, 17.06.2022 und am 06.07.2022 erfasst.
An den Erfassungstagen wurde das UG entlang der Wege und Trampelpfade sowie in begehbaren
Bereichen in die Flächen hinein begangen. Die einzelnen Kleingartenparzellen innerhalb der
Vereinsgelände sowie eingezäunte bzw. nicht zugängliche Bereiche, darunter die Pferdekoppeln,
Sportplätze und einige Gehölzbereiche, konnten nicht betreten werden. Hier wurden die Bestände
soweit möglich von außen auf die jeweiligen Flächen blickend aufgenommen.
Bei der Erfassung der Biotoptypen wurden die auf den Flächen jeweils den Bestand prägenden bzw.
den Biotoptyp charakterisierenden Pflanzenarten aufgenommen. Die Erhebung von biotoptypischen
Kennarten ermöglichte schließlich die Differenzierung und Beschreibung der jeweiligen Biotoptypen.
Die Differenzierung der Biotoptypen erfolgt gemäß der aktuellen Biotopkartieranleitung und
Biotoptypenschlüssel (FHH 2022).
Neben der örtlichen Erfassung diente der im Biotopkataster Hamburg erfasste Biotoptypenbestand
der Hamburger Biotopkartierung (Aktualität bis 12/2019, Begehungen letztmalig im Jahr 2011) als
weitere Grundlage für die Differenzierung der Biotoptypen im UG.
3.1.2 Ergebnisse
Der Biotoptypenbestand im UG wird in Abb. 3 dargestellt. Die Karte „Biotoptypenbestand“ ist zudem
dem Bericht als Anhang 1 im Format A3 beigefügt.
Grünland
Zu den Grünlandbiotoptypen gehören die eingezäunten, überwiegend als Pferdekoppeln genutzten
Flächen im Osten des UG.
Die zwei nördlichen Grünlandflächen, die eingezäunt sind und zum Kartierzeitpunkt als Pferdekoppeln
genutzt wurden, unterscheiden sich charakteristisch stark von den südlich liegenden Grünlandflächen.
Letztere sind ebenfalls eingezäunt und werden vermutlich zeitweilig auch als Weiden genutzt.
Seite 7Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Aufgrund der intensiven Nutzung als Pferdeweide weisen die nördlichen Flächen durch Verbiss und
Tritt eine sehr kurze Grasnarbe und hohe Anteile an Offenbodenstellen auf. Sie sind daher dem
Biotoptypen „Stark veränderte Weidefläche (GW)“ zuzuordnen.
Die zum Zeitpunkt der Kartierung nicht als Weiden genutzten südlicheren Grünlandflächen sind
deutlich artenreicher mit einer mehr oder weniger geschlossenen Grasnarbe. Sie sind aufgrund der
inhomogenen Ausprägung (an den Rändern treten zum Teil kleinflächig Nitrophytenfluren auf) dem
Biotoptypen „Sonstiges mesophiles Grünland (GMZ)“ zuzuordnen.
Gras-, Stauden- und Ruderalfluren
Im Untersuchungsgebiet befinden sich einzelne Flächen, die als „halbruderale Gras- und Staudenflur
mittlerer Standorte (AKM)“ zu charakterisieren sind. Die ehemals als „Stadtwiesen“ kartierten
Bereiche nördlich der Sportanlagen im Nordwesten des UG sowie südwestlich der Waldflächen um das
zentrale Rückhaltebecken (Biotopkataster Hamburg, Kartierung 2011) haben sich durch allmähliche
Sukzession zu Ruderalfluren entwickelt. Die kleinflächige halbruderale Gras- und Staudenflur nördlich
der Sportanlagen ist vor allem durch lückige, krautige Vegetation zwischen teilweise
Offenbodenstellen geprägt. Die kleinflächige und entlang eines Trampelpfades bestehende
halbruderale Gras- und Staudenflur südwestlich der Waldflächen um das zentrale RHB weist
Dominanzbestände von Gräsern, insbesondere Quecke, sowie nitrophile Arten wie Brennnessel auf.
Eine ältere Gartenbrache im Südosten des UG, nördlich des an der U-Bahn-Station Langenhorn Nord
befindlichen Parkplatzes, ist ebenfalls dem Biotoptypen „Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer
Standorte“ zuzuordnen. Vereinzelt treten in der eingezäunten Fläche durch Sukzession entstandene
Gehölze wie Brombeergebüsche sowie ehemalige Gartengehölze auf.
Sümpfe und Röhrichte
Im Norden des UG, im Bereich, in dem der Verlauf des Bornbaches seine Richtung nach Süden ändert,
hat sich aus einem vor Jahren angelegten Teich durch zunehmende Verlandung ein Sumpf entwickelt.
Dieser ist dem Biotoptypen „Sonstiger Sumpf nährstoffreicher Standorte (NGZ)“ zuzuordnen und
gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie § 14 Hamburgisches Gesetz zur Ausführung
des Bundesnaturschutzgesetzes (HmbBNatSchAG) geschützt. Von dem ursprünglichen Kleingewässer
mit Röhrichtbestand gemäß des erfassten Biotopbestandes im Biotopkataster Hamburg (Kartierung
2011) sind aufgrund der starken Gehölzausbreitung von Erlen und Flügelnuss sowie der Verlandung
kaum noch Relikte sichtbar. Der lockere Vegetationsbestand der Krautschicht setzt sich vor allem aus
Großseggen (v.a. Carex acuta und Carex riparia), Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris) und Flutender
Schwaden (Glyceria fluitans) zusammen.
Westlich an dem Sumpf angrenzend hat sich wiederum aufgrund fortgeschrittener Sukzession aus der
ehemaligen Nasswiese (Biotopkataster Hamburg, Kartierung 2011) ein „Schilf-Röhricht (NRS)“
entwickelt. Bestandsprägend in dem relativ artenarmen Biotopbestand ist Schilf (Phragmites
australis). Der Biotoptyp ist gemäß § 30 BNatSchG und § 14 HmbBNatSchAG geschützt.
Der geschützte Biotoptyp „Schilf-Röhricht“ hat sich zudem am westlichen Rand des RHBs entwickelt.
Gewässer
Das zentral im Untersuchungsgebiet gelegene Regenwasser-Rückhaltebecken wurde künstlich
angelegt. Es ist dem Biotoptypen „Rückhaltebecken, naturfern (SXR)“ zuzuordnen. Das Stillgewässer
weist naturnahe Gewässerstrukturen bzw. Ufer- und Wasserpflanzenvegetation auf, aber auch
Uferbefestigungen mit Bongossiholz sind am Ostufer zum Teil noch erhalten. Besonders naturnah, mit
Röhricht und Weidengebüsch, hat sich der Vegetationsbestand auf der künstlich angelegten Insel im
Westen des RHBs entwickelt. Die Nordwest-, Ost- und Süduferbereiche waren zum Kartierzeitpunkt
mitunter von Enten abgefressen und stark von Anglern und Passanten zertreten. Der offensichtliche
Fischreichtum des Gewässers hat eine starke Befischung zu Folge, obwohl keine Angel-
Erlaubnisbereiche gemäß Anglerkarte Hamburg – AV HH + FHH erteilt wurden. Das hohe Aufkommen
von Anglern ist als Hauptstörquelle für das Gewässer, insbesondere für die Ufervegetation und die an
Seite 8Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
entsprechende Bereiche gebundene Fauna, zu werten. Das Gewässer ist von hoher faunistischer
Bedeutung. Es ist Rast- und Brutplatz verschiedener Vogelarten, Laichhabitat für Amphibien sowie
Lebens- und Fortpflanzungsstätte verschiedener Libellenarten und weiterer Wirbelloser.
Im westlich des RHBs angrenzenden Laubmischwald endet ein sich durch den Wald schlängelnder
Graben des Biotoptypens „Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (FGR)“ in eine
breitere, flache Senke. Letztere ist dem Biotoptypen „Waldtümpel (STW)“ zuzuordnen. Die
zusammenhängenden Gewässer weisen eine periodische Wasserführung auf. In den Sommermonaten
fallen sie annähernd trocken. Sie sind durch die in der Umgebung stehenden Bäume stark beschattet
und durch den Eintrag von Falllaub geprägt. Floristisch weisen sie keine Besonderheiten auf. Von einer
gehobenen Bedeutung für eine wassergebundene Fauna ist nicht auszugehen. Die vorherrschenden
Gewässereigenschaften ergeben keine Unterschutzstellung der beiden Biotope.
Ein weiterer periodisch austrocknender Graben (FGR) befindet sich östlich entlang eines Fußweges am
westlichen Rand des Kleingartenvereins „Diekmoor II“.
Ein „stark verlandeter, austrocknender Graben (FGV)“ verläuft entlang der nördlichen Waldgrenze
des westlich des RHBs gelegenen Laubforstes. Er ist periodisch wasserführend und stark durch
Verbuschung geprägt. Es dominieren Röhrichtarten und Farne.
Nordwestlich des am RHB angrenzenden Laubmischwaldes zwischen Tennisplätzen und einem
Fußballfeld der im Westen des UG befindlichen Sportanlage befindet sich eine kleines, flaches
Stillgewässer, das dem Biotoptypen „Sonstiger Tümpel (STZ)“ zuzuordnen ist. Die periodische
Wasserführung ist auf die Winter- und Frühjahrsmonate beschränkt. Die im Sommer trockenfallende
Gewässergrund weist Flutrasenarten auf. Trotz fehlender Wasserführung über einen längeren
Zeitraum im Jahr hat der Tümpel eine gehobene Bedeutung für eine wassergebundene Fauna,
insbesondere laichende Amphibien. Das Gewässer ist daher gemäß § 30 BNatSchG und § 14
HmbBNatSchAG geschützt.
Der von Nordost nach Südwest durch das Untersuchungsgebiet verlaufende Bornbach gehört dem
Fließgewässer-Biotoptypen „Bach, naturnah mit Beeinträchtigungen/ Verbauungen (FBM)“ an. Der
Bornbach hat einen begradigten Lauf, Uferbefestigungen mit Bongossiholz sind jedoch zum Teil bereits
aufgelöst und stark mit Pflanzen überwuchert. Die Ufervegetation ist vor allem von
Sauergrasgewächsen und abschnittweise hohen Bäumen (v.a. Erle) geprägt. Unterwasservegetation
ist regelmäßig vorhanden und weist unter anderem Arten wie Wasserpest (Elodea nuttallii),
Wasserstern (Callitriche spec.), Laichkraut (Potamogeton spec.), Wasser-Schwaden (Glyceria maxima)
und Flutender Schwaden (Glyceria fluitans) auf. Der gesamte Bachlauf steht aufgrund des
artenreichen, naturnahen Bewuchses, des Alters sowie der zahlreichen, faunistisch bedeutsamen
Kleinstrukturen nach § 30 BNatSchG und § 14 HmbBNatSchAG unter Schutz.
Der grabenartige Nebenarm des Bornbachs im Osten des UG ist demselben Biotoptypen zuzuordnen.
Aufgrund der jedoch starken Beeinträchtigung durch das tief eingeschnittene, schmale Betonbett und
der geringen Naturnähe unterliegt dieser Abschnitt nicht dem Biotopschutz.
Wälder
Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich gebietsweise zahlreiche den Wäldern
zuzuordnende Biotoptypen.
Die Definition von Wald nach der Biotopkartieranleitung (FHH 2022) ist dabei nicht identisch mit der
Definition von Wald gemäß Landeswaldgesetz Hamburg (vom 13. März 1978, (HmbGVBl. S. 74).
Der am Kleingartenverein „Fasanenmoor“ angrenzende, feuchte bodensaure Birkenwald im Norden
des UG ist ein Relikt des ehemaligen Diekmoores. Er ist trotz fortschreitendem Degenerationsstadiums
noch dem Biotoptypen „Birken- und Kiefern-Bruch- bzw. Moorwald nährstoffarmer Standorte
(WBB)“ zuzuordnen und ist gemäß § 30 BNatSchG und § 14 HmbBNatSchAG geschützt.
Bestandsprägend sind Moor-Birke (Betula pubescens) und Pfeifengras (Molinia caerulea agg.).
Seite 9Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Torfmoosarten fehlen. Degenerative Entwicklungstendenzen sind vor allem dadurch zu erkennen, dass
in der Strauchschicht vermehrt Bestände von Brombeere und Himbeere (Rubus spec.) aufkommen und
das Hochmoortorf zu Abtrocknung tendiert. Vielerorts kommt es zu Eutrophierung durch Ablage von
Gartenabfällen und Müll.
Am westlichen Rand des UG, südlich der Sportanlagen sowie im Südosten des UG, nördlich des an der
U-Bahn-Station Langenhorn Nord befindlichen Parkplatzes sind kleinflächige Bestände des
Biotoptypen „Eichenmischwald frischer Sandböden (WQM)“ mit bestandsprägenden Bäumen der
Stiel-Eiche (Quercus robur) vorhanden.
Spontan durch Gehölzanflug entstandene Pionierwälder innerhalb des UG wurden als Biotoptypen
„Birken- und Espen-Pionier- oder Vorwald (WPB)“ und „Sonstiger Pionierwald (WPZ)“ erfasst. Der
bereits im Biotopkataster Hamburg (Kartierung 2011) erfasste Pionierwald WPZ am nordwestlichen
Rand des UG, nördlich der Sportanlagen hat sich gen Osten durch das dichte Aufkommen von vor allem
jungen Beständen der Zitter-Pappel (Populus tremula) flächig vergrößert. Auf der ehemals als
Stadtwiese kartierten Fläche (Biotopkataster Hamburg) hat sich im Laufe der Sukzession Pionierwald
mit bestandprägenden jungen Pappeln entwickelt. Im Nordosten des UG sind der nördlich am
Bornbach angrenzende Wald östlich der Reihenhaussiedlung sowie der Wald westlich der Bahngleise
trotz älterer, naturnaher Entwicklung der dortigen Bestände von Pionierbaumarten wie Spitzahorn
(Acer platanoides), Hänge-Birke (Betula pendula), Zitter-Pappel (Populus tremula) sowie Himbeere
(Rubus spec.) und Sal-Weide (Salix caprea) den Pionierwäldern zuzuordnen.
Bis auf einen von Laubbaumbeständen umgebenen, kleinflächigen „Fichtenforst (WZF)“ am Standort
einer ehemaligen Gartenbrache im Südwesten des UG sind alle darüber hinaus im UG vorkommenden
Waldflächen dem Biotoptypen „Laubforst aus heimischen Arten (WXH)“ zuzuordnen. In den
Beständen dominieren heimische Baumarten. Der Boden mit Forstbeständen ist in vielen Fällen
gestört. Die Baumartenzusammensetzung ist in vielen Fällen nicht standortgerecht (vgl. FHH 2022). Ein
Großteil der im UG vertretenden Laubforste hat sich jedoch infolge der Sukzession zu relativ
naturnahen Waldbeständen entwickelt.
Im Südwesten des UG hat sich südlich des Bornbaches auf einer Kleingartenbrache sowie entlang eines
schmalen Streifens nördlich des Bornbaches Laubmischwald etabliert. Im Gehölzbestand sind noch
Relikte der ehemaligen Gartennutzung wie Bestände von Rhododendron und Flieder vertreten.
Bestandsprägende Baumarten sind Feld-Ulme (Ulmus minor), Stiel-Eiche (Quercus robur), Hänge-Birke
(Betula pendula), Ahorn (Acer spec.) und Schwarz-Erle (Alnus glutinosa).
Der Baumbestand des Laubforsts am westlichen Rand der Tennisplätze am Beckermannweg wird
dominiert von Schwarz-Erle (Alnus glutinosa).
Schwarz-Erle ist zudem gemeinsam mit Zitter-Pappel im naturnahen Laubmischwald nördlich und
westlich des RHBs bestandsprägend.
Naturnah entwickelte Laubforste mit Baumbeständen aus vor allem Pappel-Hybride (Populus spec.).
Fahl-Weide (Salix x rubens), Robinie (Robinia pseudoacacia), Grau-Erle (Alnus incana), Spitzahorn (Acer
platanoides) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) befinden sich am westlichen Rand des Birken-
Moorwaldes sowie an den randlichen Hanglagen des KGV 457 „Am Weinberg“.
Im Norden des UG, nördlich des Bornbaches, befindet sich nördlich am Pionierwald WPZ angrenzend
ein eingezäunter, kleinflächiger Bestand aus locker stehenden, mittelalten Rotbuchen (Fagus
sylvatica).
Ein naturnaher Laubmischwald hat sich zudem aus Anpflanzungen am Hang entlang der Bahntrasse im
Osten des UG entwickelt.
Gehölze
Zu den Gehölzen zählen kleinflächige und lineare Gehölzbiotope sowie markante Einzelbäume.
Seite 10Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Flächige im UG vorkommende Gehölzbiotope grenzen sich durch eine kleine Flächengröße bis rund
0,5 ha von Waldbiotoptypen ab.
Ein „Naturnahes Gehölz feuchter bis nasser Standorte (HGF)“ hat sich südlich des Bornbach-
Seitenarms im zentralen Bereich des UG entwickelt. Bestandsdominierende Baumarten des heterogen
entwickelten Kleingehölzes sind Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Fahl-Weide (Salix x rubens). Ein
Biotopschutz gemäß HmbBNatSchAG § 14 (2) 2.3 Feldgehölze oder aufgrund einer sehr feuchten
Ausprägung besteht nicht.
Um das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Langenhorn-Nord am nordöstlichen Rand des UG befindet
sich ein naturnaher Gehölzstreifen mit altem Baumbestand, der aufgrund der heterogenen
Ausprägung dem „Sonstigen Kleingehölz (HGZ)“ zugeordnet wird. Ein Biotopschutz gemäß
HmbBNatSchAG § 14 (2) 2.3 Feldgehölze besteht nicht.
Durch Sukzession entstandene „Ruderalgebüsche (HRR)“ auf frischen, gut nährstoffversorgten,
gestörten Standorten sind westlich einer als Fußballfeld genutzten Tritt- und Scherrasenfläche im
Nordwesten des UG, östlich der Tennisplatzanlage im Zentrum des UG, östlich des Eichenmischwaldes
im Westen des UG und südlich des Laubwaldes im Südwesten des UG zu finden. In den überwiegend
sehr kleinflächigen Ruderalgebüschen ist Gartenbrombeere (Rubus armeniacus) bestandsprägend. Das
Ruderalgebüsch östlich der Tennisplätze und nördlich des westlich am RHB angrenzenden
Laubmischwaldes wird im Biotopkataster Hamburg (Kartierung 2011) noch als „halbruderale Gras- und
Staudenflur mittlerer Standorte“ erfasst. Die seitdem fortgeschrittene Sukzession in der Brache führte
jedoch dazu, dass nunmehr Strauchvegetation dominiert und eine Änderung des Biotoptypens
veranlasste.
Am östlichen Rand des Pionierwaldes im Nordwesten des UG ist im Zuge der Sukzession „Naturnahes
sonstiges Sukzessionsgebüsch (HRZ)“ aus vorwiegend jungen Pappeln entstanden. Aufgrund des
jungen Alters sind die Bestände der Pionierbaumarten noch nicht einem Pionierwald-Biotoptypen
zuzuordnen.
Westlich des Schilf-Röhrichts am RHB ist in den vergangenen Jahren Weidengebüsch („Weiden-Moor-
und Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (HSC)“) auf einer sumpfigen, einst künstlich
angelegten Insel des Stillgewässers (SXR) aufgekommen. Das Sumpfgebüsch ist gemäß § 30 BNatSchG
und § 14 HmbBNatSchAG geschützt.
Eine mit dem Zweck der Abschirmung bzw. Gliederung angelegte „Strauch-Baumhecke (HHM)“ mit
einer dichten Strauchschicht und Überhältern befindet sich auf dem Gelände der Freiwilligen
Feuerwehr Langenhorn-Nord entlang der Grundstücksgrenze zur Straße „Neubergerweg“. Ein
Biotopschutz gemäß HmbBNatSchAG § 14 (2) 2.1 Feldhecken besteht nicht.
Entlang eines breiteren Fußweges zwischen zwei Fußballplätze im Süden der im UG liegenden
Sportanlagen stehen an beiden Wegesrändern Gruppen aus markanten, einzelnen Laubbäumen ohne
spezifischen, naturnahen Unterwuchs. Sie sind als Biotoptyp „Baumgruppe (HEG)“ klassifiziert.
Dem Biotoptyp „Baumreihe, Allee (HEA)“ sind herausragende Bestände von in Reihen gepflanzten
Bäumen an Straßen, Wegen oder Zufahrten zuzuordnen. Innerhalb des UG wird die Langenhorner
Chaussee im Südwesten von Alleebäumen begleitet. Des Weiteren verläuft eine Baumreihe aus älteren
Stiel-Eichen (Quercus robur) entlang der Zufahrt zu einem Parkplatz im Kleingartenverein „Diekmoor I“
im Osten des UG.
Im Nordwesten des UG verteilt ist, meist entlang von Straßen und Wegen, der Biotoptyp
„Degenerierter Knick (HWD)“ zu finden. Es handelt sich in dem meisten Fällen um Knicks mit dichter
Strauch- und Baumschicht, in der die Gehölze aufgrund ausgebliebenem Rückschnitt durchgewachsen
sind. Der Knickwall ist in vielen Abschnitten degradiert. Knicks unterliegen nicht dem gesetzlichen
Biotopschutz, wenn sie außerhalb von landwirtschaftlichen Nutzflächen liegen.
Seite 11Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Ein Knick (HWD) entlang des Weges „Weg Nr. 396“ im Osten des UG ist aufgrund der Lage am Rand
von landwirtschaftlich genutztem Grünland als Biotop gesetzlich geschützt (§ 30 BNatSchG und § 14
HmbBNatSchAG).
Die im Biotopbestandplan als „Einzelbaum (HEE)“ hervorgehobenen Bäume stellen bedeutende
Einzelbäume dar, die nicht Bestandteil von Wäldern, waldartigen Gehölzbeständen, Baumreihen oder
Baumgruppen sind. Es handelt sich um ältere Einzelbäume, die als ökologisch bedeutsamer
Lebensraum durch Größe, Alter, Form oder Zustand eine Besonderheit darstellen. Auch absterbende
oder tote Bäume gehören hierzu, soweit sie für holzbewohnende Kleintiere von Bedeutung sind.
Die meisten der im Untersuchungsgebiet hervorgehobenen, markanten Einzelbäume befinden sich in
den Kleingartenanlagen und auf den Grünflächen der Siedlungsgebiete. Insbesondere die älteren und
größeren, in den Gärten der Kleingartenanlagen stehenden Einzelbäume sind von hoher ökologischer
Bedeutung, besonders für die Avifauna.
Siedlung-, Verkehrs- und Sonderflächen
Biotopkomplexe des besiedelten Bereichs umfassen Gebäude inklusive der zugehörigen Gärten,
Grünflächen, Gehölzstrukturen, ruderalen Randstrukturen und versiegelten Flächen. Im UG finden sich
folgende Biotopkomplexe der Siedlungsflächen:
Im Norden entlang der Straße „Neubergerweg“ sind Siedlungsflächen mit „Reihenhausbebauung
(BNG)“ sowie im Nordosten „Gemeinbedarfsbebauung (BSG)“ mit der Nutzung als Freiwillige
Feuerwehr.
Im Südwesten zwischen den Straßen „Langenhorner Chaussee“ und „Ursula-de-Boor-Straße“ befinden
sich westlich der „Ursula-de-Boor-Straße“ und östlich der „Langenhorner Chaussee“ neben der
Reihenhausbebauung eine „verdichtete Einzelhausbebauung (BNO)“ sowie „Neue Zeilenbebauung
(BZN)“. Letztere Biotoptypen charakterisieren zudem die Siedlungsflächen im Süden des UG, nördlich
der Straße „Foorthkamp“.
Am östlichen Rand des UG, südlich des „sonstigen mesophilen Grünlands“ liegt eine „Gewerbefläche
(BIG)“, die als Kfz-Werkstatt genutzt wird.
Folgende Biotopkomplexe der Verkehrsflächen inklusive typischem Begleitgrün finden sich innerhalb
des UG:
Die „Gleisanlage (VBG)“ für den U-Bahn-Verkehr der Hamburger Linie U 1 markiert die östliche Grenze
des UG.
„Land-/ Haupt- oder Durchgangsstraßen (VSL)“ sind im Norden mit der Straße „Neubergerweg“, im
Südosten mit der Straße „Langenhorner Chaussee“ sowie im Süden mit der Straße „Foorthkamp“
vorhanden.
Die Straße „Ursula-de-Boor-Straße“ im Südosten des UG ist aufgrund des deutlich geringeren
Verkehrsaufkommens und der verhältnismäßig geringen Breite dem Biotoptypen „Wohn- und
Nebenstraße (VSS)“ zuzuordnen.
Einfache Erschließungswege, befestigte Flurwege, Fuß- und Radwege gehören dem Biotoptypen
„Wirtschaftsweg (VSW)“ an und finden sich innerhalb des UG im Bereich der Ball- und
Laufsportanlagen im Nordwesten („Beckermannweg“ und nördliche „Ursula-de-Boor-Straße“),
nördlich der Kleingartenanlage „Diekmoor III“ im Südwesten („Weg Nr. 414“), westlich der
Pferdekoppeln im Osten („Weg Nr. 396“) sowie entlang des Bornbach-Nebenarms im Osten (Weg
westlich des „Weges Nr. 396“). Auch kleinere Wegabschnitte, die nicht ausschließlich Fußgängern und
Radfahrern zur Verfügung stehen, wurde hier den „Wirtschaftswegen“ zugeteilt. Dazu gehören der
südliche über den Bornbach führende Abschnitt der südlichen „Ursula-de-Boor-Straße“ im Südwesten
des UG und ein befahrbarer, von der Straße „Foorthkamp“ ausgehender Wegabschnitt zwischen einer
Zeilenhausbebauungsfläche und einer Kleingartenfläche im Süden des UG.
Seite 12Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Ausschließlich Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung stehende „Fußgängerflächen und Radwege
(VSF)“ durchziehen die Kleingartenanlagen und Grünflächen (Wälder und Grünanlagen) im UG. Sie
unterscheiden sich von den im UG als Biotoptyp „Sandweg (OWS)“ kartierten nicht oder leicht
befestigten Wegen durch das Vorhandensein von zumindest einer wassergebundenen Decke als
Befestigung.
Die als „Parkplatz (VSP)“ kartierten Verkehrsflächen umfassen befestigte, asphaltierte oder mit
zumindest einer wassergebundenen Decke befestigte Flächen, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen
genutzt werden. Eine größere Parkplatz-Fläche befindet sich im Osten des UGs in unmittelbarer Nähe
zum U-Bahnhof „Langenhorn-Nord“. Kleinere Parkplätze sind in den Kleingartenanlagen zu finden.
Zu den Siedlungs-, Verkehrs- und Sonderflächen werden zudem im UG vertretene Biotopkomplexe der
Freizeit-, Erholungs- und Grünanlagen sowie vegetationsbestimmte Habitatstrukturen der
besiedelten Bereiche aufgeführt.
Ein Großteil der Flächen des Untersuchungsgebietes sind Kleingärten. Sie werden zusammenfassend
dem Biotoptyp „Kleingartenanlage, strukturarm (EKA)“ zugeordnet.
Der flächenbezogen überwiegende Anteil der im UG vorhandenen Kleingärten weist größtenteils
naturferne und von nichtheimischen Pflanzenarten dominierte Vegetationsstrukturen auf. Diese
Gärten sind weitgehend geprägt von Koniferen, hartlaubigen Sträuchern und intensiv gepflegtem
Scherrasen. Dagegen ist der Anteil an Nutzgartenstrukturen und Altbäumen in diesen Gärten
vergleichsweise gering.
Ein geringerer Anteil an Kleingärten ist dagegen strukturreicher und mit einem höheren Anteil an
heimischen oder alteingebürgerten Arten, mit altem Laubbaumbestand (Obstbäume), größeren
Anteilen von Nutzgartenstrukturen und extensiver gepflegten, artenreicheren Rasenflächen
ausgestattet. Auch treten vereinzelt Gartenbrachen auf, die meist höhere Strukturvielfalt aufweisen.
Die Differenzierung der Kleingartenflächen im UG als ‚strukturarm‘ erfolgt gemäß der auf dem
überwiegenden Flächenanteil der Kleingärten vorzufindenden Charakteristik. Sie folgt den Kriterien
des Biotoptypenschlüssels (vgl. FHH BUKEA 2022).
Der Parkplatz im Süden der Kleingartenanlage „Am Weinberg“ ist parkartig durch gepflanzte randliche
Gehölze und einzelnstehende Bäume gestaltet. Die kleinteilige Grünanlage um den Parkplatz ist als
Biotoptyp „Kleinteilige Grünanlage, naturnah (EPA)“ klassifiziert.
Im Norden des UG zwischen Bornbach und der Reihenhausbebauung findet sich entlang des Fußweges
eine „kleinteilige, naturferne Grünanlage (EPK)“ aus vorwiegend nicht heimischer oder nicht
standortgerechter Vegetation.
Der als „Sonstige Parks oder Grünanlage (EPZ)“ bezeichnete Biotoptyp ist im UG im Norden im Bereich
des Sumpfs und des Röhrichts sowie im Südosten zwischen der Zeilenbebauung und Kleingärten des
Kleingartenvereins „Diekmoor I“ zu finden. Im Bereich des Sumpf- und Röhrichtgebietes im Norden
des UG breiten sich vor Jahren angepflanzte Bestände der Flügelnuss (Pterocarya fraxinifolia)
zunehmend zu einem dichten Gehölzbestand aus. Die Grünanlage im Südosten weist einen naturnahen
waldartigen Altbaumbestand auf ohne deutliche Anzeichen gärtnerischer Gestaltung.
Im zentralen westlichen Bereich des UG befinden sich mehrere „Ball- und Laufsportanlagen (ESB)“ mit
Tennisplätzen, Fußballplätzen und Hockeyplätzen.
Eine kleinflächige Grünanlage im Nordwesten des UG setzt sich aus „gepflanzten Gehölzbeständen
aus vorwiegend heimischen Arten (ZHN)“, „Zier-Gebüsch aus vorwiegend heimischen,
standortgerechten Arten (ZSN)“ und einer als Fußballplatz genutzten Fläche mit „Scher- und
Trittrasen (ZRT)“ zusammen.
Scher- und Trittrasen mit angrenzendem linearem, Gehölzbestand aus heimischen Arten wurde zudem
nördlich des nahe der U-Bahnstation gelegenen ‚P+R-Parkplatzes’ im Südosten des UG angelegt.
Seite 13Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Rasenflächen befinden sich darüber hinaus im Norden des UG, zum einen südlich der Gärten der
Reihenhausbebauung, zum anderen auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr.
Ein Ziergebüsch aus vorwiegend heimischen Arten begrenzt im Südwesten des UG ein Grundstück mit
Einzelhausbebauung und eine „Stadtwiese (ZRW)“. Die als Biotoptyp ZRW zuzuordnende
Grünlandfläche weist Kriterien des Biotoptyps „Sonstiges mesophiles Grünland“ auf. Sie wird extensiv
gemäht, jedoch nicht landwirtschaftlich genutzt. Sie ist geprägt durch inhomogene, hohe Anteile
krautiger Arten mit auffälligem Blühaspekt, die vermutlich durch die Einsaat allochthoner
Saatmischungen nach Aufgabe der vorigen Nutzung als Parkplatzfläche (Biotopkataster Hamburg,
Kartierung 2011) hervorgegangen sind. Die Wiese ist zudem durch starke Störungseinflüsse wie z.B.
Tritt auf den sich durch die Fläche ziehenden Trampelpfaden charakterisiert.
Innerhalb des UG befinden sich Stadtwiesen des Biotoptyps ZRW zudem im Norden innerhalb einer
größeren Grünanlage sowie im Osten südlich des Pionierwaldes.
Die mesophile bis feuchte, mäßig artenreiche Wiese am nördlichen Hang des „Weinberges“ wird
extensiv bewirtschaftet und ist inhomogen ausgeprägt. Dominierende Gräser sind Wiesen-
Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) und Gewöhnliches Rispengras (Poa trivialis). An feuchteren
Stellen treten Dominanzbestände von Gewöhnlichem Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) hervor.
Die intensiver bewirtschaftete und artenärmere Wiese im Osten des UG (südlich des Pionierwaldes)
wird mitunter als Parkplatz von Fahrzeugen genutzt. Mittig steht eine markante einzelne Stiel-Eiche.
Am nordöstlichen Rand der Grünlandfläche wurde jüngst eine kleine Fläche angelegt mit
„Extensivrasen-Einsaat (ZRR)“. Mit dem Zweck der Entstehung einer kleinen Blühfläche wurden hier
artenreiche Saatmischungen eingesät. Dominiert wird die Fläche jedoch von der ebenfalls auf der
benachbarten Wiese (ZRW) dominierenden Grasart Deutsches Weidelgras (Lolium perenne).
Eine „Zierstrauchhecke (ZSH)“ säumt nördlich den „Weg Nr. 414“ im Südwesten des UG und begrenzt
den nördlich angrenzenden Gewerbepark „Oehleckerring“ (außerhalb des UG).
Der Biotoptypenbestand im UG wird in Abb. 3 dargestellt. Die Karte „Biotoptypenbestand“ ist zudem
dem Bericht im Kartenanhang im Format A3 beigefügt.
Seite 14Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Gesetzlich geschützte Biotope
Folgende Biotoptypen im UG sind gemäß § 30 BNatSchG sowie § 14 HmbBNatSchAG als Biotope
gesetzlich geschützt. Die Lage der Biotope ist aus der Abb. 4 ersichtlich.
Sonstiger Sumpf nährstoffreicher Standorte (NGZ)
Unter Schutz gemäß § 30 BNatSchG (§ 30 (2) 2.2 Sümpfe) stehen alle Sumpf-Biotope nasser, oft
vermoorter oder mineralischer Standorte, die von Seggen, Binsen oder Simsen dominierter Vegetation
geprägt sind (FHH 2022).
Schilf-Röhricht (NRS)
Unter Schutz gemäß § 30 BNatSchG (§ 30 (2) 2.3 Röhrichte) stehen alle Biotoptypen, die durch
„überwiegend hochwüchsige Vegetation aus Röhrichtarten im Verlandungsbereich von Gewässern, in
feuchten Geländemulden oder als Sukzessionsstadium von Feuchtwiesen nach Nutzungsaufgabe“
geprägt sind (FHH 2022).
Bach, naturnah mit Beeinträchtigungen/ Verbauungen (FBM)
Unter Schutz nach § 30 BNatSchG (§ 30 (2) 1.1 Natürliche oder naturnahe Fließgewässer) stehen
"beeinträchtigte und/oder ehemals verbaute Abschnitte mit artenreichem, naturnahem Bewuchs
und/oder, aufgrund des Alters, mit zahlreichen, faunistisch bedeutsamen Kleinstrukturen“ (FHH
BUKEA 2022). Dazu zählt der Hauptlauf des Bornbaches im UG. Der stark beeinträchtigte in Ost-West-
Richtung verlaufende Nebenarm des Bornbachs erfüllt nicht die Anforderung für eine
Unterschutzstellung und ist somit nicht gesetzlich geschützt.
Sonstiger Tümpel (STZ)
Unter Schutz nach § 30 BNatSchG (§ 30 (2) 1.2 Natürliche oder naturnahe stehende Gewässer) stehen
„Tümpel mit überwiegendem Gewässercharakter, d.h. mit durchschnittlicher Wasserführung während
mehr als der Hälfte eines Jahres oder deutlich gewässergeprägter Vegetation oder gehobener
Bedeutung für eine wassergebundene Fauna (Amphibien, Libellen). In den Schutz einbezogen ist die
vom Gewässer beeinflusste Ufervegetation und ein Schutzstreifen von wenigstens 1 m Breite über die
Böschungsoberkante hinaus“ (FHH 2022). Der im UG erfasste „sonstige Tümpel (STZ)“ weist
entsprechende Eigenschaften für die Unterschutzstellung auf. Der periodisch trockenfallende
„Waldtümpel (STW)“ im zentralen Laubmischwald im UG erfüllt dagegen nicht ausreichend die o.g.
Kriterien für eine Unterschutzstellung.
Birken- und Kiefern-Bruch- bzw. Moorwald nährstoffarmer Standorte (WBB)
Unter Schutz nach § 30 BNatSchG (§ 30 (2) 4.1 Bruchwälder) stehen „alle intakten wie auch
teilentwässerten Bruch- und Moorwälder, soweit sie als regenerierungsfähig einzustufen sind (über
die Fläche regelmäßiges Auftreten von Nieder- bzw. Hochmoorarten)“ (FHH 2022). Der Birken-
Moorwald innerhalb des UG ist trotz des fortgeschrittenem Degenerationsstadiums noch als intakt und
regenerierungsfähig einzustufen und somit gesetzlich geschützt.
Weiden-Moor- und Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (HSC)
Das im UG erfasste, sich im Zuge der Sukzession aus dem Schilf-Röhricht entwickelte Weiden-Moor-
und Sumpfgebüsch ist nach Anlage HmbBNatSchAG Abs. 2.2 als Sumpf geschützt.
Degenerierter Knick (HWD)
Unter Schutz nach § 14 HmbBNatSchAG Abs. 2 stehen Knicks innerhalb oder am Rand
landwirtschaftlicher Nutzflächen, sofern sie nicht durch gärtnerische Nutzung und Pflege stark
überprägt sind (FHH 2022). Die Mehrheit der im UG vorhandenen Knicks liegen nicht innerhalb oder
am Rand von landwirtschaftlichen Nutzflächen und unterliegen somit keinem gesetzlichen Schutz.
Lediglich der Knick am westlichen und nördlichen Rand der Weideflächen (Pferdekoppeln) im östlichen
UG erfüllt die Kriterien für die Unterschutzstellung.
Seite 16Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Abb. 4: Gesetzlich geschützte Biotope im UG.
Seite 17Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
3.1.3 Bewertung und Empfehlungen zur Rahmenplanung
Der nach Rahmenplanung für Bebauung vorgesehene Bereich umfasst größtenteils Flächen mit
Kleingartenanlagen (EKA). Die Kleingartenflächen sind im überwiegenden Anteil eher strukturarm,
bieten im geringeren Flächenanteil jedoch auch vielfältigere Strukturen aus heimischen Gehölzarten,
alten Obstbäumen, brachliegenden Flächen und Vogelnistkästen.
Auf der für Bebauung vorgesehenen Fläche stehen Einzelbäume, von denen mehrere Bäume aufgrund
ihres umfangreichen Stamm- und Kronendurchmessers einen besonderen Wert aufweisen. Diese
sollten erhalten bleiben und vor Beeinträchtigungen geschützt werden.
Auf den Kleingartenflächen wegfallende Strukturelemente sollten möglichst innerhalb des geplanten
Wohngebietes oder in den angrenzenden, verbleibenden Flächen weitgehend ersetzt werden. Für
neue Gebäude sollten Gründächer mit krautigen Pflanzen heimischer Arten vorgesehen werden.
Zudem werden am östlichen Rand des UG mit einem Teil einer Grünlandfläche (GMZ) und einer
halbruderalen Gras- und Staudenflur (AKM) strukturreichere Offenflächen in Anspruch genommen. Bei
der Gestaltung des Uferparks sollten entsprechend Offenflächen mit extensiver Pflege eingerichtet
werden.
Der am Rand der für Bebauung vorgesehenen Fläche verlaufende Knick (HWD), der die Weidefläche
(GW) einrahmt, ist gesetzlich geschützt. Dieser ist einschließlich des Gehölzbestandes zu erhalten und
vor Beeinträchtigungen zu schützen. Dies ist auch bei einer Nutzung der Weidefläche als öffentliche
Grünfläche für Spiel und Sport zu beachten.
Im Norden, nördlich des Bornbaches, liegt eine Waldfläche aus Pionierwald und Rotbuchenbestand.
Zum Schutz der Waldfläche als Lebensraum für verschiedene Tierarten sollte dieser nicht mit einer
Durchwegung gequert werden, sondern als zusammenhängender Bestand erhalten bleiben
(öffentliche Grünfläche „Kleine Wildnis“).
Bei der Planung eines Quartiersplatzes ist der Eichenmischwaldbestand (WQM) zu berücksichtigen. Die
starkstämmigen und bestandsprägenden Eichenbäume sollten erhalten bleiben.
Im Bereich des Regenrückhaltebeckens sind mit Schilf-Röhricht (NRS) und Weiden-Moor- und
Sumpfgebüsch (HSC) gesetzlich geschützte Biotope am westlichen Ufer vorhanden. Zusammen mit
dem angrenzenden Waldbestand (WXH) und der Wasserfläche des Rückhaltebeckens (SXR) bilden
diese einen wertvollen Biotopkomplex und Lebensraum für Tierarten. Dies ist bei einer Erweiterung
des Rückhaltebeckens und der Planung eines Uferparks sowie bei Maßnahmen zur
Regenwasserrückhaltung zu berücksichtigen.
Der Bornbach ist im Abschnitt innerhalb des UG als naturnaher Bach ein gesetzlich geschützter Biotop.
Die Vegetation sowohl an Wasserpflanzen (sub- und emerse Vegetation), als auch an Ufergehölzen
und krautiger Ufervegetation ist meist arten- und strukturreich. Verbauungen sind teilweise aufgelöst
oder mit Vegetation überwachsen. Der Bornbach ist in dieser Biotopausprägung als gesetzlich
geschützter Biotop zu erhalten. Der Uferbereich sollte von beiden Uferseiten möglichst störungsfrei
gehalten werden.
3.2 Brutvögel
3.2.1 Methode
Geländearbeit
Das Erfassungsprogramm umfasste sechs Begehungen im Zeitraum März bis Juni 2022 im gesamten
Untersuchungsgebiet zum Zeitpunkt der höchstens Gesangsaktivität (morgens bei Sonnenaufgang bis
max. 10:00 Uhr) und bei geeigneter Witterung (kein Niederschlag, Windstärke bis max. 4 Bft.). Der
Erfassungszeitraum für die Begehungen März bis Juni entspricht der Kernbrutzeit der zu erwartenden
Arten.
Seite 18Rahmenplan Diekmoor Bestandserhebungen zu Fauna und Biotoptypen - Gesamtbericht
Die Termine waren:
1. Begehung 2. Begehung 3. Begehung 4. Begehung 5. Begehung 6. Begehung
23.03.2022 06.04.2022 20.04.2022 05.05.2022 25.05.2022 08.06.2022
ab 06:20 Uhr ab 06:40 Uhr ab 06:15 Uhr ab 05:40 Uhr ab 05:10 Uhr ab 4:50 Uhr
2 – 14°C, 8 – 7°C, 3 – 13°C, 2 – 12°C, 10 – 16°C, 9 – 16°C,
2 – 1 Bft, 4 Bft, 2 Bft, 2 Bft, 2 – 3 Bft, 1 – 2 Bft,
Bedeckungs- Bedeckungs- Bedeckungs- Bedeckungs- Bedeckungs- Bedeckungs-
grad: 0/8, grad: 8/8, grad: 1/8, grad: 3/8, grad: 3/8, grad: 0/8 -
kein zeitweise kein kein kein 8/8,
Niederschlag leichter Niederschlag Niederschlag Niederschlag kein
Niederschlag Niederschlag
(0,3 mm)
Die Brutvogelerfassung erfolgte nach Standardmethodik der Revierkartierung gemäß SÜDBECK et al.
(2005) über Sichtbeobachtung unter Zuhilfenahme eines Fernglases (10x42) und das Hören von
Lautäußerungen. Der Einsatz von Klangattrappen erfolgte nicht. Alle Beobachtungen, d.h. Vogelart,
Geschlecht und Verhalten, wurden mit entsprechenden standardisierten Kürzeln und Symbolen in
Tageskarten zu den jeweiligen Begehungen eingetragen.
Das gesamte UG wurde in drei Teilgebiete gegliedert (vgl. Abb. 2 in Kap. 2). Die drei Teilgebiete wurden
zeitgleich von jeweils einer kartierenden Person begangen und flächendeckend erfasst.
Die Vereinsgelände der Kleingartenvereine wurden entlang der öffentlich zugänglichen Wege
begangen. Die Parzellen der Kleingartenpächter wurden von den Wegen aus kartiert.
Weit verbreitete und allgemein besonders häufig vorkommende Arten wurden aufgrund ihrer zu
erwartenden hohen Anzahlen an Registrierungen mittels Strichlisten erfasst. Mit Hilfe von Strichlisten
wurden folgende häufig im besiedelten und gehölzreichen Gebieten vorkommende Brutvogelarten
gezählt: Amsel, Blaumeise, Buchfink, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube,
Rotkehlchen, Straßentaube, Zaunkönig und Zilpzalp. Ein Strich repräsentiert eine Beobachtung eines
Vogels mit Revier anzeigenden Merkmalen. Jeweils ein Strich wurden in dem Lebensraumtypen der
Teilbereiche eingetragen, in dem die jeweilige Beobachtung wahrgenommen wurde. Die
Vorgehensweise der hier angewendeten Strichlistenerfassung für häufige Arten und die Auswahl der
Arten basiert auf der Methodik, die im Rahmen der Atlaskartierung angewendet wird (SÜDBECK et al.
2005).
Zur Erfassung von dämmerungs- und nachtaktiven Vögeln erfolgten zusätzliche Begehungen am
10.03.2022, 07.05.2022 und 28.05.2022 in der Dämmerung bis ca. 3 Stunden nach Sonnenuntergang.
Auswertung
Zur differenzierten Darstellung der Ergebnisse wurden die drei Teilgebiete 1, 2 und 3 wiederum grob
in Teilbereiche unterteilt (vgl. Abb. 2, Kap. 2).
Zur Ermittlung des Brutbestandes im UG und in den jeweiligen Teilgebieten wurden die
Beobachtungen gemäß SÜDBECK et al. (2005) zu Brutrevieren ausgewertet.
Die Auswertung erfolgte unter Verwendung von ArcGIS (Version 10.8.1). Für jede beobachtete
Vogelart wurden alle ihr zugeteilten Registrierungen der sechs Begehungen bzw. der sechs Tages-
Erfassungskarten jeweils auf einer Artkarte zusammengefasst. Die sich dabei abzeichnenden
gruppierten Registrierungen einer Vogelart wurden anschließend unter Berücksichtigung ihrer Anzahl,
Seite 19Sie können auch lesen