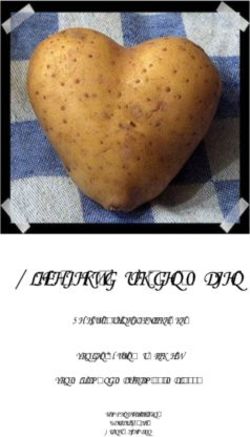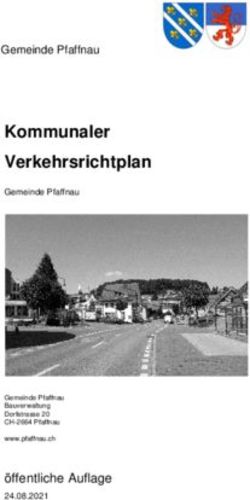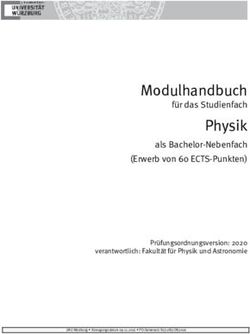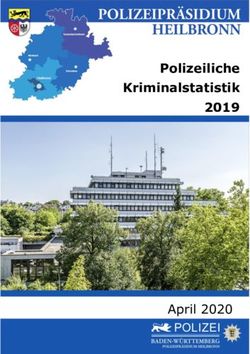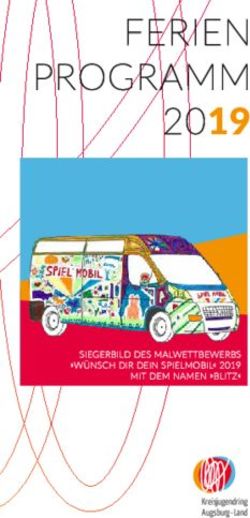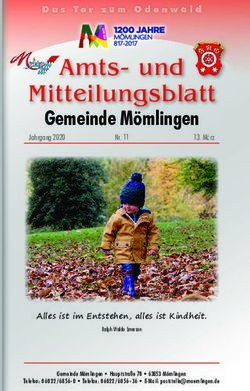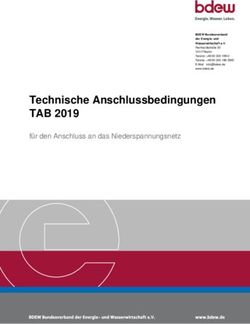BIETERLÜCKEN IM VERGABERECHT - Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades - JKU ePUB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Eingereicht von
Ing. Julia Gröchenig
Angefertigt am
Institut für Europarecht
Beurteiler / Beurteilerin
Univ.-Prof. Dr. Franz
Leidenmühler
Februar 2021
BIETERLÜCKEN IM
VERGABERECHT
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Magistra der Rechtswissenschaften
im Diplomstudium
Rechtswissenschaften
JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Österreich
jku.atEIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG
Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig
und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel nicht benutzt bzw die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen
als solche kenntlich gemacht habe.
Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten
Textdokument identisch.
Dornbirn, 25. Februar 2021
Ing. Julia Gröchenig
Seite 2 von 47Der Bundesgesetzgeber hat bei der Formulierung der Vergabegesetze die
Sprachform des generischen Maskulinums angewendet. Gemäß § 381 Abs 2
Bundesvergabegesetz 2018 gelten alle in diesem Gesetz verwendeten
personenbezogenen Bezeichnungen gleichermaßen für Personen weiblichen als
auch männlichen Geschlechts. Um eine eindeutige Zuordnung zu den
Bezeichnungen in den Vergabegesetzen zu erreichen, wird in dieser
Diplomarbeit ebenso auf die Sprachform des generischen Maskulinums
zurückgegriffen. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die
ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig
verstanden werden soll.
Seite 3 von 47Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung ......................................................................................................5
II. Grundlagen ...................................................................................................7
A. Unionsrechtliche Grundlagen .................................................................7
B. Umsetzung in Österreich........................................................................9
C. Grundsätze des Vergabeverfahrens .................................................... 11
1. Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung ................................. 12
2. Transparenz .................................................................................. 13
3. Verhältnismäßigkeit ....................................................................... 13
4. Freier und lauterer Wettbewerb ..................................................... 14
III. Ablauf eines Vergabeverfahrens ................................................................ 15
A. Kurz-Übersicht über ein Vergabeverfahren nach dem BVergG 2018 ..15
B. Rechtsschutz ....................................................................................... 18
C. Vergleichbarkeit von Angeboten .......................................................... 19
IV. Bieterlücken ................................................................................................ 21
A. Allgemeines ......................................................................................... 21
B. Unionsrechtliche Bestimmungen .......................................................... 23
C. Nationale Bestimmungen ..................................................................... 24
1. Abweichen vom Grundsatz der produktneutralen Ausschreibung .25
2. Echte und unechte Bieterlücken .................................................... 27
3. Fehler bei Angaben zu Bieterlücken .............................................. 28
D. Gleichwertigkeitsnachweis von angebotenen Produkten ..................... 31
1. Art des Nachweises ....................................................................... 31
2. Zeitpunkt des Nachweises............................................................. 32
3. Exkurs: behebbare und unbehebbare Mängel............................... 36
4. Folgen eines fehlenden Nachweises ............................................. 37
E. Möglicher Umgang in der Praxis .......................................................... 43
V. Resümee .................................................................................................... 45
VI. Literaturverzeichnis .................................................................................... 46
Seite 4 von 47I. Einleitung
„Wer echte Bieterlücken ignoriert, verliert“1
Bieterlücken sind seit Jahren ein unterschätztes Detail in Vergabeverfahren.
Viele Bieter sind bereits an Bieterlücken gescheitert und haben durch falsch oder
nicht ausgefüllte Bieterlücken eine Chance auf einen Auftrag verloren.
Besonders bei der Ausschreibung von Bauleistungen kommen oft Bieterlücken
zum Einsatz. Dies nicht zuletzt deshalb, weil bereits die verschiedenen
Leistungsbeschreibungen, wie zB die Leistungsbeschreibung Hochbau, die
Leistungsbeschreibung Haustechnik (beide herausgegeben vom
Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) oder die
Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur (herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr), Bieterlücken beinhalten.
Der Europäische Gerichtshof hat sich in der Rechtssache C-14/17, Var / Iveco
mit der Frage beschäftigt, zu welchem Zeitpunkt der Bieter die Gleichwertigkeit
eines in einer Bieterlücke angegebenen Produktes nachweisen muss.2 Zu Recht
wurde in Österreich in Bezug auf diese Entscheidung die Frage gestellt, wie die
ständige Judikatur in Österreich zu behebbaren und unbehebbaren Mängeln
damit vereinbar ist.3
Ziel dieser Diplomarbeit ist es die Problemstellungen bei Bieterlücken im
Allgemeinen und mit dem Nachweis der Gleichwertigkeit im Besonderen,
darzustellen, sowie die Vereinbarkeit der EuGH-Judikatur mit der
österreichischen Rechtslage festzustellen.
1 Reisinger/Ullreich, Wer echte Bieterlücken ignoriert, verliert, ZVB 2018/17, 70-74.
2 Vgl EuGH C-14/17, Var/Iveco, ECLI:EU:C:2018:568.
3 Vgl Kurz, Neues über Bieterlücken, Österreichische Bauzeitung 20/2018, 39.
Seite 5 von 47Die vorliegende Arbeit lässt sich in drei Themenblöcke aufteilen. Zu Beginn
werden in Kapitel II. die europäischen und nationalen Grundlagen des
Vergaberechts aufgearbeitet. Anschließend wird in Kapitel III. ein kurzer
Überblick über ein Vergabeverfahren gegeben. Der dritte Themenblock
beschäftigt sich in Kapitel IV. mit den europäischen und nationalen
Bestimmungen zu Bieterlücken, dem Nachweis der Gleichwertigkeit von
Produkten, die in Bieterlücken angeboten wurden, sowie mit dem Umgang mit
Bieterlücken in der Praxis.
Seite 6 von 47II. Grundlagen
A. Unionsrechtliche Grundlagen
Das Hauptziel der Europäischen Union war von Beginn an das Herstellen eines
Binnenmarktes und die hierfür erforderliche Harmonisierung von
Rechtsvorschriften für den freien Verkehr von Waren, Personen,
Dienstleistungen und Kapital der einzelnen Mitgliedsstaaten. Die Vergabe von
öffentlichen Aufträgen hat einen großen Anteil am gemeinsamen Markt.
Infolgedessen hat die Vergabe öffentlicher Aufträge bei der Harmonisierung von
Rechtsakten einen hohen Stellenwert.4
Das österreichische Vergaberecht ist von den europäischen Vorgaben für die
Vergabe öffentlicher Aufträge geprägt. Die EU hat mit verschiedenen
Verordnungen und Richtlinien die Vergabe von Bauleistungen, Dienstleistungen,
Lieferleistungen und Konzessionen durch öffentliche Auftraggeber für den
Oberschwellenbereich europaweit einheitlich geregelt.5 Zuletzt wurden mit den
Richtlinien RL 2014/23/EU6, RL 2014/24/EU7, RL 2014/25/EU8 und
RL 2009/81/EG9 viele Details für Ausschreibungen im Oberschwellenbereich neu
festgelegt.10
Richtlinien gemäß Art 288 Abs 3 AEUV11 sind generell-abstrakt und innerstaatlich
nicht unmittelbar anwendbar, sondern bedürfen einer Umsetzung in das
innerstaatliche Recht der Mitgliedsstaaten. Sie sind nur hinsichtlich ihrer Ziele
4 Vgl Berger/Zleptnig in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 3; Frenz,
Vergaberecht EU und national (2018) Rz 2 ff.
5 Vgl Holoubek/Fuchs/Ziniel, Vergaberecht, in Holoubek/Potacs (Hrsg), Öffentliches Wirtschaftsrecht I4
(2019) 858 ff.
6 RL 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die
Konzessionsvergabe, ABl L 94, 1.
7 RL 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche
Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG, ABl L 94, 65.
8 RL 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Vergabe
von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-und Verkehrsversorgung sowie der
Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG, ABl L 94, 243.
9 RL 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung
der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen
Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG, ABl L 216, 76.
10 Vgl Holoubek/Fuchs/Ziniel, Vergaberecht, in Holoubek/Potacs (Hrsg), Öffentliches Wirtschaftsrecht I4
(2019) 865.
11 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) BGBl III 1999/86.
Seite 7 von 47verbindlich und sind in einer bestimmten Frist in den einzelnen Mitgliedsstaaten
umzusetzen. Lediglich bei einem Umsetzungsverzug des einzelnen
Mitgliedsstaates können sich die Rechtsunterworfenen auf einzelne, ihnen
gegenüber dem Staat zu Gute kommende Regelungen einer Richtlinie berufen,
sofern diese Regelungen unbedingt und hinreichend bestimmt sind, und für die
Anwendung kein Ermessen erforderlich ist.12
Gemäß Art 19 Abs 1 EUV „sichert [der Gerichtshof der EU] die Wahrung des
Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge“.13 Entstehen im
Rahmen der Auslegung des Europarechts Unsicherheiten, können nationale
Gerichte – eine Verpflichtung besteht für letztinstanzliche Gerichte – den EuGH
anrufen und in einem Zwischenverfahren um eine Entscheidung über die
Auslegung von primärem oder sekundärem Unionsrecht oder die Gültigkeit von
Sekundärrechtsakten ersuchen. Der EuGH kann in einem solchen
Vorabentscheidungsverfahren die Vereinbarkeit von nationalen Vorschriften mit
dem Unionsrecht überprüfen.14
Die Entscheidungen des EuGH in Vorabentscheidungsverfahren wirken ex tunc
und haben grundsätzlich nur für das Anlassverfahren bindende Wirkung (inter
partes Wirkung). Alle Instanzen, die mit dem Anlassverfahren befasst sind, sind
an die Entscheidung des EuGH gebunden.15 Auslegungsurteile in
Vorabentscheidungsverfahren entfalten jedoch auch darüber hinaus eine
faktische Bindungswirkung in die Zukunft, auch für nicht am Verfahren beteiligte
Gerichte.16 Sofern nationale, letztinstanzliche Gerichte entgegen der Auslegung
12 Vgl Magiera, Rechtsakte und Rechtssetzung der Union, in Niedobitek (Hrsg), Europarecht. Grundlagen
und Politiken der Union2 (2020) § 7 Rz 28; Leidenmühler, Europarecht. Die Rechtsordnung der
europäischen Union4 (2020) 52 ff.
13 Art 19 Abs 1 Vertrag über die Europäische Union (EUV) BGBl III 1999/85.
14 Vgl Art 267 AEUV; Schroeder, Durchsetzung des Unionsrechts – Durchführung, Sanktionen,
Rechtsschutz, in Niedobitek (Hrsg), Europarecht. Grundlagen und Politiken der Union2 (2020) § 8
Rz 184 f; Leidenmühler, Europarecht. Die Rechtsordnung der europäischen Union4 (2020) 118 ff; Streinz,
Europarecht11 (2019) Rz 704 ff.
15 Vgl Schroeder, Durchsetzung des Unionsrechts – Durchführung, Sanktionen, Rechtsschutz, in
Niedobitek (Hrsg), Europarecht. Grundlagen und Politiken der Union2 (2020) § 8 Rz 189; Streinz,
Europarecht11 (2019) Rz 713.
16 Vgl Schroeder, Durchsetzung des Unionsrechts – Durchführung, Sanktionen, Rechtsschutz, in
Niedobitek (Hrsg), Europarecht. Grundlagen und Politiken der Union2 (2020) § 8 Rz 189; Pollak,
Bindungswirkung von Auslegungsurteilen des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) im
Vorabentscheidungsverfahren nach Art 177, RZ 1998, 190.
Seite 8 von 47des EuGH in einem früheren Urteil entscheiden wollen, sind sie zur erneuten
Vorlage an den EuGH verpflichtet. Vice versa sind sie an die Rechtsprechung
des EuGH gebunden.17
Auch nicht letztinstanzliche Gerichte sind grundsätzlich an die Rechtsprechung
des EuGH gebunden. Dies deshalb, da unterlegene Rechtsunterworfene bei
einer Entscheidung, der eine abweichende Auslegung des EU-Rechts zugrunde
liegt, regelmäßig den Rechtsweg beschreiten werden und das letztinstanzliche
Gericht wiederum zur Vorlage der Frage an den EuGH verpflichtet ist.18
Der Rechtsanwender handelt prinzipiell richtig, wenn er sich bei der Anwendung
der Vergabegesetze an der Judikatur der Gerichte orientiert, da es bei den
meisten Verfahrensarten eine Vielzahl an Verfahrensschritten gibt, die von den
am Verfahren beteiligten Unternehmern angefochten werden können.19
B. Umsetzung in Österreich
In Österreich erfolgte die Umsetzung der Vergaberichtlinien mit dem
Bundesvergabesetz 201820, dem Bundesvergabegesetz Konzessionen 201821
und dem Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 201222, sowie neun
Landesgesetzen23 für den Rechtsschutz.24
Diese Aufsplitterung ergibt sich durch die Kompetenzverteilung in Art 14b B-VG.
Die Gesetzgebung des materiellen Rechts ist Bundeskompetenz. Gemäß
Art 14b Abs 4 B-VG ist der Bund verpflichtet die Länder bei der Erarbeitung eines
17 Vgl EuGH C-283/81, C.I.L.F.I.T./Ministero della Sanità, ECLI:EU:C:1982:335, Rn 13; Frenz, Handbuch
Europarecht V Wirkungen und Rechtsschutz (2010) Rz 3405.
18 Vgl Frenz, Handbuch Europarecht V Wirkungen und Rechtsschutz (2010) Rz 3406.
19 Näheres dazu unter Punkt III.B. Rechtsschutz.
20 Bundesvergabegesetz 2018 (BVergG 2018) BGBl I 2018/65.
21 Bundesvergabegesetz Konzessionen 2018 (BvergGKonz 2018) BGBl I 2018/65.
22 Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 (BVergGVS 2012) BGBl I 2012/10.
23 Burgenländisches Vergaberechtsschutzgesetz (Bgld. VergRSG) LGBl 2006/66; NÖ Vergabe-
Nachprüfungsgesetz (NÖ VNG) LGBl 7200-0; Oö. Vergaberechtsschutzgesetz LGBl 2006/130; Salzburger
Vergabekontrollgesetz 2018 (S.VKG 2018) LGBl 2018/63; Steiermärkisches Vergaberechtsschutzgesetz
2018 (StVergRG 2018) LGBl 2018/62; Tiroler Vergabenachprüfungsgesetz 2018 (TVNG 2018) LGBl
2015/94; Vorarlberger Vergabenachprüfungsgesetz LGBl 2003/1; Wiener Vergaberechtsschutzgesetz
2014 (WVRG 2014) LGBl 2016/43.
24 Vgl Walther in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 1853.
Seite 9 von 47Gesetzesentwurfs einzubinden. Diese Mitwirkung geht über eine reine Anhörung
hinaus. Eine Kundmachung von Bundesgesetzen im Vergaberecht, deren
Vollziehung Landessache ist, darf nur mit Zustimmung der Länder erfolgen.25
Nach dem föderalistischen Prinzip ist die Vollziehung des materiellen Rechts
zwischen Bund und den Ländern aufgeteilt. In die Landeskompetenz fällt unter
anderem die Vergabe von Aufträgen, die durch das Land, Gemeinden,
Gemeindeverbände sowie Landes- und Gemeindegesellschaften durchgeführt
werden.26 Die Gesetzgebung zum Rechtsschutz ist nach dem gleichen Prinzip
zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Die Regelung der Angelegenheiten der
Nachprüfung ist Sache des zuständigen Materiengesetzgebers, also des
Bundes. Art 14b Abs 3 B-VG durchbricht jedoch das Adhäsionsprinzip, sodass
die Regelung des Nachprüfungsverfahrens Landessache ist.27 Der Rechtsschutz
erfolgt für die Vergabe von Aufträgen des Bundes vor dem
Bundesverwaltungsgericht, für die Vergabeverfahren der Länder, Gemeinden
und Gemeindeverbände vor dem jeweiligen Landesverwaltungsgericht.28
Die Umsetzung der Vergaberichtlinien der EU in nationales Recht erfolgt daher
in erster Linie – unter der Mitwirkung der Länder – durch den Bund (materielles
Recht und Rechtsschutz für Vergabeverfahren durch den Bund). Dabei wird,
soweit dies möglich ist, auf Gold Plating verzichtet. Es wird also angestrebt keine
höheren Standards festzulegen als in den Richtlinien gefordert sind. Eine
inhaltliche Übererfüllung im Anwendungsbereich der Richtlinie soll vermieden
werden.29 Auch im aktuellen Regierungsprogramm wird die Vermeidung von
Gold Plating, sowie die Deregulierung bei bereits erfolgtem Gold Plating
gefordert.30
25 Vgl Rill in Kneihs/Lienbacher (Hrsg), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht (2015)
Art 14b B-VG, 28; Muzak, Bundes-Verfassungsrecht6 (2020) Art 14b B-VG Rz 6 f.
26 Vgl Berger/Zleptnig in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 66 ff; Muzak,
BundesVerfassungsrecht6 (2020) Art 14b B-VG Rz 3 f
27 Vgl VfGH G 205/2018 VfSlg 20.301 = RPA 2019, 218; Muzak, Bundes-Verfassungsrecht6 (2020)
Art 14b B-VG Rz 5; Fruhmann, Regelung des Landes hängt von vorheriger materieller Vergaberegelung
des Bundes ab, ZVB 2019/39, 150-155 (151).
28 Vgl Berger/Zleptnig in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 68.
29 Vgl ErläutRV 69 BlgNr 26. GP 1; Leidenmühler, Die freiwillige „Übererfüllung“ unionsrechtlicher
Vorgaben durch die Mitgliedsstaaten. Ein Beitrag zur rechtsdogmatischen und rechtspolitischen
Diskussion um das sog. „Gold Plating“, EuR 4/2019, 383-399 (386).
30 Vgl Bundeskanzleramt Österreich, Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020-2024
(2020) 63 f.
Seite 10 von 47Der VfGH fordert auch im Unterschwellenbereich gesetzliche Regelungen, die
den Unternehmern einen Rechtsschutz ermöglichen.31 Bei der Festlegung von
Vorschriften für den Unterschwellenbereich, welcher nicht Richtlinieninhalt ist
und damit nicht der Harmonisierung der EU unterliegt, orientiert sich der nationale
Gesetzgeber an den Vorgaben für den Oberschwellenbereich. Diese autonome
Übernahme, bei dem die Vorgaben der Richtlinie für einen Anwendungsbereich,
der außerhalb der Richtlinie liegt, übernommen werden, dient letztendlich der
Schaffung eines durchgängigen Systems.32
Die Entscheidungen der nationalen Gerichte entfalten nur für den Anlassfall
Bindungswirkung.33 Das Vergaberecht ist jedoch sehr von der Rechtsfortbildung
durch die Judikatur des EuGH geprägt, weshalb hier auf die vorangegangenen
Ausführungen verwiesen wird.
C. Grundsätze des Vergabeverfahrens
Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten sind die Bestimmungen des AEUV –
die Grundfreiheiten und das allgemeine Diskriminierungsverbot – unmittelbar
anwendbar.34
In den Vergaberichtlinien sind Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung,
Transparenz und Verhältnismäßigkeit als Grundsätze der Auftragsvergabe
vorgegeben.35 Der nationale Gesetzgeber hat diese Leitlinien in
§ 20 Abs 1 BVergG 2018 übernommen und für alle Vergabeverfahren –
unabhängig ob im Oberschwellenbereich oder im Unterschwellenbereich – in
31 Vgl ErläutRV 69 BlgNr 26. GP 2; VfGH G 110/99 ua VfSlg 16.027.
32 Vgl Leidenmühler, Die freiwillige „Übererfüllung“ unionsrechtlicher Vorgaben durch die Mitgliedsstaaten.
Ein Beitrag zur rechtsdogmatischen und rechtspolitischen Diskussion um das sog. „Gold Plating“,
EuR 4/2019, 383-399 (386 f).
33 Vgl Hauer, Staats- und Verwaltungshandeln5 (2017) Rz 436.
34 Vgl Berger/Zleptnig in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 7.
35 Vgl Art 18 Abs 1 RL 2014/24/EU, ABl L 94, 65; Art 3 Abs 1 RL 2014/23/EU, ABl L 94, 1; Art 36 Abs 1 RL
2014/25/EU, ABl L 94, 243.
Seite 11 von 47Geltung gesetzt.36 Diese Grundsätze sind insbesondere zur Interpretation der
Verfahrensbestimmungen heranzuziehen.37
Die Bestimmungen im Vergaberecht zum Rechtsschutz der am Verfahren
beteiligten Unternehmer ermöglichen es denselben sich gegen Verstöße des
öffentlichen Auftraggebers gegen Verfahrensbestimmungen oder die Grundsätze
des Vergabeverfahrens zu wehren.38
1. Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung
Um ein Vergabeverfahren fair und neutral durchführen zu können, sind alle
Bewerber und Bieter gleich zu behandeln. Das Diskriminierungsverbot und das
Gleichbehandlungsgebot zählen somit zu den wichtigsten
Verfahrensgrundsätzen. Die Einhaltung der Grundsätze soll die Bevorzugung
von Bietern durch öffentliche Auftraggeber verhindern.39
Diese Grundsätze gelten in jeder Phase eines Vergabeverfahrens. Sowohl
Unternehmer, die bereits ein Angebot abgegeben haben (Bieter), als auch an der
Ausschreibung interessierte Unternehmer (potenzielle Bieter) sind vom
Auftraggeber gleich zu behandeln. Der Auftraggeber hat daher bereits die
Ausschreibungsunterlagen diskriminierungsfrei zu verfassen.40
Das Gleichbehandlungsgebot zeigt sich unter anderem darin, dass allen
Bewerbern und Bietern unter den gleichen Bedingungen die Abgabe eines
Angebotes oder Teilnahmeantrags ermöglicht werden muss. Hat ein
Unternehmer in einem Vergabeverfahren Vorarbeiten erbracht, so ist der
Auftraggeber verpflichtet einen allenfalls entstandenen Vorteil gegenüber
anderen Bewerbern bzw Bietern auszugleichen. Der Auftraggeber ist an die von
36 Die Grundsätze des Vergabeverfahrens sind für Sektorenauftraggeber in § 193 Abs 1 BVergG 2018 und
für die Vergabe von Konzessionen in § 14 Abs 1 BVergGKonz 2018 normiert.
37 Vgl Eilmannsberger/Fruhmann in Schramm/Aicher/Fruhmann/Thienel (Hrsg), Bundesvergabegesetz
20062 (2009) § 19 Rz 1; Fink/Heid in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 763.
38 Vgl Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 2.24.
39 Vgl Eilmannsberger/Fruhmann in Schramm/Aicher/Fruhmann/Thienel (Hrsg), Bundesvergabegesetz
20062 (2009) § 19 Rz 11.
40 Vgl EuGH C-16/98, Kommission/Frankreich, ECLI:EU:C:2000:541, Rn 107 ff; EuGH C-87/94,
Kommission/Belgien, ECLI:EU:C:1996:161, Rn 54; Eilmannsberger/Fruhmann in
Schramm/Aicher/Fruhmann/Thienel (Hrsg), Bundesvergabegesetz 20062 (2009) § 19 Rz 20.
Seite 12 von 47ihm festgelegten Ausschreibungsbestimmungen gebunden und darf davon nicht
abweichen, damit die Gleichbehandlung aller Unternehmer sichergestellt ist.
Angebote müssen den Ausschreibungsbestimmungen entsprechen, um eine
Vergleichbarkeit aller Angebote zu erreichen.41
2. Transparenz
Um eine Gleichbehandlung aller Bewerber bzw Bieter gewährleisten zu können,
muss jedes Vergabeverfahren ein gewisses Maß an Öffentlichkeit beinhalten. So
sind beispielsweise Zuschlagskriterien in den Ausschreibungsunterlagen zu
veröffentlichen. Der Auftraggeber hat des Weiteren seine
Zuschlagsentscheidung ausreichend zu begründen, um für die Bieter die
Voraussetzung zu schaffen die Entscheidung, warum der Zuschlag an den
präsumtiven Zuschlagsempfänger erteilt werden soll, soweit nachvollziehen zu
können, dass eine Nachprüfung der Entscheidung möglich wäre. Nur eine
transparente Verfahrensführung ermöglicht auch eine Kontrolle der
Gleichbehandlung.42
3. Verhältnismäßigkeit
Der Auftraggeber hat in einem Vergabeverfahren verschiedene Festlegungen
vorzunehmen, die auf Unternehmer, welche sich am Verfahren beteiligen wollen,
große Auswirkungen haben. Die Festlegung der Eignungskriterien hat im
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand zu erfolgen. Hierbei muss
verhältnismäßig vorgegangen werden.43 Auch bei der Beurteilung verschiedener
Ausschlussgründe ist Verhältnismäßigkeit an den Tag zu legen – so ist zB die
Dauer eines Ausschlusses aus Vergabeverfahren nach dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beurteilen.44 Insbesondere Beschränkungen
in Bezug auf Bietergemeinschaften oder die Beteiligung von Subunternehmern
41 Vgl EuGH C-87/94, Kommission/Belgien, ECLI:EU:C:1996:161, Rn 56; Heid/Ring in
Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019) § 20 Rz 4; Heid/Kurz in Heid/Preslmayr
(Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 1158 f.
42 Vgl Heid/Ring in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019) § 20 Rz 8 ff.
43 Vgl Heid/Ring in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019) § 20 Rz 11.
44 Vgl Deutschmann/Heid in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019) § 83 Rz 14 ff.
Seite 13 von 47unterliegen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung, da diese einen Unternehmer
unmittelbar von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren abhalten können.45
4. Freier und lauterer Wettbewerb
Der freie Wettbewerb ist direkter Ausfluss der Warenverkehrs-, Niederlassungs-
und Dienstleistungsfreiheit. Der Wettbewerb darf keinen Zugangs- oder
Ausübungsbeschränkungen unterliegen.46 In diesem Zusammenhang ist auf die
Pflicht des Auftraggebers hinzuweisen die zu beschaffende Leistung neutral zu
beschreiben, damit der Bieterkreis nicht eingeschränkt wird.47
Der lautere Wettbewerb ergibt sich aus dem Verhalten der Bieter zum
Auftraggeber bzw untereinander.48 Das BVergG 2018 normiert beispielsweise
eine Verpflichtung des Auftraggebers Unternehmer aus dem Vergabeverfahren
auszuschließen, die versucht haben „die Entscheidungsfindung des
Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen“49. Eine solche
Verpflichtung besteht auch bei hinreichend plausiblen Anhaltspunkten, dass
zwischen Unternehmern Preisabsprachen erfolgten.50
45 Vgl Heid/Ring in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019) § 20 Rz 11.
46 Vgl Heid/Ring in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019) § 20 Rz 12.
47 Vgl VwGH 01.02.2017, Ro 2016/04/0054; Frenz, Handbuch Europarecht I Europäische Grundfreiheiten2
(2012) Rz 851; Kromer, Produktspezifische Beschaffungen unter dem BVergG 2018, ZVB 2019/79, 321-
325 (321).
48 Vgl ErläutRV 69 BlgNR 26. GP 52.
49 § 78 Abs 1 Z 11 BVergG 2018.
50 Vgl § 78 Abs 1 Z 4 und Z 11 BVergG 2018; Heid/Ring in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG
2018 (2019) § 20 Rz 13; Eilmannsberger/Fruhmann in Schramm/Aicher/Fruhmann/Thienel (Hrsg),
Bundesvergabegesetz 20062 (2009) § 19 Rz 33.
Seite 14 von 47III. Ablauf eines Vergabeverfahrens
In den nationalen Vergabegesetzen sind verschiedene Arten von
Vergabeverfahren vorgesehen.51 Der öffentliche Auftraggeber hat das Verfahren
nach der Auftragsart und dem geschätzten Auftragswert zu wählen.52 Die
Standardverfahren für den klassischen öffentlichen Auftraggeber sind im Ober-
und im Unterschwellenbereich das offene Verfahren und das nicht offene
Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung.53
A. Kurz-Übersicht über ein Vergabeverfahren nach dem BVergG 2018
Für den klassischen öffentlichen Auftraggeber ist – abgesehen von
Konzessionsvergaben – das BVergG 2018 einschlägig.54 Bei der Beschreibung
eines Vergabeverfahrens wird daher auf die Bestimmungen für ein offenes
Verfahren nach dem BVergG 2018 zurückgegriffen.
Noch vor Beginn des eigentlichen Verfahrens sind die Ausschreibungsunterlagen
(oder Auftragsunterlagen) – das Kernstück eines Vergabeverfahrens – zu
erstellen. Die Ausschreibungsunterlagen umfassen neben den
Ausschreibungsbestimmungen auch den Vertrag, der am Ende des
Vergabeverfahrens zwischen Auftraggeber und Unternehmer abgeschlossen
werden soll.55
Das offene Verfahren ist als einstufiges Vergabeverfahren ausgebildet. Nach der
öffentlichen Bekanntmachung der Ausschreibung kann eine unbeschränkte
Anzahl an Bietern ein Angebot abgeben.56 Eine Vergabe darf jedoch nur an
geeignete Unternehmer erfolgen. Aus diesem Grund hat der Auftraggeber in den
Ausschreibungsbestimmungen für jedes einzelne Vergabeverfahren spezifische
51 Vgl §§ 31, 203 BVergG 2018; § 23 BVergGVS 2012; Holoubek/Fuchs/Ziniel, Vergaberecht, in
Holoubek/Potacs (Hrsg), Öffentliches Wirtschaftsrecht I4 (2019) 907.
52 Vgl §§ 12 ff BVergG 2018 und §§ 33 ff BvergG 2018.
53 Vgl § 33 BVergG 2018; Fink/Heid in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 787.
54 Vgl § 1 Z 1 BVergG 2018.
55 Vgl §§ 91, 105, 106 und 110 BVergG 2018; Heid/Kurz in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch
Vergaberecht4 (2015) Rz 1153 ff.
56 Vgl § 31 Abs 2 BVergG 2018; Fink/Heid in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz
788; Holoubek/Fuchs/Ziniel, Vergaberecht, in Holoubek/Potacs (Hrsg), Öffentliches Wirtschaftsrecht I4
(2019) 908.
Seite 15 von 47Kriterien festzulegen, welche die Mindestanforderungen an Unternehmer für die
Teilnahme am Vergabeverfahren darstellen. Kann ein Unternehmer diese
Eignungskriterien nicht erfüllen, ist das Angebot dieses Unternehmers aus dem
Vergabeverfahren auszuscheiden.57
Um später das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot ermitteln zu
können, hat der Auftraggeber nichtdiskriminierende, auftragsbezogene
Zuschlagskriterien festzulegen, die eine objektive Bewertung der eingegangenen
Angebote ermöglichen.58
Unmittelbar vor Einleitung des Vergabeverfahrens hat die sachkundige
Ermittlung des geschätzten Auftragswertes zu erfolgen, welcher Grundlage für
die Wahl des Vergabeverfahrens ist.59
Das Verfahren wird mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung eingeleitet.60
Zu diesem Zeitpunkt sind auch den Unternehmern die Ausschreibungsunterlagen
zur Verfügung zu stellen.61 Im Oberschwellenbereich sind Vergabeverfahren
verpflichtend elektronisch durchzuführen.62
Während der Angebotsfrist werden etwaige Bieterfragen beantwortet und der
Auftraggeber kann die Ausschreibungsunterlage, falls erforderlich, berichtigen.
Die Unternehmer sind von etwaigen Klarstellungen und Berichtigungen
zeitgerecht in Kenntnis zu setzen.63 Bis zum Ende der Angebotsfrist haben die
Unternehmer Zeit ihre Angebote einzubringen.64
57 Vgl §§ 2 Z 22 lit c, 20 Abs 1, 80 Abs 1 und 141 Abs 1 Z 2 BVergG 2018; Dillinger/Oppel, Das neue
Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 2.21.
58 Vgl §§ 2 Z 22 lit d und 91 Abs 4 BVergG 2018; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018
(2018) Rz 2.23.
59 Vgl § 13 Abs 3 BVergG 2018; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 3.66
und 3.161.
60 Vgl § 13 Abs 3 BVergG 2018; Fink/Heid in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015)
Rz 788.
61 Vgl § 89 Abs 1 BVergG 2018; Fink/Heid in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015)
Rz 789 f.
62 Vgl § 48 Abs 2 BVergG 2018; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 2.21.
63 Vgl §§ 69, 72 und 101 BVergG 2018; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 Rz 3.206 ff.
64 Vgl § 129 BVergG 2018; Fink/Hofer in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 1546.
Seite 16 von 47Nach Ablauf der Angebotsfrist werden die Angebote geöffnet.65 Bis zu diesem
Zeitpunkt sind die Anzahl und die Namen der am Verfahren interessierten
Unternehmer bzw der Unternehmer, die bereits ein Angebot abgegeben haben,
geheim zu halten.66
Im Anschluss an die Angebotsöffnung beginnt die Phase der Angebotsprüfung.67
Die Angebote sind von sachkundigen Personen zu prüfen.68 Hierbei werden unter
anderem die Vollständigkeit der Angebote, die Übereinstimmung der Angebote
mit den Ausschreibungsunterlagen, die Eignung der Bieter und ihrer
Subunternehmer, das Nicht-Vorliegen von Ausschlussgründen, sowie die
Preisangemessenheit der Angebote geprüft.69
Liegen in Angeboten Mängel vor, so erfolgt bei behebbaren Mängeln ein
Mängelbehebungsverfahren. Sind Angebote mit nicht behebbaren Mängeln
behaftet, so sind diese aus dem Vergabeverfahren auszuscheiden.70
Die im Vergabeverfahren verbliebenen Angebote sind nach den in der
Ausschreibung festgelegten Zuschlagskriterien zu bewerten und so das
technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot zu ermitteln.71
Die im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter sind über die
Zuschlagsentscheidung des Auftraggebers zu informieren. Die
Zuschlagsentscheidung ist ausreichend zu begründen.72
65 Vgl § 133 Abs 1 BVergG 2018; Kondert in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015)
Rz 1521.
66 Vgl § 112 Abs 4 BVergG 2018; Fink/Heid in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015)
Rz 792.
67 Vgl §§ 134 ff BVergG 2018; Fink/Hofer in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015)
Rz 1532.
68 Vgl § 134 BVergG 2018; Fink/Hofer in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 1536.
69 Vgl § 135 BvergG 2018; Fink/Hofer in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 1533.
70 Vgl §§ 138 f und 141 BVergG 2018; Fink/Hofer in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4
(2015) Rz 1597 ff.
71 Vgl § 142 Abs 1 BVergG 2018; Fink/Hofer in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015)
Rz 1532; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 5.74.
72 Vgl § 143 BVergG 2018; Fink/Heid in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 804;
Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 7.10 ff.
Seite 17 von 47Nach Ablauf der Stillhaltefrist kann an den präsumtiven Zuschlagsempfänger der
Zuschlag erteilt werden.73 Mit der Zuschlagserteilung ist das Vergabeverfahren
beendet.74 Liegen jedoch Umstände vor, wegen denen der Auftraggeber keinen
Zuschlag erteilen darf oder möchte, so ist das Vergabeverfahren stattdessen
mittels Widerruf zu beenden.75
Im Oberschwellenbereich und bei Vergabeverfahren, die vom Bund durchgeführt
werden, ist die Vergabe des Auftrages nach Zuschlagserteilung öffentlich
bekannt zu geben (Bekanntgabe vergebener Aufträge).76
B. Rechtsschutz
Die Vergabekontrolle erfolgt vor dem Verwaltungsgericht des Bundes bzw vor
den Verwaltungsgerichten der Länder.77 Bis zur Zuschlagserteilung bzw
Widerrufserklärung ist ein Unternehmer berechtigt einen Nachprüfungsantrag
gegen eine gesondert anfechtbare Entscheidung eines Auftraggebers wegen
einer Rechtswidrigkeit zu stellen, sofern ein Vertragsabschlussinteresse
behauptet wird und ihm durch die Rechtswidrigkeit ein Schaden entstanden ist.78
Nach Beendigung des Vergabeverfahrens durch eine Zuschlagserteilung oder
die Erklärung eines Widerrufes steht dem Bieter unter den gleichen Bedingungen
ein Feststellungsverfahren offen, sofern er die Rechtswidrigkeit nicht in einem
Nachprüfungsverfahren geltend machen hätte können.79
Die erste gesondert anfechtbare Entscheidung des Auftraggebers in einem
Vergabeverfahren liegt bereits in einem frühen Stadium des Vergabeverfahrens
vor. Mit der Bekanntmachung des Vergabeverfahrens werden die
73 Vgl §§ 144 Abs 1 und 145 BVergG 2018; Fink/Heid in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4
(2015) Rz 805; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 2.24.
74 Vgl § 146 Abs 1 BVergG 2018; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 2.24;
Keschmann in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 1701.
75 Vgl §§ 146 Abs 1 und 149 BVergG 2018; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018)
Rz 3.213; Sturm in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 1617.
76 Vgl §§ 61 f BVergG 2018; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 3.198 ff;
Auprich in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 1732.
77 Vgl Berger/Zleptnig in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 68.
78 Vgl § 342 Abs 1 BVergG 2018; Walther in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015)
Rz 2039.
79 Vgl § 353 Abs 1 BVergG 2018; Walther in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015)
Rz 2366.
Seite 18 von 47Ausschreibungsunterlagen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt, welche von
den Unternehmern mit einem Nachprüfungsantrag anfechtbar sind. Die letzte
gesondert anfechtbare Entscheidung liegt in der Zuschlagsentscheidung des
Auftraggebers – bzw bei einem Widerruf der Ausschreibung in der
Widerrufsentscheidung – , die allen Bietern zugestellt werden muss.80
Dem System der gesondert anfechtbaren Entscheidungen ist immanent, dass bei
Nichtanfechtung einer solchen Entscheidung alle vorangegangenen
Verfahrensschritte bestandsfest werden und somit nicht mehr angefochten
werden können. Mit Ablauf der Anfechtungsfrist (Präklusionsfrist) geht der
Anspruch auf Nachprüfung somit verloren.81
Hat die zuständige Vergabekontrollbehörde einen hinreichend qualifizierten
Verstoß gegen das BVergG 2018 festgestellt, hat ein Bewerber bzw Bieter des
Weiteren die Möglichkeit nach den zivilrechtlichen Bestimmungen
Schadenersatz vor den ordentlichen Gerichten einzuklagen.82
C. Vergleichbarkeit von Angeboten
Die Notwendigkeit der Vergleichbarkeit von Angeboten ergibt sich bereits aus
den Verfahrensgrundsätzen. Insbesondere das Gleichbehandlungsgebot und
das Diskriminierungsverbot sind hier einschlägig.83
Um in einem Vergabeverfahren den präsumtiven Zuschlagsempfänger ermitteln
zu können, ist es erforderlich, dass die Angebote der verschiedenen Bieter
miteinander vergleichbar sind.84
80 Vgl § 2 Z 15 lit a sublit aa BVergG 2018; Heid/Kurz in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4
(2015) Rz 1161.
81 Vgl ErläutRV 69 BlgNR 26.GP 198; VwGH 2013/04/0149 mwN Moick/Gföhler, BVergG 2018 § 343
(Stand 01.08.2018, rdb.at) E 52; VwGH 2007/04/0090 mwN Moick/Gföhler, BVergG 2018 § 343 (Stand
01.08.2018, rdb.at) E 39; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 2.25; Reisner
in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 2047.
82 Vgl § 369 BVergG 2018; Kurz in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019) § 369
Rz 4; Walther in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch Vergaberecht4 (2015) Rz 2366.
83 Vgl Kurz in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019) § 104 Rz 1.
84 Vgl § 88 Abs 2 BVergG 2018; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 5.74.
Seite 19 von 47Die Bieter müssen bei der Abgabe ihres Angebotes die Vorgaben des
Auftraggebers in den Ausschreibungsunterlagen einhalten. Daher ist es
unabdingbar, dass die Ausschreibungsunterlagen derart gestaltet sind, dass eine
Vergleichbarkeit der Angebote gewährleistet werden kann.85 Aus diesem Grund
hat der Auftraggeber die Ausschreibungsbestimmungen, die allgemeinen und die
technischen Vertragsbestimmungen, sowie das Leistungsverzeichnis so klar und
präzise auszuarbeiten, dass die Bieter in die Lage versetzt werden die
ausgeschriebene Leistung zu kalkulieren, sowie die geforderten Produkte
anzubieten.86
Im offenen und im nicht offenen Verfahren darf über den Inhalt der Angebote
nicht verhandelt werden, sodass eine Angebotsänderung nach der Öffnung der
Angebote nicht möglich ist.87 Eine unklare Ausschreibung, die zu nicht
vergleichbaren Angeboten führt, verpflichtet den Auftraggeber aufgrund des
Gleichbehandlungsgebots zu einem Widerruf des Vergabeverfahrens.88
85 Vgl §§ 104 Abs 1 und 125 Abs 1 BVergG 2018; Smutek in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer,
BVergG 2018 (2019) § 125 Rz 2.
86 Vgl §§ 88 Abs 2 und 104 Abs 1 BVergG 2018; Heid/Kurz in Heid/Preslmayr (Hrsg), Handbuch
Vergaberecht4 (2015) Rz 1164.
87 Vgl § 112 Abs 3 BVergG 2018; Hofbauer in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019)
§ 112 Rz 6.
88 Vgl Reisinger/Ullreich in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019) § 148 Rz 1 ff.
Seite 20 von 47IV. Bieterlücken
A. Allgemeines
Das BVergG 2018 verlangt eine neutrale Leistungsbeschreibung. Das Fordern
von bestimmten Produkten, Methoden oder Verfahren ist nach § 106 Abs 5
BVergG 2018 grundsätzlich nicht zulässig.89 Da die Bezugnahme auf ein
bestimmtes Produkt den häufigsten der genannten Fälle darstellt, wird in der
Folge eine produktspezifische Ausschreibung stellvertretend für alle
Abweichungen von einer neutralen Ausschreibung herangezogen.
Bei vielen Leistungen, vor allem bei Bauleistungen, werden verschiedene
Produkte für die Erbringung einer Leistung eingesetzt. Bei einer Ausschreibung
von Fliesenlegerarbeiten hat der Bieter unter anderem ein Produkt „Fliese“, ein
Produkt „Abdichtung“, ein Produkt „Fliesenkleber“ oder auch ein Produkt
„Revisionsschachtabdeckung“ anzubieten.
Gestaltet der Auftraggeber nun eine neutrale Ausschreibung, so hat er für jedes
dieser Produkte eindeutige Anforderungen zu beschreiben, ohne auf ein
bestimmtes Produkt abzustellen (Prinzip der produktneutralen Ausschreibung).
Selbst wenn ihm dies gelingt, steht er nach Abgabe der Angebote vor dem
Problem, dass er nicht weiß, welche Produkte der Bieter nun tatsächlich
einbauen wird.90
Aus diesem Grund werden bei der neutralen Ausschreibung einer Leistung
Bieterlücken verwendet. „Bei Bieterlücken handelt es sich um freie Zeilen oder
Teile davon, in die der Bieter das von ihm angebotene Produkt, Verfahren oder
Leistungsmerkmal einträgt.“91 Oppel beschreibt Bieterlücken als eine „konkrete
Lösungsmöglichkeit für öffentliche Auftraggeber, die Ausschreibungsunterlage
89 Vgl Kromer, Produktspezifische Beschaffungen unter dem BVergG 2018, ZVB 2019/79, 321-325 (321).
90 Vgl Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 5.143.
91 BVwG W123 2171271-2 ZVB 2018/17 (Reisinger/Ullreich); BVwG W123 2133597-2 ZVB 2017/3
(Grasböck).
Seite 21 von 47so zu gestalten, dass dem Erfordernis der Zulassung gleichwertiger Produkte
entsprochen wird.“92
Mit Bieterlücken kann der Auftraggeber bei einer neutralen Ausschreibung das
vom Bieter angebotene Produkt abfragen, um bei der Angebotsprüfung die
Übereinstimmung des angebotenen Produkts mit den in der Ausschreibung
vorgegebenen Anforderungen zu überprüfen.93
Des Weiteren ist in Ausnahmefällen die Ausschreibung eines bestimmten
Produktes (ohne den Zusatz „oder gleichwertig“) oder die Angabe eines
Leitproduktes (mit dem Zusatz „oder gleichwertig“) möglich. Ein bestimmtes
Produkt darf nur in sehr engen Grenzen und bei sachlicher Rechtfertigung
ausgeschrieben werden. Dies kann zB aus Kompatibilitätsgründen erforderlich
sein.94
Wird ein konkretes Produkt ausgeschrieben, erübrigt sich eine Angabe eines
Produktes durch den Bieter, da er nur dieses bestimmte Produkt anbieten kann.
Eine Bieterlücke ist daher nicht erforderlich.95
Gibt der Auftraggeber ein Leitprodukt vor, muss er eine, vom Bieter angebotene,
gleichwertige Alternative96 zulassen. Auch hierfür wird im Leistungsverzeichnis
eine Bieterlücke vorgesehen.97
92 Oppel in Schramm/Aicher/Fruhmann (Hrsg), Bundesvergabegesetz 20183 (1. Lfg 2020) § 106 Rz 119.
93 Vgl BVwG W123 2171271-2 ZVB 2018/17 (Reisinger/Ullreich); BVA N/0040-BVA/10/2012-27
Rindler/Lehner in Gast (Hrsg), Bundesvergabegesetz Leitsatzkommentar2 (2. ErgLfg 2018) § 135 BVergG
2018 E 66; BVA 27.09.2010, N/0071-BVA/10/210-34.
94 Vgl Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 5.143 f; Kromer,
Produktspezifische Beschaffungen unter dem BVergG 2018, ZVB 2019/79, 321-325 (323).
95 Vgl Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 5.144.
96 Durch das Ausfüllen von Bieterlücken wird jedoch kein Alternativangebot oder Abänderungsangebot
erstellt, sondern ein Hauptangebot. Vgl VwGH 2001/04/0250 Moick/Gföhler, BVergG 2018 § 96 (Stand
01.08.2018, rdb.at) E 12; Oppel in Schramm/Aicher/Fruhmann (Hrsg), Bundesvergabegesetz 20183 (1. Lfg
2020) § 106 Rz 75 f.
97 Vgl Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 5.145.
Seite 22 von 47B. Unionsrechtliche Bestimmungen
Bei den technischen Spezifikationen iSd Vergaberichtlinien handelt es sich um
die gesamte technische Beschreibung des Leistungsgegenstandes.98
Die Festlegung der technischen Spezifikationen kann der öffentliche
Auftraggeber, einerseits in Form von Leistungs- und Funktionsanforderungen
vornehmen, sofern dadurch die Merkmale des Leistungsgegenstands
ausreichend beschrieben werden können. Andererseits kann für die
Konkretisierung des Leistungsgegenstands unter anderem auf technische
europäische und / oder nationale Normen bzw Zulassungen Bezug genommen
werden. Auch Mischformen sind denkbar. Die Vergaberichtlinien verpflichten den
Auftraggeber hierbei in keiner Weise dazu eine dieser Methoden zu bevorzugen
– er kann hier frei wählen.99
Dem Auftraggeber kommt durch diese Bestimmungen in den Vergaberichtlinien
grundsätzlich ein weites Ermessen bei der Formulierung der technischen
Spezifikationen zu, da er die Anforderungen an den zu beschaffenden
Leistungsgegenstand am besten kennt. Der Grundsatz der Gleichbehandlung
schränkt dieses weite Ermessen jedoch insofern ein, als die technischen
Spezifikationen so zu wählen sind, dass der Wettbewerb nicht ungerechtfertigt
behindert wird. Der Bieterkreis soll durch die Wahl der technischen Merkmale
nicht unsachlich eingeschränkt werden.100 Um dem Transparenzprinzip zu
entsprechen, müssen die in der Ausschreibung festgelegten technischen
Spezifikationen eindeutig, klar und präzise sein. Damit wird erreicht, dass alle
interessierten Unternehmer die Vorgaben in der Ausschreibung gleich verstehen
und so korrekte und vergleichbare Angebote abgeben können.101
98 Vgl Anhang VIII Punkt 1 lit a und b RL 2014/24/EU, ABl L 94, 65.
99 Vgl Art 42 Abs 3 RL 2014/24/EU, ABl L 94, 65; Art 60 Abs 3 RL 2014/25/EU, ABl L 94, 243; Art 17 Abs 3
RL 2009/81/EG, ABl L 219,76; Bittner, Die Grenzen bei der Festlegung von Leistungsanforderungen, ZVB
2019/29 113-117 (114 f).
100 Vgl ErwGr 74 RL 2014/24/EU, ABl L 94, 65; Bittner, Die Grenzen bei der Festlegung von
Leistungsanforderungen, ZVB 2019/29 113-117 (115).
101 Vgl Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 5.140.
Seite 23 von 47Auf bestimmte Verfahren, Marken, Waren, etc darf nur in sehr engem Rahmen
Bezug genommen werden. Dies ist damit begründet, dass durch solche
Festlegungen bestimmte Waren (und damit Unternehmer) bevorteilt oder
benachteiligt werden.102 Die festgelegten Anforderungen, insbesondere an
Produkte (Waren), können eine unionsrechtlich verbotene Maßnahme gleicher
Wirkung im Bereich der Warenverkehrsfreiheit darstellen.103 Aus diesem Grund
ordnen die Vergaberichtlinien an, dass die Festlegung von technischen
Merkmalen über eine solche produktbezogene bzw verfahrensbezogene Angabe
nur ausnahmsweise vorgenommen werden darf und jedenfalls der Zusatz „oder
gleichwertig“ anzuführen ist.104 Durch das Zulassen gleichwertiger Produkte bzw
Waren kann auch der Warenverkehrsfreiheit besser entsprochen werden.105
Die Gleichwertigkeit der vom Bieter angebotenen Produkte hat dieser in seinem
Angebot mit geeigneten Mitteln nachzuweisen. Der Auftraggeber kann hierfür die
Vorlage spezieller Testberichte bzw Zertifizierungen einer
Konformitätsbewertungsstelle verlangen, muss jedoch auch Zertifikate von
vergleichbaren Konformitätsbewertungsstellen akzeptieren. Fehlt einem Bieter
der Zugang zu diesen Nachweisen oder hat er keine Möglichkeit diese
Nachweise zeitgerecht zu erlangen, muss der Auftraggeber auch andere
geeignete Nachweise anerkennen.106
C. Nationale Bestimmungen
Der Bundesgesetzgeber hat grundsätzlich sowohl für den Unterschwellenbereich
als auch für den Oberschwellenbereich für die Vergabe von Aufträgen durch
klassische öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber die
102 Vgl Art 42 Abs 4 RL 2014/24/EU, ABl L 94, 65; Art 60 Abs 4 RL 2014/25/EU, ABl L 94, 243; Art 17
Abs 8 RL 2009/81/EG, ABl L 219,76; Art 36 Abs 2 RL 2014/23/EU, ABl L 94, 1.
103 Vgl Holoubek/Fuchs/Ziniel, Vergaberecht, in Holoubek/Potacs (Hrsg), Öffentliches Wirtschaftsrecht I4
(2019) 861; Frenz, Handbuch Europarecht I Europäische Grundfreiheiten2 (2012) Rz 851.
104 Vgl Art 42 Abs 4 RL 2014/24/EU, ABl L 94, 65; Art 60 Abs 4 RL 2014/25/EU, ABl L 94, 243; Art 17
Abs 8 RL 2009/81/EG, ABl L 219,76; Art 36 Abs 2 RL 2014/23/EU, ABl L 94, 1.
105 Vgl Holoubek/Fuchs/Ziniel, Vergaberecht, in Holoubek/Potacs (Hrsg), Öffentliches Wirtschaftsrecht I4
(2019) 861 f.
106 Vgl Art 42 Abs 5 und 6 sowie Art 44 RL 2014/24/EU, ABl L 94, 65; Art 60 Abs 5 und 6 sowie Art 62
RL 2014/25/EU, ABl L 94, 243; Art 17 Abs 4 und 5 RL 2009/81/EG, ABl L 219,76; Art 36 Abs 4 und 5
RL 2014/23/EU, ABl L 94, 1.
Seite 24 von 47Bestimmungen der Vergaberichtlinien in nationales Recht übernommen. Darüber
hinaus wurden ergänzende Bestimmungen normiert.107
Sowohl für konstruktive als auch für funktionelle Leistungsbeschreibungen des
Auftragsgegenstandes hat der Auftraggeber technische Spezifikationen
festzulegen und, sofern erforderlich, durch Pläne, Muster, Proben oder Ähnliches
zu vervollständigen.108 Dies gilt auch für teilfunktionale Ausschreibungen.109
Nach der Legaldefinition des BVergG 2018 beschreiben technische
Spezifikationen die geforderten Merkmale für die ausgeschriebene Leistung,
wobei sich diese Merkmale auf Prozess bzw Methode zur Produktion oder
Leistungserbringung, oder den Prozess eines Lebenszyklus-Stadiums beziehen
können.110 Die Merkmale müssen sowohl einen Zusammenhang mit dem
Auftragsgegenstand als auch Verhältnismäßigkeit in Bezug auf den
Auftragsgegenstand vorweisen. Nicht erforderlich ist jedoch, dass diese
Merkmale materieller Bestandteil der Leistung sind, womit auch soziale oder
umweltbezogene Aspekte der Produktion oder der Leistungserbringung gefordert
werden können.111
1. Abweichen vom Grundsatz der produktneutralen Ausschreibung
Grundsätzlich hat eine produktneutrale Ausschreibung zu erfolgen.112
Hiervon kann unter sehr restriktiver Auslegung des Ausnahmetatbestands
abgewichen werden, wenn der Auftragsgegenstand dies erfordert. Sofern
beispielsweise die „Wahrung der technischen Einheit bei der Erweiterung oder
107 Vgl §§ 2 Z 37, 91 Abs 8, 104, 106, 109, 125, 262 Abs 7, 272, 274, 277 und 292 BVergG 2018. Das
BVergGVS enthält ähnliche Bestimmungen. Im BVergGKonz 2018 sind die Regelungen etwas weniger
detailliert und das BVergGKonz 2018 bezeichnet die technischen Spezifikationen als technische und
funktionelle Anforderungen.
108 Vgl §§ 104 und 273 BVergG 2018.
109 Vgl Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 5.130 und 5.140.
110 Vgl § 2 Z 37 BVergG 2018.
111 Vgl § 2 Z 37 BVergG 2018; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 5.140.
112 Vgl ErläutRV 69 BlgNR 26.GP 133; Diem in Gölles (Hrsg), BVergG 2018 § 106 (Stand 01.10.2019,
rdb.at) Rz 14.
Seite 25 von 47Instandhaltung von Systemen“113 dies notwendig macht, könnte eine
produktspezifische Ausschreibung erfolgen.114
Ist es nicht möglich den Auftragsgegenstand ausreichend klar und präzise zu
beschreiben, ohne auf ein Leitprodukt Bezug zu nehmen, so ist dies
ausnahmsweise zulässig. Dies trifft regelmäßig dann zu, wenn andernfalls die
Ausschreibung der Leistung einen unvertretbaren Aufwand darstellen würde,
oder durch die Nichtangabe des Leitproduktes die Klarheit der Anforderungen
des Auftraggebers an das zu beschaffende Produkt verloren gehen würde. Wenn
die Recherchearbeit eines Bieters, welches Produkt alle neutral beschriebenen
Anforderungen des Auftraggebers erfüllt, einen zu großen Aufwand bedeuten
würde, werden im Leistungsverzeichnis ebenso Leitprodukte verwendet.115 Auch
wenn das Gesetz dies nur in Ausnahmefällen zulässt, stellt die Bezugnahme auf
ein Leitprodukt in der Praxis eher den Regelfall dar.116
Die Verwendung eines Leitproduktes erfordert den Zusatz „oder gleichwertig“,
sodass der Bieter nicht an dieses Leitprodukt gebunden ist. Sofern
ausnahmsweise die Ausschreibung eines bestimmten Erzeugnisses mit dem
Zusatz „oder gleichwertig“ erfolgt, sind Kriterien festzulegen, anhand deren die
Gleichwertigkeit überprüft werden kann.117
Bei konstruktiven Leistungsbeschreibungen sind im Leistungsverzeichnis freie
Zeilen (Bieterlücken) vorzusehen, in die der Bieter Angaben zum angebotenen
gleichwertigen Produkt (Fabrikat und Type, etc) anzugeben hat. Macht der Bieter
113 § 106 Abs 5 BvergG 2018.
114 Vgl ErläutRV 69 BlgNR 26.GP 133; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018)
Rz 5.144.
115 Vgl § 106 Abs 5 BvergG 2018; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 5.145;
Oppel, Die ÖNORM B 2110 und das neue BVergG 2018 – „Normenbindung neu“. Ausgewählte Themen
zur ÖNORM B 2110, ZVB 2019/9, 36-46 (42).
116 Vgl § 106 Abs 6 BVergG 2018; Pachner in Schramm/Aicher/Fruhmann (Hrsg), Bundesvergabegesetz
20062 (3.ErgLfg 2013) § 98 Rz 54.
117 Vgl § 106 Abs 6 BVergG 2018; Diem in Gölles (Hrsg), BVergG 2018 § 106 (Stand 01.10.2019, rdb.at)
Rz 39; Kurz in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019) § 107 Rz 11;Gruber in
Schramm/Aicher/Fruhmann (Hrsg), Bundesvergabegesetz 20183 (1. Lfg 2020) § 125 Rz 31.
Seite 26 von 47keine Angaben, gelten die vom Auftraggeber festgesetzten Produkte als
angeboten.118
Die Gleichwertigkeit des angebotenen Produktes ist durch den Bieter
nachzuweisen. Hat der Bieter ein anderes jedoch nicht gleichwertiges Erzeugnis
angeboten, gilt das ausgeschriebene Produkt nur dann als angeboten, wenn der
Bieter dies in seinem Angebot gesondert erklärt.119
2. Echte und unechte Bieterlücken
In Österreich werden echte und unechte Bieterlücken unterschieden.120
Bei einer unechten Bieterlücke gibt der Auftraggeber in seiner Ausschreibung ein
Leitprodukt vor. Der Bieter kann auch ein davon abweichendes, jedoch
gleichwertiges Produkt anbieten, wobei die Gleichwertigkeit vom Bieter
nachzuweisen ist.121 Der Bieter kann erklären, dass er die Leitprodukte anbietet,
sofern die von ihm angegebenen Produkte nicht gleichwertig zu den
Leitprodukten sind.122 Um diese Erklärung für den Auftraggeber leichter
erkennbar zu machen, ist diese besonders zu bezeichnen oder hat in einem
getrennten Dokument zu erfolgen.123
Bei echten Bieterlücken beschreibt der Auftraggeber ausschließlich anhand
objektiver Merkmale, welche Leistung er erwartet – der Auftraggeber gibt also
kein Leitprodukt an. Der Bieter muss ein Produkt auswählen und anbieten. Das
von ihm angebotene Produkt hat er in der entsprechenden Bieterlücke
anzugeben.124
118 Vgl §§106 Abs 6 und 125 Abs 7 BVergG 2018; Diem in Gölles (Hrsg), BVergG 2018 § 106 (Stand
01.10.2019, rdb.at) Rz 37.
119 Vgl § 125 Abs 7 BVergG 2018; Smutek in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019)
§ 125 Rz 14.
120 Vgl Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 5.147; Smutek in
Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019) § 125 Rz 11 ff.
121 Vgl § 125 Abs 7 BVergG 2018; Dillinger/Oppel, Das neue Bundesvergabegesetz 2018 (2018) Rz 5.148;
Smutek in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019) § 125 Rz 11.
122 Vgl § 125 Abs 7 BVergG 2018; Smutek in Heid/Reisner/Deutschmann/Hofbauer, BVergG 2018 (2019)
§ 125 Rz 14.
123 Vgl ErläutRV 69 BlgNR 26.GP 149; Gruber in Schramm/Aicher/Fruhmann (Hrsg),
Bundesvergabegesetz 20183 (1. Lfg 2020) § 125 Rz 28.
124 Vgl BVwG W123 2171271-2 ZVB 2018/17 (Reisinger/Ullreich); BVwG W123 2133597-2 ZVB 2017/3
(Grasböck); BVwG W149 2135160-2 ZVB 2017/64 (Gruber/Gruber).
Seite 27 von 47Sie können auch lesen