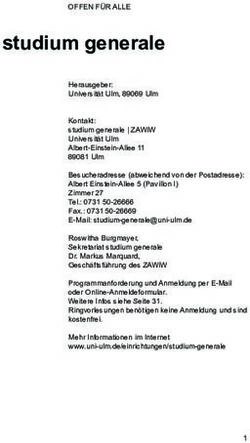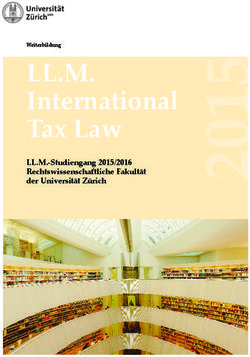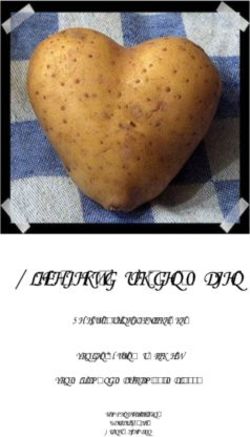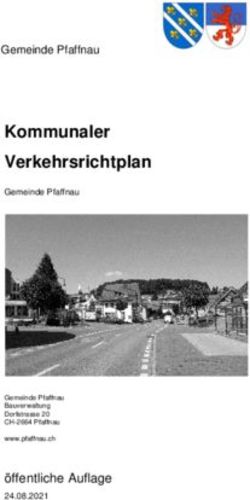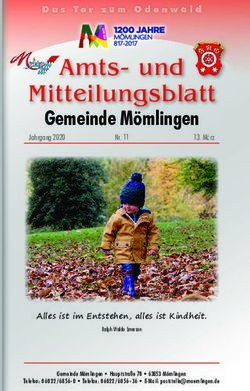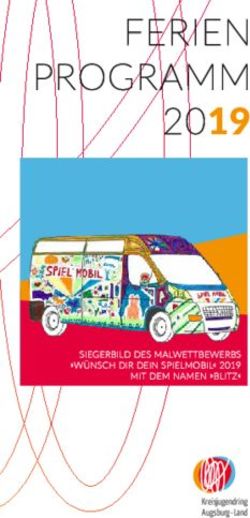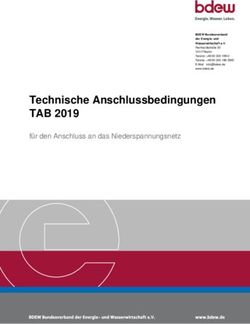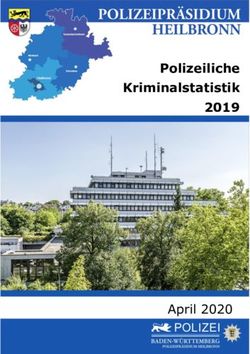Modulhandbuch - Hochschule Koblenz
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
Modulhandbuch
für den
konsekutiven Studiengang
Master of Science
Wirtschaftsingenieurwesen
Vertiefung Bauingenieurwesen
Version: SS 2016 Seite 1
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
Tabellenverzeichnis
T1 Studienplan für den Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
T2 Pflichtmodule für den Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur (Vertiefung Bauingenieur-
wesen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
T3 Wahlpflichtmodule für den Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur (Vertiefung Bauinge-
nieurwesen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungen 3
Modulübersichten 4
Studienplan für den Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Module im Pflichtbereich 5
MPIG MPIG Internationales Geschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
MPSF MPSF Strukturierte Finanzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MPSM MPSM Strategisches Management in Fallstudien . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MPOM MPOM Operations Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MPCG MPCG Controlling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Module im Technischen Bereich 14
BSIB3 BSIB-3 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen . . . . . . . . . . . . . . 15
BTEC2 BTEC-2 Betontechnologie 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
FASA FASA Fasade Glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
IMMO1 IMMO-1 Immobilienmanagement 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
IMMO2 IMMO-2 Immobilienmanagement 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MATH2 MATH-2 Mathematik 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MATH3 MATH-3 Mathematik 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MATH5 MATH-5 Mathematik 5 - Numerische Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
MPBB5 MPBB5 Baubetrieb 5 (Projektsteuerung im Bauwesen) . . . . . . . . . . . . . . 26
MPBB6 MPBB6 Baubetrieb 6 (Claim Management im Bauwesen) . . . . . . . . . . . . . 27
MPPM2 MPPM2 Projektmanagement 2 (Management von Baustellen) . . . . . . . . . . 28
MPPM3 MPPM3 Projektmanagement 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
MWIP1 MWIP-1 Wissenschaftliches Projekt-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NABA NABA Nachhaltiges Bauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
OKOG ÖKOG Ökologische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PHKO2 PHKO-2 Bauphysik und Baukonstruktion 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
QUAL1 QUAL-1 Diversity im Bauwesen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
QUAL2 QUAL-2 Präsentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
STA2 STAHL2 Stahlbau Stabiliät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
STAT1 STAT-1 Statik 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
STAT2 STAT-2 Statik 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
STRP STRP Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen . . . . . . . . . . . . . . 41
UFAL UFAL Überfachliche Lehre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
WASW1 WASW-1 Wasserwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
WASW2 WASW-2 Wasserwesen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
WVER WVER Wasserbauliches Versuchswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Version: SS 2016 Seite 2
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
Abkürzungen
BEK Bachelor Entwicklung und Konstruktion
BET Bachelor Elektrotechnik
BIT Bachelor Informationstechnik
BLA Bachelor Lehramt (Berufsbildende Schule)
BMB Bachelor Maschinenbau
BMBD Bachelor Maschinenbau Dualer Studiengang
BMT Bachelor Mechatronik
BWI Bachelor Wirtschaftsingenieur
CP Credit Points (=ECTS)
ET Elektrotechnik
ECTS European Credit Points (=CP)
FB Fachbereich
FR Fachrichtung
FS Fachsemester
IT Informationstechnik
LA Lehramt
MB Maschinenbau
MHB Modulhandbuch
MEN Master Engineering
MMB Master Maschinenbau
MLA Master Lehramt
MST Master Systemtechnik
MWI Master Wirtschaftsingenieur
MT Mechatronik
N. N. Nomen nominandum, (noch) unbekannte Person
PO Prüfungsordnung
SS Sommersemester
SWS Semester-Wochenstunden
ST Systemtechnik
WI Wirtschaftsingenieur
WS Wintersemester
Version: SS 2016 Seite 3
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
Modulübersichten
Studienplan für den Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur
Tabelle T1: Studienplan für den Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur
Semester 1 2 3 Modul
Pflichtbereich Wirtschaftswissenschaften 30 CP CP CP
Internationales Geschäft 6 6 MPIG
Strukturierte Finanzierungen 6 6 MPSF
Strategisches Management 6 6 MPSM
Operations Management 6 6 MPOM
Controlling 6 6 MPCG
Vertiefung Bauingenieur 30
Projektmanagement 2 5 5 MPPM2
Projektmanagement 3 5 5 MPPM3
Baubetrieb 5 5 5 MPBB5
Baubetrieb 6 5 5 MPBB6
Wahlpflichtmodule
Technisches Wahlpflichtmodul 1 5 5 MWPB1
Technisches Wahlpflichtmodul 2 5 5 MWPB2
Projekte 30
Abschlussarbeit 30 30 Thesis
ECTS-Summe 90 30 30 30
Anzahl der Module 12 5 6 1
Version: SS 2016 Seite 4
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MPIG MPIG Internationales Geschäft
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Pflichtfach
Semester: 1-2
Häufigkeit: Jedes Wintersemester
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: keine
Modulverantwortlich: Prof. Dr. Clemens Büter
Lehrende(r): Prof. Dr. Clemens Büter
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 6 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: oder Wissenschaftliche Hausarbeit
Lehrformen: Vorlesung, Seminaristischer Unterricht (abhängig von der Teilnehmerzahl)
mit Vortrags-, Diskussions- und Übungselementen.
Arbeitsaufwand: 64 Stunden Präsenzzeit, 116 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Beamer, Tafel, Vorlesungsunterlagen, Folien-/ PowerPoint-Präsentation
Geplante Gruppengröße: keine Beschränkung
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele:
Die Studierenden lernen wesentliche Rahmenbedingungen internationaler Geschäftsbeziehungen. Sie er-
kennen betriebliche Erfordernisse, Methodiken und Zusammenhänge für den erfolgreichen Abschluss in-
ternationaler Geschäftstätigkeit.
Überfachliche Kompetenzen:
• Erschließung und Systematisierung anwendungsbezogener Aspekte
• Diskussion praxisorientierter Lösungsansätze
• Methodik wissenschaftlichen Arbeitens
Inhalte:
• Einführung
• Rahmenbedingungen
• Internationale Geschäftssysteme
• Besonderheiten internationaler Kaufverträge
• Internationale Kalkulation und Preise
• Internationale Lieferbedingungen
• Internationale Zahlungsbedingungen
• Außenhandelsfinanzierung
• Währung und Wechselkurssicherung
• Internationale Garantien
Enthalten sind Beispiele und Berechnungen der deutschen Exportindustrie, insbesondere aus dem Bereich
Maschinen- und Anlagenbau.
Literatur:
• Büter C. (2013) Außenhandel – Grundlagen internationaler Handelsbeziehungen (Springer Lehrbuch),
3. Auflage, Berlin Heidelberg.
• Büter C. (2010) Internationale Unternehmensführung – Entscheidungsorientierte Einführung, Olden-
bourg, München.
• International Chamber of Commerce (2012) Guide to Export/Import, Paris.
• OECD (2009) International Trade, Paris.
Version: SS 2016 Seite 5
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
• siehe auch Semesterapparat in der Bibliothek.
Version: SS 2016 Seite 6
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MPSF MPSF Strukturierte Finanzierung
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Pflichtfach
Semester: 1-2
Häufigkeit: Jedes Wintersemester
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: keine
Modulverantwortlich: Prof Dr. Michael Kaul
Lehrende(r): Prof Dr. Michael Kaul, Gastreferenten
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 6 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: oder Wissenschftliche Hausarbeit mit mündlicher Prüfung
Lehrformen: Seminaristischer Unterricht (abhängig von der Teilnehmerzahl) mit Vortrags-,
Diskussions- und Übungselementen, Gastreferenten
Arbeitsaufwand: 64 Stunden Präsenzzeit, 116 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Vorlesung, Diskussion, Bearbeitung und Präsentation von Themen, Gruppen-
arbeit, Übung und Selbststudium
Geplante Gruppengröße: keine Beschränkung
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele:
Nach diesem Modul haben die Studierenden ihre Kenntnisse über die grundlegenden Finanzinstrumente,
deren Verwendung, die notwendigen Vorarbeiten und die Varianten Strukturierter Finanzierungsmodelle
ausgeweitet und vertieft.
Überfachliche Kompetenzen:
Selbständiges Arbeiten, Arbeiten in Gruppen, Diskussionsfähigkeit, eigenständiges Erarbeiten eines The-
mas und Präsentation
Inhalte:
Im Kerngebiet der Veranstaltung werden einige der möglichen Varianten an Strukturierten Finanzierun-
gen besprochen, wie bspw. Akquisitionsfinanzierungen, Projektfinanzierungen, Öffentlich-Private Partner-
schaften, Gewerbliche Immobilienfinanzierungen u. langfristige Investitionsfinanzierungen, letztere insb. in
Schwellenländern.
Ergänzt wird dies durch die Besprechung zentraler Teilaspekte Strukturierter Finanzierungen; dazu gehören
unter anderem Private Equity, Mezzanine, Währungs- und Zinsrisikomanagement sowie die Cashflow- bzw.
Liquiditätsplanung.
Zusätzlich können internationale Aspekte, weitere Finanzierungsarten und auch aktuelle Themen bespro-
chen werden.
Literatur:
(jeweils die aktuelle Auflage)
• Allman, K.A.: Modeling Structured Finance Cash Flows with Microsoft Excel, Hoboken.
• Doll, G.F.: Gewerbliche Immobilien-Finanzierung, München.
• Fabozzi, F.J., Davis, H.A., Choudhry, M.: Introduction to Structured Finance, Hoboken.
• Gatti, S.: Project Finance in Theory and Practice, Waltham.
• Hull, J. C.: Optionen, Futures und andere Derivate, München.
• Jugel, S.: Private Equity Investments: Praxis des Beteiligungsmanagements, Wiesbaden.
• Kreuch, P.: Strukturierte Finanzierung in Corporate Finance, Göttingen.
Version: SS 2016 Seite 7
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
• Müller-Känel, O.: Mezzanine Finance: Neue Perspektiven in der Unternehmensfinanzierung, Berne.
• Prümer, M.: Cash Flow Management, Wiesbaden.
• Reuter, A.: Projektfinanzierung: Anwendungsmöglichkeiten, ÖPP und Infrastrukturfinanzierung, Risiko-
management, Vertragsgestaltung, Kapitalmarkt, bilanzielle Behandlung, München.
• Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J., Jordan, B.D.: Modern Financial Management, New York.
• Walch, P., Weichselbaum, K. (Hrsg.): Handbuch Immobilienfinanzierung: Strukturierte Finanzierung von
Gewerbeimmobilien, Wien.
• Welch, I.: Corporate Finance, Upper Saddle River.
• Wolff,. B., Hill, M., Pfaue, M.: Strukturierte Finanzierungen, Stuttgart.
Bei Bedarf wird weitere Literatur in der Veranstaltung bekannt gegeben.
Version: SS 2016 Seite 8
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MPSM MPSM Strategisches Management in Fallstudien
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Pflichtfach
Semester: 1-2
Häufigkeit: Jedes Wintersemester
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: keine
Modulverantwortlich: Prof Dr. Christian Lebrenz
Lehrende(r): Prof Dr. Christian Lebrenz
Sprache: Deutsch und Englisch
ECTS-Punkte/SWS: 6 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: oder Wissenschaftliche Hausarbeit
Lehrformen: Vorlesung, Seminaristischer Unterricht (abhängig von der Teilnehmerzahl)
mit Vortrags-, Diskussions- und Übungselementen.
Arbeitsaufwand: 64 Stunden Präsenzzeit, 116 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Beamer, Tafel, Folienskript und Beiträge aus der Praxis zu den aktuellen The-
men des strategischen Managements
Geplante Gruppengröße: keine Beschränkung
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele:
Nach Abschluss des Moduls haben die Studierenden ein fundiertes Verständnis für die zentralen Fragege-
stellungen des strategischen Managements.
Sie kennen die zentralen Ansätze und Prozessschritte der Strategieentwicklung und – implementierung.
Die Studierenden sind in der Lage, für ein Unternehmen
strategische Optionen unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der Organisation zu entwickeln
und Empfehlungen für die Auswahl einer Option abzugeben.
Die Studierenden sind dabei in der Lage, für den Prozess notwendige Informationen aus selbstständig zu
recherchieren, nationale und internationale Studien
fundiert auszuwerten und auf die Relevanz für die eigene Fragestellung hin zu bewerten.
Überfachliche Kompetenzen:
• Teamarbeit (Argumentieren über gegebene Inhalte, Moderieren von Teamsitzungen)
• Konzeption von Thesenpapieren
• Mündliche Präsentation von Inhalten in Referatsform
• Fähigkeit zur Kommunikation (schriftlich und mündlich) in englischer Sprache
Inhalte:
• Einführung
– Perspektiven und theoretische Grundlagen
– Schulen und Ansätze des strategischen Managements
– Case Study Methode
• Strategische Analyse
– Umweltanalyse
– Unternehmensanalyse
• Strategieformulierung
– Strategische Optionen
– Strategische Entscheidung
• Strategieimplementierung
– Rahmenbedingungen
Version: SS 2016 Seite 9
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
– Operationalisierung
– Strategischer Wandel
– Strategische Evaluierung
– Zweck & Ziele
– Funktionen
– Kennzahlen & Instrumente
Literatur:
(jeweils die aktuelle Auflage)
• Dillerup, R.; Stoi, R.: Unternehmensführung, München.
• Hungenberg, H.: Strategisches Management in Unternehmen, München.
• Lynch, R.: Strategic Management, Harlow.
• Macharzina, K.; Wolf, J.: Unternehmensführung: Das internationale Managementwissen Konzepte - Me-
thoden – Praxis, München.
• Mintzberg, H. Ahlstrand, B. Lampel, J.; Strategy Safari: der Wegweiser durch den Dschungel des strate-
gischen Managements, München.
• Müller-Stewens, G.; Lechner, CH: Strategisches Management: wie strategische Initiativen zum Wandel
führen, Stuttgart.
• Simon, H.: Hidden Champions - Aufbruch nach Globalia: die Erfolgsstrategien unbekannter Welt-
marktführer, Frankfurt.
• aktuelle Studien, Fallstudien.
Version: SS 2016 Seite 10
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MPOM MPOM Operations Management
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Pflichtfach
Semester: 1-2
Häufigkeit: Jedes Wintersemester
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: keine
Modulverantwortlich: Prof Dr. Ayelt Komus, Prof. Dr. Elmar Bräkling
Lehrende(r): Prof Dr. Ayelt Komus, Prof. Dr. Elmar Bräkling
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 6 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: oder Wissenschaftliche Hausarbeit
Lehrformen: Vorlesung, Seminaristischer Unterricht (abhängig von der Teilnehmerzahl)
mit Vortrags-, Diskussions- und Übungselementen
Arbeitsaufwand: 64 Stunden Präsenzzeit, 116 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Beamer, Tafel, Vorlesungsunterlagen, Folien-/ PowerPoint-Präsentation
Geplante Gruppengröße: keine Beschränkung
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele:
• Kernaufgaben der Beschaffungsfunktion gestalten und führen können
• Kernaufgaben der Logistikfunktion gestalten und führen können
• Kernaufgaben des Prozess- und Informationsmanagements in Grundlagen gestalten und führen können
Überfachliche Kompetenzen:
Industrielle Gestaltungs- und Führungskompetenz
Inhalte:
• Einkauf
• Logistik
• Produktion
• Organisation
• Wirtschaftsinformatik
• Prozessmanagement
Literatur:
(jeweils aktuelle Auflage):
• Bräkling, Oidtmann: Power in Procurement.
• Bräkling, Oidtmann, Lux: Logistikmanagement.
• Gadatsch, Andreas: Grundkurs Geschäftsprozess-Management: Methoden und Werkzeuge für die IT-
Praxis: Eine Einführung für Studenten und Praktiker.
Version: SS 2016 Seite 11
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MPCG MPCG Controlling
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Pflichtfach
Semester: 1-2
Häufigkeit: Jedes Wintersemester
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: keine
Modulverantwortlich: Prof. Dr. Andreas Mengen
Lehrende(r): Prof. Dr. Andreas Mengen
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 6 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: oder Wissenschaftliche Hausarbeit mit mündlicher Prüfung
Lehrformen: Vorlesung, Seminaristischer Unterricht (abhängig von der Teilnehmerzahl)
mit Vortrags-, Diskussions- und Übungselementen.
Arbeitsaufwand: 64 Stunden Präsenzzeit, 116 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Vorlesung, Diskussion, Bearbeitung und Präsentation von Themen, Gruppen-
arbeit, Übung und Selbststudium
Geplante Gruppengröße: keine Beschränkung
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele:
Nach diesem Modul sind die Studierenden in der Lage, die Methoden des Controllings zu verstehen und
selbstständig anzuwenden. Das im Bachelor-Studium erworbene Wissen wird vertieft
und ergänzt. Sie können selbstständig komplexe, controllingspezifische Problemstellungen lösen und die
Lösung auch fachfremden Gesprächspartnern kommunizieren.
Überfachliche Kompetenzen:
Selbständiges Arbeiten, Arbeiten in Gruppen, Diskussionsfähigkeit, eigenständiges Erarbeiten eines The-
mas und Präsentation
Inhalte:
• Einführung
- Kapitel 1: Überblick über das Controlling
• Steuerungssysteme
- Kapitel 2: Kennzahlensysteme und Balanced Scorecard
- Kapitel 3: Wertorientierung
• Kostenmanagement
- Kapitel 4: Target Costing
- Kapitel 5 : Prozesskostenrechnung
• Strategisches und operatives Controlling
- Kapitel 6: Strategisches Controlling
- Kapitel 7: Operatives Controlling (Planung und Budgetierung)
• Funktionsbereichscontrolling und branchenspezifisches Controlling
Literatur:
• Coenenberg, A. G., Fischer, T. M., Günther, T. (2009): Kostenrechnung und Kostenanalyse, 7. Auflage,
Stuttgart.
• Ewert, R., Wagenhofer, A.(2008): Interne Unternehmensrechnung, 7. Auflage, Berlin/Heidelberg.
• Fischer, T. M., Möller, K., Schultze, W. (2012): Controlling – Grundlage, Instrumente und Entwicklungs-
perspektive, Stuttgart, Schäffer-Poeschel.
Version: SS 2016 Seite 12
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
• Weber, J., Bramsemann, U., Heineke, C., Hirsch, B. (2004): Wertorientierte Unternehmenssteuerung,
Wiesbaden.
• Weber, J., Schäffer, U. (2011): Einführung in das Controlling, 13. Auflage, Stuttgart.
Version: SS 2016 Seite 13
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
Module im Technischen Bereich
Aus der Liste der technischen Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen muss für die Technischen Wahlpflichtmo-
dule eine Auswahl getroffen werden. Diese individuelle Zusammenstellung von Lehrveranstaltungen dient
der individuellen Profilbildung. In Tabelle T2 sehen Sie die Pflichtmodule, in T3 die möglichen Wahlpflicht-
module.
Tabelle T2: Pflichtmodule für den Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur (Vertiefung Bauingenieurwe-
sen)
Modul Lehrveranstaltung SWS ECTS PL/SL
MPBB5 Baubetrieb 5 (Projektsteuerung im Bauwesen) 4 5 PL/SL
MPBB6 Baubetrieb 6 (Claim Management im Bauwesen) 4 5 PL/SL
MPPM2 Projektmanagement 2 (Management von Baustellen) 4 5 PL/SL
MPPM3 Projektmanagement 3 4 5 PL/SL
Tabelle T3: Wahlpflichtmodule für den Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur (Vertiefung Bauingenieur-
wesen)
Modul Lehrveranstaltung SWS ECTS PL/SL
BSIB3 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen 4 5 PL/SL
BTEC2 Betontechnologie 2 4 5 PL
FASA Fassade Glas 4 5 PL
IMMO1 Immobilienmanagement 1 4 5 PL
IMMO2 Immobilienmanagement 2 4 5 PL
MATH2 Mathematik 2 4 5 PL/SL
MATH3 Mathematik 3 4 5 PL
MATH5 Mathematik 5 - Numerische Methoden 4 5 PL
MWIP1 Wissenschaftliches Projekt 1 4 5 PL/SL
NABA Nachhaltiges Bauen 4 5 PL
OKOG Ökologische Grundlagen 4 5 PL/SL
PHKO2 Bauphysik und Baukonstruktion 2 4 5 PL/SL
QUAL1 Diversity im Bauwesen 1 2 2,5 PL/SL
QUAL2 Präsentation 2 2,5 PL/SL
STA2 Stahlbau Stabiliät 4 5 PL/SL
STAT1 Statik 1 4 5 PL/SL
STAT2 Statik 2 4 5 PL/SL
STRP Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen 4 5 PL/SL
UFAL Überfachliche Lehre 4 5 PL/SL
WASW1 Wasserwesen 4 5 PL/SL
WASW2 Wasserwesen 2 4 5 PL
WVER Wasserbauliches Versuchswesen 4 5 SL
Version: SS 2016 Seite 14
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
BSIB3 BSIB-3 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Wahlpflichtmodul
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: siehe aktueller Vorlesungsplan
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: BSTK-1
Modulverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Manfred Breitbach
Lehrende(r): Prof. Dr.-Ing. Manfred Breitbach
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: keine
Lehrformen: Seminaristischer Unterricht (abhängig von der Teilnehmerzahl) mit Vortrags-,
Diskussions- und Übungselementen
Arbeitsaufwand: 60 Stunden Präsenzzeit, 90 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Vorlesungsmanuskript mit schrittweiser Darstellung von Beispielen, Exkursio-
nen / Übungsbeispiele, Mitschrift, Anschauungsmaterialien, Laborübungen
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele:
Die Studierenden haben die Fähigkeit, Schäden und kritische Konstruktionen an Betonbauteilen und Inge-
nieurbauwerken zu erkennen, zu analysieren und zu bewerten.
Sie haben erweiterte Kenntnisse über Expositionen, Schadensmechanismen, Untersuchungsmethoden,
Dauerhaftigkeitsbeurteilungen und -prognosen. Sie sind in der Lage, Untersuchungskonzepte zu planen,
Bauzustandsanalysen durchzuführen, Instandsetzungspläne, Instandsetzungskonzepte, alternative Lösun-
gen und Leistungsverzeichnisse sowie Bauunterhaltungspläne anzufertigen.
Sie sind befähigt, besondere Anforderungen aus der betrieblichen Nutzung, der Expositionen und baube-
trieblichen Aspekten hinsichtlich der betontechnologischen
Anforderungen, Bestellung, Lieferung und Einbau umzusetzen und für die Bauausführung verantwortliche
Festlegungen zu treffen.
Überfachliche Kompetenzen:
Selbständiges Arbeiten, Arbeiten in Gruppen, Diskussionsfähigkeit, eigenständiges Erarbeiten eines The-
mas und Präsentation
Inhalte:
• Fortgeschrittene betontechnologische Kenntnisse
• Schadensmechanismen
• Beton- und Stahlkorrosion
• bauphysikalische und bauchemische Zusammenhänge
• Rissursachen/ -charakteristik/ - sanierung
• Bauzustandsanalyse
• Chemische und physikalische Prüfverfahren
• Prognoseverfahren
• Instandsetzungskonzept
• Instandsetzungsprinzipien
• Materialien und Instandsetzungssysteme
• Sonderlösungen
• Regelwerke, Stand der Technik, Tendenzen
Version: SS 2016 Seite 15
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
Literatur:
Die aktuellen Themen werden anhand zeitnaher Forschungsarbeiten, Dissertationen, Regelwerksbearbei-
tung vermittelt, so dass der wissenschaftliche Charakter im Vordergrund steht.
• Raupach, M.; Orlowski, J.: Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen – Grundlagen, Planung und
Instandsetzungsprinzipien nach neuer Norm. Verlag Bau + Technik Düsseldorf 2008.
• Breitbach, M.: Füllgüter für die Injektion von Rissen in Betonbauteilen- Qualitätssicherung und
Ausführungsprinzipien. Neustadt/Weinstraße: Forum Bauwerkserhaltung e.V., FBE, 1992.
In: Internationaler Kongreß zur Bauwerkserhaltung, S. 148 – 149.
• Breitbach, M.; Sasse, H. R.: Materialauswahl für die Injektion von Rissen - Stoffe und Eignung. Ess-
lingen: Expert Verlag 1993. In: Werkstoffwissenschaften und Bausanierung. Tagungsbericht des dritten
internationalen Kolloquiums
(Wittmann, F. H.; Bartz, W. J. Ed.), Teil 1, S. 211 – 227.
• Ehrenstein, G. W.: Mit Kunststoffen konstruieren. Carl Hanser Verlag München Wien, 1995.
• Ehrenstein, G. W.: Kunststoff-Schadensanalyse; Methoden und Verfahren. Carl Hanser Verlag München
Wien, 1992.
• Wesche, K. H.: Kunststoffe für tragende Bauteile; Band 4: Holz, Kunststoffe (Organische Stoffe). Bauver-
lag GmbH. Wiesbaden und Berlin, 1988.
• Reul, Horst.: Die Sanierung der Sanierung - Grundlagen und Fallbeispiele. Fraunhofer IRB Verlag, 2005.
• DIN 31 051 Grundlagen der Instandhaltung.
• DIN EN 13 306 Begriffe der Instandhaltung.
• DAfStb-Richtlinie:
- Schutz und Instandsetzung von Bauteilen
- Teil 1: Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze.
- Teil 2: Bauprodukte und Anwendungen.
- Teil 3: Anforderung an die Betriebe und Überwachung.
- Teil 4: Prüfverfahren.
• DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton.
• DIN EN 1504:
- Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betonbauwerken
- Teil 1: Definitionen.
- Teil 2: Oberflächenschutzsysteme für Beton.
- Teil 3: statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung.
• DBV-Merkblatt Betondeckung und Bewehrung (Deutscher Beton-Verein e.V.).
• DIN 18 349 VOB:
- Verdingungsordnung für Bauleistungen – Teil C:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV);
- Betonerhaltungsarbeiten
• DIN 18 195-1 Bauwerksabdichtungen; Teil 1: Grundsätze, Definitionen, Zuordnung und
Abdichtungsarten.
• DIN 18 195-2 Bauwerksabdichtungen; Teil 2: Stoffe.
• DIN 18 195-3 Bauwerksabdichtungen; Teil 3: Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der
Stoffe.
• DIN 18 195-4 Bauwerksabdichtungen; Teil 4: Abdichtung gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwas-
ser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden, Bemessung und Ausführung.
• DIN 18 195-5 Bauwerksabdichtungen; Teil 5: Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser auf Decken-
flächen und in Nassräumen, Bemessung und Ausführung.
• DIN 18 195-6 Bauwerksabdichtungen; Teil 6: Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser, Bemessung und Ausführung.
• DIN 18 195-7 Bauwerksabdichtungen; Teil 7: Abdichtung gegen von innen drückendes Wasser, Bemes-
sung und Ausführung.
• DIN 18 195-8 Bauwerksabdichtungen; Teil 8: Abdichtung über Bewegungsfugen.
• DIN 18 195-9 Bauwerksabdichtungen; Teil 9: Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse.
• DIN 18 195-10 Bauwerksabdichtungen; Teil 10: Schutzschichten und Schutzmaßnahmen.
Version: SS 2016 Seite 16
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
• DIN 4095 Baugrund; Dränung zum Schutz baulicher Anlagen - Planung, Bemessung und Ausführung.
• DIN EN 13 578 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken
- Prüfverfahren: Verträglichkeit zwischen Beschichtung und wassergesättigtem, oberflächentrockenem
Beton.
• DAfStb WU-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton; Deutscher Ausschuss für Stahlbeton
DAfStb im DIN (11.2003).
• Zement-Merkblatt H10 Wasserundurchlässige Betonbauwerke; Bauberatung Zement (08.2006).
Version: SS 2016 Seite 17
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
BTEC2 BTEC-2 Betontechnologie 2
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Wahlpflichtmodul
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: siehe aktueller Vorlesunsgplan
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: keine
Modulverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Manfred Breitbach
Lehrende(r): Prof. Dr.-Ing. Manfred Breitbach
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: keine
Lehrformen: Seminaristischer Unterricht (abhängig von der Teilnehmerzahl) mit Vortrags-,
Diskussions- und Übungselementen
Arbeitsaufwand: 75 Stunden Präsenzzeit, 75 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Vorlesungsmanuskript, Übungsbeispiele, E-learning-Teilmodule, Exkursio-
nen
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Fachliche Kompetenzen:
* zur Festlegung von Frischbeton- und Festbetoneigenschaften
* zur Anwendung von Sonder- und Spezialbetonen und zementgebundenen Baustoffen
* zur Umsetzung der Überwachungsklassen ÜK 2 und ÜK 3 DIN 1045-3
Überfachliche Kompetenzen:
Selbständiges Arbeiten, Arbeiten in Gruppen, Diskussionsfähigkeit, eigenständiges Erarbeiten eines The-
mas und Präsentation
Inhalte:
– Einführung
– Konstruktive Forderungen
– Ausgangstoffe des Betons
– Beton
– Transportbeton
– Konformitätskrterien
– Bauausführung
– Fugen
– Expositionskassen
– Betone für bestimmte Anwendungsgebiete
– Leichtboden
– Schwerboden
– Einpressmörtel
– sonstige Verfahren+
– Sichtbeton
– vorgefertigte Bauteile
– Zementstrich
– Mörtel
– Qualitätsicherung
– Dauerhaftigkeit
Version: SS 2016 Seite 18
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
– Schnittstellen und Verantwortlichkeit
Literatur:
• DIN 1045 DAfStb-Richtlinie DIN 18 349 VOB DIN 18 551.
Version: SS 2016 Seite 19
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
FASA FASA Fasade Glas
Studiengang:
Kategorie: Wahlpflichtmodul
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: siehe aktueller Vorlesungsplan
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: Baukonstruktion, Bauphysik, Stabwerke, Trägerroste, Plattentheorie
Modulverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Schuchardt
Lehrende(r): Prof. Dr.-Ing. Schuchardt
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: keine
Lehrformen: Wissensvermittlung via: Tafel, Vorlesungsunterlagen, Übungsbeispiele,
Folien-/ PowerPoint-Präsentation
Arbeitsaufwand: 60 Stunden Präsenzzeit, 90 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Tafel, Beamer, Overheadprojektor
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele, Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen:
Die Studierenden sollen anhand von ausgewählten und realisierten Fassadeprojekten den jeweiligen Stand
der Technik der Konstruktion im Fassadenbau erlangen.
Im Rahmen der Entwurfsplanung sollen die Studierenden befähigt werden, eigene Konzepte zu entwickeln
und auf die baulichen Erfordernisse abzustimmen.
Erlernen und Erfassen der notwendigen Konstruktionselemente und Konstruktionsweisen.
Inhalte:
Konstruktionsmerkmale und angewandte bauphysikalische und statische Berechnungsmethoden von Kalt-
, Warm- Kalt/Warm und Membranfassaden:
a) Pfosten-, Riegelbauart und daraus abgeleiteten Bauweisen, Element- Stapel, Kasten, Doppelschalen,
Schacht, Korridor ...-fassaden;
b) Flächenbauteile und Vorhangfassaden - dünnwandige Fassadenplatten, Membranen
c) Konstruktiver Glasbau
d) Materialkombinierte Bauweisen mit Tragfunktion-, Sandwich-, Platten-, Fertigteile Stahl- und Aluminium-
sandwichelementen
Laborübung – Fassadenprüfstand, Fassadenbaulabor
EDV Übung mit Finite Elemente Programmen
Literatur:
• Frick, Knöll, Neumann, Weinbrenner, Baukonstruktionslehre T1+2 – Teubner.
• ift Rosenheim – Schriftenreihen Richtlinien, Empfehlungen u.a.“, Berichte“ – Eigene Schriftenreihe.
” ”
• Oesterle, Lieb, Lutz, Heusler, Doppelschalige Fassaden – Callwey 1999.
• DIN Taschenbücher Nr. 83, 79, 94, u. DIN Kommentar Außenwandbekleidungen - Beuth Verlag.
• Bauschädensammlung Schriftenreihe Fraunhofer IRB Verlag.
• Zusammenstellung bewährter Natursteine; BTI – Informationsstelle Naturwerkstein Würzburg.
Version: SS 2016 Seite 20
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
IMMO1 IMMO-1 Immobilienmanagement 1
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Wahlpflichtmodul
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: siehe aktueller Vorlesungsplan
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: keine
Modulverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Krudewig
Lehrende(r): Lehrbeauftragter
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: keine
Lehrformen: Schlüsselkompetenzen: Selbständiges Arbeiten, Arbeite in Gruppen, Diskus-
sionsfähigkeit, eigenständiges Erarbeiten eines Themas und Präsentation
Arbeitsaufwand: 60 Stunden Präsenzzeit, 90 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Beamer, Tafel, Vorlesungsunterlagen, Folien-/ PowerPoint-Präsentation
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele, Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen:
Die Studierenden sollen die wichtigsten Begriffe des Immobilienmanagements (IMMO) kennen lernen und
für die Bedeutung und Probleme des IMMO sensibilisiert werden.
Kenntnisse über Ziele, Aufgaben und Funktionen des strategischen und operativen Immobilienmanage-
ments sollen von den Studierenden erworben und diese in der
beruflichen Praxis einsetzbar sein. Das Modul Immobilienmanagement 1 beschäftigt sich mit der Erstel-
lungsphase einer Immobilie. Es werden die
Themenfelder der Projektentwicklung des Projektmanagements, des nachhaltigen Bauens, der Investition
und möglicher Finanzierungen behandelt.
Das Inbetriebnahmemanagement als Bindeglied zwischen der Realisierung und der Nutzung wird behan-
delt. Die Studierenden kennen die zeitliche Abfolge in der Immobilienrealisierung
und wesentliche Aufgaben in den einzelnen Themenfeldern umzusetzen.
Inhalte:
• Grundlagen des Immobilienmanagements hinsichtlich Entwicklung, Bedeutung, Aufgaben und Funktio-
nen
• Die Projektentwicklung von der Idee bis zur Entscheidung der Realisierung. Die Tätigkeiten während der
Entwicklungsphase
• Verfahrensweisen zu Aufgaben und Tätigkeiten während der Projektrealisierung. Darstellung besonderer
Themen als Ergänzung zum Modul Projektmanagement
• Die Immobilieninvestitionsrechnung und die Immobilienfinanzierung als Grundvoraussetzung zur Reali-
sierung
• Inbetriebnahme-Management der Übergang (die Übergabe/Übernahme) der Immobilie von der Realisie-
rung zur Nutzung
Literatur:
• HOAI 2013 und AHO 2014.
• Nutzungskostenmanagement als Aufgabe der Projektsteuerung.
• Immobilienwirtschaft – Handbuch für Studium und Praxis.
• Modernes Immobilienmanagement.
• Immobilienmanagement im Lebenszyklus.
• DIN-Normen und VDI-Richtlinien.
Version: SS 2016 Seite 21
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
IMMO2 IMMO-2 Immobilienmanagement 2
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Wahlpflichtmodul
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: siehe aktueller Vorlesungsplan
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: keine
Modulverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Krudewig
Lehrende(r): Lehrbeauftragter
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: keine
Lehrformen: Schlüsselkompetenzen: Selbständiges Arbeiten, Arbeite in Gruppen, Diskus-
sionsfähigkeit, eigenständiges Erarbeiten eines Themas und Präsentation
Arbeitsaufwand: 60 Stunden Präsenzzeit, 90 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Beamer, Tafel, Vorlesungsunterlagen, Folien-/ PowerPoint-Präsentation
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele, Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen:
Die Studierenden sollen die wichtigsten Begriffe des Immobilienmanagements (IMMO) kennen lernen und
für die Bedeutung und Probleme des IMMO sensibilisiert werden.
Kenntnisse über Ziele, Aufgaben und Funktionen des strategischen und operativen Immobilienmanage-
ments sollen von den Studierenden erworben und diese in der
beruflichen Praxis einsetzbar sein. Das Modul Immobilienmanagement 2 beschäftigt sich mit der Nutzungs-
phase einer Immobilie. Es werden die Themenfelder der Bereitstellung
von Immobilien, Immobilienmarketing, Facility Management, Gebäudemanagement, Bewertung von Immo-
bilien, Bauen im Bestand, Denkmalpflege und Flächenrecycling behandelt. Die Studierenden kennen
die Inhalte und zeitliche Abfolge in der Immobiliennutzung bis hin zur Verwertung und können wesentliche
Aufgaben in den einzelnen Themenfeldern umzusetzen.
Inhalte:
• Bereitstellungsarten von Immobilien
• Immobilienmarketing zur Vermeidung von Leerstand
• Historische Entwicklung vom Facility Management und die strategische Bedeutung
• Operatives Facility Management – Gebäudemanagement
• Bewertungsverfahren von Immobilien
• Bauen in Bestandsimmobilien auch unter Beachtung des Denkmalschutzes
• Recycling von Brachflächen
Literatur:
• Redevelopment von Bestandsimmobilien.
• Immobilienwirtschaft – Handbuch für Studium und Praxis.
• Facility Management.
• Modernes Immobilienmanagement.
• Immobilienmanagement im Lebenszyklus.
• Lehrbuch zur Immobilienbewertung.
• DIN-Normen und VDI-Richtlinien.
Version: SS 2016 Seite 22
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MATH2 MATH-2 Mathematik 2
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Wahlpflichtmodul
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: Jedes Semester
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: MATH-1
Modulverantwortlich: Vertr. Prof. Berweiler
Lehrende(r): Vertr. Prof. Berweiler
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: und / oder Wissenschaftliche Hausarbeit
Lehrformen: Seminaristischer Unterricht (abhängig von der Teilnehmerzahl) mit Vortrags-,
Diskussions- und Übungselementen
Arbeitsaufwand: 60 Stunden Präsenzzeit, 90 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Beamer, Tafel, Vorlesungsunterlagen, Folien-/ PowerPoint-Präsentation
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele:
Die Kenntnis der Infinitesimalrechnung und die Fähigkeit zur Lösung von Aufgabenstellungen in der Be-
rufspraxis des Bauingenieurs.
Überfachliche Kompetenzen:
Selbständiges Arbeiten, Arbeiten in Gruppen, Diskussionsfähigkeit, eigenständiges Erarbeiten eines The-
mas und Präsentation
Inhalte:
Differentialrechnung:
• Differenzen- und Differentialquotient
• Differentiation der Grundfunktionen und Differentiationsregeln
• Numerische Differentiation
• Tangente und Normale
• Anwendungen der Kurvendiskussion
• Newtonsches Näherungsverfahren
Integralrechnung:
• Bestimmtes- und unbestimmtes Integral
• Integrationsregeln und Grundintegrale
• Integrationsmethoden
• Numerische Integration
• Flächenmomente
• Biegebalken
Literatur:
• Lothar Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1.
• Vieweg Verlag, 12. Auflage, 2009.
Version: SS 2016 Seite 23
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MATH3 MATH-3 Mathematik 3
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Wahlpflichtmodul
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: siehe aktueller Vorlesungsplan
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: MATH-2
Modulverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Bogacki
Lehrende(r): Prof. Dr.-Ing. Bogacki
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: keine
Lehrformen: Seminaristischer Unterricht (abhängig von der Teilnehmerzahl) mit Vortrags-,
Diskussions- und Übungselementen
Arbeitsaufwand: 60 Stunden Präsenzzeit, 90 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Beamer, Tafel, Vorlesungsunterlagen, Folien-/ PowerPoint-Präsentation,
Übungsbeispiele, Computeralgebrasoftware
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele:
Die Fähigkeit, zur Lösung von Aufgabenstellungen in der Berufspraxis des Bauingenieurs Methoden der
höheren Mathematik anzuwenden. Die Studierenden
erlernen selbstständiges Arbeiten, analytisches Denken, Team- und Kooperationsfähigkeit, Selbstlernkom-
petenz und den Transfer zwischen Theorie und
Praxis.
Überfachliche Kompetenzen:
Selbständiges Arbeiten, Arbeiten in Gruppen, Diskussionsfähigkeit, eigenständiges Erarbeiten eines The-
mas und Präsentation
Inhalte:
• Lineare Algebra: Vektoren & Matrizen, Lineare Gleichungssysteme, Eigenwertprobleme
• Höhere Differential- und Integralrechnung: Partielle Ableitungen, Regel von de l‘Hospital, Gradient, Di-
vergenz, Rotation, Spezielle Koordinatensysteme, Kurvenintegrale,
Oberflächenintegrale, Integralsätze von Gauß und Stokes, Taylor-Reihen, Fourier-Reihen
• Ausgewählte Differentialgleichungen: Gewöhnliche Differentialgleichungen 1. Ordnung, Lineare homo-
gene Differentialgleichungen 2. Ordnung, Ausgewählte Differentialgleichungen
aus dem Bauingenieurwesen
Literatur:
• Lothar Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 2 & 3.Vieweg Verlag, 12.
Auflage, 2009.
Version: SS 2016 Seite 24
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MATH5 MATH-5 Mathematik 5 - Numerische Methoden
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Wahlpflichtmodul
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: siehe aktueller Vorlesungsplan
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: MATH-3 ; BINF-2
Modulverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Bogacki
Lehrende(r): Prof. Dr.-Ing. Bogacki
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: keine
Lehrformen: Seminaristischer Unterricht (abhängig von der Teilnehmerzahl) mit Vortrags-,
Diskussions- und Übungselementen.
Arbeitsaufwand: 60 Stunden Präsenzzeit, 90 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Beamer, Tafel, Vorlesungsunterlagen, Folien-/ PowerPoint-Präsentation,
EDV-Seminar
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele:
Die Kenntnis numerischer Lösungsverfahren für ausgewählte mathematische Probleme sowie die Fähig-
keit, diese in ein Visual-Basic Programm umzusetzen. Die Studierenden erlernen
selbstständiges Arbeiten, analytisches Denken, Team- und Kooperationsfähigkeit, Selbstlernkompetenz
und den Transfer zwischen Theorie und Praxis.
Überfachliche Kompetenzen:
Selbständiges Arbeiten, Arbeiten in Gruppen, Diskussionsfähigkeit, eigenständiges Erarbeiten eines The-
mas und Präsentation.
Inhalte:
• Nullstellen
• Interpolationsverfahren
• Numerische Integration
• Lineare Gleichungssysteme
• Eigenwerte
Literatur:
• Schwarz, H. R.: Numerische Mathematik. Teubner, Stuttgart.
• Zurmühl, R.; Falk, S.: Matrizen und ihre technischen Anwendungen, Teil 1: Grundlagen. Springer, Berlin-
Heidelberg-New York-Tokio.
Version: SS 2016 Seite 25
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MPBB5 MPBB5 Baubetrieb 5 (Projektsteuerung im Bauwesen)
Studiengang:
Kategorie: Pflichtfach
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: siehe aktueller Vorlesungsplan
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: keine
Modulverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Engler
Lehrende(r): Prof. Dr.-Ing. Engler
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: keine
Lehrformen: Wissensvermittlung via: Power-Point-Präsentationen und Tafel
Arbeitsaufwand: 60 Stunden Präsenzzeit, 90 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Tafel, Beamer, Overheadprojektor
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele, Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen:
Die Studierenden erlenen die Fähigkeit komplexe Großbaustellen in der Gesamtheit von Kosten, Terminen
und Qualitäten zu steuern, in Verbindung mit Muster bzw. Schemata
für die Umsetzung von Projektsteuerungstätigkeiten.
Inhalte:
• Grundlagen der Projektsteuerung
• Leistungsbild (VOB/B) und Honorierung (HOAI)
• Projektorganisation, Projektablauf
• Qualität-, Termine- und Kostengrundlagen
• Verträge leben
• Versicherungen
• Sicherheiten und Dokumente
Literatur:
• Ahrens/Bastian/Muchowski, Handbuch Projektsteuerung – Baumanagement, Fraunhofer IRB – Verlag.
• Eschenbruch, Projektmanagement und Projektsteuerung, Werner Verlag.
• AHO Ausschuss der Ingenieurverbände und Ingenieurkammern für die Honorarordnung e.V. / Deutscher
Verband der Projektsteuerer e.V., Untersuchungen zum Leistungsbild, zur Honorierung
und zur Beauftragung von Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft, AHO
Heft 9.
Version: SS 2016 Seite 26
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MPBB6 MPBB6 Baubetrieb 6 (Claim Management im Bauwesen)
Studiengang:
Kategorie: Pflichtfach
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: siehe aktueller Vorlesungsplan
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: Baubetrieb 3
Modulverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Engler
Lehrende(r): Prof. Dr.-Ing. Engler
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: keine
Lehrformen: Wissensvermittlung via: Power-Point-Präsentationen und Tafel
Arbeitsaufwand: 60 Stunden Präsenzzeit, 90 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Tafel, Beamer, Overheadprojektor
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele, Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen:
Die Studierenden sind in der Lage bei komplexen Bauvorhaben die Änderungen von Bauverträgen ver-
handlungssicher zu beherrschen.
Sie erlernen selbstständiges Arbeiten, analytisches Denken, Team- und Kooperationsfähigkeit, Selbstlern-
kompetenz und den Transfer zwischen Theorie und Praxis.
Inhalte:
• Verspätete Zuschlagserteilung
• Nicht angeordnete Mengenänderungen
• Zusätzlich erforderliche Bauleistungen
• Geänderte Bauleistungen
• Verlängerung der Bauzeit infolge Mengenänderungen
• Verlängerung der Bauzeit infolge Behinderungen
• Kündigung des Bauvertrages
• Beschleunigung des Bauablaufes
• Dokumentation von Vertragsänderungen
• Streitregulierung
Literatur:
• Vygen/Wirth/Schmidt, Bauvertragsrecht – Grundwissen, Werner Verlag.
• Kapellmann/Langen, Einführung in die VOB/B – Basiswissen für die Praxis, Werner Verlag.
Version: SS 2016 Seite 27
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MPPM2 MPPM2 Projektmanagement 2 (Management von Baustellen)
Studiengang:
Kategorie: Pflichtfach
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: siehe aktueller Vorlesungsplan
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: keine
Modulverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Krudewig
Lehrende(r): Prof. Dr.-Ing. Krudewig
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: Klausur
Studienleistung: Projektarbeit
Lehrformen: Wissensvermittlung via: Vorlesungsskript, Power-Point-Präsentation, EDV-
Übung mit ARRIBA bauen & MS-Project
Arbeitsaufwand: 65 Stunden Präsenzzeit, 85 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Tafel, Beamer, Overheadprojektor
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele, Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen:
Die Studierenden erlernen die Fähigkeit sich in die Aufgaben eines Bauleiters des Auftragnehmers ver-
setzten zu können. Methoden zur Zeit- und Kostenplanung und –Kontrolle und sind in der Lage diese für
Bauprojekte einzusetzen. Die Studierenden haben
die Fähigkeit, eine gestellt Aufgabe mit Hilfe von Mitarbeitern in der geforderten Qualität termingerecht
abzuliefern. Sie haben die Fähigkeit, ein Projekt aus Sicht des Auftragnehmers so zu organisieren, dass
terminliche, qualitative und kostenmäßige
Abweichungen frühzeitig erkannt und noch rechtzeitig mit dem Team korrigiert werden können. Die Studie-
renden haben Erfahrung im Umgang mit Mitarbeitern im Rahmen von Teamarbeit. Sie erlernen selbstständi-
ges Arbeiten, analytisches Denken,
Team- und Kooperationsfähigkeit, Selbstlernkompetenz und den Transfer zwischen Theorie und Praxis.
Inhalte:
• Arbeitsvorbereitung
• Terminplanung
• Bauausführung
• Rechnungsprüfung
• Abrechnung und Leistungsbewertung
• ARRIBA bauen – Abrechnung nach REB 23.003
• ARRIBA bauen – Abrechnungsbeispiel
• Claims
• Bau-/Dokumentation
• Baustellenergebnis, Beendigung der Baumaßnahm
• Microsoft Project - Grundlagenvorlesung
• Studienleistung: Betreuung der Bachelor Studierenden
Version: SS 2016 Seite 28
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MPPM3 MPPM3 Projektmanagement 3
Studiengang:
Kategorie: Pflichtfach
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: siehe aktueller Vorlesungsplan
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: keine
Modulverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Krudewig; Prof. Dr.-Ing. Bogacki
Lehrende(r): Prof. Dr.-Ing. Krudewig; Prof. Dr.-Ing. Bogacki
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: keine
Studienleistung: Projektarbeit
Lehrformen: Wissensvermittlung via: Vorlesungsmanuskript, PP-Präsentationen, Klein-
gruppenarbeit
Arbeitsaufwand: 60 Stunden Präsenzzeit, 90 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Tafel, Beamer, Overheadprojektor
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele, Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen:
Mitarbeiterführung – Führungstechnik:
Die Studierenden haben einen Überblick über die Aufgaben und Kompetenzen eines/r Teamleiter/in. Sie
haben praktische Fertigkeiten in der Teamleitung.
Sie kennen die Grundlagen zur Mitarbeiterführung und Mitarbeitermotivation. Sie reflektieren ihre Rolle als
Führungspersönlichkeit und bereiten sich auf die
Übernahme von Führungsaufgaben im Berufsleben vor. Sie erlernen selbstständiges Arbeiten, analyti-
sches Denken, Team- und Kooperationsfähigkeit, Selbstlernkompetenz und
den Transfer zwischen Theorie und Praxis.
Mitarbeiterführung – Entscheidungstechnik:
Die Studierenden haben die Fähigkeit, die Methoden der Entscheidungsfindung auf Probleme der Baupra-
xis anzuwenden. Sie erlernen selbstständiges Arbeiten, analytisches Denken,
Team- und Kooperationsfähigkeit, Selbstlernkompetenz und den Transfer zwischen Theorie und Praxis.
Inhalte:
• Mitarbeiterführung – Führungstechnik:
* Rolle als Führungskraft, Führungsverständnis und Führungsstile
* Mitarbeitermotivation und Personalentwicklung
* Besprechungen effektiv führen, Sitzungsleitung
* Zeitmanagement, Selbstmanagement
* Konfliktmanagement: Konflikttheorien, Konfliktanalyse
* Teamleitung: Aufgaben und Kompetenzen
* Teamleitung und Teammitglieder: Rollen und Typen
* Gruppenphasen und Gruppendynamik, Teamentwicklung
• Mitarbeiterführung – Entscheidungstechnik:
* Grundlagen der Entscheidungstheorie
* Entscheidungsprobleme- und Prozesse
* Entscheidungsalgorithmen
* Methoden des Operations Research: Entscheidungsbäume, Kosten-Nutzen Analyse, Analytical Hierar-
chical Process, etc.
* Einführung in das Konfliktmanagement
Version: SS 2016 Seite 29
Stand: 15. September 2016Hochschule Koblenz ∗ Fachbereiche Ingenieurwesen & Wirtschaftswissenschaften ∗ Modulhandbuch
Master Wirtschaftsingenieur
MWIP1 MWIP-1 Wissenschaftliches Projekt-1
Studiengang: Master: WI
Kategorie: Wahlpflichtmodul
Semester: 1.-2. Semester
Häufigkeit: Jedes Sommersemester
Voraussetzungen: keine
Vorkenntnisse: keine
Modulverantwortlich: Prüfungsamt
Lehrende(r): Individueller Betreuer
Sprache: Deutsch
ECTS-Punkte/SWS: 5 / 4 SWS
Leistungsnachweis: Prüfungsleistung: keine
Studienleistung: Wissenschaftliche Hausarbeit
Lehrformen: Projektarbeit
Arbeitsaufwand: 16 Stunden Präsenzzeit, 134 Stunden für Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffes
Medienformen: Tafel, Beamer, Overheadprojektor
Anerkennbare praxisbezogene Leistungen/Kompetenzen in Dualen Studiengängen: keine
Lernziele:
Die Studierenden sollen unter Betreuung lernen, wissenschaftlich zu arbeiten. Dazu soll ein vorgegebenes
Thema in enger Abstimmung mit dem Betreuer wissenschaftlich aufbereitet und die Ergebnisse in einem
Forschungsbericht festhalten werden.
Überfachliche Kompetenzen:
Selbständiges Arbeiten, Arbeiten in Gruppen, Diskussionsfähigkeit, eigenständiges Erarbeiten eines The-
mas und Präsentation
Inhalte:
Nach Vereinbarung
Version: SS 2016 Seite 30
Stand: 15. September 2016Sie können auch lesen