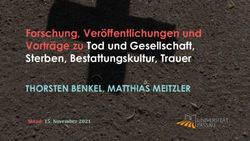Der demografische Wandel in Brandenburg - Gemeinden ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der demografische
Wandel in
Brandenburg
Probleme, Strategien und Ideen
für Kommunalverwaltungen
Dokumentation der Brandenburg-Konferenz
vom 26. September 2012
ver.di Berlin-Brandenburg
Fachbereich GemeindenDer demografische
Wandel in
Brandenburg
Probleme, Strategien und Ideen
für Kommunalverwaltungen
3 Auswirkungen des demografischen Wandels
auf Brandenburger Kommunen
Jens Tessmann – Universität Potsdam (KWI)
8 Demografischer Wandel:
Herausforderungen, Fragen und Handlungserfordernisse
Werner Roepke, ver.di-Landesfachbereichsleiter
Gemeinden Berlin-Brandenburg
12 Wie viele Städte und Gemeinden braucht das Land?
Ist eine neue Gemeindegebietsreform eine Antwort
auf den demografischen Wandel?
Karl-Ludwig Böttcher, Städte- und Gemeindebund Brandenburg
21 Podiumsdiskussion
Zukunftsvision Brandenburg 2020 –
Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Zwischenbericht der
Enquete-Kommission des Landtages Brandenburg
V.i.S.d.P.: Werner Roepke, ver.di Berlin, Fachbereich Gemeinden,
Köpenicker Straße 30, 10179 BerlinJens Tessmann Universität Potsdam (KWI) tessmann@uni-potsdam.de Auswirkungen des demografischen Wandels auf Brandenburger Kommunen Das Land Brandenburg unterliegt ebenso wie andere Regionen Deutschlands den Auswirkungen des demografischen Wandels. Aus der spezifischen raumstrukturellen Situation des Landes ergeben sich dabei jedoch besondere Herausforderungen. Da sich die prognostizierten demografischen Trends weiter fortsetzen werden, ergibt sich besonders für die Zukunft mit Blick auf das Jahr 2030 ein großer Handlungsbedarf für die Landes- und Kommunalpolitik. Grundlage für die Entwicklung von Strategien ist die genaue Kenntnis des Wandlungsprozesses und dessen Folgen. Für die demografische Entwicklung ist grundsätzlich die Betrachtung von Geburten- und Sterberate sowie insbesondere von Wanderungsbewegungen wichtig. Deutschlandweit wird aufgrund von steigender Lebenserwartung und sinkenden Geburtenzahlen bei begrenzten Wanderungsgewinnen von einer zukünftig niedrigeren Bevölkerungszahl und einer Überzahl der Älteren ausgegangen. Prägend für die Brandenburger Demografie war / ist besonders die Ab- wanderung der jungen und mittelalten Jahrgänge in die Wachstumszen- tren der alten Bundesländer sowie in das unmittelbare Berliner Umland. In der Folge wird für das Jahr 2030 eine Bevölkerungsabnahme im ber- linfernen Raum um 22 % prognostiziert. Im Gegensatz dazu kann das Berliner Umland von dem Trend profitieren. Die Bevölkerung wird unter gleich bleibenden Bedingungen dort im gleichen Zeitraum um 7,1 % zu- nehmen. Im Saldo werden die Brandenburger um 11,7 % zurückgehen. Dieser Rückgang geht auch mit einer Bevölkerungskonzentration rund um Berlin und mit einer Abnahme der Bevölkerungsdichte bei zunehmender Der demografische Wandel in Brandenburg 3
Berlinferne einher. Daraus ergibt sich für den ländlichen Raum eine
Verstärkung des demografischen Deutschlandtrends. Bevölkerungsab-
nahme und Überalterung werden dort besonders spürbar sein. Weitaus
positiver sieht die Entwicklung im Berliner Umland aus.
Quelle: Landesamt für Bauen Mit Blick auf die Entwicklung der Landkreisebene ergibt sich für das
und Verkehr Brandenburg, Prognosejahr 2030 im berlinfernen Raum eine Abnahme der Bevölkerung
Bevölkerungsentwicklung 2010
gegenüber 1990 in den Ämtern zwischen 18 % und 27 %. Für Landkreise, welche mit ihrer Fläche Anteil
und amtsfreien Gemeinden. am Berliner Umland haben (Sektoralkreise), wird die geschätzte Bevölke-
Raumbeobachtung 2012. rungsabnahme deutlich geringer ausfallen. Dort nimmt die Bevölkerung
zwischen 2 % und 9 % ab. Die Landeshauptstadt Potsdam kann sogar
ein Wachstum um 19% verbuchen. Die übrigen kreisfreien Städte neh-
men demgegenüber eine „mittlere“ Position ein. Sie verlieren zwischen
13 % und 16 % ihrer Einwohner. Im Ergebnis dieser Prognosen kann also
von einer deutlichen Zunahme der regionalen Unterschiede bei der Be-
völkerungsentwicklung ausgegangen werden.
4 Der demografische Wandel in BrandenburgQuelle: Landesamt für Bauen Für die Infrastruktur und die öffentliche Daseinsvorsorge in den berlin-
und Verkehr Brandenburg,
fernen Räumen ergeben sich daraus Auslastungsschwierigkeiten und
Bevölkerungsentwicklung 2030
gegenüber 2010 in den Land- Finanzierungsprobleme. Durch die geringe Anzahl an Nutzern ist die
kreisen und kreisfreien Städten. Funktionsfähigkeit von technischen und sozialen Einrichtungen in ihrer
Raumbeobachtung 2012.
bestehenden Form deshalb bedroht. Ebenso führt die Verteilung der Be-
triebskosten auf immer weniger Nutzer zu unverhältnismäßigen Gebüh-
rensteigerungen. Parallel dazu werden auch die einwohnerbezogenen
öffentlichen Einnahmen aus den allgemeinen Finanzzuweisungen sinken.
Mit steigenden Steuereinnahmen ist aufgrund der geringen Wirtschafts-
und Erwerbstätigkeit der alternden Landbevölkerung auch nicht zu
rechnen. Um also weiterhin eine qualitativ hochwertige Versorgung mit
öffentlichen Infrastrukturleistungen und Gütern des täglichen Bedarfes
zu sichern, sind neben „moderater“ kommunaler Strukturanpassung
neuartige Organisations- und Finanzierungsformen gefragt.
Der demografische Wandel in Brandenburg 5Von grundsätzlicher strategischer Bedeutung ist daher die Bündelung
der Kräfte vor Ort über klassische Behörden- und Organisationsgrenzen
hinweg. In Abhängigkeit von der lokalen und regionalen Konstellation
aus privaten, öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Akteuren, sind
zukünftig die Zusammenführung der unterschiedlichen Ressourcen und
Kompetenzen notwendig. Auf Basis der Analyse der regionalwirtschaft-
lichen Innovationspotentiale erscheint die Bildung von Dienstleistungs-
partnerschaften wichtig. Erfolgsfaktor dieser Kooperationen ist die Ver-
bindung der Stärken der Beteiligten. Die Rolle der öffentlichen Hand in
den Versorgungspartnerschaften kann insoweit sehr stark variieren. So
kann die Kommune z. B. Räumlichkeiten, Kostenübernahmen, Zuschüsse,
Personal und Organisationskompetenz zur Verfügung stellen.
Für private und gemeinwirtschaftliche (z. B. AWO, Caritas) Anbieter so-
wie Vereine können so die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden,
die ein Versorgungsangebot erst möglich machen. Zusätzlich zu den
Synergie-Effekten können durch die Kombination der Dienstleistungen
auch neuartige Angebote als Paket erreicht werden. Für die räumliche
Konzentration der Angebote bieten sich sogenannte multifunktionale
Versorgungszentren (Gemeindezentren) an. In Abhängigkeit von der
örtlichen Situation können diese auch von der Bürgerschaft, also durch
bürgerschaftliches Engagement (Bürgerzentren), getragen werden. Die-
se neuen kooperativen Arrangements erfordern auch die Nutzung von
passenden Organisationsformen wie z. B. Gemeinsamen Kommunalun-
ternehmen und Genossenschaften.
Die Gemeinde- bzw. Bürgerzentren können aber auch ideal als Logistik-
knoten (Servicestation) für die Bereitstellung von mobilen Serviceange-
boten genutzt werden. Auch dabei sollten die öffentlichen, privat-
wirtschaftlichen und gemeinwirtschaftlichen Anbieter mit ihren Ver-
waltungs-, Service-, Pflege- und Sozialleistungen etc. kooperieren. Im
Ergebnis können ebenso wie bei den stationären Angeboten Kosten
und Wegezeiten gespart und der Zugang zu bzw. die Verfügbarkeit von
Leistungen in peripheren Landregionen bei der alternden Bevölkerung
verbessert werden. Unterstützung können diese Leistungsstrukturen
durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnik
erfahren. Auf diese Weise werden nicht nur der Austausch von
Informationen und die Kommunikation verbessert, sondern es wird
auch die Steuerung des vernetzten Leistungsprozesses ermöglicht.
Insgesamt betrachtet ist es zur Vermeidung von Versorgungsdefiziten
und vor allem zur Steigerung der Attraktivität der Landregionen not-
6 Der demografische Wandel in Brandenburgwendig, den Austausch zwischen dem Berliner Metropolraum und der Peripherie zu steigern. Insoweit müssen in Anknüpfung an bestehende Dialog- und Vernetzungsformen weitere Austauschprozesse etabliert und gefördert werden. Potentiale und Stärken der Landregionen sind regional und überregional zukünftig besser zu kommunizieren. Die staatliche Förderpolitik sollte im Wege von Bund-Land-Programmen ver- stärkt innovative lokale und regionale Bündnisse und deren Austausch zur Neuorganisation der Daseinsvorsorge im Fokus haben. Dazu sind der Ausbau und die Intensivierung des Dialoges zwischen Bundes- und Landespolitik mit den örtlichen Akteuren zwingend. Mobilisierungs-, Förderungs-, Beratungs- und Analyseleistungen sollten flankierend zur Verfügung gestellt werden. Der demografische Wandel in Brandenburg 7
Werner Roepke
ver.di-Landesfachbereichsleiter
Gemeinden Berlin-Brandenburg
Demografischer Wandel: Herausforderungen,
Fragen und Handlungserfordernisse
Die demografische Entwicklung im Land Brandenburg ist besorgniserre-
gend. Gründe dafür sind der dramatische Geburtenrückgang, die Alte-
rung der Bevölkerung sowie die Wanderungsbewegung in den soge-
nannten Speckgürtel und in andere Bundesländer.
Konsequenzen für • Viele Kommunen werden schrumpfen
die Kommunen • Alle Kommunen werden älter
• Trend zur „Rückflucht in die Städte“
Konsequenzen für Welche Aufgaben in welcher Qualität und Quantität sollen künftig ange-
die kommunale Auf- boten werden? Folgende Handlungsfelder werden im Vordergrund stehen:
gabenwahrnehmung • Kinder- und Familienfreundlichkeit
• Seniorenpolitik (altersgerechtes Wohnen, Integration)
• Anpassung der Infrastruktur
• Bürgerschaftliches Engagement
Erarbeitung von „Vor dem Hintergrund der prognostizierten demografischen Entwicklung
Lösungsansätzen und der absehbaren Verschlechterung der finanziellen Situation von
durch eine Land und Kommunen ist es [...] absehbar, dass die bisherige Aufgaben-
Enquetekommission1 verteilung zwischen Land und Kommunen nicht zukunftsfähig ist und
im Landtag die Verwaltungsstrukturen in ihrer jetzigen Form keinen Bestand haben
können. Die Enquetekommission soll die wesentlichen Problemfelder
aufgreifen, die aktuellen Strukturen bewerten und Lösungsmöglich-
keiten aufzeigen.“2
Stellenabbau als Ziel Die Stellenausstattung in der Landesverwaltung soll um 6 220 Stellen
der Reformen? auf 42 000 bis 2018 gekürzt werden. Das lehnt ver.di ab.
8 Der demografische Wandel in BrandenburgBürgerschaftliches Ohne das bürgerschaftliche Engagement, das Ehrenamt, würde vieles in
Engagement unserem Gemeinwesen nicht funktionieren, dies ist auch Ausdruck
gelebter Demokratie. Gewerkschaften, Sportvereine, politische Parteien
und nicht zuletzt der Brandschutz und Rettungsdienste werden zum
großen Teil durch ehrenamtliches Engagement getragen.
Kritisch wird es, wenn Kommunen versuchen, ihre schlechte Finanzlage
durch unbezahlte Bürgerarbeit zu kompensieren. Überproportional be-
troffen davon sind Frauenarbeitsplätze z. B. in Bibliotheken, Jugendzen-
tren, Bürgerbussen. Zu hinterfragen ist die Dauerhaftigkeit der Freiwilli-
genarbeit und der Existenz der Leistungen. Aus gewerkschaftlicher Sicht
findet bürgerschaftliches Engagement hier die Grenze, wenn kommu-
nale Arbeitsplätze gefährdet werden und ehrenamtliches Engagement
nur aus Haushaltskonsolidierungsgründen gefördert wird.
ver.di wird unter diesen Gesichtspunkten die Empfehlungen der Enquete-
kommission, die im Zwischenbericht noch nicht vorliegen, bewerten.
Herausforderung • Vorteile: erspart Wege, gut für ländlich geprägten Raum
e-Government • Nachteile: Zugangs- und Bedienmöglichkeiten (Diskussion:
e-Government-Gemeindeschwester), Verlust des persönlichen
Kontaktes, der nicht durch Technik ersetzt werden kann.
ver.di findet e-Government als zusätzliche Möglichkeit gut, als Ersatz für
persönliche Beratung in der öffentlichen Verwaltung mehr als kritisch.
Im Zwischenbericht gibt es dazu noch keine abschließende Meinung.
Kooperationen Kooperationen zwischen Kommunen (Cottbus LK Spree-Neiße), Land-
kreisen werden als Alternative zu erneuten Gebietsveränderungen disku-
tiert. Kooperationen sind auch zwischen Berlin und Brandenburg (Obere
Gerichtsbarkeit, Statistisches Landesämter) möglich. Dieser Weg ist an
einigen Stellen recht erfolgreich. Warum der Zwischenbericht dann fest-
stellt, dass Kooperationen allein nicht ausreichen, bedarf der Erklärung.
Funktionalreform Die Betrachtung der vertikalen und horizontalen Aufgabenverteilung ist
notwendig. Der Zwischenbericht gibt noch keine abschließenden
Empfehlungen. Meine Meinung: Ob eine Aufgabe zentral oder dezen-
tral wahrgenommen wird, ist differenziert zu betrachten. Nach meinen
Erfahrungen ist es in den meisten Fällen sinnvoll, die Leistung orts- und
1 Eine Enquetekommission
besteht aus Abgeordneten aller
bürgernah in den Kommunen zu erbringen. Allerdings müssen dafür die
Fraktionen und externen Sach- Strukturen vor Ort vorhanden sein und es darf keine Aufgabe ohne per-
verständigen. Beide Gruppen sonelle Ressourcen umgeschichtet werden. Personal folgt der Aufgabe.
arbeiten in ihr als gleichberech-
tigte Mitglieder. Sie sollen Ent-
Gefahr: Stellenabbau bis 2018
scheidungen über umfangreiche Indikator: Bürgerzufriedenheit
und bedeutsame Sachkomplexe
vorbereiten.
2 Aus der Begründung zur Ein-
setzung der Enquetekommission Der demografische Wandel in Brandenburg 9Zufriedenheit der Eine aktuelle Bürgerumfrage hat folgende Ergebnisse:
Bürgerinnen und • Der Gemeindebereich wird mit Abstand am besten mit gut bis sehr
Bürger mit den Ver- gut beurteilt. Damit liegt die Beurteilung im oberen Bereich.
waltungsleistungen • Die Landkreisebene landet im oberen mittleren Bereich
(befriedigend).
• Die Landesverwaltungsebene landet nur im mittleren Bereich.
Strukturreform – Die derzeitige Kommunale Verwaltungsstruktur mit
Gebietsreformen • 4 kreisfreien Städten (Brandenburg, Cottbus, Frankfurt, Potsdam)
• 14 Landkreisen
• 415 Gemeinden (144 amtsfrei, 271 amtsangehörig in 53 Ämtern)
• 112 Kommunen besitzen Stadtrecht
ist das Ergebnis der Gemeindegebietsreform und der Kreisneugliede-
rung von 2003.
In der Öffentlichkeit werden die „positiven“ Möglichkeiten einer erneu-
te n Gebietsreform unterschiedlich und kontrovers diskutiert. Die Vor-
schläge reichen von Abschaffung der Landkreise3 bis zum Erhalt der
jetzigen Strukturen. Der Zwischenbericht hat dazu keine Vorschläge
gemacht.
Die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) hat
anlässlich der Verabschiedung des Leitantrages „Brandenburg 2030“
auf dem Landesparteitag 22.9.12 in Luckenwalde Vorschläge veröffent-
licht. Danach soll keine Gemeinde weniger als 12 000 Einwohner haben.
Der Richtwert für Kreise beträgt 150 000 Einwohner. Es soll nur noch
eine kreisfreie Stadt (Potsdam) und nur noch elf Landkreise geben.
Die Beschäftigten- Das Durchschnittsalter der 45 700 Gemeindebeschäftigten beträgt rund
struktur altert analog 47 Jahre und entspricht damit etwa dem Durchschnitt der Brandenbur-
zur Bevölkerungs- ger Bevölkerung mit 46 Jahren.
entwicklung In Literatur und Wissenschaft werden als ältere Beschäftigte Kollegin-
nen und Kollegen mit 50+ bezeichnet. Es gibt ihnen gegenüber zwei
wesentliche Vorurteile:4
• Erhöhter Krankenstand: Krankenkassenerhebungen zeigen jedoch,
dass jüngere Beschäftigte häufiger, ältere länger arbeitsunfähig sind.
Dabei spielen chronische Erkrankungen (Herz-/Kreislauf, Atemwege
und Skelett) eine große Rolle.
• Lernfähigkeit: Ältere haben eine nachlassende Lerngeschwindigkeit,
jedoch oft erprobte und bessere Lösungsstrategien. „Lernentwöh-
nung“ hängt jedoch weniger mit dem Alter, als mit Lernmethoden
und -zeiten zusammen. Wer öfter zum Lernen motiviert wird, lernt
schneller.
10 Der demografische Wandel in BrandenburgAlternsmanagement, d. h. weitreichendes Personalmanagement, ist er-
forderlich mittels
• Qualifizierung
• Prävention
• Arbeitsorganisation sowie
• Personalplanung und -entwicklung
Das Durchschnittsalter erhöht sich durch die Rente mit 67. Gewerk-
schaftliche Forderung ist die Rücknahme der Erhöhung des Renten-
eintrittsalters. Schon heute erreicht nur noch eine Minderheit der
Erwerbstätigen das reguläre Renteneintrittsalter. Deshalb öffnet sich
hier ein gewerkschaftliches Handlungsfeld, damit möglichst viele Be-
schäftigte gesund die Regelrente erreichen.
Beispiele für gelungene Regelungen sind:
• Gesundheit-TV S&E
• Demografie-TV in Sachsen-Anhalt
• Anspruch auf freiwillige Teilzeit, teilweise (15–20 %) Rückfluss
der eingesparten Personalmittel in Ausbildung und Übernahme
von Azubis
• Altersteilzeit 83 % vom Netto ab 60
• Als notwendig vereinbart:
Wissenstransfer und Gesundheitsmanagement
• Projekt zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege
Der demografische Wandel in Brandenburg 11Karl-Ludwig Böttcher
Städte- und Gemeindebund Brandenburg
Wie viele Städte und Gemeinden
braucht das Land?
Ist eine neue Gemeindegebietsreform eine Antwort
auf den demografischen Wandel?
Derzeitige kommunale
Verwaltungsstruktur
419 Städte und Gemeinden
• 4 kreisfreie Städte (braun)
• 144 amtsfreie Städte und
Gemeinden (blau), davon 6
große kreisangehörige
• 271 amtsangehörige
Städte und Gemeinden
• 53 Ämter (weiß)
• viele weitere Formen
kommunaler
Zusammenarbeit)
14 Landkreise
12 Der demografische Wandel in BrandenburgAktuelle • Ergebnis der Gemeindestrukturreform 1998 / 2003
Gemeindestruktur • Gerichtsverfahren Juni 2006 abgeschlossen
255 Verfassungsbeschwerden
243 Anträge auf Erlass einstweiliger Anordnungen
Beschäftigte in 36.372 Vollzeitäquivalente:
Kommunen Kreisfreie Städte 4.955 VZÄ
(30.6.2011) Landkreise 10.705 VZÄ
Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Ämter 20.712 VZÄ
Quelle: Amt für Statistik Darunter: allgemeine Verwaltung 8.056 VZÄ
Berlin-Brandenburg
Darunter: Kindertagesbetreuung 7.514 VZÄ
Ziele der Reform • Amtsfreie Gemeinden und Ämter sollen so strukturiert sein, dass
(2000) der wirtschaftliche Einsatz moderner technischer Verwaltungsmittel
ebenso gesichert ist wie die Beschäftigung von hauptamtlichem
Verwaltungspersonal, das den Anforderungen einer modernen Ver-
waltung entsprechend qualifiziert und spezialisiert ist.
• Durch Stärkung der örtlichen Selbstverwaltung sind die Vorausset-
zungen zu schaffen, dass im Interesse der Bürgernähe weitere Auf-
gaben auf die untere kommunale Ebene verlagert werden können.
(Starke Gemeinden für Brandenburg, Leitlinien der Landesregierung
für die Entwicklung der Gemeindestruktur im Land Brandenburg,
11.7.2000)
• Die Verwaltungs- und Leistungskraft der Städte, Gemeinden und
Ämter ist durch die Neugliederung so zu stärken, dass sie dauerhaft
in der Lage sind, die eigenen und übertragene Aufgaben sachgerecht,
effizient und in hoher Qualität zu erfüllen und die wirtschaftliche
Nutzung der erforderlichen kommunalen Einrichtungen zu sichern.
• Die Gliederung der künftigen örtlichen Verwaltungseinheiten muss
die raumordnerischen, wirtschaftlichen und verkehrsmäßigen Zusam-
menhänge, das soziale Gefüge, die geschichtlichen und kulturellen
Beziehungen berücksichtigen und die Weiterentwicklung zu einheit-
lichen Lebens- und Wirtschaftsräumen durch koordinierte Planung
und Steuerung von Infrastrukturmaßnahmen ermöglichen.
• Die künftigen Gemeindestrukturen sollen zur Stärkung der bürger-
schaftlichen Beteiligung an der kommunalen Selbstverwaltung bei-
tragen.
• Belastbare Evaluierung fehlt
So auch Zwischenbericht Enquete-Kommission 5/2
• Bericht des Ministeriums des Innern liegt vor
Kernaussage: Vielfach wird Einwohnerzahl von 5 000 wieder unter-
schritten. „Erster Aufschlag“
Der demografische Wandel in Brandenburg 13• Stellungnahme StGB vom 2. März 2011 zum Entwurf
Entwurf stellt keine Evaluierung dar, keine Grundlage für
Vorbereitung weiterer Gebietsänderungen
Keine Untersuchung, ob Reformziele erreicht wurden
Gesetzgeber waren die sinkenden Einwohnerzahlen bekannt
(keine neue Entwicklung)
Bevölkerungsentwicklung 1990– 2010 / Bevölkerungsvorausschätzung bis 2030
Quelle: LBV, Bevölkerungsvorausschätzung 2011– 2030 Ämter und amtsfreie Gemeinden
Einwohnerdichte wird weiter abnehmen
Quelle: LBV, Bevölkerungsvorausschätzung 2011– 2030 Ämter und amtsfreie Gemeinden
14 Der demografische Wandel in BrandenburgBeispiel:
Bevölkerungsvorausschätzung für OPR 2011 – 2030
Quelle: LBV, Bevölkerungsvorausschätzung 2011– 2030 Ämter und amtsfreie Gemeinden
Der demografische Wandel in Brandenburg 15Vorausschätzung
der Einwohnerzahlen
der Ämter und amts-
freien Gemeinden
Vorausschätzung eServices können Entfernungen überbrücken
der Einwohnerzahlen • Sicherung bisheriger Angebote
der Ämter und amts- Öffentliche Verwaltung. Beispiele: Steuererklärung ELSTER, Mobiler
freien Gemeinden Bürgerservice, Formularserver, Elektronische Melderegisterauskunft …
Wirtschaft. Beispiele: Onlineshopping, Onlinebanking …
• Schaffung neuer / qualifizierterer Angebote
Öffentliche Verwaltung. Beispiele: Umsetzung EU-Dienstleistungs-
richtlinie, MAERKER (elektronische Partizipation) …
Wirtschaft. Beispiele: Telearbeit, Onlineplattformen …
eServices können örtlich sichtbare Ansprechpartner nicht ersetzen
16 Der demografische Wandel in BrandenburgDeckungslücke im Landeshaushalt ca. 500 Mio. Euro Quelle: Landtag Brandenburg, Zwischenbericht EK 5/2, DS 5/6000, S. 43 Neue Diskussion über Gebietsstruktur Angestoßen von der SPD. Ihre Ziele: Effizienzsteigerung, Kostensenkung Diskussionspapier Brandenburg 2030: „Die kommunale Daseinsvorsorge ist auf Gemeindeebene – auch in sehr dünn besiedelten Gebieten – langfristig gesichert. Die Städte, Gemeinden und Ämter haben im Jahr 2030 in der Regel mindestens 12 000 Einwohner.“ ➙ Fläche von 400 bis 600 Quadratkilometern Jetzt auch Vorschlag aus SGK
Landtag Brandenburg: Enquete-Kommission „Kommunal- und Landesverwaltung –
bürgernah, effektiv und zukunftsfest – Brandenburg 2020“
Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen (DS 5/2952)
Angenommen am 23. März 2011(DS 5/2952-B)
Vorsitzender: Stefan Ludwig (LINKE) / Stellvertreter: Sven Petke (CDU)
7 Mitglieder, 7 Sachverständige
Einsetzungsbeschluss
1. Die Ergebnisse der Ämterreform 1992, der Kreisgebietsreform 1993 und der Gemeindegebiets-
reform des Jahres 2003 sind zu prüfen und unter dem Aspekt der Zukunftsfähigkeit in einer zusam-
menfassenden Bewertung darzustellen. Dabei sind die Erfahrungen anderer Länder, insbesondere
der Reformen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zu berücksichtigen. Die
Leistungsfähigkeit, Strukturen und Größen der kommunalen Verwaltungseinheiten sind vor dem
Hintergrund des Bevölkerungsrückgangs zu bewerten.
2. Die derzeitige vertikale und horizontale Aufgabenverteilung zwischen Land, Landkreisen und Kom-
munen und die dabei eingesetzten Personal- und Finanzmittel sind systematisch zu erfassen und vor
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und den sich ändernden finanziellen Rahmenbe-
dingungen zu bewerten. Zur Sicherung der Daseinsvorsorge sind die Leistungen kritisch zu beurteilen.
3. Die Struktur der Aufgabenverteilung auf allen Ebenen ist kritisch zu bewerten. Es ist zu überprü-
fen, an welcher Stelle diese Aufgaben bürgerfreundlich, am effizientesten und kostengünstigsten
erbracht werden können und ob auf Ebene der Landesbehörden neue Zusammenarbeitsmodelle
mit anderen Ländern gefunden werden können. Die Vorschläge dürfen einer möglichen Länderneu-
gliederung nicht im Wege stehen.
4. Es sollen Vorschläge unterbreitet werden, in denen die Qualität und der Umfang kommunaler
Kooperationen durch geeignete Maßnahmen einschließlich Änderungen gesetzlicher Regelungen
befördert werden kann und in welchem Verhältnis Kooperationen und Fusionen zueinander stehen.
5. Bei der Betrachtung von Neustrukturierungen der Verwaltungseinheiten ist auch die Frage zu
untersuchen, ob die Ämter im Land Brandenburg vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung
in anderen Ländern umgestaltet oder nach den Erfahrungen anderer Flächenländer neu konzipiert
werden müssen.
6. Die Enquetekommission soll ausgehend von den Analyseergebnissen dem Landtag verschiedene
Modellvarianten einschließlich Mindestgrößen für eine mögliche Neu- bzw. Umstrukturierung der
Gebietskörperschaften im Land Brandenburg vorlegen, die den sich verändernden finanziellen und
demographischen Bedingungen Rechnung tragen. Die modifizierten Verwaltungsstrukturen sollen
flexible und zukunftsfeste Elemente beinhalten, um auf künftige demographische Entwicklungen
reagieren zu können. Grundlage für eine Gebietsreform ist eine Funktionalreform. Die Entwicklungen
und Reformen in anderen Ländern sollen dabei vergleichend herangezogen werden.
18 Der demografische Wandel in BrandenburgEnquete-Kommission • Zwischenbericht jetzt vorgelegt (DS 5/6000)
• Keine belastbare Evaluierung der Ergebnisse der Reform
1998 / 2003.
• Ämtermodell hat sich neben der Einheitsgemeinde, insbeson-
dere im ländlichen Raum, grundsätzlich bewährt (S. 20).
• Abschlussbericht 2. Quartal 2013
Neuordnung der • Spezielle Arbeitsgruppe „Aufgabenerfassung“
Aufgabenverteilung • Soll Kommunalisierbarkeit von Landesaufgaben systematisch
im Land prüfen und Kommission Vorschläge unterbreiten.
• Soll auch prüfen, welche Kreisaufgaben auf amtsfreie
Gemeinden und Ämter übertragen werden können und
Vorschläge unterbreiten.
• Grundlage möglicher Reformen
1. Welche Aufgaben sollen die Kommunen zukünftig
(zusätzlich) übernehmen – Funktionalreform!
2. Daraus Struktur ableiten
3. Finanzausgleich anpassen
Interkommunale • Kooperationen
Kooperation • Kernbereich der Selbstverwaltung
ausbauen • Beispiele: Kommunaler Versorgungsverband, Kommunale
Studieninstitute, Kommunaler Arbeitgeberverband (Rechtsschutz),
Leitstellen Rettungsdienst, Sparkassen, Gemeinsame Standesämter,
Gemeinsame Vollstreckungsstellen, ÖPNV
• Kooperationen ausbauen
• Information, Beratung und Erfahrungsaustausch derzeit am
wichtigsten
• Bislang noch keine Bündelungsstelle in Landesregierung
• Daneben rechtliche Hemmnisse abbauen
StGB: Umfassender
Ansatz erforderlich
Der demografische Wandel in Brandenburg 19Ausblick: • Ämter und amtsfreie Gemeinden
Gemeinden Eingangstor zur Verwaltung fortentwickeln
zum Eingangstor • Vergleich mit Aufgaben, die bereits erfüllt werden:
fortentwickeln Gewerberecht, Ordnungsrecht, Personenstandsrecht,
Melderecht
• Elektronische Verwaltung aktiver nutzen
• z. B. Amt Schlieben (ca. 5 800 EW)
• Wohngeldstelle: Zentrale Auszahlung, dezentrale Berechnung
• straßenverkehrsrechtliche Anordnungen: Verbindung zu
Aufgaben als Straßenbaulastträger
Weitere www.stgb-brandenburg.de
Informationen: mit Infothek Verwaltungsstrukturreform im Land Brandenburg
20 Der demografische Wandel in BrandenburgPodiumsdiskussion
Zukunftsvision Brandenburg 2020
Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem
Zwischenbericht der Enquete-Kommission
des Landtages Brandenburg
Teilnehmende:
Ines Hübner (Bürgermeisterin Stadt Velten)
Karl-Ludwig Böttcher (Geschäftsführer Städte- und Gemeindebund Brandenburg)
Stefan Ludwig (MdL Brandenburg, Vorsitzender der Enquete-Kommission)
Ansgar Gusy (Geschäftsführer des Vereins für grün-bürgerbewegte Kommunalpolitik Brandenburg)
Moderation: Werner Roepke
Notwendigkeit Ines Hübner:
der Reform und „Die finanziellen Probleme der Kommunen entstehen durch Wegfall
Instrumente von Förderprogrammen sowie durch Rückzug des Landes aus der
Finanzierung, damit haben die Kommunen keine auskömmliche
Finanzierung mehr.”
„Die Frage ist: wer kann die Aufgaben am besten erledigen?”
„Dienstleistungen sollen für den Bürger in größtmöglicher Nähe
erbracht werden.”
„Mitarbeiter/innen der Verwaltungen und Bürger in den
Diskussionsprozess einbeziehen.”
„Instrument Bürgerbeteiligung ernst nehmen.”
„In den Verwaltungen steht schon jetzt nur eine Mindestausstattung
an Personal zur Verfügung.”
„Qualitätsfrage, Front- und Backoffice, Spezialisierung”
Stefan Ludwig:
„Es gibt noch keine Entscheidungen, die Entscheidungsläufe
beginnen jetzt.”
„Der Reformbedarf bei der Finanzierung Landkreise / Land / Gemeinden
ist unbestritten.”
„Die unterschiedliche Entwicklung der Regionen bis 2020 ist bereits
jetzt deutlich sichtbar.“
Der demografische Wandel in Brandenburg 21„Es wird ,Absiedlungen’ wegen der schlechten Verkehrsanbindung
geben.”
„Reform der Verwaltungen ist notwendig: es gibt die Idee der
,Verbandsgemeinden’.”
„Die kommunale Selbstverwaltung soll beibehalten werden.”
„Reformprozesse von unten beginnen!”
Wie sieht Ansgar Gusy:
Brandenburg „Die Kommunalverwaltungen müssen effizient sein. Die Frage ist: was
2020 aus? kann effizienter gestaltet werden?”
„Ein Vergleich der Personalausgaben (z. B. mit Sachsen) muss erfolgen.”
„Die Doppik bringt erst in 5 bis 10 Jahren brauchbare Ergebnisse.”
Gemeinwohl vs. „Der Anspruch besteht, alle Leute im Prozess mitzunehmen.”
Individualrecht „Datentransparenz ist unabdingbar.”
Bürgerbeteiligung „Die Unterrichtungspflicht der Politik gegenüber den Bürgerinnen und
Bürgern muss besser erfüllt werden.”
Unter welchen K.-L.Böttcher:
Voraussetzungen „Der wesentlicher Mangel ist, dass bisher keine belastbare Evaluation
hätten Sie dem der vorangegangenen Reformen vorgenommen wurde.”
Zwischenbericht der „Die Berücksichtigung wirtschaftswissenschaftlicher Gutachten
Enquetekommission wäre dringend notwendig.”
zugestimmt? „Es gibt die Erwartung eines guten Endberichts, dessen Ergebnisse
auch umgesetzt werden.”
„Die Beteiligung und Zustimmung der Personalräte ist dringend
geboten.”
Fragen und • Tarifverträge zum Personalabbau/Reformprozess abschließen!
Forderungen aus • Personalräte einbeziehen! Beschäftigte gewinnen sich
dem Plenum einzubringen!
• Sozialverträglichen Abbau gestalten (Bsp. TV Umbau)
• Wie kann man Anreize schaffen: Problematik Eingruppierung
z. B. Front-Office?
… und Antworten „Eine soziale Abfederung ist notwendig, der KAV ist dafür
aus dem Podium Ansprechpartner.” … „In Königs Wusterhausen wurden alle
dazu Möglichkeiten des TVÖD ausgeschöpft und bessere Bezahlung
Beschäftigte im Frontoffice erreicht.” … „Die Motivation der
Beschäftigten wird schwieriger wegen der sich verschlechternden
Arbeitsbedingungen.“ (S. Ludwig)
22 Der demografische Wandel in Brandenburg„Die Themen Motivation, Qualifizierung und Bezahlung müssen angegangen werden!” … „Der Umstrukturierungsprozess muss insgesamt beschleunigt werden: 2017 ist es zu spät.” (I. Hübner) „Die Einnahmeseite der Kommunen muss verbessert werden u. a. durch Erhalt der Gewerbesteuer, da diese eine verlässliche Einnahmequelle für die Kommunen ist.” … „Was soll ein Tarifvertrag zum Reformprozess versprechen? Das Geld wird auf jeden Fall weniger, keine leeren Versprechungen machen!” … „Die Attraktivität der Verwaltung erhöhen.” (A. Gusy) „Die Personalräte und Beschäftigten mit ins Boot holen und jetzt in den Diskussionsprozess in der Enquetekommission einbeziehen.” … „Die Kommunalfinanzen erhöhen durch erneuerbare Energien (Windparks), dafür Einführung einer Ertrags- und Gewerbesteuer” … „Den Skandal Leiharbeit und Teilzeitstellen / befristete Arbeit endlich beenden.” Wer sagt das? sh Der demografische Wandel in Brandenburg 23
Beitrittserklärung
Ve r e i n t e D i e n s t l e i s t u n g s g e w e r k s c h a f t , Kö p e n i c ke r S t ra ß e 3 0 , 10 17 9 B e r l i n
Ich möchte Mitglied werden ab ________________ ■ Vollzeit Werber/in: Tätigkeits-/Berufsjahr
Monat/Jahr
■ Teilzeit ___________ Anzahl Wochenstd. Name
Persönliche Daten: ■ Arbeitslos Bruttoeinkommen
Name ■ Wehr-/Zivildienst bis ________________________________ Vorname
■ Azubi – Volontär/in – Referendar/in bis _________ Euro ________________________________________________________
Vorname Titel ■ Schüler/in – Student/in bis ________________________ Mitgliedsnummer
■ Praktikant/in bis _____________________________________ Monatsbeitrag
Straße/Hausnummer ■ Altersteilzeit bis ______________________________________
■ Sonstiges ______________________________________________
Einzugsermächtigung: Euro ________________________________________________________
PLZ Wohnort
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft, den Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-
Beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale) jeweiligen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Satzung pro Monat 1 Prozent des regelmäßigen
Land (nur bei Wohnsitz im Ausland) Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren bzw. monatlichen Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen,
im Gehalts-/Lohnabzug Pensionär/innen, Vorruheständler/innen, Kranken-
Straße/Hausnummer
■ monatlich ■ vierteljährlich geldbezieher/innen und Erwerbslose beträgt der
Telefon (privat /dienstlich) Monatsbeitrag 0,5 Prozent des regelmäßigen Brutto-
■ halbjährlich ■ jährlich einzuziehen.
einkommens. Der Mindestbeitrag beträgt 2,50 Euro
PLZ Ort
monatlich. Für Hausfrauen/Hausmänner, Schüler/innen,
Name des Geldinstituts, in Filiale
E-Mail Studierende, Wehr-, Zivildienstleistende, Erziehungs-
Personalnummer geldempfänger/innen und Sozialhilfempfänger/innen
Bankleitzahl Kontonummer beträgt der Beitrag 2,50 Euro monatlich. Jedem
Geburtsdatum Krankenkasse Mitglied steht es frei, höhere Beiträge zu zahlen.
Branche ausgeübte Tätigkeit
Name des Kontoinhabers Datum Unterschrift
Nationalität
■ Ich bin Meister/in – Techniker/in – Ingenieur/in Datum / Unterschrift des Kontoinhabers
Geschlecht ■ weiblich ■ männlich
Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten im
Tarifvertrag Rahmen der Zweckbestimmung des Mitgliedsverhält-
Beschäftigungsdaten: Ich war Mitglied der Gewerkschaft __________________ nisses und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer
■ Arbeiter/in ■ Angestellte/r Aufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt
■ Beamter/in ■ DO-Angestellte/r von: _______________ bis: _____________________ Tarifliche Lohn- bzw. Gehaltsgruppe werden. Ergänzend gelten die Regelungen des
■ Selbstständige/r ■ freie/r Mitarbeiter/in Monat/Jahr Monat/Jahr lt. Tarifvertrag ____________________________________________ Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.Sie können auch lesen