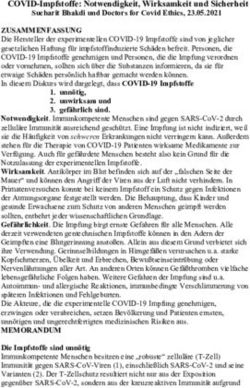Der kultivierte Affe Philosophie, Geschichte und Gegenwart - Hans Werner Ingensiep
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhalt
1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 Von der Antike zur Renaissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Heraklit: der Mensch zwischen Affe und Gott . . . . . . . . . . . . . . . 15
Die ersten Menschenaffen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Aristoteles: der Affe zwischen Mensch und Vierfüßler . . . . . . . 18
Plinius und antike Hinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mittelalter: der allegorische Affe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Renaissance: humanistische Affenkunde bei Gesner . . . . . . . . . 29
3 Neue Entdeckungen – Monster, Satyr, Pygmy . . . . . . . . . . . 33
Die Ungeheuer des Andrew Battel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Der indische Satyr des Nicolaes Tulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Rezeption der ersten Illustration von Menschenaffen . . . . . . . . . 42
Ferne Kunde – Bontius und Dapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Der Pygmy des Edward Tyson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Philosophische Seitenblicke im 17. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . 51
Tierautomaten und Affen im Cartesianismus . . . . . . . . . . . . 52
Über Mensch, Tier, Identität und Person –
Locke und Leibniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4 Der aufgeklärte Menschenaffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Die Naturhistoriker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Scheuchzer – der Menschenaffe in der Bibel . . . . . . . . . . . . . 61
Linné – Anthropomorpha im System . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Buffon – Naturgeschichte der Affen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Die Philosophen und die Menschenaffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
La Mettrie – der Mensch eine Maschine, und der Affe? . . . 70
Rousseau – als Affe unter guten Wilden . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Wieland – Kritik an Rousseaus Affendeutung . . . . . . . . . . . 76
Menschenaffen wild und mild im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Rousseaus „Thiermensch“ kommt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Bonnet – der höchste Affe in der natürlichen Stufenleiter . 83
Le Cat – ein Forscher über Waldmenschen . . . . . . . . . . . . . . 85
Monboddo – der Orang als sprachloser Mensch . . . . . . . . . 90
Naturgeschichte und Affenliteratur für Bildungsbürger . . . . . . . 92
Inhalt 55 Der abgeklärte Menschenaffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Die „Ourangoutang-Sache“ – Vosmaer und Forster . . . . . . . . . . 96
Vosmaer – ein Forscher beobachtet einen lebenden Orang . . . . 99
Haag – ein Maler inszeniert einen Orang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Camper – der abgeklärte Orang unter dem Messer
des Anatomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Der abgeklärte Orang bei deutschen Philosophen . . . . . . . . . . . 109
Herder – der Orang im Visier der Ideen . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Kant – der Orang am Rand der Vernunftanthropologie . . . 115
Der Orang in der Naturgeschichte am Ende
des 18. Jahrhunderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6 Menschenaffen vor und nach Darwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Menschenaffen in der Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Menschenaffen in der Naturgeschichte und im System . . . . . . . 128
Der Aufstieg der Menschenaffen auf die Bäume . . . . . . . . . . . . . 135
Idealistische Naturphilosophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Schopenhauer und der Intellekt im Dienst des Willens . . . . . . . 141
Evolution vor Darwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Mensch und Menschenaffen nach Darwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Die doppelte Anthropozentrik – Büchner & Co. . . . . . . . . . . . . . 146
Der Affe als politischer Handwerker – Engels . . . . . . . . . . . . . . . 149
Kulturkritik mit Affen – Nietzsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Naturbilder im Rückblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
7 Gorillas zwischen Bestialisierung und Humanisierung . . 155
Vom Skelett zur Gruppenidylle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Von aggressiven Gesten zur Bestialisierung nach Darwin . . . . . 161
Die Berichte des Afrikareisenden Paul Belloni Du Chaillu . 161
Die Rolle des Darwinismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Ein junger Aristokrat am Anfang der Humanisierung . . . . . . . . 169
Gigant Bobby als Publikumsliebling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Goma – Familienbeziehungen zwischen Gorilla und Mensch . 176
Am vorläufigen Ende der „Gorilla Story“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
8 Schimpansen auf dem Weg zu Intelligenz und Kreativität . . 181
Wolfgang Köhler: Einsichten auf Teneriffa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Vorstudien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Zugang und Interessen Köhlers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
6 InhaltErgebnisse und Hintergründe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Mit Stöcken und Kisten,
aber ohne Anthropomorphismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Orang-Studien eines Schimpansoiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Nachwirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Philosophische Anthropologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Max Scheler: Technische Intelligenz ja,
aber Weltoffenheit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Helmuth Plessner: Affen-Intelligenz ja, aber ein Sinn
fürs Negative? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Arnold Gehlen: „Intelligenz“ ja, aber ohne
Handlungsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Kulturphilosophie – Rothacker, Klages, Schweitzer . . . . . . . 210
Von Menschen zum Malen angestiftete Affen . . . . . . . . . . . . . . . 214
Congo – ein Schimpanse macht Kunstgeschichte . . . . . . . . . . . . 220
„Apestract“ – kreative Menschenaffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
9 Sind Menschenaffen Personen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Vom Individuum zur Persönlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Von der Persönlichkeit zur psychologischen Person –
Washoe, Kanzi, Koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Kritik und methodologische Vorsicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Der kultivierte Menschenaffe als moralische Person? . . . . . . . . . 236
10 Anthropomorphologie, Anthropologie und
Primatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Rückblick auf die Ursprünge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Aufklärung, Mythos und Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Im Bann des Anthropomorphismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Sind Entmythologisierung und Entanthropomorphisierung
möglich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Naturbilder im Hintergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Eurozentrismus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Geschlechterstereotypien? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Primatologie zwischen Scylla und Charybdis . . . . . . . . . . . . . . . 254
Erklären und Verstehen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Anthropomorphismus und Anthropozentrismus . . . . . . . . . . . . 271
Ein Ausblick im Rückblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Inhalt 7Farbtafeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Nachwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Bildverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Namensregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Sachregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
8 InhaltSchimpansen auf dem Weg zu Intelligenz
und Kreativität
„Die Schimpansen zeigen einsichtiges Verhalten von der Art des beim
8
Menschen bekannten.“
(Wolfgang Köhler, Intelligenzprüfungen, 1917)
„Dem intelligentesten Lebewesen in der Tierreihe,
dem menschenähnlichsten, fehlt der Sinn für’s Negative.“
(Helmuth Plessner, Stufen, 1928)
Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Menschenaffen. Nie zuvor er-
hielten sie so viel Aufmerksamkeit, da sie mit immer neuen, bislang dem
Menschen vorbehaltenen Fähigkeiten aufwarteten. In dem Maße in dem
klassische Differenzen zwischen Mensch und Menschenaffen biologisch ab-
gebaut, geistig überwunden oder uninteressant werden – aufrechter Gang,
intelligenter Werkzeuggebrauch, künstlerische Kreativität, expressive und so-
ziale Fähigkeiten wie Lachen, Weinen, Kooperation und Kommunikation –
werden von philosophischer Seite neue Hürden errichtet. So werden die
Primatologen zu einem endlosen Hürdenlauf von den essentialistischen
Fragen angetrieben, die Philosophen in Bezug auf das Wesen der Spezies
Homo s apiens sapiens aufwerfen.
Der komplexe Prozess der Kultivierung von Menschenaffen im 20. Jahr-
hundert erfolgt in drei Episoden in unterschiedlichen Epochen: 1. Im Um-
gang mit der Intelligenzfrage seit den 1920er Jahren nach Köhlers Untersu-
chungen mit Schimpansen, durch den die „Philosophische Anthropologie“,
in Deutschland vertreten durch Max Scheler, Helmuth Plessner und Ar-
nold Gehlen, sich herausgefordert sieht, die Sonderstellung des Menschen
durch feinsinnige Bestimmungen zu zementieren. 2. In den 50er Jahren
werden malende Menschenaffen wie der Schimpanse „Congo“ zur Sensa
tion und um 1960 nach Untersuchungen von Morris mit Schimpansen auf
ihre Kreativität geprüft. 3. Im Umgang mit Fragen zur Kommunikation und
„Sprache“ bei Menschenaffen, nachdem Schimpansen um 1970 bei den
Gardners lernten, sich mittels einer Taubstummensprache zu artikulieren.
Dies wiederum spornt Philosophen der Wissenschaft, der Sprache oder des
Geistes an, die Interspezies-Kommunikation zwischen Mensch und Men-
schenaffe einer kritischen Prüfung zu unterziehen, während die Primatolo-
gin Francine Patterson auf Grundlage der Kommunikationserfahrung die
Schimpansen auf dem Weg zu Intelligenz und Kreativität 181Forderung nach Anerkennung der Menschenaffen als Personen erhebt
(Kap. 9).
Intelligenz, Kreativität, Kommunikation, Personalität – stets schwebt der
Verdacht des Klugen-Hans-Effektes über den Leistungen der Menschenaffen.
Der Kluge Hans war ein Berliner Droschkenpferd, das kurz nach 1900 die
Welt durch vermeintlich intelligente Leistungen wie Kopfrechnen und Klopf-
sprechen in Erstaunen versetzte (Baranzke 2001). Die scheinbare Pferdeintel-
ligenz stellte sich jedoch als Artefakt einer unbewussten Feindressur und
als Produkt eines durch den Versuchsleiter induzierten Erwartungseffekts
heraus und führte 1907 zur Entdeckung des „Klugen-Hans-Fehlers“ durch
den Mitarbeiter des Begründers der Gestaltpsychologie Carl Stumpf, Oskar
Pfungst (1874–1932). Dieses klassische Werk von Oskar Pfungst Das Pferd
des Herrn von Osten. (Der kluge Hans). Ein Beitrag zur experimentellen Tier-
und Menschen-Psychologie (Leipzig 1907) ist bis heute aktuell (Reprint 1983).
Fortan wurde versucht, den Kluger-Hans-Fehler methodisch auszuschließen,
im Lauf der Verhaltensforschung u. a. durch die Trennung von Versuchsleiter
und Versuchstier und das Arrangement sogenannter Kaspar-Hauser-Versu-
che.
Die Versuche Wolfgang Köhlers waren ein Meilenstein in der Menschen-
affenforschung. Wie kam es zu seiner Primatenstation auf Teneriffa? Die
Samson-Stiftung forderte die Preußische Akademie der Wissenschaften auf,
die „wissenschaftlichen Forschungen und Untersuchungen über die natürli-
chen, biologischen Grundlagen der Moral, der individuellen sowohl wie der
sozialen, zu ermöglichen oder zu fördern“ (Zentr. Archiv der Akad. der Wis-
senschaften der DDR-II-XIII Z-Bd. 1, Blatt 23–25, zit. n. Lück 1987, 171). Vor
diesem Hintergrund beabsichtigte Akademiemitglied Stumpf, seinen Mitar-
beiter und Entzauberer des Klugen Hans, Oskar Pfungst, auf eine Anthropo-
idenstation auf Teneriffa zu schicken. Da dieser jedoch ablehnte, übernahm
schließlich Stumpfs Schüler und ab 1922 auch Nachfolger auf dem Direkto-
renstuhl des Berliner Psychologischen Instituts, Wolfgang Köhler, diese Auf-
gabe, um dort erste systematische und seriöse Prüfungen von „Intelligenz-
leistungen“ bei Anthropoiden vorzunehmen. Erster Leiter der Station war
aber Eugen Teuber, ein Mitarbeiter des Mediziners Max Rothmann, der 1912
vorschlug, neurologische Untersuchungen an Affen durch psychologische zu
ergänzen. Teuber reiste Ende Dezember 1912 nach Teneriffa und pachtete im
Norden der Insel, südöstlich von Puerto de la Cruz, für sieben Jahre das Ge-
lände einer Bananenpflanzung (Lück 1987, 170 f.). Was im Detail auf dieser
ersten deutschen Primatenstation geschah und welche Rolle die Akteure
spielen, ist aufschlussreich und prägt die Folgezeit.
182 Schimpansen auf dem Weg zu Intelligenz und KreativitätWolfgang Köhler: Einsichten auf Teneriffa
Unter dem Eindruck der „Klugen Hans“-Episode, d. h. angesichts der peinli-
chen Erfahrungen von Selbsttäuschung und anthropomorphen Fehlinterpre-
tationen tierischen Verhaltens, beginnt die moderne Tierpsychologie und
Primatenforschung mit möglichst seriösen Methoden und Interpretationen,
möglichst frei von Anthropomorphismen. Auf dem Weg vom Klugen Hans
zum Klugen Affen dokumentieren und interpretieren Wolfgang Köhlers
(1887–1967) Intelligenzprüfungen an Anthropoiden (Berlin 1917) für die wis-
senschaftliche Gemeinschaft konkrete Intelligenzleistungen bei Schimpan-
sen, die wiederum Anstöße für weitere Experimente und auch philosophi-
sche Diskussionen geben. Schimpansen wie „Sultan“, die praktisch-technische
Intelligenz zeigen, regen traditionelle Philosophen zur Reflexion an und die
neu erstarkende Philosophische Anthropologie ergreift die Gelegenheit, das
Profil des Menschen im Affenvergleich zu schärfen. Diese Untersuchungen
werden nicht nur ablehnend und skeptisch, sondern auch neugierig und
wohlwollend aufgenommen. Doch dienen kritische Differenzierungen vor-
nehmlich dazu, eine „Sonderstellung“ des Menschen zu belegen. Köhlers
Untersuchungen in den Jahren von 1914 bis 1920 auf der Anthropoidensta
tion in Teneriffa sind bis heute paradigmatisch für zoologische Verhaltens-
forschung, aber das neue Bild von Menschenaffen berührt auch die junge
Forschungsrichtung der Gestaltpsychologie (Lück 1987; Schurig 1987). Wie
begann es und was waren die Ziele und Interessen in diesem berühmten pri-
matologischen Forschungsprojekt?
Vorstudien
Bereits vor Köhlers Ankunft formulieren die Forscher Max Rothmann und
E. Teuber Intentionen, Ziele und Aufgaben für die neue Primatenstation auf
Teneriffa; sie machen auch erste Beobachtungen zu Schimpansen (Roth-
mann/Teuber 1915). Die experimentelle Hirnphysiologie und die evolutio-
näre Nähe von Menschenaffen zu Menschen geben den Hauptanstoß, ab
1912 auf der Insel Teneriffa unter den dortigen, für Schimpansen guten kli-
matischen Bedingungen zu forschen. Von Anfang an sollen Methoden ver-
mieden werden, die in früheren Beobachtungen und Experimenten der
„Tierpsychologie“ durch „Dressur“ induzierte Höchstleistungen ähnlich ei-
nem menschlichen Gehirn hervorbringen, „da doch Pferde und Hunde so
Hervorragendes leisten könnten“ – eine solche Methodik wird entschieden
abgelehnt. Vielmehr solle es um die Erfassung der „Eigenleistungen“ der Tie-
re gehen, auf einem besonderen, ihnen zuträglichen, freien, mit einem Draht-
Wolfgang Köhler: Einsichten auf Teneriffa 183netz überdachten Gelände (Rothmann/Teuber 1915, 5). „Die Tiere haben so
das Gefühl völliger Freiheit, können aber nicht entweichen.“ Sieben Schim-
pansen werden „frisch gefangen“; der erste namens „Konsul“ stammt aus
Südnigeria; die anderen kommen aus Kamerun, darunter sechs fünf- bis
sechsjährige schwarzgesichtige Schimpansen (1915, 6). Das zweite Männ-
chen namens „Sultan“ gilt schon damals als das intelligenteste Individuum.
Dem Bericht nach waren sie anfangs durch den langen Aufenthalt in en-
gen Kisten sehr „eingeschüchtert“, überwanden dann aber im Freigehege ihre
„Ängstlichkeit“ und zeigten nun eine Neigung zur „Herdenbildung“. Zur
Überraschung der Beobachter zeigte sich auch, „daß sie sehr häufig ganz
spontan den aufrechten Gang einnahmen“ (1915, 8). Sogar Spiele und „Tän-
ze“ mit sexueller Bedeutung wurden bei „Sultan“ beobachtet, ferner „Wort-
verständnis“ und auch schon ein spezifischer Werkzeuggebrauch, nämlich
das Vermögen Sultans, mit einem Stock eine ihm sonst nicht erreichbare Ba-
nane heranzuholen (1915, 15).
Zukunftsziele der Station waren die Fortpflanzung der Schimpansen und
weitere vergleichende Untersuchungen zu Lebensgewohnheiten und Aus-
drucksbewegungen mit Orangs und Gorillas vorzunehmen (1915, 18). Aus-
drücklich wird in diesen Vorstudien den beobachteten Menschenaffen schon
„Weinen“ und „Lachen“ im Minenspiel zugestanden, nicht aber eine eigentli-
che „Sprache“ in dem Sinn, wie es früher schon Garner (1900) behauptet
hatte (Rothmann/Teuber 1915, 14). Bereits in diesen Vorstudien werden also
wichtige Impulse und Aspekte angesprochen, die später Köhler zugeschrie-
ben werden, wie z. B. Werkzeuggebrauch bei Schimpansen.
Zugang und Interessen Köhlers
Was und wie untersuchte Köhler? In seiner ersten Einzelstudie auf Teneriffa
befasst sich Köhler mit optischen Untersuchungen, vor allem mit dem Schim-
pansen „Sultan“ und mit Hühnern (Köhler 1915). Es ging ihm zunächst um
die Feststellung ihrer Fähigkeiten zum binokularen räumlichen Sehen und
zum Farbensehen, die als Hauptergebnis erbrachte, dass der Schimpanse wie
der Mensch Oberflächenfarben sehen könne. Solchen gestaltpsychologischen
Fragen galt Köhlers besonderes Interesse. Bei diesen Voruntersuchungen mit
„Sultan“ zum Wahlverhalten mit Früchten legt Köhler besonderen Wert
darauf, Methoden zu finden, um die Abhängigkeit der Wahl von jeglicher
Zeichengebung durch den Versuchsleiter auszuschalten. Das erscheint
Köhler seit der Pfungst-Prüfung des „Klugen Hans“ unbedingt notwendig,
um während der Studien eine wissenschaftliche Tierdressur bei der Wahl zu
verhindern (Köhler 1915, 28 ff.). Das Aufmerksamkeitsverhalten der Schim-
184 Schimpansen auf dem Weg zu Intelligenz und Kreativitätpansen sollte nicht auf den Versuchsleiter, sondern ganz auf die Wahlobjekte
gelenkt werden, z. B. durch eine „neutrale Gesichts- und Körperhaltung“ des
Experimentators. Sein Rückzug auf eine neutrale Beobachterperspektive soll-
te ein Höchstmaß an Wissenschaftlichkeit verbürgen.
„Damit können wir uns beim Schimpansen durch unmittelbare Beob-
achtung gegen diese Fehlerquelle sichern, während das bei Tieren ande-
rer Blickart (dem Pferd z. B.) nicht in demselben Grade möglich sein
dürfte. […] Unser Verhalten bot ja hier, wo Erfolg und Misserfolg bei der
Wahl allein wirkten und wir neutrale Beobachter waren, viel weniger
Anlaß, uns zu beachten, als in jenen Versuchen mit Sultan.“ (Köhler
1915, 30)
Ergebnisse und Hintergründe
Köhlers klassische Intelligenzprüfungen umfassen Untersuchungen zum
Verhalten mit Umwegen oder zur Nachahmung, vor allem aber zum Werk-
zeuggebrauch und zur Werkzeugherstellung durch Schimpansen. Die Ergeb-
nisse werden erstmals in dem viel zitierten Werk Intelligenzprüfungen an An-
thropoiden. I (Köhler 1917) publiziert, worin auch die später weltberühmten
fotografischen Dokumentationen zu finden sind (Abb. 15). Köhlers Kern-
konzept war, Schimpansen mehrere Hindernisse in den Weg zu setzen, bevor
sie ihr primäres Triebziel, z. B. eine Banane, erreichen konnten. Also mussten
sie fortlaufend Mittel herbeischaffen, wie Kisten oder Stöcke, um dieses
Triebziel zu erreichen und so das „Problem“ zu lösen. Aus seinen Ergebnissen
zieht Köhler folgende allgemeine Schlüsse:
„Die Schimpansen zeigen einsichtiges Verhalten von der Art des beim
Menschen bekannten. […] Dieser Anthropoide tritt nicht nur allein mit
allerhand morphologischen und im engeren Sinne physiologischen Mo-
menten aus dem übrigen Tiersystem heraus und in die Nähe der Men-
schenrassen, er weist auch jene Verhaltensform auf, die als spezifisch
menschlich gilt. […] Soweit stimmen die Beobachtungen gut zu den
Erfordernissen entwicklungsgeschichtlicher Theorien; insbesondere be-
stätigt sich die Korrelation von Intelligenz und Gehirnentwicklung.“
(Köhler 1917, 209 f.)
Köhlers Untersuchungen richteten sich gegen die Auffassung des Psycho
logen Thorndike, dass sogenannte Intelligenzleistungen bei Affen rein
assoziativ erlernt würden, ja, dass daher gar keine eigentliche „Einsicht“ der
Individuen in die Gesamtsituation vorliege. Daher legt Köhler auf die Über-
Wolfgang Köhler: Einsichten auf Teneriffa 185Sie können auch lesen