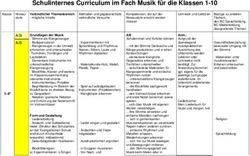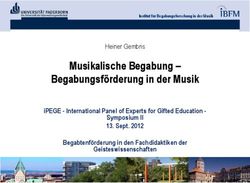Die Fachsicht Musik in der DigiBib NRW Entwicklung einer Virtuellen Bibliothek Musik f r die nordrhein-westf lischen Musikhochschulbibliotheken
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Die Fachsicht Musik in der DigiBib NRW
Entwicklung einer Virtuellen Bibliothek Musik
für die nordrhein-westfälischen Musikhochschulbibliotheken
Diplomarbeit
an der
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)
Fachbereich Buch und Museum
Studiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft
vorgelegt von
Kristina Richts
Leipzig 2006Richts, Kristina: Die Fachsicht Musik in der DigiBib NRW : Entwicklung einer Virtuellen Bibliothek Musik für die nordrhein-westfälischen Musikhochschulbibliotheken / Kristina Richts. – 2006. - 70, XXIV Bl. : Ill. Leipzig, Hochsch. für Technik, Wirtschaft und Kultur (FH), Diplomarbeit, 2006 Kurzreferat Die Arbeit befasst sich mit dem musikbezogenen Linkbereich der Digitalen Bibliothek (DigiBib), der sogenannten „Fachsicht Musik“, welche im Auskunftsdienst der drei Musik- hochschulbibliotheken in Detmold, Essen und Köln eine besondere Rolle spielt. Da sich herausgestellt hat, dass eine umfassende Pflege des Angebotes nicht von allen drei Standorten aus gewährleistet werden kann, die Institutionen jedoch zum überwiegenden Teil heterogene Zielgruppen bedienen, soll künftig auf ein gemeinsames Angebot zurückgegriffen werden. Auf mehrheitlichen Beschluss hin werden Pflege und Aufbau des neuen Fachinformations- angebotes dabei vom Standort Detmold aus erfolgen. Das gegenwärtige Angebot weist zum Teil erhebliche Defizite in Struktur und Inhalten auf. Aus diesem Grunde setzt sich die Arbeit zum Ziel, das derzeitige Angebot vollständig zu überarbeiten und ein bedarfsgerechtes, nutzerorientiertes gemeinsames Informationsangebot zu erstellen. Es soll dabei vorrangig darum gehen, eine Grundlage für den künftigen Bestands- aufbau an Internetquellen zur Musik zu erarbeiten. Die Arbeit selbst stellt dabei zunächst das vom Hochschulbibliothekszentrum Köln erstellte Internet-Portal DigiBib einschließlich des für den kooperativen Bestandaufbau erforderlichen Linkverwaltungssystems DigiLink vor. Im Anschluss daran werden die drei Musikhochschu- len und ihre Bibliotheken kurz charakterisiert und die sich hieraus ergebenden besonderen Anforderungen an die Inhalte der Fachsicht Musik (http://digilink.digibib.net/cgi-bin/digi mod/show.pl?sigel=MUS) im Wesentlichen herausgestellt. Zudem ist die vorliegende Arbeit als Dokumentation des Aufbaus der neuen Fachsicht zu ver- stehen. Die Schwachpunkte des gegenwärtigen Angebotes werden gekennzeichnet, die Ziele des neuen Angebotes zusammengefasst sowie Gliederung, Auswahlkriterien und Beschreibung der Links umfassend dargestellt. Den Abschluss der Arbeit bildet eine kurze Benutzungs- anleitung für das neue Angebot.
3
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 4
1. Einleitung 5
2. Die Digitale Bibliothek (DigiBib) 9
2.1 Entwicklung und Funktionen des Internet-Portals 9
2.2 Das Linkverwaltungssystem DigiLink 13
3. Die Musikhochschulen Nordrhein-Westfalens und ihre Bibliotheken 17
3.1 Hochschule für Musik Detmold 17
3.2 Folkwang Hochschule Essen 19
3.3 Hochschule für Musik Köln 21
3.4 Die Hochschulbibliotheken als Teilnehmer der DigiBib 23
4. Die Fachsicht Musik in der DigiBib als Virtuelle Bibliothek Musik
für die Musikhochschulen Detmold, Essen und Köln 27
4.1 Kritik am gegenwärtigen Angebot 27
4.2 Anforderungen an die neue Fachsicht 36
4.3 Die Fachsicht Musik 39
4.3.1 Gliederung 39
4.3.2 Auswahl der Links 46
4.3.3 Beschreibungskriterien 52
4.3.4 Pflege der Linksammlung 56
4.4 Benutzungsanleitung 58
5. Resümee - Die neue Fachsicht im Auskunftsdienst 62
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS 64
SELBSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG
ANHANG 1: Gliederung der Fachsicht Musik I
ANHANG 2: Musterexemplar der entwickelten Benutzungsanleitung XXIV4 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: DigiBib – Metasuche 11 Abb. 2: Administrationsoberfläche 14 Abb. 3: Administrationsoberfläche – Kategorienverwaltung 14 Abb. 4: Anlegen eines Links – Schritt 1/3: Metadaten eintragen 15 Abb. 5: Fehlerbericht für 20060510 16 Abb. 6: Angehörigenstruktur HfM Detmold in % 18 Abb. 7: Angehörigenstruktur HfM Detmold 18 Abb. 8: Angehörigenstruktur Folkwang Hochschule Essen in % 20 Abb. 9: Angehörigenstruktur HfM Köln in % 22 Abb. 10: Übersicht der Fachsicht Musik, Standort HfM Detmold 28 Abb. 11: Kategorie „Popularmusik“ 29 Abb. 12: Einträge unterhalb der Übersicht der Fachsicht Musik 30 Abb. 13: Virtuelle Chormusik-Bibliothek Musica 32 Abb. 14: Kategorie „Verbände, Institutionen“ 33 Abb. 15 Kategorie „Musikinformationszentren“ 33 Abb. 16: Kategorie „Bibliographien, Bibliothekskataloge“ 34 Abb. 17: Kategorie „Musikal. Aufführungsstätten“ 35 Abb. 18: Übersicht der neuen Fachsicht Musik 39 Abb. 19: Kategorie „Bibliographische und Faktendatenbanken Musik“ 40 Abb. 20: Kategorie „Musikwirtschaft und Musikmarkt“ 42 Abb. 21: Kategorie „Musikepochen“ 43 Abb. 22: Kategorie „Musikalische Gattungen“ 43 Abb. 23: Kategorie „Interpreten“ 45 Abb. 24: Kategorie „Musikinformationszentren“ 49 Abb. 25: Kategorie „Musikpädagogik“ 51 Abb. 26: Kategorie „Oper“ 51 Abb. 27: Kategorie „Virtuelle Bibliotheken Musik” 53 Abb. 28: FabiO – Fachbibliographien und Online-Datenbanken : Musik 54 Abb. 29: Kategorie „Bibliothekskataloge“ 55 Abb. 30: Kategorie „Stellenmarkt” 56 Abb. 31: Benutzungsanleitung Fachsicht Musik – Innenseite 60 Abb. 32: Benutzungsanleitung Fachsicht Musik – Außenseite 61
1. Einleitung 5
1. Einleitung
Im Laufe der vergangenen Jahre haben die elektronischen Informationsmittel für den biblio-
thekarischen Auskunftsdienst erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Zahl existierender In-
ternetressourcen zum Themengebiet Musik ist dabei auch sehr hoch und äußerst vielfältig
ausgestaltet. Eine wesentliche Aufgabe der Bibliotheken besteht folglich darin, dem Nutzer1
eine Qualitätsauswahl geeigneter Informationsmittel für seine Recherche bereit zu stellen.
Die Erstellung entsprechender Serviceleistungen ist zwar zunächst zeitintensiv, doch „die biblio-
graphischen Angebote bieten der Bibliothek einen Zugang zu ungeahnter bibliographischer
Information, die Adressenverzeichnisse sind äußerst nützlich und der Fels in der Brandung des
Internetozeans." 2
Mittlerweile lässt sich eine Vielzahl digitaler Bibliotheksangebote nachweisen. Als einer der
Vorreiter der Entwicklung kann die Digitale Bibliothek (DigiBib) gelten, mit deren Entwick-
lung das Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen bereits im Jahre
1998 begann. Seit nunmehr sieben Jahren ist das Informations-Portal erfolgreich im Einsatz und
ermöglicht zahlreichen Teilnehmerbibliotheken die Nutzung verschiedener themenbezogener
Linksammlungen.
Auch drei der nordrhein-westfälischen Musikhochschulbibliotheken entschieden sich im
Laufe des Jahres 2004 für die Teilnahme an der Digitalen Bibliothek: die Bibliotheken der
Hochschule für Musik Detmold, der Folkwang Hochschule Essen sowie der Hochschule für
Musik Köln.3 Damit bieten sie ihren Nutzern die Möglichkeit, schnell und weitaus überwiegend
kostenlos auf freie und lizenzierte Angebote zu großen Bibliothekskatalogen und Literatur-
datenbanken aus aller Welt zugreifen zu können.
Die vorliegende Arbeit entstand auf Anregung von Claudia Stratemeier, der Bibliotheksleiterin
der Hochschule für Musik Detmold und befasst sich mit dem musikbezogenen Linkbereich
der Digitalen Bibliothek, der sogenannten „Fachsicht Musik“. Diese trägt wesentlich zur
1
Wegen der besseren Lesbarkeit wurde im folgenden Text darauf verzichtet, durchgängig die männliche und die
weibliche Bezeichnung von Personengruppen zu verwenden (z.B. Nutzerinnen und Nutzer). Grundsätzlich
haben deshalb die „männlichen“ Formen im Sinne der generischen Bedeutung für beide Geschlechter Geltung.
2
Silbernagel (1999), S. 152.
3
Die Robert Schumann Hochschule Düsseldorf ist als einzige nordrhein-westfälische Musikhochschule bislang
nicht Teilnehmer der Digitalen Bibliothek und findet aus diesem Grunde keine Berücksichtigung.1. Einleitung 6 Vermittlung von bibliographischen und Fakteninformationen zum Fachgebiet Musik bei und spielt deshalb im Auskunftsdienst der drei Musikhochschulbibliotheken eine besondere Rolle. Die regelmäßige Pflege solcher Linksammlungen erfordert großen Zeitaufwand und damit unmittelbar verbunden entsprechende personelle Kapazitäten, die gerade in kleineren Biblio- theken oftmals nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Die Beobachtungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine umfassende Pflege des Angebotes nicht von allen drei Standorten aus gewährleistet werden kann. Da die Nutzerkreise der drei Hochschulen zu großen Teilen homogen gestaltet sind, bietet sich der gemeinsame Bestandsaufbau an Internetquellen zur Musik geradezu an. So wurde im Jahre 2005 der mehrheitliche Beschluss gefasst, ein gemeinsames Angebot für die drei Standorte bereitzustellen, dessen Pflege und Aufbau vom Standort Detmold aus erfolgt. Die Hochschulbibliotheken in Essen und Köln werden sich nicht aktiv am Aufbau der Fachsicht beteiligen. Die zentrale Administration des Angebotes wird dabei vom Hochschulbibliothekszentrum (hbz) in Köln geleistet. Mit Hilfe des hier eigens für den Aufbau der DigiBib entwickelten Linkverwaltungssystems DigiLink besteht die Möglichkeit, den Bestandsaufbau von Inter- netressourcen und Datenbanken kooperativ zu gestalten. DigiLink fördert auf diese Weise den sinnvollen Einsatz vorhandener Ressourcen und vermag damit zum Teil erhebliche Synergie- effekte zu erzielen. Als Grundlage für den Aufbau der neuen Fachsicht Musik dient der derzeit vorhandene musikbezogene Linkbereich der Hochschule für Musik Detmold. An diesem Standort wurde relativ zeitig damit begonnen, diese bestehende Linksammlung zu pflegen und sie auf den Bedarf vor Ort auszurichten. Jedoch beschränkte sich diese Aufgabe bislang zumeist auf die Einarbeitung von Linkvorschlägen anderer Institutionen. Eine grundlegende Überarbeitung des Angebotes und die Erstellung einer tragfähigen Struktur, welche sich als Grundlage für den planmäßigen Auf- und Ausbau eignet, sind bislang nicht aktiv umgesetzt worden. So weist das gegenwärtige Angebot zum Teil erhebliche Defizite in Struktur und Inhalten auf. Die Arbeit setzt aus diesem Grunde zum Ziel, das derzeitige Angebot vollständig zu überarbeiten und ein bedarfsgerechtes, nutzerorientiertes Informationsangebot zu erstellen.
1. Einleitung 7 Gleichzeitig ist die Arbeit als Dokumentation des Aufbaus der neuen Fachsicht zu verstehen, der über eine vom hbz zur Verfügung gestellte eigene Administrationsoberfläche vorgenom- men werden konnte. Die Überarbeitung der Fachsicht selbst nahm durch ihre vollständige Neustrukturierung und die notwendigen Ergänzungen sehr viel Zeit (etwa die Hälfte der für die Anfertigung der Diplomarbeit zur Verfügung stehenden Wochen) in Anspruch. So muss- ten alle im Angebot verzeichneten Internetquellen auf ihre jeweiligen Inhalte überprüft wer- den, um den Links individuell ausformulierte Beschreibungen anfügen zu können und dem Nutzer auf diese Weise einen Mehrwert an Information zu bieten. Neben der schriftlichen Ausarbeitung steht folglich das neu gestaltete praktische Angebot, das sowohl im Internet (http://digilink.digibib.net/cgi-bin/digimod/show.pl?sigel=MUS), als auch in gedruckter Version im Anhang 1 dieser Arbeit eingesehen werden kann. Auf die Beifügung einer Offline-Demo-Version musste jedoch verzichtet werden, da dies nach Rückfrage beim hbz einen unvertretbar hohen technischen Aufwand bedeutet hätte, der im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten war. Die Arbeit selbst stellt zunächst das vom hbz erstellte Internet-Portal Digitale Bibliothek (DigiBib) einschließlich des Linkverwaltungssystems DigiLink vor. Im Anschluss daran wer- den die drei Musikhochschulbibliotheken und ihre Bibliotheken charakterisiert sowie die aus der Besonderheit der Fachinformation erwachsenden spezifischen Anforderungen an die Fach- sicht Musik herausgestellt. Aufbauend auf einer Beschreibung der Kritikpunkte am gegenwärtigen Angebot werden die Ziele der neuen Fachsicht Musik gekennzeichnet. Die Gliederung des neuen Angebotes wird vorgestellt sowie auf Auswahl- und Beschreibungskriterien der Links umfassend eingegangen. Des weiteren wird herausgestellt, welche Aufgaben mit der künftigen Pflege des Angebotes unmittelbar verbunden sind. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Flyer, der als Benutzungsanleitung konzipiert wurde und das Ziel verfolgt, die Wahrnehmung des Angebotes nachhaltig zu verbessern. Mit Hilfe einer simulierten Suchanfrage wird der Nutzer mit den grundlegenden Funktionsweisen der Fach- sicht Musik vertraut gemacht und ihm die korrekte Vorgehensweise bei einer Recherche in der Fachsicht aufgezeigt. Ein Muster des entwickelten Flyers befindet sich im Anhang 2 der Arbeit. Eines der Hauptprobleme beim Aufbau der neuen Fachsicht Musik bildete die Quellenlage. Derzeit finden sich überwiegend allgemeingültige Quellen zum Aufbau von Linksammlungen,
1. Einleitung 8 hingegen kaum Sekundärliteratur zur DigiBib sowie zur Erstellung musikbezogener Link- sammlungen. Der Aufbau selbst musste sich aus diesem Grunde weitgehend auf eigene Er- kenntnisse stützen, die aus der Analyse anderer für das Themengebiet Musik existierender Virtueller Bibliotheken gewonnen wurden. Die zur Erstellung der Arbeit herangezogene Literatur und die verwendeten Quellen finden sich in einem Verzeichnis am Schluss des Hauptteils. Bei der Entwicklung einer geeigneten Struktur für die neue Fachsicht wurde sehr großer Wert auf Praxisnähe gelegt. Aus diesem Grunde wurde das Angebot in den unterschiedlichen Entwicklungsstadien mit Detmolder Musikstudenten getestet. Mein Dank gilt allen, die mir während der Diplomarbeitsphase helfend zur Seite standen, insbesondere Claudia Stratemeier (Bibliothek der Hochschule für Musik Detmold) und Ricarda Hörig (Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Seminars Detmold) für die Anregung und die fachliche Unterstützung, sowie Nannette Heyder und Peter Mayr (beide Hochschulbibliotheks- zentrum Köln) für die technische Beratung.
9
2. Die Digitale Bibliothek (DigiBib)
2.1 Entwicklung und Funktionen des Internet-Portals
Das im Jahre 1973 als Verbundzentrale des nordrhein-westfälischen Bibliotheksverbundes4
gegründete Hochschulbibliothekszentrum (hbz) des Landes Nordrhein-Westfalen mit Sitz in
Köln versteht sich als ’zentrale Dienstleistungs- und Entwicklungseinrichtung für Hochschul-
bibliotheken, Öffentliche Bibliotheken und Spezialbibliotheken innerhalb und außerhalb von
Nordrhein-Westfalen’.5 Als solche übernimmt es für die ihm angeschlossenen Bibliotheken
insbesondere diejenigen Aufgabenbereiche, welche von systemadministrativem und –biblio-
thekarischem Charakter6 sind und deren Ausgestaltung und Verwirklichung vom wirtschaftli-
chen Aspekt her oftmals nicht von einzelnen Institutionen wahrgenommen werden können.
So ist es für die Erfüllung von Planungs- und Entwicklungsaufgaben für die bibliothekarische
Datenverarbeitung der ihm angeschlossenen Bibliotheken zuständig, betreibt die hbz-Ver-
bunddatenbank und koordiniert die Verbundarbeit der Mitgliedsbibliotheken.
In seiner Funktion als bibliothekarisches Servicezentrum stellt das hbz des weiteren einen
großen Komplex von Angeboten für die Verbundbibliotheken bereit, darunter automatisierte
Fernleihverfahren, Dokumentlieferdienste und lokale Bibliothekssysteme.7 Ferner ist es für
die automatische Schlagwortkettennachführung Der Deutschen Bibliothek sowie die Anrei-
cherung von Titeldaten zuständig und stellt seinen Nutzern eigene Rechercheoberflächen in
Form von Verbundkatalog8 und Suchmaschinentechnologie bereit. Über die Z 39.50-Server-
Funktionalität werden Möglichkeiten zur Recherche in anderen Verbundsystemen, Portalen
und Datenbanken geboten.9
Zu den Produkten des hbz zählen neben der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS), dem Dienst-
leistungspaket „lok-in hbz“, welches Bibliothekssystemfunktionen über Internet zur Verfü-
gung stellt, dem Medienverwaltungssystem „hbz-Medienserver“, der Open-Access-Initiative
“Digital Peer Publishing“ (DiPP) auch das Internet-Portal „DigiBib – Die Digitale Bibliothek“
4
Vgl. Schmidt, S. 49.
5
Vgl. Töteberg, Die Digitale Bibliothek (DigiBib) - Powerpointversion, [S. 3].
6
Ebd.
7
Vgl. Schmidt, S. 49.
8
Der sog. Dreiländerkatalog wird seit November 2005 in der Version 1.0 bereitgestellt und übernimmt die Rolle
des bisherigen Verbund-OPACs.
9
Vgl. Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, hbz - Vorteile der Verbundteilnahme.2. Die Digitale Bibliothek (DigiBib) 10
und das für den kooperativen Bestandsaufbau an Internetressourcen und Datenbanken kon-
zipierte Linkverwaltungssystem DigiLink.10
Die Digitale Bibliothek (DigiBib) wurde im Juni 199911 als zentrales, kooperativ betriebenes
Internet-Portal12 eröffnet und verfolgt die Zielsetzung, eine Vielzahl von Informationsquellen
und –dienstleistungen von Bibliotheken unter einer gemeinsamen virtuellen Oberfläche zu
vereinen, um dem Kunden mittels komfortabler Suchmöglichkeiten einen schnellen und
kostenlosen Zugang zu nationalen und internationalen Informationsquellen aller Fachgebiete
zur Verfügung zu stellen und damit langfristig zu einer nachhaltigen und kostengünstigen
Verbesserung der Versorgung der Hochschulen des Landes und anderer interessierter Institu-
tionen mit fachlich relevanten, zitierfähigen Informationen in elektronischer und gedruckter
Form über das Internet beizutragen.
Zunächst vorrangig für die wissenschaftlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen konzi-
piert, ist der Nutzerkreis der DigiBib längst über die Landesgrenzen Nordrhein-Westfalens
hinausgewachsen. Mittlerweile beteiligen sich etwa 170 Bibliotheken unterschiedlicher Trä-
ger aus zehn Bundesländern aktiv an diesem Informationsangebot. Konkret belief sich die
Anzahl der Kooperationspartner im Dezember 2005 auf 48 wissenschaftliche Bibliotheken aus
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Brandenburg, 111 öffentliche Bibliotheken (da-
runter u.a. die Stadtbibliotheken München und Hamburg), zwei private Hochschulen sowie
neun Spezialbibliotheken.13
Das Portal steht dem Nutzer unter der Internet-Adresse http://www.digibib.net/ zur Verfü-
gung. Als Provider ist das hbz für die Entwicklung und Parametrisierung des Portals zuständig.14
Dabei orientiert es sich eng am Bedarf der jeweiligen Kundenbibliotheken. Des weiteren
übernimmt es die zentrale Administration und Konfiguration der Software- und Hardware-
module, wodurch die einzelnen Bibliotheken von solchen Aufgabenbereichen entlastet werden.
Diese zentrale Aufgabenbündelung bewirkt zum Teil erhebliche Einsparungs- und Synergie-
effekte.
10
Sämtliche Informationen zu den hier angeführten Produkten des hbz sind folgender Quelle entnommen:
Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, hbz – Angebote für Bibliotheken.
11
Vgl. Töteberg, E-Mail vom 20.09.1999.
12
Vgl. DigiBib Flyer.
13
Vgl. Töteberg, Die Digitale Bibliothek (DigiBib) – Powerpointversion, [S. 7].
14
Vgl. Flauger, S. 122.2. Die Digitale Bibliothek (DigiBib) 11
Die DigiBib-Teilnahme selbst wird vertraglich zwischen dem hbz und der jeweiligen Teil-
nehmerbibliothek geregelt. Vorteilhaft hervorzuheben ist, dass letztere zu sehr günstigen
Preisen an Konsortien für elektronische Inhalte teilnehmen können und sich nicht selbst um
Verhandlungen und Vertragsabschlüsse zu kümmern brauchen.15
Eine weitere Besonderheit des Portals besteht darin, dass es sich dem Endnutzer trotz der
zentralen Installation als lokales Angebot der jeweiligen Anwenderbibliothek präsentiert.
Neben zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten, welche die Bibliotheken bei der Gestal-
tung ihrer eigenen lokalen Sicht erhalten, lässt sich das Angebot unter anderem nahtlos in das
Corporate Design (Logo, Farbdesign, Schrift etc.) der jeweiligen Einrichtung implementieren.
Die jeweilige Anwender-Bibliothek kann eine individuelle Auswahl an Katalogen und Da-
tenbanken treffen, welche bei Suchanfragen vom System durchsucht werden sollen.
Nach dem Login, welches entweder anonym (über ein Gast-Login) oder authentifiziert (nach
persönlicher Anmeldung) erfolgen kann öffnet sich dem Nutzer zunächst eine Metasuche.
Abb. 1: DigiBib - Metasuche
Quelle: http://thetis.hbz-nrw.de/Digibib?SERVICE=TEMPLATE&SUBSERVICE=MSEARCH_FRAME&SID
=THETIS:238801356&LOCATION=575 vom 01.05.2006.
Über die Suchoberfläche (vgl. Abb. 1) werden ihm hier vielfältige Recherchemöglichkeiten
geboten. So kann er zwischen einer parallelen Suche in Volltextdatenbanken, Bibliographien und
15
Vgl. DigiBib – Die Digitale Bibliothek.2. Die Digitale Bibliothek (DigiBib) 12
Bibliothekskatalogen oder einer individuellen Suche in freien und lizenzierten Datenbanken
wählen. Letztere stehen ihm unter dem Menüpunkt „E-Ressourcen“ in fachlich aufbereiteten
Linkverwaltungen zur Verfügung und bieten den Zugang auf das jeweilige Lokalangebot elek-
tronischer Ressourcen. In welchen Datenbanken eine Recherche möglich ist, hängt dabei immer
von den jeweiligen Lizenzen der entsprechenden Bibliothek ab. Darüber hinaus kann der
Nutzer auf eine Vielzahl von Multimedia-CD-ROMs, elektronischen Lehrbüchern und CD-
ROM-Datenbanken zugreifen. Abgerundet wird das Angebot durch die Bereitstellung ausge-
wählter Links im WWW und einer WWW-Metasuchmaschine.16
Die Rechercheergebnisse selbst werden zunächst stets in einer Kurztitelliste angezeigt, auf
Wunsch dann in Form einer Langanzeige. In das System integriert sind sowohl eine Verfüg-
barkeitsrecherche als auch ein Bestellsystem (Online-Endnutzerfernleihe), so dass der Nutzer
schnell Literaturhinweise findet und ihm zugleich auch immer der Weg zu gefundenen Doku-
menten aufgezeigt wird.17 Am Ende seiner Recherche erhält er das Medium entweder als
Volltext, nachgewiesen in Bibliotheken, als lieferbar angezeigt in Online-Buchhandlungen oder
als beschaffbar über Dokumentlieferdienste bzw. über Fernleihe. Unter dem Menüpunkt „Liefer-
dienste“ findet sich ferner eine Zusammenstellung aller Lieferdienste mit ihren jeweiligen In-
ternetauftritten. Der Nutzer kann hier den von ihm bevorzugten Lieferdienst direkt aufrufen.
16
Vgl. DigiBib Flyer.
17
Vgl. Töteberg, Die Digitale Bibliothek (DigiBib) – Powerpointversion, [S. 42].13
2.2 Das Linkverwaltungssystem DigiLink
Über den Menüpunkt „E-Ressourcen“ gelangt der DigiBib-Nutzer zu standortunabhängigen
Informationsquellen18, welche in sogenannten „Fachsichten“ zusammengestellt sind. Hierbei
kann es sich um weiterführende Links zu Quellen im Internet oder um lokale Datenbanken
handeln. Der Zugriff auf diese erfolgt entweder über alphabetisches oder fachliches Browsing
und wird durch Suchfunktionen optimiert.
Grundlage für die Erstellung solcher Linksammlungen bildet das vom hbz Köln eigens für
den kooperativen Bestandsaufbau von Internetressourcen und Datenbanken19 konzipierte
DigiBib-Linkverwaltungssystem DigiLink, welches seit 200420 erfolgreich in vielen Teilnehmer-
bibliotheken zum Einsatz kommt. Ende 2005 wurden mit DigiLink rund 70 000 Einträge an 81
Standorten verwaltet.21 Vor allem kleinere Bibliotheken mit nur wenig personellen Kapazitäten
können maßgeblich von der kooperativen Linkverwaltung profitieren.
Aufgrund des heterogenen Nutzerkreises muss ein System wie DigiLink über eine sehr hohe
Anpassungsfähigkeit und flexible Gestaltungsmöglichkeiten verfügen. So lässt sich DigiLink
nahtlos sowohl innerhalb als auch außerhalb der Digitalen Bibliothek in den Internetauftritt
der jeweiligen Institution integrieren und sich optimal auf deren Bedürfnisse ausrichten.
Die Verwaltung der einrichtungsspezifischen Linksammlungen erfolgt mittels eigener web-
basierter Administrationsoberflächen („Cockpits“)22, welche es den Anwendern erlauben, frei
über die Bezeichnungen der einzelnen Kategorien sowie die Anzahl der Kategorien und Hier-
archieebenen zu entscheiden. Über ein Auswahlmenü (vgl. Abb. 2) kann die Linksammlung
beispielsweise anhand von Cascading Style Sheets (CSS) optisch sehr detailliert an das Lay-
out der jeweiligen Anwenderbibliothek angepasst werden. Ferner besteht hier die Möglichkeit,
Inhalte der Kopf- und Fußzeilen ebenso wie einen Einleitungstext individuell auszugestalten
und in einer weiteren Option Logos für die Kategorisierung von Datenbanken (lizenz-
pflichtig, CD-ROM-Datenbank)23 auszuwählen bzw. zu verändern.
18
Vgl. DigiBib Flyer.
19
Vgl. Digilink – Informationsportal.
20
Vgl. Mayr, S. 139.
21
Vgl. Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, Jahresbericht (2005), S. 11.
22
Vgl. Mayr, S. 140.
23
Vgl. DigiLink – Informationsportal.2. Die Digitale Bibliothek (DigiBib) 14
Abb. 2: Administrationsoberfläche
Quelle: http://digilink.digibib.net/cgi-bin/digilink/cockpit.pl vom 01.05.2006.
Abb. 3: Anlegen eines Links – Schritt 1/3: Metadaten eintragen
Quelle: http://digilink.digibib.net/cgi-bin/digilink/cockpit.pl?local_link=true&CGISESSID=c2f6b1727d98cdd4
dca07d0b56a09a98&action=linkAnlegenForm&url=http%3A%2F%2F vom 01.05.2006.2. Die Digitale Bibliothek (DigiBib) 15
Über die Administrationsoberfläche wird zum einen die eigene Linksammlung gepflegt, sie
ist aber auch Ausgangspunkt für Arbeitsvorgänge wie die Einarbeitung von Linkvorschlägen,
das Anlegen (vgl. Abb. 3), Löschen, Umbenennen und Verschieben von Links (vgl. Abb. 4)
oder das Importieren neuer Aufnahmen.
Abb. 4: Administrationsoberfläche - Kategorienverwaltung
Quelle: http://digilink.digibib.net/cgi-bin/digilink/cockpit.pl?action=kategorienShow&CGISESSID=16d39dafb
3c673c6a53ca8194acea049 vom 01.05.2006.
Der laufende Betrieb selbst wird durch den Einsatz eines automatischen Linkcheckers opti-
miert.24 Dieser fasst für jeden Standort einmal pro Monat problematische Links zusammen
und dokumentiert diese in einem Fehlerbericht (vgl. Abb. 5), den die Anwenderbibliothek
zugesandt bekommt.25
Des weiteren werden vom System Statistiken über die Häufigkeit der Nutzung einzelner
Links und Kategorien geführt.26 So können über die sogenannte „Null-Liste“ unbenutzte Be-
standteile ausfindig gemacht werden. Hierbei handelt es sich um eine wesentliche Hilfe zur
bedarfsgerechten Entwicklung des Angebotes.
24
Vgl. Digilink – Informationsportal.
25
Vgl. Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, hbz – Informationen rund um DigiLink.
26
Vgl. DigiLink – Informationsportal.2. Die Digitale Bibliothek (DigiBib) 16
Abb. 5: Fehlerbericht für 20060510
Quelle: http://digilink.digibib.net/digilink/log/MUS_20060510_fehler.html vom 10.05.2006.
Einrichtungen können zwischen drei Optionen des Bestandsaufbaus wählen. Das hbz bietet
neben dem Grundmodul ein Standardmodul für Öffentliche (bestehend aus 330 Links) und eines
für wissenschaftliche Bibliotheken (bestehend aus 617 Links) an.27 Darüber hinaus besteht
aber auch die Möglichkeit, den DigiLink-Bestand einer Bibliothek mit deren Einverständnis
zu klonen und einer ähnlich ausgerichteten Einrichtung zur Verfügung zu stellen. Die Pflege
des neuen DigiLink-Standortes erfolgt in diesem Fall vom Quellstandort aus. Ausgenommen
davon sind lediglich lokale Anpassungen.28
Entscheidet sich eine Einrichtung für den Aufbau einer individuellen Sammlung, so kann sie
entweder Umfang und fachliche Gliederung selbst gestalten29 oder aber eine bereits bestehende
Sammlung durch Erstellen einer Kopie als Grundlage nutzen und diese dann auf den Bedarf
vor Ort ausrichten und mit eigenen Metadaten (Titel, Beschreibung etc.) anreichern.
Da die Wartung großer Linksammlungen sehr aufwändig ist, lässt sich insgesamt sagen, dass
durch die kooperative Erfassung und Pflege auf Seiten aller Beteiligter erhebliche Effizienz-
und Synergieeffekte erzielt werden können. Es entsteht weder Installations- noch Admini-
strationsaufwand und darüber hinaus können die oftmals ohnehin geringen personellen Kapazi-
täten auf diese Weise sinnvoller eingesetzt werden.
27
Vgl. Mayr, S. 140.
28
Vgl. Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, hbz – Informationen rund um DigiLink.
29
Ebd.17
3. Die Musikhochschulen Nordrhein-Westfalens und ihre Bibliotheken
3.1 Hochschule für Musik Detmold
Die „Hochschule für Musik Detmold“, welche vor rund 60 Jahren unter dem Titel „Nordwest-
deutsche Musikakademie Detmold“ gegründet wurde, versteht sich selbst als Vollhochschule.
Als solche vereint sie ‚künstlerische, pädagogische und wissenschaftliche Kompetenz auf
höchstem Niveau.’30
An der Musikhochschule werden folgende Studiengänge gelehrt: Komposition, Dirigieren,
Künstlerische Instrumentalausbildung, Gesang, Musikpädagogik (Musikschullehrer und selb-
ständige Musiklehrer), Schulmusik/Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sowie Kir-
chenmusik (evangelisch und katholisch).31
Im Studienangebot befindet sich zudem auch der Studiengang „Musikübertragung (Tonmei-
ster)“. Die Aufgabenbereiche von Tonmeistern liegen in der Leitung von Musikaufnahmen,
beispielsweise Rundfunk-, Fernseh- und Tonträgeraufnahmen. Qualifikationsbedingung hierfür
ist eine hochspezialisierte Ausbildung, welche vom „Erich-Thienhaus-Institut“, einem Ton-
meisterinstitut mit internationalem Bekanntheitsgrad, übernommen wird.32
Eine weitere Besonderheit vor Ort besteht in einer Kooperationsvereinbarung der Hochschule
für Musik Detmold und der Universität Paderborn im Hinblick auf den Studiengang Musik-
wissenschaft. Auf Grund dessen ist das in Detmold angesiedelte Musikwissenschaftliche Se-
minar eine gemeinsame zentrale wissenschaftliche Einrichtung beider Hochschulen. Das Lehr-
angebot gilt sowohl für das Lehramtsstudium Musik und die einzelnen Studienrichtungen an
der Musikhochschule Detmold als auch für die Magisterstudiengänge der Universität Pa-
derborn.33 Das Seminar verfügt über eine ca. 45 000 Medieneinheiten34 umfassende Bibliothek,
die den Angehörigen zur Präsenznutzung zur Verfügung steht.35
30
Vgl. Hochschule für Musik Detmold, Leitbild.
31
Vgl. Hochschule für Musik Detmold, Studiengänge.
32
Vgl. Hochschule für Musik Detmold, Allgemeines.
33
Vgl. Musikwissenschaftliches Seminar Detmold/Paderborn, Studiengänge.
34
Vgl. Hörig, Mündl. Auskunft vom 11.05.2006.
35
Die Informationen sind den Punkten 1 und 2 folgender Quelle entnommen: Musikwissenschaftliches Seminar
Detmold/Paderborn, Bibliotheksordnung.3. Die Musikhochschulen Nordrhein-Westfalens und ihre Bibliotheken 18
Laut Angaben der Hochschulverwaltung hatte die Hochschule im Wintersemester 2005/06
946 Angehörige36, die sich prozentual gesehen folgendermaßen verteilen:
Abb. 6: Angehörigenstruktur HfM Detmold in %
Mitarbeiter
Lehrende 5%
20%
Studenten
75%
Quelle: Eigene Darstellung.
Eine differenziertere Aufgliederung der drei Angehörigengruppen enthält die nachfolgende
Tabelle (Abb. 7):
Abb. 7: Angehörigenstruktur HfM Detmold
Anzahl der Studenten: Anzahl der Lehrenden:
• 629 Haupthörer • 51 Professoren
• 19 Jungstudenten • 19 Lehrkräfte für besondere Aufgaben
• 13 Studienkollegiaten • 2 Professorenvertretungen
• 11 Nebenhörer • 86 Lehrbeauftragte
• 16 Künstlerische/Wissenschaftliche
Hilfskräfte
Anteil der ausländischen Studierenden:
• 333 Studenten ! 49,6%
Anzahl der Mitarbeiter: 45
Quelle: Stratemeier, E-Mail vom 10.01.2006.
Hochschulbibliothek
Die zentrale Hochschulbibliothek der Hochschule für Musik Detmold ist gemäß § 30 Abs. 1
des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz HG)
in der Fassung vom 30.11.2004 eine Betriebseinheit der Hochschule für Musik Detmold.37 Ihr
angegliedert ist die Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Seminars Detmold/Paderborn.
Statistisch erfasst sind dabei lediglich diejenigen Bestände, die aus Mitteln der HfM Detmold
36
Vgl. Stratemeier, E-Mail vom 10.01.2006.
37
Vgl. Hochschule für Musik Detmold, Benutzungsordnung der Bibliothek, §1 Rechtliche Grundlagen.3. Die Musikhochschulen Nordrhein-Westfalens und ihre Bibliotheken 19
finanziert wurden. Diese belaufen sich auf insgesamt 123 505 Medieneinheiten und setzen
sich wie folgt zusammen: 33 224 Bücher, 1 925 Dissertationen, 6 095 Mikroformen, 70 571
Noten, 11 277 Tonträger, 24 Dias, 142 Filme, 143 elektronische Publikationen und 104 laufende
Zeitschriften.38
Im Jahre 2004 wurden insgesamt 51 099 Ausleihvorgänge getätigt. Ausleihberechtigt sind
dabei:
a) die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule für Musik Detmold
b) die Studierenden und Lehrenden der Universität Paderborn, Fakultät für Kultur-
wissenschaften, explizit alle unter das Fach „Musik“ fallenden Studiengänge.39
Im Jahre 2004 konnte die Bibliothek insgesamt 1 244 aktive Benutzer verzeichnen. Hinzu ka-
men zum gleichen Zeitpunkt 99 externe Benutzer.40 Hierin liegt eine Besonderheit der
Bibliothek der HfM Detmold, welche im Gegensatz zu den Musikhochschulbibliotheken in
Essen und Köln auch externe, interessierte Personen zur Ausleihe zulässt, sofern die Biblio-
thek in ihrer eigentlichen Aufgabe (§4 der Benutzungsordnung) hierdurch nicht beeinträch-
tigt wird.41
Gebühren zur Benutzung der Bibliothek werden grundsätzlich nicht erhoben.42
3.2 Folkwang Hochschule Essen
Die Folkwang Hochschule Essen wurde im Jahre 1927 unter dem Namen „Folkwang-Schule
für Musik, Tanz und Sprechen“ gegründet. Seit damals steht sie mit ihrem Namen für die
’Idee der spartenübergreifenden Zusammenarbeit verschiedener Kunstrichtungen’.43 Hier wer-
den Studierende der Musik, des Theaters und der darstellenden Künste sowie des Tanzes fächer-
übergreifend und fächerverbindend ausgebildet.
Von der Hochschule wird oftmals als einem ’Ort interdisziplinärer künstlerischer und wis-
senschaftlicher Forschung, Lehre und Praxis’44 gesprochen. Sie ’leitet aus ihrer Tradition und
38
Die Angaben beziehen sich auf das Erwerbungsjahr 2004 und sind folgender Publikation entnommen:
Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken 2005/2006 (2005), S. 99.
39
Vgl. Hochschule für Musik Detmold, Benutzungsordnung der Bibliothek, § 6 Zulassung.
40
Die Zahlen sind der Auswertung der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) für das Jahr 2004 entnommen. Sie
sind verfügbar unter: http://www.biblilotheksstatistik.de/auswertung/2004/DBS_2004_B_01.html.
41
Vgl. Anm. 39.
42
Vgl. Hochschule für Musik Detmold, Benutzungsordnung der Bibliothek, § 7 Gebühren.
43
Vgl. Folkwang Hochschule Essen, Idee und Geschichte.
44
Vgl. Folkwang Hochschule Essen, Leitbild und Zielvereinbarung.3. Die Musikhochschulen Nordrhein-Westfalens und ihre Bibliotheken 20
aus ihrer Verankerung an den Standorten Essen, Bochum, Duisburg und Dortmund (Orchester-
zentrum/NRW) den Anspruch ab, die Kunsthochschule des Ruhrgebietes zu werden’.45
Studenten der Folkwang Hochschule können sich im Bereich Musik für die Studiengänge
„Differenzierte Musikerausbildung Instrumental“, Solistenausbildung für Instrumentalfächer
und Gesang, Jazz, Komposition, Kammermusik, Orchesterdirigieren und Chordirigieren, Evan-
gelische und katholische Kirchenmusik, Lehrämter Musik sowie Musikpädagogik, einschreiben.
Der Studiengang Musikwissenschaft kann in Kombination mit einem künstlerischen Fach
belegt werden.46
Im Sommersemester 2005 hatte die Folkwang Hochschule insgesamt 1 162 Angehörige. An
der Hochschule waren zu diesem Zeitpunkt 838 Studenten immatrikuliert. Von ihnen studierten
806 am Standort Essen/Duisburg und 32 am Standort Bochum. Hinzu kamen 24 Zweithörer
und 11 Jungstudenten. Der Anteil ausländischer Studierender betrug 41%. An der Hochschule
waren zum gleichen Zeitpunkt 289 Lehrende beschäftigt, darunter 90 Professoren, 22 haupt-
berufliche Dozenten, 171 Lehrbeauftragte sowie ein Professurvertreter.47 Die Standorte Bochum
und Essen mit eingeschlossen sind an der Folkwang Hochschule etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt.48
Abb. 8: Angehörigenstruktur Folkwang Hochschule Essen in %
Mitarbeiter
Lehrende 4%
24%
Studenten
72%
Quelle: Eigene Darstellung.
Hochschulbibliothek
Die Bibliothek der Folkwang Hochschule Essen ist eine zentrale Betriebseinheit der Hoch-
schule und umfasst den gesamten Bestand hochschuleigener Medien, welcher sich im Jahre
2004 auf etwa 118 000 Medieneinheiten belief. Diese setzen sich aus 28 000 Bänden der Lehr-
45
Vgl. Anm. 44.
46
Vgl. Folkwang Hochschule Essen, Standort Essen.
47
Vgl. Folkwang Hochschule Essen, Daten und Fakten.
48
Vgl. Folkwang Hochschule Essen, Verwaltung.3. Die Musikhochschulen Nordrhein-Westfalens und ihre Bibliotheken 21
buchsammlung, 68 551 Noten, 17 415 Schallplatten und 84 laufenden Zeitschriften zusammen.
Weitere 6 800 Schallplatten und Tonbänder entstammen dem Alfred-Krupp-Nachlass. Im
selben Jahr wurden 37 000 Entleihvorgänge gezählt.49
Die Bibliothek kann von allen Hochschulangehörigen gebührenfrei in Anspruch genommen
werden. Nicht-Angehörige der Hochschule dürfen hochschuleigene Medien nur mit besonderer
Genehmigung entleihen. Hierfür kann ihnen gegebenenfalls eine entsprechende Verwaltungs-
gebühr berechnet werden.50
Aussagen über die Zahl der aktiven Benutzer liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.
3.3 Hochschule für Musik Köln
Im Jahre 1850 als städtisches „Conservatorium der Musik in Coeln“51 gegründet, hat sich die
Hochschule für Musik Köln mit ihren Standorten in Aachen und Wuppertal zur größten Mu-
sikhochschule Europas entwickelt.
Hier können Studierende aus folgendem Studienangebot wählen:
Künstlerische Instrumental- und Gesangsausbildung, Dirigieren, Komposition, Jazz/Populäre
Musik/Weltmusik, Bühnentanz, Evangelische und katholische Kirchenmusik, Musikpädago-
gik und Lehramt Musik.52
Im Wintersemester 2005/2006 hatte die Hochschule am Standort Köln 1 400 Angehörige.
Diese Zahl setzt sich aus 1 029 Studentinnen und Studenten, 310 Dozenten und Lehrbeauf-
tragten sowie 61 Mitarbeitern in der Verwaltung zusammen.53
Am Standort Aachen waren zum gleichen Zeitpunkt bei einer Anzahl von 229 Studenten, 71
Dozenten und Lehrbeauftragte sowie vier weitere Mitarbeiter tätig. Der Standort Wuppertal
hatte 236 Studenten sowie 81 Dozenten und Lehrbeauftragte. Die Mitarbeiteranzahl belief sich
wie auch in Aachen auf vier Personen.54
Exakte Daten über die Anzahl ausländischer Studierender liegen für diese drei Standorte der-
zeit nicht vor.
49
Die innerhalb dieses Abschnitts angeführten Zahlen beziehen sich alle auf das Erwerbungsjahr 2004 und sind
folgender Publikation entnommen: Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken 2005/2006 (2005), S. 125.
50
Die Informationen sind den Punkten 1 und 2 folgender Quelle entnommen: Folkwang Hochschule Essen,
Regelungen für die Benutzung der Bibliothek der Folkwang Hochschule Essen.
51
Vgl. Hochschule für Musik Köln, Geschichte.
52
Vgl. Hochschule für Musik Köln, Studiengänge.
53
Vgl. Schubert, E-Mail vom 21.12.2005.
54
Vgl. Schubert, E-Mail vom 10.01.2006.3. Die Musikhochschulen Nordrhein-Westfalens und ihre Bibliotheken 22
Abb. 9: Angehörigenstruktur der HfM Köln in %
Mitarbeiter
Lehrende 3%
23%
Studenten
74%
Quelle: Eigene Darstellung.
Hochschulbibliothek
„Die Bibliothek der Hochschule für Musik Köln ist eine zentrale Betriebseinheit im Sinne
des § 33 Wiss-HG und umfasst den gesamten Bestand der Hochschule an Literatur, Noten,
Tonträgern und sonstigen Informationsmitteln. Sie ist eine Dienstleistungseinrichtung und
dient der Unterstützung von Forschung, Lehre und Studium der Mitglieder und Angehörigen
der Hochschule für Musik Köln gemäß § 6 KunstHG.“55 Angegliedert sind zwei Abteilungen
an den Standorten Aachen und Wuppertal.56
Die Bestände der Bibliothek beliefen sich im Jahre 2004 auf insgesamt 141 050 Medienein-
heiten und setzten sich aus 35 793 Musikbüchern, 1 559 Dissertationen, 1 418 Mikroformen,
91 409 Noten, 47 Dias, 120 Filmen, 7 440 Schallplatten, 4 338 Tonträgern, 61 elektronischen
Publikationen, 393 Handschriften und laufenden Zeitschriften zusammen.57
Im Jahre 2004 wurden insgesamt 95 034 Ausleihvorgänge getätigt.58 Zum gleichen Zeitpunkt
waren in der Bibliothek insgesamt 1 694 aktive Benutzer verzeichnet.59 Eine Ausleihe ist nur
für Angehörige der Hochschule möglich, auswärtigen sonstigen Bibliotheksnutzern werden
die Bestände lediglich zur Präsenznutzung zur Verfügung gestellt. Gebühren zur Benutzung
der Bibliotheksbestände werden nicht erhoben.60
55
Vgl. Hochschule für Musik Köln, Bibliotheksordnung, § 1 Geltungsbereich/Aufgaben der Bibliothek.
56
Vgl. Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken 2005/2006 (2005), S. 213.
57
Die Angaben beziehen sich alle auf das Erwerbungsjahr 2004 und sind der in Anm. 56 genannten Publikation
entnommen.
58
Vgl. Anm. 56.
59
Vgl. Die Zahlen sind der Auswertung der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) für das Jahr 2004 entnommen.
Sie sind verfügbar unter: http://www.biblilotheksstatistik.de/auswertung/2004/DBS_2004_B_01.html.
59
Vgl. Hochschule für Musik Köln, Bibliotheksordnung, § 6 Gebühren.23
3.4 Die Hochschulbibliotheken als Teilnehmer der DigiBib
Bibliotheken der Musikhochschulen sind künstlerisch-wissenschaftliche Spezialbibliotheken
der Funktionsstufe 3 (spezialisierter Bedarf).61 Ihre Bestände sind meist stark am Studienangebot
der jeweiligen Hochschule orientiert und für die Öffentlichkeit oftmals nur eingeschränkt zu-
gänglich.62 Ihre Aufgaben bestehen in erster Linie darin, alle Angehörigen der entsprechenden
Einrichtung mit konventionellen und elektronischen Informationen für Studium, Forschung
und Lehre sowie für die künstlerische Praxis zu versorgen und den dienstlichen Betrieb der
Hochschule zu unterstützen.
Neben Musikalien und Tonträgern werden die Bibliotheksbestände von Musikhochschulbi-
bliotheken zumeist um notwendige Literatur zu Grundlagen- und Nebenfächern sowie um
Bibliographien und Nachschlagewerke ergänzt. Umfang und Art der Bestände richten sich
dabei nach den örtlichen Voraussetzungen. Als Fachinformationseinrichtungen sind Musik-
hochschulbibliotheken neben der herkömmlichen Literaturdokumentation und –information
vor allem für Faktendokumentation und Fakteninformation zuständig.63 Im Hinblick auf die
Entwicklungen der vergangenen Jahre, sind deshalb die elektronischen Ressourcen als bedeu-
tender Bestandteil der Informationsversorgung zu sehen. Die Erschließung und Vermittlung
der im Internet gebotenen elektronischen Ressourcen stellt ein neues Aufgabenfeld der Bi-
bliotheken dar, dem noch immer zu wenig Bedeutung beigemessen wird und das, gerade im
Hinblick auf eine sinnvolle Qualitätsauswahl der im Netz gebotenen Fülle unterschiedlichster
Quellen, oftmals Schwierigkeiten mit sich führt.
Alle drei Hochschulbibliotheken haben diesbezüglich einen großen Schritt getan, als sie sich
im Laufe des Jahres 2004 für die Teilnahme an der DigiBib entschieden und seither auf die
Möglichkeit zurückgreifen können, ihren Nutzern zusätzliche Ressourcen zu den herkömm-
lichen Informationsangeboten bereitzustellen und individuell Einfluss auf deren Auswahl und
Präsentation zu nehmen.
Welche inhaltlichen Anforderungen an die Fachsicht ergeben sich nun also aus den drei
Hochschulstandorten?
61
Vgl. Bibliotheken ’93 (1994), S. 46.
62
Ebd., S. 46 f.
63
Vgl. Hacker (2000), S. 316.3. Die Musikhochschulen Nordrhein-Westfalens und ihre Bibliotheken 24
Wie den Beschreibungen unter 3.1 bis 3.3 zu entnehmen ist, sind die Nutzerkreise weitestge-
hend homogen. Ein Vergleich zeigt, dass alle drei Einrichtungen über ein sehr ähnliches Stu-
dienangebot verfügen, wenngleich sich natürlich von Standort zu Standort einige Differenzen
hinsichtlich der Studiengang-Bezeichnungen ergeben.
Auch die Strukturen der drei Hochschulen weisen große Ähnlichkeiten in der Zusammenset-
zung ihrer Angehörigen auf. Je etwa ein Viertel der Hochschulangehörigen besteht aus Leh-
renden und Mitarbeitern. Der Anteil der Studenten beläuft sich an den drei Standorten auf
72 bis 75 Prozent. Des weiteren hat sich herausgestellt, dass der Anteil ausländischer Studie-
render, zumindest in Bezug auf die Hochschulen in Detmold und Essen, 40 bis 50 Prozent
der Gesamtzahl aller Studierender ausmacht.64
Mithin kann davon ausgegangen werden, dass die an den drei Standorten entstehenden Infor-
mationsbedürfnisse und inhaltlichen Anforderungen an die Fachsicht sehr ähnlich ausge-
staltet sind.
Die Fachsicht Musik ist ein Instrument zur Informationsvermittlung und sollte primär auf den
praktischen Gebrauch im Auskunftsdienst ausgelegt sein. Die enthaltenen Informationen soll-
ten schnell, effizient und ohne großen Aufwand auffindbar sein. Dabei ist es unbedingt not-
wendig, die Inhalte auf die vor Ort existierenden Anforderungen auszurichten, um gestellte
Fragen korrekt und so schnell wie möglich beantworten zu können.
So besteht die Hauptaufgabe der Fachsicht darin, dem Nutzer schnellen und unkomplizierten
Zugang zu im Internet existierenden Informationsportalen und Rechercheinstrumenten zu ge-
währleisten. Weiterhin soll sie ihm mittels einer Verlinkung zu weiteren Online-Katalogen
Hilfestellung bei der Ermittlung von Besitznachweisen anderer Bibliotheken bieten. Im Hin-
blick auf die Musikwissenschaft ist es besonders wichtig, hier den Zugriff auf Kataloge von
bedeutenden nationalen und internationalen Musiksammlungen mit historisch gewachsenen
Beständen an Musikalien und Musikschriften, von Handschriftenbeständen und sonstigen be-
deutenden Quellenbeständen, wie zum Beispiel Komponisten-Autographen, zu gewährleisten.
In diesem Zusammenhang sollte auch der Zugriff auf die Bibliothekskataloge der Forschungs-
institute geboten werden, welche für die Edition wissenschaftlicher Gesamtausgaben zuständig
64
Die Daten bezüglich des Anteils ausländischer Studierender wurden der Vollständigkeit halber mit erhoben,
treten jedoch beim Aufbau des musikalischen Linkbereichs in den Hintergrund und finden keine weitere Be-
rücksichtigung.3. Die Musikhochschulen Nordrhein-Westfalens und ihre Bibliotheken 25
sind, darunter beispielsweise die Bach-Archive in Leipzig und Göttingen oder das Beethoven-
Haus Bonn.
Eine weitere Aufgabe seitens der Bibliotheken besteht in der Vermittlung von bibliographi-
schen und Fakteninformationen (lexikalische Auskünfte, Adressauskünfte etc.). Da die Zahl
der Auskunftsmittel im Bereich Musik groß ist, sollte die Fachsicht zumindest die wesentli-
chen Nachschlagewerke und Bibliographien enthalten. Diese sind in ihren Online-Versionen
jedoch zumeist lizenzpflichtig, weshalb es wenig sinnvoll ist, alle Angebote in die Fachsicht
aufzunehmen. Bislang erfolgten die Anbindungen des Répertoire International de Littérature
Musicale (RILM), des Grove Music Online65 und des Catalogue of Printed Music. Zusätzlich
wird der Zugriff auf das wichtigste Katalogprojekt im Fachgebiet Musik, das „Répertoire
International des Sources Musicales (RISM)“, geboten. Über ein Konsortium der lizenzierten
Online-Version des „Répertoire International de la Presse Musicale (RIPM)“ verfügen die
drei Standorte bislang nicht.
Aus der Spezifik des Themengebietes Musik ergibt sich zudem die Notwendigkeit, einige
spezielle Informationsmittel, wie etwa elektronisch verfügbare Werkverzeichnisse einzelner
Komponisten, Diskographien, Verzeichnisse musikschaffender und musikausübender Personen
oder auch Datenbankangebote zur Ermittlung einzelner Lieder, Songs und Arien und deren
Nachweis, in der Fachsicht zu verzeichnen.
Eine weitere Besonderheit von Musikhochschulbibliotheken besteht darin, dass die von ihnen
zu beschaffende Literatur häufig bei speziellen Verlagen, Fachverlagen, im Musikalien-
handel oder gegebenenfalls direkt beim Herausgeber erworben werden muss. Hierfür ist eine
genaue Kenntnis der einzelnen Verlagsprogramme und Sortimente erforderlich. Die Anschaf-
fungen beruhen zum größten Teil auf Vorschlägen der Lehrenden.
Ebenso unverzichtbar für die Auskunftstätigkeit in Musikhochschulbibliotheken sind Infor-
mationsquellen zu nationalen und internationalen Musikorganisationen und –institutionen.
Oftmals sind Adressauskünfte gewünscht, potentielle Arbeitgeber gesucht oder Fragen hin-
sichtlich der Zuständigkeitsbereiche einzelner Einrichtungen nicht geklärt. In diesem Zusam-
menhang ist es notwendig, den Hochschulangehören einen schnellen Zugriff auf Informationen
65
Auf Beschluss der drei Standorte wird lediglich ein lizenziertes Nachschlagewerk bezogen. Das Angebot
„Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG)“ ist deshalb nicht enthalten.3. Die Musikhochschulen Nordrhein-Westfalens und ihre Bibliotheken 26 hinsichtlich existierender Musik-Ausbildungsinstitutionen (Musikakademien, Musikhochschulen, musikwissenschaftliche Institutionen etc.), Musikinformationszentren, Musikräten, Verbänden, Vereinigungen, Gesellschaften, Musikalischen Aufführungsstätten etc. zu gewährleisten. Oberstes Ziel einer jeden Bibliothek ist es, ihre Nutzer schnell und umfassend mit den von ihnen gewünschten Informationen zu versorgen. Dieses Ziel kann jedoch nur erreicht werden, wenn alle vorhandenen Informationsquellen zur Recherche herangezogen werden. Letzteres kann vom Auskunftsdienst selbstverständlich nur in begrenztem Maße wahrgenommen werden, so dass oftmals nur bestimmte Quellen zur Beantwortung einer Suchanfrage mit herangezogen werden können. Sich umfassend über die in der DigiBib enthaltenen Inhalte zu informieren, bleibt dem Nutzer selbst überlassen. Da es sich um ein frei zugängliches Angebot handelt, kann er diese Quellen jederzeit und ortsunabhängig zur eigenen Recherche heranziehen. So ist das Zusammenstellen solch großer Linksammlungen wie der Fachsicht Musik letztend- lich als Serviceleistung der Hochschulbibliotheken für ihre Nutzer zu verstehen, um ihnen bei der Auswahl qualifizierter Internetquellen behilflich zu sein. Die konventionellen Aus- kunftsmittel zu ersetzen vermag sie in keiner Weise, jedoch sollte sie als wichtige und not- wendige Ergänzung zu ihnen betrachtet werden.
27
4. Die Fachsicht Musik in der DigiBib als Virtuelle Bibliothek Musik für
die Musikhochschulen Detmold, Essen und Köln
4.1 Kritik am gegenwärtigen Angebot
Bei einer genauen Analyse der bisherigen Fachsicht Musik durch die Verfasserin stellte sich
heraus, dass diese zum Teil erhebliche Mängel in Struktur und Inhalten aufweist. So wurden
die einzelnen Themenbereiche des Musiklebens nicht gleichermaßen berücksichtigt; das An-
gebot in seiner Gesamtheit erscheint wenig benutzerorientiert und nicht hinreichend genug
am Bedarf der Einrichtungen ausgerichtet. Zudem ist bislang kein Schema erkennbar, nach
welchem der bisherige Aufbau der Linksammlung erfolgt sein könnte. Folglich wirkt die
Fachsicht im derzeitigen Zustand eher behelfsmäßig auf den Nutzer und wenig sinnvoll
strukturiert. Darauf dürfte auch die bislang fehlende Akzeptanz des Fachinformationsangebotes
weitestgehend zurückzuführen sein.
Die Notwendigkeit einer grundlegenden Bearbeitung der Fachsicht ergibt sich zudem allein
schon aus der Tatsache, dass diese seit Teilnahmebeginn der Hochschulen an der DigiBib
keine wesentlichen Veränderungen erfahren hat. Zwar sind Linkvorschläge anderer Institutionen
eingearbeitet worden, aber sowohl die Struktur des Angebotes als auch dessen inhaltliche
Schwerpunkte sind im Prinzip noch die gleichen wie im Jahre 2004. Das Angebot ist dem-
nach weder hinreichend aktuell noch planmäßig auf die jeweils vor Ort existierenden Bedarfe
ausgerichtet und folglich auch nur wenig benutzerorientiert ausgestaltet.
Nicht vergessen werden darf, dass die Pflege einer solchen Linksammlung wie der DigiBib
und der Fachsicht im einzelnen einige Zeit in Anspruch nimmt, die nicht unbedingt immer in
ausreichendem Maße erübrigt werden kann. Um der Fachsicht in ihrer Funktion als Informa-
tionsmittel zukünftig einen gefestigten Platz im Auskunftsdienst zuzuweisen, bedarf sie zunächst
einer grundlegenden Überarbeitung und sollte auch im Nachhinein regelmäßig gepflegt und
an bestehenden inhaltlichen und strukturellen Anforderungen ausgerichtet werden.
Um diese Anforderungen formulieren und Maßstäbe festlegen zu können, nach welchen der
Ausbau künftig erfolgen kann und auch, um bereits bestehende Fehlerquellen zu vermeiden,
ist es zunächst einmal zwingend erforderlich, die Kritikpunkte am gegenwärtigen Angebot zu
kennzeichnen. Diese sollen nachfolgend herausgestellt und charakterisiert werden.Sie können auch lesen