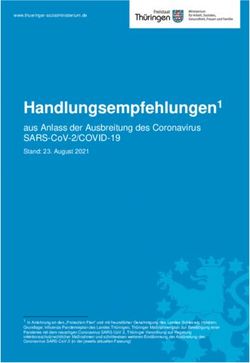Die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft vom 23. Februar 2020: SPD-Bürgermeister behauptet sich gegen Grünen-Herausforderin und setzt rot-grüne ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
576 Dokumentation und Analysen
Die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft vom 23. Februar 2020:
SPD-Bürgermeister behauptet sich gegen Grünen-Herausforderin
und setzt rot-grüne Koalition fort*
Patrick Horst
Nach einem intensiven Wahljahr 2019 mit Wahlen zum Europäischen Parlament und zu
vier Landtagen stand 2020 allein die Hamburger Bürgerschaftswahl auf dem Kalender.
Obwohl in der Hansestadt die Uhren bekanntlich anders gehen als im Bund1, war der
Wahl besondere Aufmerksamkeit in Berlin sicher, da sich in ihrem Umfeld bereits Bedin-
gungen für die kommende Bundestagswahl abzeichneten: 2021 würde erstmals seit 1949
keine amtierende Bundeskanzlerin antreten, sofern Angela Merkel bei ihrer Zusicherung
bliebe, nicht für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren. Für die Hamburg-Wahl wurde dies
durch die Turbulenzen der Regierungsbildung in Thüringen Anfang Februar virulent, wo
der FDP-Abgeordnete Thomas Kemmerich mit den Stimmen der CDU und der AfD zum
Ministerpräsidenten gewählt, anschließend aber von Merkel und FDP-Parteichef Christian
Lindner, der sich heftiger innerparteilicher Kritik ausgesetzt sah, wieder zum Rücktritt
gedrängt worden war. Der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer war es zuvor
nicht gelungen, die Thüringer CDU von diesem Tabubruch abzuhalten; sie kündigte dar-
aufhin ihren Rücktritt an. Das Rennen um den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur
war damit wieder offen: Am 18. Februar, fünf Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg,
erklärte der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen seine Kandidatur für den Parteivorsitz.
Ministerpräsident Armin Laschet und der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich
Merz, beide wie auch Röttgen aus Nordrhein-Westfalen, warteten die Hamburg-Wahl noch
ab, bevor sie am 25. Februar ebenfalls ihre Bewerbung ankündigten.
Während die Situation der Union im Bund hochgradig volatil war, befand sich die SPD
in der schwersten Krise ihrer Existenz. Nach der Niederlage ihrer Partei bei der Europawahl
hatte die erst ein Jahr amtierende Vorsitzende Andrea Nahles alle politischen Ämter nieder-
gelegt. In einem langwierigen innerparteilichen Mitgliederentscheid wählte die SPD sich
daraufhin eine neue Parteispitze: Hier setzten sich im Dezember 2019 die bundespolitisch
zuvor kaum in Erscheinung getretenen Saskia Eskens, MdB aus Baden-Württemberg, und
Norbert Walter-Borjans (Finanzminister Nordrhein-Westfalens 2010 bis 2017), die dem lin-
ken Parteiflügel zuzurechnen waren, gegen Vizekanzler Olaf Scholz und seine Co-Bewerbe-
rin Klara Geywitz durch. Die Grünen, die mit der Europawahl zur zweiten Kraft im zuneh-
mend fragmentierten und polarisierten Parteiensystem aufgestiegen waren2, diskutierten
* Eine Langfassung des Manuskripts, das auch die Plakatwahlkämpfe der Parteien und die Effekte
des Hamburger Wahlrechts auf das Wahlergebnis eingehender analysiert, steht auf der persönli-
chen Webseite des Verfassers zur Verfügung: https://patrickhorst.de/wp-content/uploads/2020/06/
Hamburgwahl_2020.pdf
1 Vgl. Patrick Horst, Das Parteiensystem Hamburgs, in: Uwe Jun / Melanie Haas / Oskar Nieder‑
mayer (Hrsg.), Parteien und Parteiensysteme in den deutschen Ländern, Wiesbaden 2008, S. 217
– 246.
2 Vgl. Oskar Niedermayer, Von der „nationalen Nebenwahl“ zur „europäisierten Wahl“? Die Wahl
zum Europäischen Parlament vom 26. Mai 2019, in: ZParl, 50. Jg. (2019), H. 4, S. 691 – 714;
ders., Die Entwicklung des deutschen Parteiensystems. Zur Bedeutung kurzfristiger Faktoren im
Jahrzehnt des europäischen Wandels, in: ZParl, 49. Jg. (2018), H. 2, S. 286 – 303.
Zeitschrift für Parlamentsfragen (ZParl), Heft 3/2020, S. 576 – 596, DOI: 10.5771/0340-1758-2020-3-576
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Horst: Die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft vom 23. Februar 2020 577
zur selben Zeit die Frage, ob sie mit einem Kanzlerkandidaten in die Bundestagswahl zie-
hen sollten. Vier Tage vor der Wahl erschütterte dann ein rechtsterroristischer Anschlag in
Hanau, bei dem neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet wurden, die Repu-
blik, die sich seit der Flüchtlingskrise 2015 politisch pluralisiert hatte und in der die AfD
mittlerweile in allen Parlamenten auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene vertreten
war.
1. Die Ausgangslage
In Hamburg regierte derweil die SPD im neunten Jahr. Der frühere Bürgermeister Olaf
Scholz, der seine Partei 2011 nach dem Bruch der schwarz-grünen Koalition zur absoluten
Mehrheit zurückgeführt hatte3, hatte die Richtung vorgegeben: Ordentlich, solide und
„gut“ wollten die Sozialdemokraten die Hansestadt regieren.4 Nach Auffassung der Ham-
burgerinnen und Hamburger hatte Scholz Kurs gehalten, auch wenn sie ihm bei der Bür-
gerschaftswahl 2015 die Grünen als Koalitionspartner an die Seite gestellt hatten. Mit
einem Wahlergebnis von 45,6 Prozent für die SPD und persönlichen Zustimmungswerten
von 76 Prozent war dies jedoch kein Misstrauensvotum. Die Wähler blieben mit der Politik
ihres Senats zufrieden – auch nachdem Scholz im März 2018 Vizekanzler der Großen Koa-
lition geworden und Finanzsenator Peter Tschentscher ins Bürgermeisteramt aufgerückt war.
Das Scheitern der Olympiabewerbung zu Beginn der rot-grünen Koalition machten die
Hamburger ihrer Regierung nicht zum Vorwurf. Schließlich waren sie in einem Bürger-
schaftsreferendum gefragt worden und hatten sich mit ihrem „Nein“ gegen die übermäch-
tig scheinende Koalition aus SPD, Grünen, CDU, FDP und Handelskammer durchge-
setzt.5 Den missglückten G-20-Gipfel vom Juli 2017, der nach exzessiven gewalttätigen
Ausschreitungen fast zum Sturz von Bürgermeister Scholz geführt hatte, verziehen die Wäh-
ler dem Senat auch deshalb, weil er dem neuen Bürgermeister Tschentscher nicht persönlich
angelastet werden konnte.6
SPD und Grüne profitierten ferner von dem Wirtschaftsboom, der die Hansestadt nach
Überwindung der Finanzkrise erfasst hatte. Das Versprechen, gut regieren zu wollen, ließ
sich leichter in einem Umfeld wirtschaftlicher Prosperität als in Zeiten der Knappheit
umsetzen. Seit dem Amtsantritt der SPD im Jahre 2011 war die Einwohnerzahl Hamburgs
wie auch die Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse um gut
100.000 Personen gewachsen – in Hamburg lebten wieder wie zu Beginn der 1960er Jahre
3 Vgl. Patrick Horst, Die Wahl zur Hamburger Bürgerschaft vom 20. Februar 2011: Ehemalige
„Hamburg-Partei“ erobert absolute Mehrheit zurück, in: ZParl, 42. Jg. (2011), H. 4, S. 724 –
744.
4 Vgl. ders., Die Hamburger Bürgerschaftswahl vom 15. Februar 2015: Rot-Grün für Olympia und
für die Referendumsfestigkeit der hanseatischen Feierabenddemokratie, in: ZParl, 46. Jg. (2015),
H. 3, S. 518 – 538.
5 Vgl. Michael Neumann, Hamburg 2024 – Das gab es nur einmal!, in: Astrid Lorenz / Christian
Pieter Hoffmann / Uwe Hitschfeld (Hrsg.), Partizipation für alle und alles? Fallstricke, Grenzen,
Möglichkeiten, Wiesbaden 2020, S. 25 – 41.
6 Vgl. Peter Ulrich Meyer, Die glücklichsten Jahre des Politikers Olaf Scholz, in: Hamburger
Abendblatt vom 31. Dezember 2019, S. 12.
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.578 Dokumentation und Analysen
über 1,8 Millionen Menschen.7 Im selben Zeitraum wuchsen die Steuereinnahmen der
Stadt um gut 60 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro im Jahre 2019.8 Das versetzte den Senat
nicht nur in die Lage, die seit 2015 steigenden Kosten für die Unterbringung und Integra-
tion von Flüchtlingen zu bewältigen, sondern auch seine Wahlversprechen zu halten: Der
öffentliche Personennahverkehr beförderte 2016 hundert Millionen Fahrgäste mehr als
noch 2010, nämlich 770,5 Millionen. Für seine Kitas gab Hamburg 2017 822 Millionen
Euro aus, mehr als doppelt so viel wie noch 2010. In der Schulpolitik passte Hamburg die
Zahl der Lehrer automatisch an die steigende Zahl der Schüler an und baute das Ganz-
tagsangebot der Grundschulen flächendeckend aus. Den Bau von Sozialwohnungen stei-
gerte die Stadt auf etwa 3.000 im Jahr.9
Die positive Ausgangslage für den rot-grünen Senat spiegelte sich in einer Meinungsum-
frage vom Februar 2019 wider. 85 Prozent der Hamburger schätzten die wirtschaftliche
Situation der Stadt positiv ein – ein ähnlich hoher Rekordwert wie im Januar 2015 (87
Prozent). Eine Mehrheit von 54 Prozent zeigte sich auch mit der Arbeit des Senats zufrie-
den. Wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Fragen spielten demzufolge keine herausra-
gende Rolle; am stärksten beschäftigten die Hamburger verkehrs- (38 Prozent), wohnungs-
markt- (32 Prozent) und bildungspolitische Fragen (26 Prozent). In der
Kompetenzzumessung lag die SPD auf nahezu allen Politikfeldern vorn. Nur in der Ver-
kehrspolitik konnten die Grünen gleichziehen, in der Umweltpolitik wurde ihnen wie bei
der Inneren Sicherheit der CDU die höchste Kompetenz zugeschrieben.10
Am 26. Mai 2019 verschoben sich die Kräfte im Hamburger Parteiensystem deutlich –
vor allem zwischen SPD und Grünen. In der Europawahl waren die Grünen mit 31,1
Prozent der Stimmen vor SPD (19,8 Prozent) und CDU (17,7 Prozent) zur stärksten Partei
in der Stadt geworden. Für die Hamburger Landespolitik noch bedeutsamer waren die
gleichzeitig stattfindenden Bezirksversammlungswahlen, in denen die Grünen landesweit
31,3 Prozent der Stimmen und 111 von 357 Mandaten erzielten. In vier der sieben Ham-
burger Bezirke waren sie zudem stärkste Partei geworden.11 Diese Erfolge in praktische
Kommunalpolitik umzusetzen war jedoch nicht immer leicht. Nur in Altona, wo die Grü-
nen mit wechselnden Mehrheiten regierten, und in Hamburg-Nord, wo sie mit der SPD
koalierten, gelang der Partei die Wahl grüner Bezirksamtsleiter.12 In Hamburg-Mitte wech-
selten sechs Bezirksabgeordnete der Grünen zur SPD und ermöglichten es einer Koalition
aus SPD, CDU und FDP, Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) im Amt zu halten.13 In
Eimsbüttel scheiterte eine Koalition der Grünen und der CDU gleich zweimal damit,
7 Vgl. Freie und Hansestadt Hamburg, Finanzbericht 2019/2020, Hamburg, Juli 2020, S. 3.
8 Vgl. Oliver Hollenstein, Coronavirus in Hamburg: Das Ende der goldenen Jahre, in: Die Zeit
Hamburg vom 26. Mai 2020.
9 Vgl. Freie und Hansestadt Hamburg, a.a.O. (Fn. 7), S. 3 – 4.
10 Infratest dimap, LänderTREND Hamburg Februar 2019 im Auftrag des NDR.
11 Vgl. Statistisches Amt für Schleswig-Holstein und Hamburg, Endgültiges Ergebnis der Europa-
wahl 2019 im Vergleich zur Europawahl 2014 in Hamburg, Hamburg, 7. Juni 2019; dasselbe,
Analyse der Wahlen zu den Bezirksversammlungen in Hamburg am 26. Mai 2019 – Endgültige
Ergebnisse. Teil 1: Bezirksergebnisse, Mandatsverteilung, Aggregiertes Ergebnis für Hamburg,
Hamburg, 13. Juni 2019.
12 Vgl. Andreas Dey / Peter Ulrich Meyer, Hamburgs erste grüne Bezirksamtsleiterin, in: Hamburger
Abendblatt vom 27. September 2019, S. 11.
13 Vgl. Frank Drieschner, Im Zweifel gegen die Angeklagten, in: Die Zeit vom 25. Juli 2019; ders.,
Grüne in Hamburg-Mitte kommen Parteiausschluss zuvor, in: Die Zeit vom 1. Oktober 2019.
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Horst: Die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft vom 23. Februar 2020 579
SPD-Bezirksamtsleiter Kay Gätgens durch eine Politikerin der Grünen zu ersetzen.14 Dies
war kein gutes Omen für eine schwarz-grüne Koalition auf Landesebene, zumal sich hier
einige Abgeordnete der CDU dem liberalen Kurs ihres Bürgermeisterkandidaten widersetz-
ten.
Ende Dezember 2019, kurz bevor der Wahlkampf in seine entscheidende Phase eintrat,
zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Koalitionspartnern ab. In
der Sonntagsfrage hatten die Grünen mit 26 Prozent fast zur SPD aufgeschlossen, die auf
28 Prozent kam. Während das Regierungslager 54 Prozent der Hamburger hinter sich
wusste, kamen die vier Oppositionsparteien CDU (17), Linke (11), AfD (7) und FDP (6)
zusammen auf nur 41 Prozent. Die Voraussetzungen für einen personalisierten Bürgermeis-
terwahlkampf waren gegeben; schwer würde es jedoch für die Opposition werden, sich in
diesem Zweikampf zur Geltung zu bringen. Bei den persönlichen Popularitätswerten hatte
der Erste Bürgermeister Ende Dezember die Nase vorn: 56 Prozent waren mit Tschentschers
Arbeit zufrieden, 39 Prozent mit der seiner Stellvertreterin. CDU-Spitzenkandidat Marcus
Weinberg lag mit Zufriedenheitswerten von 22 Prozent noch hinter der Linken-Fraktions-
chefin Cansu Özdemir, deren Arbeit 35 Prozent positiv bewerteten.15
2. Der Wahlkampf
Nach den Sommerferien 2019 nahmen die Planungen der Parteien für ihre Bürgerschafts-
wahlkampagnen an Fahrt auf. Mit der Auswahl ihrer Werbeagenturen wollten SPD, Grüne
und CDU Siegeszuversicht projizieren. Die SPD ging mit Frank Stauss, der schon für Ger‑
hard Schröder (2005), Olaf Scholz (2011) und Malu Dreyer (2016) Wahlkampf gemacht
hatte, ins Rennen. Stauss konzipierte für Spitzenkandidat Peter Tschentscher das Image eines
Bürgermeisters, der die gesamte Stadt im Blick habe. Er stehe für „Vertrauenswürdigkeit,
Intelligenz und Neugierde“, sei „überlegt und beherrscht“. Außerdem stellte Stauss die
Wirtschaftskompetenz der Hamburger SPD, die sie von der Bundes-SPD abhebe, ins Zen-
trum seiner Kampagne.16
Für die Grünen arbeitete Matthias Riegel von der PR-Agentur Wigwam, der bereits für
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann Wahlkampf gemacht hatte,
am Image der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Seine Idee war, der Grünen
das Ansehen einer stets freundlichen, herzlichen und verbindlichen „Landesmutter“ zu
geben, die als Mutter zweier Töchter auch in konservativ-bürgerlichen Kreisen Sympathie
genieße. Fegebank pflege zudem „einen Politikstil, bei dem es kein ‚von oben herab‘ gibt,
sondern viel Wert auf Dialog und das Gemeinsame gelegt wird“. Die grüne Bürgermeister-
kandidatin stehe „für Leidenschaft und Lust auf Zukunft“. Das Motto der Kampagne sei
„Bock auf besser“. Laut Riegel gehe es „um Zuversicht und Mut, die Stadt besser zu
machen“17.
14 Vgl. Andreas Dey, Grünen-Debakel und die Folgen für Hamburg, in: Hamburger Abendblatt
vom 21. Dezember 2019, S. 12.
15 Infratest dimap, LänderTREND Hamburg Dezember 2019 im Auftrag des NDR.
16 Zitiert bei Jens Meyer-Wellmann, Von Schröder, Günther und Kretschmann lernen, in: Hambur-
ger Abendblatt vom 31. August 2019, S. 12.
17 Zitiert ebenda.
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.580 Dokumentation und Analysen
Kerstin Flemming von der Agentur Guru hatte 2017 für Daniel Günther (CDU) die Kam-
pagne entworfen, die ihn ins Ministerpräsidentenamt von Schleswig-Holstein führte. In
Hamburg übernahm sie eine deutlich schwierigere Aufgabe, war doch die CDU lange dar-
an gescheitert, überhaupt einen Bürgermeisterkandidaten zu finden. Landeschef Roland
Heintze und Fraktionsvorsitzender André Trepoll, die beide selbst auf die Kandidatur ver-
zichtet hatten, mussten im Oktober 2018 erst den krankheitsbedingten Rückzug von Aygül
Özkan, der ehemaligen Sozial- und Integrationsministerin Niedersachsens, verkraften und
fanden dann lange keinen auswärtigen Kandidaten. Im April 2019 erklärte sich schließlich
Marcus Weinberg, der bereits von 2011 bis 2015 die Landes-CDU geführt und dabei
die „liberale Großstadtpartei“ propagiert hatte, zur Kandidatur bereit.18 Mit dem Bundes-
tagsabgeordneten, der einer Zusammenarbeit mit den Grünen offen gegenüberstand,
wollte Guru „das Herz des urbanen Milieus erreichen“. Weinberg sollte als Familienvater,
Vespa-Fahrer und St.-Pauli-Fan einerseits nahbar, andererseits aber auch als „Visionär“
erscheinen.19
In den letzten vier Monaten des Jahres 2019 beschäftigten sich die Parteien mit ihren
Wahlprogrammen und Kandidatenlisten für die Bürgerschaftswahl. Den Anfang machte
die CDU, deren Landesvorstand Ende August seinen Personalvorschlag präsentierte. Nach
Spitzenkandidat Weinberg kandidierte mit Antje Möller, der Vorsitzenden der Hamburger
Elternkammer, eine Quereinsteigerin auf dem zweiten Platz der Landesliste. Der CDU-
Landesvorsitzende Heintze warb mit dem Slogan „jünger, weiblicher, frischer“ für die Liste,
die vier Frauen unter den ersten zehn und zehn Frauen unter den ersten 20 Kandidaten
vorsah. Dies war jedoch ein wenig Augenwischerei, denn die Besonderheiten des Hambur-
ger Wahlrechts haben zur Folge, dass bei einer Partei in der Größenordnung der Hambur-
ger CDU die Landesliste kaum zum Zuge kommt. In den 17 Wahlkreisen aber hatte die
CDU auch 2020 nur drei Spitzenkandidatinnen nominiert.20
Das Wahlprogramm der CDU unter dem Titel „Unser Hamburg: Wir wachsen zusam-
men“ war wenig markant; es postulierte „Freiheit statt Bevormundung – Gemeinschaft,
Gerechtigkeit und Leistungsbereitschaft stärken!“21 Priorität im Programm genossen die
Kernkompetenzen der CDU: Wirtschaft und Innere Sicherheit.22 Mit diesen Themen
drang die CDU jedoch kaum durch, weil die Bilanz des Senats auf beiden Feldern kaum
Angriffsflächen bot. Es waren auch nicht die Themen, die den Sozial- und Familienpoliti-
ker Weinberg umtrieben. Das CDU-Programm strich deshalb auch solche Materien heraus,
die eher in die Kompetenz der politischen Konkurrenten fielen. Wie SPD und Grüne setzte
man auf die „Mobilitätswende“, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und das
Fahrrad. Die vom Senat geplanten neuen Schnellbahnlinien U 5 und S 4 trug die CDU
mit, der Umstieg auf Busse und Bahnen sollte durch ein preiswertes 365-Euro-Jahresticket
für den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) erleichtert werden. Die bei den Grünen nach
18 Vgl. Frank Drieschner, Marcus Weinberg: Der Mittelfeldspieler, in: Die Zeit vom 22. April 2019.
19 Zitiert bei Jens-Meyer-Wellmann, a.a.O. (Fn. 16).
20 Vgl. Andreas Dey, CDU überrascht bei Listenaufstellung, in: Hamburger Abendblatt vom
26. August 2020, S. 9.
21 CDU Hamburg, Unser Hamburg: Wir wachsen zusammen. #ZUSAMMENWACHSEN-
DESTADT, Hamburg, Oktober 2019, S. 7.
22 Vgl. „CDU setzt auf Wirtschaft und Innere Sicherheit“, in: Hamburger Abendblatt vom
30. Oktober 2019, S. 12.
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Horst: Die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft vom 23. Februar 2020 581
wie vor populäre Idee einer Stadtbahn sollte zumindest in einer reduzierten Variante für
den Hamburger Westen ergebnisoffen geprüft werden. Wie SPD und Grüne warb die
CDU auch für die Energiewende, die Steigerung des Wohnungsbaus und Hamburgs Rolle
als Wissenschaftsmetropole. Insgesamt, so der Wahlaufruf am Ende des Programms, ziele
man auf „die Menschen, die den Laden am Laufen halten“, sie „sollen entlastet und geför-
dert werden“23.
Die Grünen verabschiedeten Ende September ihr „Zukunftsprogramm“, das Klima-
schutz und Verkehrswende in den Mittelpunkt rückte.24 Bis spätestens 2035 wollten sie
Hamburg klimaneutral machen, wobei die „Verkehrswende“ im Mittelpunkt stand. Dazu
gehörten die Ausweitung des kostenpflichtigen Parkens und des Bewohnerparkens, die
„auto-arme Innenstadt“, die Priorisierung eines preiswerten ÖPNVs, der Ausbau von Fahr-
radstraßen und geschützten Fahrradstreifen, die Fortführung des Schnellbahnausbaus und
die Stadtbahn als Vision für die Zukunft. Darüber hinaus propagierten die Grünen ein
Wohnungsbauprogramm. In der Wissenschaftspolitik konnten sie darauf verweisen, die
Universität unter Wissenschaftssenatorin Fegebank, die kurz vor der Wahl vom Deutschen
Hochschulverband zur „Wissenschaftsministerin des Jahres“ gewählt wurde, zur Exzellenz-
universität gemacht zu haben.25 In der Innen- und Rechtspolitik zeigten die Grünen Mut
zu unpopulären Forderungen: Entkriminalisierung des Cannabisbesitzes, des Schwarzfah-
rens und der Vermummung bei Demonstrationen. Das Wahlalter wollten sie auf 14 Jahre
absenken.26
Ihre Listen stellten die Grünen am 9. November auf einer Mitgliederversammlung auf.
Anders als früher gab es diesmal auf den ersten sechs Plätzen der Landesliste keine Kampf-
kandidaturen. Spitzenkandidatin Katharina Fegebank erhielt 97 Prozent der Stimmen, es
folgten im bewährten Wechsel der Geschlechter der Fraktionsvorsitzende Anjes Tjarks, die
Parteivorsitzende Anna Gallina, Umweltsenator Jens Kerstan, Sozial- und Frauenpolitikerin
Mareike Engels und Justizsenator Till Steffen.27 Das Spitzenpersonal der Grünen hatte sich
darüber hinaus durch Doppelkandidaturen auf der Landesliste und in den Wahlkreisen
gegen Überraschungen beim schwer berechenbaren Hamburger Wahlrecht abgesichert.28
Die SPD kürte Bürgermeister Peter Tschentscher am 2. November zum Spitzenkandida-
ten. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgten Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, Fraktions-
chef Dirk Kienscherf, Parteichefin Melanie Leonhard und der Eimsbütteler Kreisvorsitzende
Milan Pein. In seiner Nominierungsrede zog Tschentscher zufrieden Bilanz der neunjährigen
SPD-Regierungszeit. Zu den besonderen Erfolgen zählte er das Wohnungsbauprogramm,
den kostenfreien Kita-Besuch, das flächendeckende Ganztagsangebot in der Grundschule,
die Neueinstellungen von Lehrern und den Ausbau des ÖPNVs. Mit Stolz verwies er auf
23 CDU Hamburg, a.a.O. (Fn. 21), S. 81.
24 Vgl. Bündnis 90/Die Grünen Hamburg, Hamburg hat eine Wahl. Grünes Zukunftsprogramm
für unsere Stadt, Hamburg, September 2020.
25 „Hochschulverband zeichnet Katharina Fegebank aus“, in: Hamburger Abendblatt vom 11. Feb-
ruar 2020, S. 12.
26 Vgl. Jens Meyer-Wellmann, Wie die Grünen Hamburg umgestalten wollen, in: Hamburger
Abendblatt vom 25. September 2019, S. 17.
27 Vgl. ders., Hamburg soll ein „Labor zur Welt“ werden, in: Hamburger Abendblatt vom 11.
November 2019, S. 10.
28 Vgl. Peter Ulrich Meyer, Neue Harmonie unter Männern an der Grünen-Spitze, in: Hamburger
Abendblatt vom 30. Oktober 2019, S. 12.
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.582 Dokumentation und Analysen
die Rekordzahl von einer Million sozialversicherungspflichtig beschäftigten Menschen und
auf die niedrigste Kriminalitätsrate seit 30 Jahren.29
Ihr vollständig ausformuliertes „Regierungsprogramm“30 für die kommenden fünf Jahre
legten die Sozialdemokraten vier Wochen später vor. In der Verkehrspolitik setzte sie neben
dem „Hamburg-Takt“ im ÖPNV und dem kostenlosen HVV-Schülerticket auf den Bau
der S 4 und der U 5, die Hafenquerspange (A 26-Ost) zur Verbindung von A 1 und A 7
sowie eine Untertunnelung der Köhlbrandquerung. Einen Schwerpunkt nahm das „bezahl-
bare Wohnen“ ein. Hier versprach die SPD, künftig den Neubau von jährlich 4.000 Woh-
nungen zu fördern und eine 30-jährige Mietpreisbindung für diese Wohnungen vorzuse-
hen. Dem Klimawandel sollte durch Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien
begegnet werden. Hafen und Flughafen, zu denen sich die wirtschaftsfreundliche Hambur-
ger SPD bekannte, sollten ihren Teil dazu beitragen, Hamburg bis zum Jahr 2050 kli-
maneutral zu machen. In der Bildungspolitik strebte die SPD den Bau 40 neuer Schulen
mit 5.000 Kita-Plätzen an.31
Noch schwerer als die CDU hatten es die drei anderen in der Bürgerschaft vertretenen
Parteien FDP, AfD und Linke, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erringen. Die FDP
wählte ihre Fraktionsvorsitzende Anna von Treuenfels-Frowein zur Spitzenkandidatin und leg-
te ihre Schwerpunkte im Wahlkampf auf digitale Bildung in der frühen Kindheit, Klima-
schutz durch technischen Fortschritt und einen „Wohnkosten-TÜV“.32 Die AfD trat mit
ihrem Landes- und Fraktionsvorsitzenden Dirk Nockemann als Spitzenkandidat an. Sie woll-
te die Polizei stärken und setzte sich gegen die „Umwelthysterie“ zur Wehr, wie sie ihrer
Meinung nach in den regelmäßigen „Fridays-for-Future“-Demonstrationen zum Ausdruck
kam.33 Bei der Linken gab es auch auf den ersten Plätzen der Landesliste Kampfkandidatu-
ren: Fraktionschefin Cansu Özdemir wurde zur Spitzenkandidatin gewählt; es folgten David
Stoop, Sprecher des Landesverbands, und Sabine Boeddinghaus, die Co-Fraktionsvorsitzende
in der Bürgerschaft. Die Linke trat für eine „radikale sozial-ökologische Wende“, einen kos-
tenlosen ÖPNV und einen „Mietendeckel“ nach Berliner Vorbild ein.34
Der Wahlkampf bis Ende des Jahres wurde von den grünen Themen Klima- und Ver-
kehrspolitik geprägt. Die Parteien reagierten auf Aktivitäten aus der Zivilgesellschaft wie
die wöchentlichen „Fridays-for-Future“-Demonstrationen, eine Volksinitiative zur Förde-
rung des Radverkehrs35 oder bezirkliche Verkehrsprojekte, die das „autofreie Ottensen“
29 Vgl. ders., SPD feiert Kandidat Tschentscher, in: Hamburger Abendblatt vom 4. November
2019, S. 10.
30 SPD Hamburg, Zukunftsstadt Hamburg. Lebenswert, wirtschaftsstark und klimafreundlich für
alle. SPD-Regierungsprogramm 2020 – 2025, Hamburg, November 2019.
31 Vgl. Jens Meyer-Wellmann, SPD bejubelt Tschentscher und sich selbst, in: Hamburger Abendblatt
vom 2. Dezember 2019, S. 9; Peter Ulrich Meyer, „Wir haben bewiesen, dass wir es können!“, in:
Hamburger Abendblatt vom 27. November 2019, S. 12.
32 Vgl. „Hamburger FDP legt Schwerpunkte für Wahlkampf fest“, in: Hamburger Abendblatt vom
2. September 2019, S. 12.
33 Vgl. „AfD-Kehrtwende: Nockemann setzt sich gegen Wolf durch“, in: Hamburger Abendblatt
vom 30. September 2019, S. 12.
34 Vgl. Andreas Dey, Linke macht sich das Leben schwer, in: Hamburger Abendblatt vom 21. Okto-
ber 2019, S. 10.
35 Vgl. die Presseberichterstattung auf der Webseite der Volksinitiative „Radentscheid Hamburg“,
https://radentscheid-hamburg.de/presse/ (Abruf am 9. Juli 2020).
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Horst: Die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft vom 23. Februar 2020 583
erprobten.36 Die Grünen legten bereits im August 2019 ihren Plan für die „weitestgehend
autofreie“ oder „autoarme“ Innenstadt vor. Der parteipolitisch nicht mehr aktive Altbür-
germeister Ole von Beust (CDU) ärgerte viele in seiner Partei damit, dass er diese Pläne
öffentlich unterstützte.37 Er und Spitzenkandidat Weinberg schienen die einzigen CDU-
Politiker zu sein, die in der Verkehrspolitik an die Grünen anschlussfähig waren. Ansonsten
machten die Christdemokraten vor allem damit von sich reden, dass sie die vielen Baustel-
len, Staus und die steigende Zahl der Unfälle auf den neuen Fahrradstraßen kritisierten.38
SPD, Grüne und die interessierten Verbände zeigten sich wenig beeindruckt von dieser
Kritik und dominierten die Öffentlichkeit in den letzten drei Monaten vor Weihnachten
mit ihrer Diskussion um den Klimaplan des Senats. Dabei handelte es sich um die Zusam-
menstellung von mehr als 400 Einzelmaßnahmen, mit denen Hamburg bis zum Jahre
2030 seinen Kohlendioxidausstoß gegenüber 1990 um 55 Prozent reduzieren und bis 2050
klimaneutral werden wollte. Bürgermeister Tschentscher und Umweltsenator Kerstan stritten
darüber, wer die treibende Kraft hinter dem Klimaplan gewesen sei.39 Anfang Dezember
einigte sich der rot-grüne Senat auf den Entwurf eines Klimaschutzgesetzes40, das von der
Bürgerschaft auf ihrer letzten Sitzung vor der Wahl verabschiedet wurde. Mit Unterstüt-
zung der CDU und der Linken wurde die Begrenzung der Erderwärmung als Staatsziel in
die Hamburgische Verfassung aufgenommen.41
Mit Beginn des neuen Jahres trat der Wahlkampf in seine heiße Phase ein. Am meisten
Beachtung in diesen letzten sieben Wochen vor der Wahl fanden die diversen Streitgespräche
zwischen Bürgermeister Tschentscher und seiner Herausforderin Fegebank. Vier solcher
„Duelle“ gab es, die im Fernsehen ausgestrahlt oder im Internet verbreitet wurden. Den
Anfang machte die Wochenzeitung Die Zeit am 19. Januar mit einem sachlich geführten
90-minütigen Gespräch, das kaum inhaltliche Unterschiede zwischen den beiden Kontra-
henten herausarbeitete.42 Es folgte am 6. Februar ein vom Hamburger Abendblatt veranstal-
tetes, ebenfalls 90 Minuten dauerndes Duell, das durch die Ereignisse in Thüringen über-
schattet wurde. Beide Spitzenkandidaten zeigten sich schockiert von der Wahl Kemmerichs
36 Vgl. „Ottensen autofrei: Initiative droht mit Klage“, in: Hamburger Abendblatt vom 17. August
2019, S. 13.
37 Vgl. „Ole von Beust wirbt für autofreie Hamburger Innenstadt“, in: Hamburger Abendblatt vom
18. November 2019, S. 1, 9.
38 Vgl. Jens Meyer-Wellmann, Ärger um Straßenbaustellen: Warum wird nicht rund um die Uhr
gearbeitet?, in: Hamburger Abendblatt vom 10. September 2019, S. 1; ders., Zahl der Unfälle auf
Hamburgs neuen Fahrradstreifen steigt, in: Hamburger Abendblatt vom 17. September 2019,
S. 1; Marc Hasse, CDU: Verkehrspolitik ist „außer Takt“, in: Hamburger Abendblatt vom
19. Dezember 2019, S. 14.
39 Vgl. Jens Meyer-Wellmann, Klimakrisen im rot-grünen Senat, in: Hamburger Abendblatt vom 12.
Oktober 2019, S. 12; ders., SPD mit neuer Strategie gegen Grüne, in: Hamburger Abendblatt
vom 9. November 2019, S. 12.
40 Vgl. Marc Hasse / Andreas Dey, Hamburger Klimaplan: Aus für Ölheizungen – Solaranlagen
Pflicht, in: Hamburger Abendblatt vom 4. Dezember 2019, S. 1, 12.
41 Vgl. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Plenarprotokoll 21/113, 12. Februar
2020, S. 8898 – 8899.
42 Vgl. „Er oder Sie? Autofreie Innenstadt, Hafen, Klima: Die Bürgermeister-Kandidaten Peter
Tschentscher und Katharina Fegebank im großen Streitgespräch“, in: Die Zeit Hamburg vom 30.
Januar 2020, S. 1 – 2.
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.584 Dokumentation und Analysen
mit den Stimmen der AfD und erleichtert über seinen Rückzug am Tag danach.43 Sechs
Tage später trafen sich beide erneut zu einem halbstündigen, von RTL Nord gesendeten TV-
Duell, in dem die Herausforderin mit Verve die „echte Mobilitätswende“ propagierte, wäh-
rend der Bürgermeister auf die Bremse trat.44 Den Höhepunkt der Streitgespräche bildete
das einstündige, zur besten Sendezeit ausgestrahlte TV-Duell fünf Tage vor der Wahl im
NDR, das von der Cum-Ex-Affäre überlagert wurde. Dabei ging es um die Frage, ob die
Warburg Bank im Jahre 2016 politischen Einfluss auf den Hamburger Senat genommen
hatte, um eine Steuernachzahlung in Höhe von 47 Millionen Euro zu verhindern. Fegebank
mahnte „dringend“ Aufklärung an und forderte einen Untersuchungsausschuss, während
Tschentscher, zur damaligen Zeit der zuständige Finanzsenator, den Vorwurf politischer Ein-
flussnahme zurückwies45 – zu Recht, wie die Berichterstattung in den folgenden Tagen zei-
gen sollte.46
Intensiv diskutiert wurden auch die Bündnisoptionen. In einem Sechsparteiensystem
mit zwei für koalitionsunfähig erachteten Parteien (Linke und AfD) eröffnete sich ein
Spielraum für Koalitionsstrategien – auch wenn für SPD und Grüne die Lage eigentlich
klar war. Bürgermeister Tschentscher wiederholte immer wieder, dass Rot-Grün die „nahelie-
gende Option“ sei. Er betonte allerdings auch, dass für ihn diese Option nur als Bürger-
meister und nicht als Juniorpartner infrage käme.47 Tschentscher signalisierte aber auch
Offenheit der CDU und der FDP gegenüber, um sich für Wähler dieser Parteien wählbar
zu machen und den Druck auf die Grünen zu erhöhen. Für CDU und FDP kristallisierte
sich im Wahlkampf die rot-schwarze oder die „Deutschland-Koalition“ als die bevorzugte,
weil jeweils einzig realistische Option heraus.48 Katharina Fegebank beharrte auf ihrer Prä-
ferenz für Grün-Rot – machte aber zugleich deutlich, dass sie nicht, nur um Erste Bürger-
meisterin zu werden, eine Koalition mit der CDU und der FDP anstreben würde.49
3. Das Wahlergebnis
Am Wahlabend des 23. Februar gab es zwei Sieger – einen gefühlten und einen realen. Der
gefühlte Sieger war die Hamburger SPD, die zwar gegenüber ihrem Ergebnis von vor fünf
Jahren 6,4 Punkte verlor und nur noch auf einen Stimmenanteil von 39,2 Prozent der
Stimmen kam, aber mit deutlichem Vorsprung vor ihrem grünen Koalitionspartner lag.
43 Vgl. Alexander Josefowicz, Tschentscher und Fegebank – das Duell, in: Hamburger Abendblatt
vom 7. Februar 2020, S. 12.
44 „Hamburg wählt: TV-Duell der Spitzenkandidaten Peter Tschentscher vs. Katharina Fegebank“,
in: RTL Nord online vom 12. Februar 2020, https://www.rtlnord.de/nachrichten/tv-duell-zur-
wahl-in-hamburg-peter-tschentscher-vs-katharina-fegebank.html (Abruf am 8. Juli 2020).
45 „TV-Duell vor Hamburg-Wahl: Cum-Ex-Affäre ist Thema“, in: NDR online vom 18. Februar
2020, https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburg-Wahl-Fegebank-und-Tschentscher-
im-TV-Duell,wahlduell130.html (Abruf am 8. Juli 2020).
46 Vgl. Andreas Dey, Cum-Ex: Neue Zweifel an den Vorwürfen, in: Hamburger Abendblatt vom
20. Februar 2020, S. 12.
47 Zitiert bei „Tschentscher stellt Bedingung für weitere Koalition“, in: Hamburger Abendblatt vom
30. Dezember 2019, S. 11.
48 Vgl. „CDU favorisiert jetzt ein Bündnis mit SPD und FDP“, in: Hamburger Abendblatt vom
10. Januar 2020, S. 12.
49 So im Fernsehduell bei RTL Nord, a.a.O. (Fn. 44).
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Horst: Die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft vom 23. Februar 2020 585
Tabelle 1: Das endgültige Ergebnis der Hamburger Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020
(in Klammern Veränderungen gegenüber 2015)
Landesliste (LL) Wahlkreise (WK) Sitze
Anzahl % Anzahl % Insgesamt LL WK
Wahlberechtigte 1.316.691 100 1.361.691 100
Wahlbeteiligung 829.497 63,0 (+6,5) 829.497 63,0
Briefwahlquote 283.793 34,2 (+3,5) 283.793 34,2
Abgegebene 828.973 100 827.572 100
ungültige 8.737 1,1 (-1,7) 15.389 1,9
gültige Stimmhefte 820.236 98,9 (+1,7) 812.183 98,1
Gültige Stimmen 4.062.376 100 4.016.871 100 123 (+2) 52 71
aus Heilungsregel 49.940 1,2
SPD 1.593.825 39,2 (-6,4) 1.403.351 34,9 54 (-4) 26 28
CDU 453.717 11,2 (-4,7) 605.273 15,1 15 (-5) - 15
Linke 368.683 9,1 (+0,6) 446.600 11,1 13 (+2) 6 7
FDP 202.059 4,97 (-2,4) 220.031 5,5 1 (-8) - 1
Grüne 981.628 24,2 (+11,9) 1.032.826 25,7 33 (+18) 13 20
AfD 215.306 5,3 (-0,8) 217.201 5,4 7 (-1) 7 -
ÖDP 27.617 0,7 (+0,3) 25.903 0,6 - - -
Freie Wähler 25.023 0,6 16.357 0,4 - - -
Piraten 20.559 0,5 (-1,1) 17.575 0,4 - - -
Volt Hamburg 52.361 1,3 25.524 0,6 - - -
Die Partei 56.755 1,4 (+0,5) - - - - -
Hamburg 21.530 0,5 - - - - -
Die Humanisten 8.354 0,2 - - - - -
Gesundheitsforschung 7.759 0,2 - - - - -
Tierschutzpartei 27.200 0,7 - - - - -
DiB - - 2.808 0,1 - - -
Menschliche Welt - - 1.702 0,0 - - -
Sedat Ayhan - - 1.067 0,0 - - -
SLDP - 653 0,0 - - -
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Analyse der Bürgerschaftswahl am
23. Februar 2020 in Hamburg. Endgültige Ergebnisse, 12. März 2020, S. 5 – 7.
Die Grünen waren mit einem Rekordergebnis von 24,2 Prozent (plus 11,9 Punkte) die
tatsächlichen Sieger dieser Wahl. Bei Landtagswahlen hatten sie bisher überhaupt nur ein-
mal in Baden-Württemberg ein besseres Ergebnis erzielt.50 Dennoch hatten sie ihr Wahlziel,
nach 199 männlichen Bürgermeistern die erste Bürgermeisterin der Stadt zu stellen, am
Ende klar verfehlt. Die SPD, die in der deutschlandweiten Sonntagsfrage zwischenzeitlich
auf unter 15 Prozent abgesackt war, stellte dagegen unter Beweis, dass sie noch Wahlen
gewinnen und den starken Partner in einer stabilen Zweierkoalition stellen konnte. Zu den
Gewinnern zählten auch die Linke, die 0,6 Punkte auf 9,1 Prozent zulegte, und die Ham-
burger Wähler, von denen knapp 100.000 mehr von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten
als noch 2015. Mit 63 Prozent lag die Wahlbeteiligung 6,5 Punkte über derjenigen von vor
fünf Jahren. Unter den sonstigen Parteien schnitten „Die Partei“ und „Volt Hamburg“ mit
1,4 beziehungsweise 1,3 Prozent am besten ab (vgl. Tabelle 1).
50 Vgl. Forschungsgruppe Wahlen, Wahl in Hamburg. Eine Analyse der Bürgerschaftswahl vom 23.
Februar 2020, Mannheim, März 2020, S. 8.
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.586 Dokumentation und Analysen
In der nicht so fernen Hauptstadt fühlte sich darüber hinaus noch einer als Sieger: Vize-
kanzler Olaf Scholz war extra vorzeitig vom G20-Finanzministertreffen in Saudi-Arabien
nach Berlin zurückgekehrt, um mit seinen Hamburger Genossen feiern zu können. Er
erschien am Wahlabend auffallend oft vor Mikrophonen und lächelte an der Seite seines
Nachfolgers im Amt des Hamburger Bürgermeisters vergnügt in die Fernsehkameras. Fast
40 Prozent waren ein Ergebnis, das vielen in Berlin fast unwirklich vorkam. Nicht so
Scholz, der 2011 und 2015 in Hamburg sogar noch bessere Resultate erzielt hatte und
darauf hinwies, dass es gelungen sei, diese früheren Wahlerfolge mit seinem pragmatischen
und sozialen Politikstil fortzusetzen. Das Wahlergebnis sei „ein Mutsignal für uns alle“,
so Scholz. „Wir können gewinnen. Wenn wir das in einer richtigen Aufstellung machen,
können wir Wahlen so entscheiden, dass wir auch bei der nächsten Bundestagswahl vorne
liegen.“51 Die SPD hatte plötzlich wieder einen Favoriten für die Kanzlerkandidatur.52
Eindeutige Verlierer der Hamburger Bürgerschaftswahl waren die „bürgerlichen“ Oppo-
sitionsparteien CDU und FDP – nicht zufällig also diejenigen, die zweieinhalb Wochen
zuvor die Republik erschüttert hatten, als sie ihren „faustischen Pakt“53 mit der Thüringer
AfD des Björn Höcke schlossen. Die CDU büßte 4,7 Punkte ein und kam nur noch auf
11,2 Prozent der Stimmen – ihr schlechtestes Ergebnis in Hamburg und ihr zweitschlech-
testes bei einer Landtagswahl überhaupt. Die FDP verlor 2,4 Punkte und scheiterte mit
4,97 Prozent an der Sperrklausel. Auch die AfD verlor 0,8 Punkte – erstmalig bei einer
Landtagswahl54 – und übersprang nur knapp und spät am Wahlabend die Fünf-Prozent-
Hürde (vgl. Tabelle 1). In der „Berliner Runde“ vor der Tagesschau sahen SPD-Generalse-
kretär Lars Klingbeil und Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner die bundespoliti-
sche Lehre der Hamburg-Wahl vor allem darin, dass die „geistigen Brandstifter der AfD“
(Klingbeil) und „diejenigen, die für Hass und Hetze in diesem Land verantwortlich sind“
(Kellner) die Quittung bekommen hätten. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak betonte
dagegen, dass es „ein ganz persönlicher Sieg des Amtsinhabers in Hamburg“ gewesen sei.55
In der nächsten Bürgerschaft werden nur noch fünf Parteien in Fraktionsstärke vertreten
sein. Größte Fraktion bleibt die SPD mit 54 Sitzen, vier weniger als 2015. Zweitstärkste
Fraktion sind erstmals die Grünen mit 33 Sitzen (plus 18). Zusammen verfügen SPD und
Grüne über 87 der 123 Sitze – eine Zweidrittelmehrheit. Die Opposition ist schwach und
fragmentiert: Größte Oppositionspartei ist mit nur noch 15 Sitzen die CDU (-5), gefolgt
von der Linken mit 13 (plus zwei) und der AfD mit sieben Mandaten (-1). Als fraktionslo-
se Abgeordnete zog FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein, die in ihrem
Blankeneser Wahlkreis direkt gewählt wurde, ins Parlament ein (vgl. Tabelle 1).
51 Zitiert bei Lydia Rosenfelder / Christian Teevs, SPD-Sieg in Hamburg: Der Scholz-Plan, in: Der
Spiegel vom 24. Februar 2020.
52 Vgl. Mark Schieritz, Olaf Scholz: Operation Kanzleramt, in: Die Zeit vom 26. Februar 2020;
Mike Szymanski, Olaf Scholz und die SPD: Plötzlich Favorit, in: Süddeutsche Zeitung vom
15. Mai 2020.
53 Georg Anastasiadis, Wahl-Hammer in Thüringen: Landesregierung in Björn Höckes Fängen – Ein
Kommentar, in: Münchner Merkur vom 6. Februar 2020.
54 Forschungsgruppe Wahlen, a.a.O. (Fn. 50), S. 8.
55 „Berliner Runde zur Bürgerschaftswahl in Hamburg“, in: Tagesschau.de vom 23. Februar 2020,
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-665189.html (Abruf am 8. Juli 2020).
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Horst: Die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft vom 23. Februar 2020 587
3.1. Landeslisten- und Wahlkreisergebnisse
Hamburgs personalisiertes Verhältniswahlrecht mit offenen Listen eröffnet den Wählern
auf Landes- wie auf Wahlkreisebene eine Präferenzstimmgebung. Auf Landesebene („gelbe
Stimmzettel“) können sie ihre maximal fünf Stimmen Parteilisten („Listenstimmen“) und/
oder konkreten Bewerbern auf den Parteilisten („Personenstimmen“) geben. In den Wahl-
kreisen („rote Stimmzettel“) verfügen sie ausschließlich über fünf Personenstimmen. Insge-
samt wurden bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar 44 Prozent der gut vier Millionen
Stimmen auf der Landesliste als Personenstimmen vergeben, 54,7 Prozent als Listenstim-
men. Die restlichen gut 50.000 Stimmen (1,2 Prozent) stammten aus der zur Bürger-
schaftswahl 2020 neu eingeführten „Heilungsregel“. Ihr zufolge wurden ungültige gelbe
Stimmzettel, die mehr als fünf Stimmen enthielten, „geheilt“ – sofern die Stimmen aus-
schließlich an eine Partei gegeben wurden. Diese Partei erhielt dann die maximal mögli-
chen fünf Stimmen. Die Heilungsregel hat aus Sicht des Wahlgesetzgebers den Vorzug,
dass sie den Anteil der ungültigen Stimmen herunterrechnet – in diesem Fall von 2,3 auf
1,1 Prozent. SPD, AfD und CDU profitierten von dieser Regel am stärksten; ihre Wähler
hatten offensichtlich etwas größere Probleme mit dem Wahlrecht als die der anderen Par-
teien (vgl. Tabellen 1 und 2). Auf Grundlage dieser wundersamen „Heilung“ ungültiger
Stimmen auf eine Bewährung des Hamburger Wahlrechts zu schließen, wäre sicherlich
gewagt; dennoch scheinen sich die Hamburger Parteien mit dem Wahlrecht arrangieren zu
wollen.
Wie schon 2011 und 2015 war auch 2020 die SPD die einzige Partei, die mehr Perso-
nen- (56,5 Prozent) als Listenstimmen (41,6 Prozent) erhielt. Wie in den beiden vorange-
gangenen Wahlen war dies auch diesmal der Popularität des Bürgermeisters zu verdanken,
der allein 72 Prozent aller Personenstimmen der SPD auf sich vereinigte. Nur Olaf Scholz
(2011: 72,5, 2015: 79,2 Prozent) und der früheren FDP-Spitzenkandidatin Katja Suding
(2011: 74,1, 2015: 73,4 Prozent) war es bisher gelungen, einen höheren Anteil der Perso-
Tabelle 2: Anteil von Personen-, Listen- und „geheilten“ Stimmen an den Landesstimmen; Anteil
der Personenstimmen für die Spitzenkandidaten an den Personenstimmen ihrer Partei
Personenstimmen (in %) Geheilte
Listenstimmen
Partei Landesliste davon Spitzen- Stimmen
Insgesamt (in %)
kandidaten (in %) (in %)
SPD 1.593.825 901.176 (56,5) 649.132 (72,0) 662.264 (41,6) 30.385 (1,9)
CDU 453.717 180.561 (39,8) 64.669 (35,8) 267.291 (58,9) 5.865 (1,3)
Linke 368.683 130.754 (35,5) 38.615 (29,5) 235.224 (63,8) 2.705 (0,7)
FDP 202.059 76.502 (37,9) 29.579 (38,7) 123.772 (61,3) 1.785 (0,9)
Grüne 981.628 386.397 (39,4) 213.925 (55,4) 590.756 (60,2) 4.475 (0,5)
AfD 215.306 61.754 (28,7) 25.718 (41,6) 150.172 (69,7) 3.380 (1,6)
Sonstige 247.158 51.414 (20,8) 15.915 (31,0) 194.399 (78,7) 1.345 (0,5)
Gesamt 4.062.376 1.788.558 (44,0) 1.037.553 (58,0) 2.223.878 (54,7) 49.940 (1,2)
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Analyse der Bürgerschaftswahl am
23. Februar 2020 in Hamburg. Endgültige Ergebnisse, 12. März 2020, S. 9; Berechnung und Zuteilung
der Mandate, 8. April 2020, S. 44 – 53; eigene Berechnungen.
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.588 Dokumentation und Analysen
nenstimmen ihrer Partei auf sich zu ziehen als Peter Tschentscher.56 Das Personaltableau von
CDU und Grünen zog nur knapp 40 Prozent ihrer Wähler an, die anderen 60 Prozent
stimmten für die Parteiliste. Katharina Fegebank konnte immerhin 55,4 Prozent der grünen
Personenstimmen auf sich lenken, während Marcus Weinberg dies nur mit 35,8 Prozent der
CDU-Personenstimmen gelang. Wie unzureichend die Popularität Weinbergs war, lässt sich
auch daran erkennen, dass nicht nur Freidemokratin Anna von Treuenfels-Frowein, sondern
auch AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann eine höhere Popularität unter den Wählern
ihrer Partei genossen (Tabelle 2).
Die Relation der Listen- zu den Personenstimmen hatte nach der Mechanik des Ham-
burger Wahlrechts zur Folge, dass auf der Landesliste der SPD nur die ersten elf Plätze
„zogen“ und die restlichen 15 Mandate nach Personenstimmen besetzt wurden. Dies
ermöglichte vor allem solchen Kandidaten, die sich bereits als Senator oder Landesparla-
mentarier einen Namen gemacht hatten, auch von hinteren Listenplätzen in die Bürger-
schaft gewählt zu werden. Ein Migrationshintergrund und eine gute politische Vernetzung
konnten auch nicht schaden. Bei allen anderen Parteien führte die Relation der Listen- zu
den Personenstimmen dazu, dass der Anteil der nach Präferenzstimmgebung gewählten
Personen geringer ausfiel als der nach Parteiliste. Bei der Linken kamen die ersten vier Lis-
tenplätze zum Zug, zwei Bewerber wurden aufgrund ihrer Personenstimmen gewählt. Von
den 13 Landeslistenabgeordneten der Grünen wurden acht nach Liste, fünf aufgrund ihrer
Personenstimmen gewählt. Die AfD entsendete ihre ersten fünf Kandidaten von der Lan-
desliste in die Bürgerschaft; zwei weitere erkämpften sich ihr Mandat über die Präferenz-
stimmen. Bei der CDU zog die Liste gar nicht, da ihr Wahlkreisergebnis knapp vier Pro-
zentpunkte über ihrem Landesergebnis lag und sie als drittstärkste Partei überproportional
viele Direktmandate errang: 15 der 71 Wahlkreismandate (vgl. Tabelle 3).
Tabelle 3: Endgültige Mandatsverteilung bei der Hamburger Bürgerschaftswahl 2020
(in Klammern Differenz zu 2015)
Landesliste
Partei Insgesamt Nach Wahlkreisliste
Nach
Insgesamt Personen-
Parteiliste
stimmen
SPD 54 (-4) 26 (+3) 11 (+1) 15 (+2) 28 (-7)
CDU 15 (-5) 0 (-2) 0 (-1) 0 (-1) 15 (-3)
Linke 13 (+2) 6 (-1) 4 (±0) 2 (-1) 7 (+3)
FDP 1 (-8) 0 (-8) 0 (-4) 0 (-4) 1 (±0)
Grüne 33 (+18) 13 (+11) 8 (+7) 5 (+4) 20 (+7)
AfD 7 (-1) 7 (-1) 5 (-1) 2 (±0) 0 (±0)
Insgesamt 123 (+2) 52 (+2) 28 (+2) 24 (±0) 71 (±0)
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Analyse der Bürgerschaftswahl am
23. Februar 2020 in Hamburg. Endgültige Ergebnisse, 12. März 2020, S. 11.
56 Vgl. Patrick Horst, Das neue Hamburger Wahlrecht auf dem Prüfstand: kontraproduktiv, aber
schwer reformierbar, in: ZParl, 42. Jg. (2011), H. 4, S. 707 – 724, S. 714; ders., a.a.O. (Fn. 4), S.
530.
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Horst: Die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft vom 23. Februar 2020 589
3.2. Motive der Wahlentscheidung: Parteien-, Kandidaten- und Themenbewertungen
Bei der Bewertung der Parteien setzten die Hamburger wie schon in der Vergangenheit eine
betont lokale Brille auf: Für 71 Prozent war die Politik in Hamburg wichtiger für ihre
Wahlentscheidung als die Bundespolitik, unter Anhängern der SPD waren es sogar 86 Pro-
zent. Für die SPD war dies ein unschätzbarer Vorteil, weil sie in der Hansestadt auf einer
+5/-5-Skala mit +2,5 annähernd so gut wie 2015 (+2,7) bewertet wurde und sich von
ihrem weniger positiven Image auf Bundesebene (+1,0) erfolgreich abkoppeln konnte. Die
SPD wurde nicht nur von ihren eigenen Anhängern sehr positiv beurteilt, sondern auch
von Anhängern der Grünen (+2,5), der CDU (+1,7) und der FDP (+1,6). 80 Prozent der
Hamburger stimmten der Aussage zu: „Die SPD passt am besten zu Hamburg“, womit die
Sozialdemokraten wieder zu ihrem traditionellen Image der „Hamburg-Partei“ zurückge-
funden hatten. Der SPD fühlten sich immerhin 26 Prozent der Wähler langfristig politisch
verbunden – die Vergleichswerte für die Grünen betrugen 15 und für die CDU zwölf Pro-
zent. Auch bei der mit 34 Prozent größten Gruppe der parteiungebundenen Wähler lag die
SPD mit 34 Prozent deutlich vor Grünen (22), AfD (11) und CDU (7 Prozent). Mit +1,8
deutlich positiver bewertet als noch vor fünf Jahren wurden die Grünen, deren Bundespar-
tei den Hamburgern als einzige ebenso attraktiv erschien wie die Landespartei. Ähnlich
positiv beurteilt wie ihr Profil als Partei wurde auch die Regierungsarbeit von SPD (+2,0)
und Grünen (+1,5), weshalb sich sechs von zehn Hamburgern eine Neuauflage der rot-
grünen Koalition wünschten.57
Alle anderen Parteien wurden neutral oder negativ eingeschätzt: CDU (0,0), Linke
(-0,3), FDP (-0,7) und AfD (-4,0). Die CDU wurde selbst von den eigenen Anhängern
kaum positiver bewertet (+2,5) als die SPD (+1,7), was zu erklären vermag, dass sie im
Landesergebnis nicht einmal ihr Potenzial langfristig parteigebundener Wähler ausschöpfte.
Die Frage, inwieweit die Ereignisse in Thüringen sich negativ auf das Wahlergebnis aus-
wirkten, fiel von Partei zu Partei unterschiedlich aus. Am stärksten litt die FDP. Während
nur acht Prozent der Wähler insgesamt meinten, dass die Vorgänge in Thüringen einen sehr
großen Einfluss auf ihre Wahlentscheidung hatten, waren 20 Prozent unter den ehemaligen
FDP-Wählern, aber nur acht Prozent der ehemaligen CDU-Wähler dieser Meinung. Auf 34
Prozent der AfD-Wähler hatten die Ereignisse in Thüringen sogar eher eine bestärkende
Wirkung. Die AfD litt vor allem unter ihrem schlechten Image und ihrer breiten Ächtung
in Hamburg: 87 Prozent der Hamburger waren der Auffassung, dass rechtsextremes Gedan-
kengut in der Partei weit oder sehr weit verbreitet sei.58
Die Parteibewertungen spiegelten sich auch in den Haltungen der Wähler gegenüber
den Spitzenkandidaten wider. Im Vergleich zu den Wahlumfragen vom Dezember 2019
konnten Tschentscher und Fegebank ihre Zufriedenheitswerte in der Bevölkerung noch ein-
mal deutlich steigern. Mit der Arbeit des Bürgermeisters waren am Wahltag 67 Prozent der
Hamburger zufrieden, mit der Arbeit seiner Stellvertreterin 50 Prozent. CDU-Spitzenkan-
didat Weinberg dagegen verharrte bei Zufriedenheitswerten von 23 Prozent noch hinter
Linken-Spitzenkandidatin Özdemir (34 Prozent). Auf die Frage, für wen sie sich in einer
57 Vgl. Forschungsgruppe Wahlen, a.a.O. (Fn. 50), S. 12 – 17.
58 Ebenda, S. 13 – 16; Infratest dimap, „Bürgerschaftswahl 2020 Hamburg“, in: Tagesschau.de
ohne Datum, https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2020-02-23-LT-DE-HH/umfrage-einfluss.sht-
ml (Abruf 27. Juni 2020).
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.590 Dokumentation und Analysen
hypothetischen Direktwahl des Bürgermeisters entscheiden würden, antworteten 53 Pro-
zent mit Tschentscher, 30 Prozent mit Fegebank.59 Gefragt, wen sie lieber als Bürgermeister
hätten, entschieden sich sogar 57 Prozent für Tschentscher und nur 27 Prozent für Fegebank.
Die Abweichung bei diesen beiden ähnlich scheinenden Fragen könnte auf die höheren
Beliebtheitswerte Tschentschers im direkten Profilvergleich zurückzuführen sein: Bei den
Sympathiewerten lag der Erste Bürgermeister zehn Punkte vor seiner Herausforderin, hin-
sichtlich der Glaubwürdigkeit 17 und des Sachverstands 34 Punkte. In der Bewertung der
Spitzenkandidaten auf der +5/-5 Skala (halte sehr viel / halte nichts von) lag Tschentscher
mit sehr guten +2,7 vor Fegebank mit guten +1,7. Weinberg, der mit einem Bekanntheits-
problem zu kämpfen hatte, folgte abgeschlagen mit einem Wert von +0,4.60
Thematisch wurde die Bürgerschaftswahl in Hamburg eindeutig von der Verkehrspolitik
dominiert. Für 62 Prozent der Hamburger zählte sie zu den zwei wichtigsten Problemberei-
chen. Das Aufgabenfeld „Wohnungsmarkt/Mieten“ nannten 39 Prozent, den Bereich „Kli-
ma/Umwelt/Energiewende“ 19 Prozent. Auf Platz vier der wichtigsten politischen Proble-
me folgte mit elf Prozent der Bereich „Schule/Bildung“. In der Verkehrspolitik hatte ein
bemerkenswerter Bewusstseinswandel eingesetzt, seitdem die Grünen 2015 verkündet hat-
ten, Hamburg zur „Fahrrad-Metropole Deutschlands“61 machen zu wollen: Für zwei Drit-
tel der Hamburger gingen Vorschläge zur Einrichtung autofreier Innenstadtbereiche in die
richtige Richtung. Auch dem Bau von Radwegen zulasten von Autofahrspuren wurde
mehrheitlich zugestimmt.62 In der zugeschriebenen verkehrspolitischen Lösungskompetenz
konnten die Grünen mit ihren Konzepten der SPD erstmals den Rang ablaufen: 36 Prozent
hielten sie hier für am fähigsten, nur 24 Prozent die SPD. Im zweitwichtigsten politischen
Problemfeld „Wohnungsmarkt/Mieten“ war dagegen der Kompetenzvorsprung der SPD
(39) vor Linken (12) und Grünen (10 Prozent) ungebrochen. Im drittwichtigsten Aufga-
benfeld des Klimaschutzes dominierten wie eh und je die Grünen: 60 Prozent schrieben
ihnen hierbei die größte Lösungskompetenz zu, die SPD kam nur auf 14 Prozent. Auf allen
anderen, 2020 weniger bedeutsamen Politikfeldern wurde der SPD am meisten zugetraut.
Das galt auch für die allgemeine „Zukunftskompetenz“, die 37 Prozent der Hamburger bei
der SPD, aber immerhin 20 Prozent bei den Grünen verorteten. 63
Die bemerkenswerten Kompetenzwerte der beiden Regierungsparteien profitierten auch
von der positiven Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der persönli-
chen Lebensverhältnisse. 65 Prozent blickten optimistisch in die Zukunft und sahen die
Stadt eher gut vorbereitet auf künftige Herausforderungen. Im Vergleich mit den anderen
westdeutschen Bundesländern hielten 72 Prozent die wirtschaftliche Lage in ihrem Stadt-
staat für besser, nur drei Prozent für schlechter. Die allgemeine wirtschaftliche Lage in
Hamburg bewerteten im Januar 2020 laut Infratest dimap 83 Prozent als sehr gut oder gut,
nur 14 Prozent als weniger gut oder schlecht. Bei den nur drei vorgegebenen Antwortmög-
lichkeiten der Forschungsgruppe Wahlen schätzten 62 Prozent die allgemeine wirtschaftli-
che Lage in Hamburg als gut, ein Drittel als teils gut, teils schlecht und vier Prozent als
59 Ebenda, https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2020-02-23-LT-DE-HH/umfrage-kandidat.shtml
(Abruf am 27. Juni 2020).
60 Vgl. Forschungsgruppe Wahlen, a.a.O. (Fn. 50), S. 18 – 21.
61 Vgl. Patrick Horst, a.a.O. (Fn. 4), S. 523.
62 Vgl. Infratest dimap, LänderTREND Hamburg Januar 2020 im Auftrag des NDR.
63 Vgl. Forschungsgruppe Wahlen, a.a.O. (Fn. 50), S. 24 – 27.
https://doi.org/10.5771/0340-1758-2020-3-576
Generiert durch Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, am 14.10.2020, 14:41:42.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Sie können auch lesen