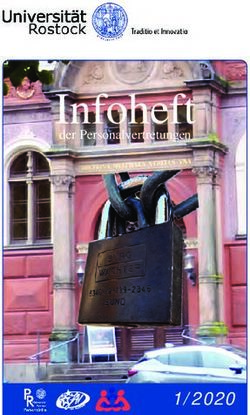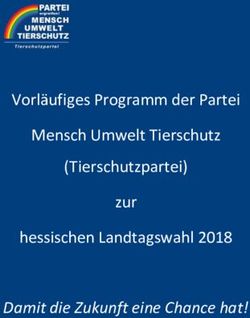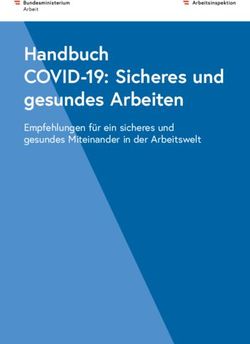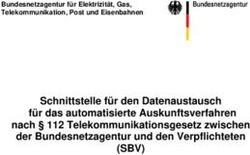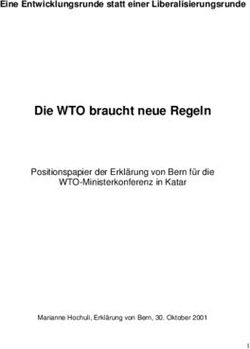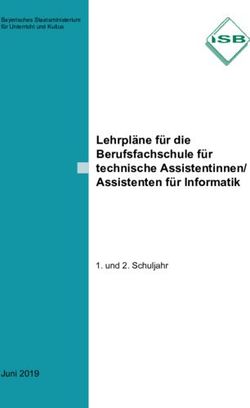Diskursivität im didaktischen Denken und Handeln - Ludwig Duncker / Christian Mathis - Ingenta ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
PR 2021, 75. Jahrgang, S. 253-260
© 2021 Ludwig Duncker / Christian Mathis - DOI https://doi.org/10.3726/PR032021.0024
Ludwig Duncker / Christian Mathis
Diskursivität im didaktischen
Denken und Handeln
Das Prinzip der Diskursivität, dies muss dabei eng mit einem Bildungsverständ-
gleich zu Beginn eingeräumt werden, mar- nis, das über eine bloße Feststellung von
kiert in einer zunächst noch etwas offenen Tatsachen und Informationen hinausweist
Weise unterschiedliche Ansprüche, die mit und mehr einen philosophisch begründ-
didaktischem Denken und Handeln verbun- baren Weg des Suchens und Findens von
den sind und die an die Didaktik als Auf- Wahrheit beschreitet. Dabei wird aufgrund
trag herangetragen werden. Gleichwohl seiner Vorläufigkeit und Revidierbarkeit die
sind diese so wichtig, dass es nicht unan- Prozesshaftigkeit des Weltverständnisses
gemessen erscheint, von der Profilierung betont. Eine Diskursive Didaktik will des-
einer „Diskursiven Didaktik“ zu sprechen. halb einen Bildungshorizont erschließen,
Zunächst ist mit dieser Bezeichnung ge- der das Befragen der Wirklichkeit zum
meint, dass es Aufgabe des Unterrichts Kernstück einer interessierten und facet-
sein muss, Themen und Inhalte zu erschlie- tenreich ausgelegten Auseinandersetzung
ßen, die eine aspektreiche, von Widersprü- mit ihr erklärt und dabei die Schülerinnen
chen und Spannungsfeldern durchzogene, und Schüler in die Lage versetzt, sich ar-
auf unterschiedliche Perspektiven der gumentierend und differenzierend auf die
Betrachtung rückführbare Auseinander- Welt einzulassen.
setzung mit der Wirklichkeit ermöglichen Dennoch muss die Didaktik, die eine
sollen. Dies ergibt sich schon daraus, dass solche Position vertritt, sich auch selbst
die Wirklichkeit in vieler Hinsicht als kom- als diskursiv präsentieren. Als eine schul-
plex, vielschichtig und uneindeutig gelten pädagogische Teildisziplin steht sie in
kann und deshalb auch in ihren strittigen wissenschaftlicher Konkurrenz mit an-
und in diskursiven Verfahren oft erst frei- deren Konzepten des Lehrens und Ler-
zulegenden Aspekten aufgegriffen werden nens, gegen die sie sich abgrenzt oder
muss. Dabei sind auch die Wege der Aus- mit denen sie in einem mehr oder weniger
einandersetzung, also die Formen und Me- spannungsvollen Wechselverhältnis steht.
thoden in die Diskursivität einzubeziehen, Dies gilt aber für jede didaktische Theorie,
weil sie in entscheidender Weise dazu solange sie keinen alleingültigen Anspruch
beitragen, den Aspektreichtum, die Un- erhebt und sich an akademischen Ge-
eindeutigkeiten und Widersprüchlichkei- pflogenheiten orientiert, wie sie für jede
ten aufzudecken und sichtbar zu machen. wissenschaftliche Diskussion gelten müs-
Diskursivität enthält also den Anspruch, sen. Hierzu gehört auch die Einsicht, dass
aufklärend zum Verständnis der Wirklich- kein didaktisches Prinzip alle Ansprüche
keit beizutragen. Eine Didaktik, die sich in sich aufnehmen kann, die auf die Ein-
dieser Aufgabe annimmt, korrespondiert lösung des Bildungsauftrags der Schule
3 / 2021 Pädagogische Rundschau 253
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0ausgerichtet sind. Insofern muss sich jede stellen. Dies betrifft nicht nur Fragen der
Didaktik auch einordnen in ein Gesamtver- Organisation und des Managements
ständnis von Schule und Unterricht, das – zweifellos bedeutsame Aspekte der
in unserem Falle mit den großen Leitlinien Schulsteuerung –, sondern auch das Leh-
der Wissenschaftsorientierung, der Orien- ren und Lernen im Unterricht selbst. Wo
tierung an demokratischen Grundwerten unter ökonomisch motivierten Blicken das
und den Grundprinzipien einer aufgeklär- Lehren und Lernen einem Zwang zur Ver-
ten Literalität auszulegen wäre. Daraus er- eindeutigung unterworfen wird, beispiels-
wachsen wiederum Ansprüche, aber auch weise durch eine Output-Orientierung
Grenzen für das didaktische Prinzip der des Unterrichts, durch internationale Leis-
Diskursivität. tungsvergleiche, durch Messverfahren zur
Gleichzeitig muss betont werden, dass Bestimmung von Schul- und Unterrichts-
das, was unter dem Begriff einer Diskur- qualität, wächst die Gefahr, Unterricht ein-
siven Didaktik zu verhandeln ist, nicht in zuengen auf die Produktion überprüfbarer
allen Punkten als grundsätzlich neu zu be- Ergebnisse. Unterricht zielt dann allein auf
werten ist. Es gibt eine bildungstheoreti- die Erzeugung evaluierbarer Resultate, die
sche Tradition im allgemeindidaktischen eine Vereindeutigung von Lernergebnissen
Denken und Handeln, die in fruchtbarer voraussetzen. Vereindeutigung eleminiert
Weise den Bildungsanspruch des Unter- jedoch Inhalte und Formen von Diskursivi-
richts dadurch aufgegriffen und ausgelegt tät. Sie engt Vielfalt ein, meidet offene Fra-
hat, dass sie Schülerinnen und Schülern gen und räumt Widersprüche, die in der
eine multi-, viel- oder mehrperspektivische Sache begründet liegen, aus dem Weg.
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit Die Widerständigkeit der Sache wird ge-
zugemutet und ermöglicht hat.1 Auch dort, lichsam „geschliffen“. Der Unterrichts-
wo in didaktischen Konzepten offene Ge- gegenstand oder die Sache, die und an
sprächssituationen vorgesehen sind, sei der gelernt werden soll, ist eben oft sui ge-
es durch eine geeignete Auswahl didakti- neris nicht eindeutig. Durch die Produktion
scher Materialien, sei es durch besondere von überprüfbaren Ergebnissen wird die
methodische Arrangements, die Anlässe Sache oft kleinschrittig und methodisch
für Dialog und Diskussion bereitstellen, las- geschickt in lernbare Häppchen aufgeteilt.
sen sich Spuren in die jüngere und ältere Andreas Gruschka konnte etwa zeigen,
Geschichte der Didaktik zurückverfolgen. dass dabei die Unterrichtsmethodik hilft,
Sie reichen zurück bis hin zu den sokrati- der Sache auszuweichen.3 Die Überwin-
schen Dialogen in der Antike, die bis heute dung fragwürdiger Eindeutigkeiten wird
immer wieder Beachtung finden.2 so zu einem grundlegenden Problemfeld
Andererseits gibt es genügend An- einer Diskursiven Didaktik.
lässe, diese Traditionslinien wieder neu Aus erkenntnistheoretischer Sicht
zu beleben und auch terminologisch wie muss didaktischen Tendenzen einer Ver-
konzeptionell zu schärfen, weil es inner- eindeutigung des Lehrens und Lernens
halb und außerhalb der Schule Tendenzen entgegengehalten werden, dass die Wirk-
gibt, die dem Anspruch der Diskursivität lichkeit voller offener Fragen und Probleme
und damit auch einem Bildungsanspruch ist, die im Rahmen des Bildungsauftrags
im Wege stehen. Hier sind innerhalb der auch im Unterricht aufzugreifen, aufzuklä-
Schule aktuell vor allem solche Tenden- ren und zu bearbeiten sind. Eine Reduktion
zen zu nennen, die die Schule unter öko- von Komplexität auf eindeutige Aussagen
nomische Kategorien der Optimierung, würde eine Verkürzung und Verfälschung
Effizienzsteigerung und Kontrollierbarkeit des Verständnisses von Wirklichkeit
254 Pädagogische Rundschau 3 / 2021
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0bewirken und Schülerinnen und Schülern Diskursiven Didaktik bedeutsam – ein Ver-
kaum helfen, ein tragfähiges Weltbild auf- lust an Vielfalt und Ambiguität zu beklagen.
zubauen. Der Rückfall in Formen eines nai- Als Ursachen führt er die Verstädterung,
ven Positivismus, der vorsieht, sich auf die die größere Mobilität, die Globalisierung,
Feststellung von Tatsachen zu begrenzen, Belastungen durch Verkehr, eine zuneh-
würde für die Didaktik bedeuten, interpre- mend industrialisierte Landwirtschaft, den
tative und nur diskursiv zu klärende Aspek- Klimawandel, die Monopolisierung der
te des Weltverstehens auszuklammern. größeren Lebensmittelkonzerne bis hin
Auch Sinnfragen wären dann nicht mehr zur kapitalistischen Wirtschaftsweise an.5
Gegenstand schulischen Lernens. Eine Auch in Kunst und Musik, in Religion und
Orientierung im Denken, die auf einer Ein- Architektur sei dieser Verlust an Ambiguität
grenzung auf instrumentelle und funktiona- zu beobachten. Zu vermissen sei „unsere
le Formen des Denkens beruht, würde ein Bereitschaft oder unseren Unwillen, Viel-
Verständnis von Lehren und Lernen, das falt in all ihren Erscheinungsformen zu er-
sich in weitem Sinne auch als eine Form tragen“ wozu auch der „Umgang mit den
praktischer Philosophie begreift, schon im vielfältigen Wahrheiten einer uneindeutigen
Ansatz verfehlen. Welt“6 gehöre. Denn „die Welt“, so Bauer,
Was die Beachtung und Berücksich- sei „voll von Ambiguität“.7
tigung von Diskursivität betrifft, muss je- Gerade Bedeutungsvielfalt werde zu-
doch auch auf Entwicklungen außerhalb nehmend eingeschränkt. Behauptungen
der Schule eingegangen werden. Auf den würden auf der einen Seite durch funk-
ersten Blick sieht es so aus, als fände im tionalistische und gar fundamentalistische
gesellschaftlichen Alltag eine wachsende Verengungen, auf der anderen Seite durch
Diversifizierung statt. Eine unübersichtlich eine Vergleichgültigung und durch inhalt-
gewordene Anzahl an TV-Programmen, liche Beliebigkeit einer kommunikativen
eine zunehmende Vielfalt konsumierbarer Zugänglichkeit und diskursiven Verstän-
Warenangebote, eine Pluralisierung der digung entzogen. Hierzu zähle auch ein
Lebensstile und eine teilweise sich auf- „Authentizitätswahn“8, der kulturelle, politi-
dringlich gebärdende Vielzahl an Identifika- sche und künstlerische Ansprüche an eine
tionsangeboten scheinen zunächst darauf bedeutungsoffene Kommunikation ver-
hinzudeuten, dass der gesellschaftliche wehre. Zusammenfassend mündet Bauers
Alltag von einer wachsenden Vielfalt ge- Diagnose darin ein, dass er in vielen ge-
kennzeichnet ist. Ein zweiter Blick lässt je- sellschaftlichen und kulturellen Bereichen
doch erkennen, dass unter der Oberfläche eine starke Tendenz zur Diskursverweige-
solcher Vielfalt eine bedenkliche Tendenz rung erkennt, die als Ursachen und Folgen
zur Vereinheitlichung und Vereindeutigung des Verlusts an Ambiguität in Erscheinung
sichtbar wird. Thomas Bauer zeigt an treten. Selbstverständlich sollte eine Dis-
zahlreichen Beispielen auf, dass gegen- kursive Didaktik nicht aus einer pessimis-
wärtig insgesamt eher eine „Tendenz zu tischen Verlustgeschichte heraus motiviert
einem Weniger an Vielfalt, ein Rückgang bzw. begründet werden. Bauers Ausfüh-
an Mannigfaltigkeit zu beobachten“4 sei. rungen sind jedoch relevant, weil er den
Er führt das Aussterben von Sprachen und Blick hinter die vermeintliche Diversität der
Dialekten an, er nennt die inhaltlich gleich- Welt und auf die Tendenz zur Diskursver-
förmigen Angebote der verschiedenen TV- weigerung und Vereindeutigung richtet.
Sender, auch den Rückgang biologischer Die Entwicklungen innerhalb und
Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt. Es sei außerhalb der Schule scheinen sich an
insgesamt – und das ist hinsichtlich einer vielen Stellen zu berühren. Sie liefern
3 / 2021 Pädagogische Rundschau 255
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0jedenfalls zahlreiche Argumente, den An- Prozesse des Lehrens und Lernens in der
spruch der Diskursivität in der Didaktik Schule bedeutsam sind. Dies schließt trotz
neu zu thematisieren und ihn in seiner Not- aller Diskursivität, die auch den wissen-
wendigkeit, aber auch in seinen möglichen schaftlichen Umgang mit diesem Prinzip
Grenzen auszuleuchten. Weil Schule und prägen muss, ein, dass auch Positionen
Unterricht keinen gesellschaftlich und kul- vertreten werden dürfen, die Gültigkeit
turell ausgegrenzten Raum bilden, stehen beanspruchen und keiner Relativierung
didaktische Prinzipien immer auch in einem unterworfen werden. Auch dies soll den
Kontext außerschulischer Entwicklungen, Umgang mit diesem Prinzip im Rahmen
auf die die Schule Bezug nehmen muss. einer wissenschaftlichen didaktischen Dis-
Insofern muss auch der Bildungsauftrag kussion kennzeichnen.
immer wieder neu interpretiert und jus- Der Aufbau und die Abfolge der Bei-
tiert werden. Dabei kann es nicht Aufga- träge in diesem Heft ist so gestaltet,
be der Schule sein, den außerschulischen dass verschiedene Texte das Prinzip der
Trends nur hinterherzulaufen und ihnen Diskursivität in seiner Bedeutung für die
unkritisch zu folgen. Die Schule muss in Allgemeine Didaktik wie für einzelne Fach-
relativer Eigenständigkeit und in Wahrneh- didaktiken erörtern. Als Bindeglied tritt
mung pädagogischer Verantwortung auch dabei nicht nur das Prinzip der Diskur-
überlegen, wo sie Anforderungen, die von sivität selbst in Erscheinung, sondern in
außen an sie herangetragen werden, an- Verbindung mit ihm der Anspruch, einen
nimmt und wo sie zumindest partiell gesell- Bildungshorizont auszuleuchten, der not-
schaftlichen und kulturellen Entwicklungen wendig das Prinzip der Diskursivität ein-
mit eigenen Konzepten gegensteuert. Dies schließen muss. Dabei wird deutlich, dass
führt, auf Prozesse der Vereindeutigung fachdidaktische Diskussionen nicht isoliert
bezogen, zwingend zur Aufgabe, Bildung voneinander stehen, sondern vielfältig mit-
und Diskursivität zusammenzuführen und einander vernetzt sind, auch wenn dies
auch in produktiven didaktischen Konzep- andernorts oft zu wenig angesprochen
ten auszulegen. und aufgezeigt wird. Schulfächer sind dort
Die Beiträge in dieser Ausgabe der von einem fließenden Übergang und einer
Pädagogischen Rundschau reflektieren wechselseitigen Verbindung gekennzeich-
das Prinzip der Diskursivität im Kontext net, wo sie sich auf gemeinsame Grund-
didaktischer Theorie und Praxis. Dabei ist lagen stützen und Bildungsprozesse
der Blick auch über die Schule hinaus zu anregen wollen. Dies stärkt den Bildungs-
richten. Nicht zuletzt ist auch der Begriff auftrag auch dann, wenn nicht spezielle
der Diskursivität selbst in seinen Bedin- Verfahren eines fächerübergreifenden Ler-
gungen, Möglichkeiten und Grenzen zu nens berücksichtigt werden9.
reflektieren. Es versteht sich von selbst, Gleichsam eingerahmt werden diese
dass es hier nicht darum gehen kann, eine Texte zur allgemein-didaktischen und fach
in sich geschlossene Theorie einer Didak- didaktischen Diskussion durch zwei Bei-
tik der Diskursivität vorzustellen. Ebenso träge, die sich sehr grundsätzlich mit dem
wäre es fahrlässig, den grundsätzlichen Begriff der Diskursivität, seinen Möglich-
Verzicht auf Eindeutigkeit und das Lernen keiten und Grenzen befassen. Dabei wird
von belastbarem Wissen zu propagieren. auf wissenschaftliche Positionen in Philo-
Vielmehr geht es darum, in unterschied- sophie, Soziologie und Pädagogik aus
lichen Facetten und Perspektiven Fragen Geschichte und Gegenwart rekurriert,
und Probleme aufzugreifen, die für eine die es verbieten, im Bezug auf Diskur-
Diskursive Didaktik relevant und die für sivität voreilig eine schnelle Lösung aller
256 Pädagogische Rundschau 3 / 2021
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0Bildungsprobleme zu suchen. Sie mahnen Dreßler, bedarf einer „Anthropologie der
deshalb auch zu einer umsichtigen Praxis Selbstbestimmung, die dem Menschen zu-
im Umgang mit Diskursivität. traut, mittels Vernunftgebrach verantwort-
Jens Dreßler nimmt im Rückgriff auf lich zu handeln.“
geisteswissenschaftliche und philoso- Der Beitrag von Ludwig Duncker und
phisch-pädagogische Traditionen eine Katja Siepmann stellt das didaktische Prin-
grundbegriffliche Standortbestimmung vor, zip der Diskursivität in einen bildungstheo-
in denen der Begriff der Diskursivität ver- retischen Zusammenhang. Dies erscheint
ankert ist und in der er auch seine Bedeu- schon deshalb angebracht, weil in aktuel-
tung für didaktisches Handeln gewinnt. Im len Entwicklungen Schule und Unterricht
Verweis auf Wilhelm Dilthey wird deutlich, eher vom Verlust eines Bildungsanspruchs
dass Diskursivität in enger Verbindung zu betroffen sind. Dies lässt sich mit Bezügen
Denkleistungen steht, die als „prüfendes zu ausgewählten Analysen des gegenwär-
Umherlaufen“ bei der Suche nach Wahr- tigen Bildungsgeschehens aufzeigen und
heit in Erscheinung treten. Dabei wird nachweisen. Zur näheren Bestimmung
auch ein normativer Anspruch sichtbar, der des didaktischen Prinzips der Diskursivi-
eine fragend-suchende Grundhaltung mit tät kann auf die Diskussion um das Prinzip
einem methodisch geordneten Vorgehen der Perspektivenvielfalt zurückgegriffen
verbindet. Mit Rousseau kann dann auf äs- werden, auf dem Diskursivität aufbauen
thetische Implikationen und die Klärungs- kann. Dabei werden jedoch einige Aspek-
bedürftigkeit sinnlicher Wahrnehmungen te weitergeführt und ausdifferenziert, die
verwiesen werden, die ein Nachdenken im Prinzip der Perspektivenvielfalt noch
erfordern und damit ein diskursives Den- nicht expliziert sind. Es sind vor allem die
ken im Zusammenhang von Erkenntnispro- Bezüge zur Kontroversität sowie der Posi-
zessen herausfordern. In einem weiteren tionalität, die als mögliches Resultat einer
Schritt wird Diskursivität im Kontext der diskursiven Auseinandersetzung in Er-
Theorie kommunikativen Handelns bei scheinung treten und ein bloß auf Addition
Jürgen Habermas angesprochen und als und Pluralität beruhendes Verständnis von
reflexive, verständigungsorientierte und Viel- bzw. Multiperspektivität überschrei-
auf intersubjektive Gültigkeit ausgerichtete ten. An exemplarisch ausgewählten didak-
Tätigkeit des Vernunftgebrauchs erörtert, tischen Feldern kann diese Erweiterung
die es ermöglicht, Diskursivität als Weg und Ausdifferenzierung in ihrer Bedeutung
der Begründung von Weltbezügen zu be- für Lehr- und Lernprozesse im Unterricht
greifen, die ein verantwortliches Handeln aufgezeigt und als Ertrag für eine bildungs-
ermöglichen. Die Fragilität diskursiver Pro- theoretisch profilierte Didaktik kenntlich
zesse kann schließlich mit Bezügen auf gemacht werden.
Martin Buber und Marian Heitger sicht- Wolfgang Sander weist in seinem
bar werden, weil hier Diskursivität auf die Beitrag darauf hin, dass Diskursivität und
Grundbedingung einer dialogischen Hal- Kontroversität in der Politischen Bildung
tung verweist, die die Anerkennung des seit langem etablierte Prinzipien sind, wo-
jeweils anderen voraussetzt. Damit sind durch Schülerinnen und Schüler in der
Implikationen angesprochen, die auch in multiperspektiven Auseinandersetzung mit
weiteren pädagogischen Kontexten ihre politischen Problemen und Konflikten zur
Risiken entfalten und Diskursivität in ihrer reflektierten politischen Urteilsbildung
Angewiesenheit auf eine wechselseitige befähigt werden sollen. Sander fragt in
Offenheit und einen vertrauensvoll ge- seinem Beitrag nach Grenzen von Kontro-
führten Dialog ausweisen. Diskursivität, so versität und Diskursivität und verweist auf
3 / 2021 Pädagogische Rundschau 257
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0zwei bedeutsame Problemfelder: 1) Politi- von politischer Mündigkeit und Urteils-
scher Extremismus: Sander betont, dass fähigkeit der Schülerinnen und Schüler
die Kontroversen, um die es in der schu- dürfen Lehrpersonen extremistischen und
lischen politischen Bildung gehe, sich im identitätspolitisch begründeten Versuchen,
Rahmen des demokratischen Spektrums Tabus zu errichten und Diskursräume ein-
befinden müssen, denn nur demokratisch zuengen, nicht nachgeben. Lehrpersonen
verfasste Gesellschaften können die päd- haben als „Wächter über Diskursivität im
agogisch intendierte Mündigkeit der Schü- Unterricht“ die Aufgabe, Angriffen auf sie
lerinnen und Schüler akzeptieren. Sander entschieden entgegenzutreten.
erläutert, wo hinsichtlich Rechtsextremis- Christian Mathis fordert in seinem Bei-
mus, Linksextremismus, Islamismus sowie trag, Geschichte als Denkfach zu konzi-
Antisemitismus und Rassismus eine „sym- pieren. Dabei kommen der Perspektivität,
bolische ‚rote Linie’“ gezogen werden Kontroversität und Pluralität sowie der
muss und legitimiert diese auf dem Hinter- Urteilsbildung eine zentrale Rolle zu. Histo-
grund einer Diskursiven Didaktik gerade risches Denken ist ein diskursives Ringen
durch die Verteidigung von Diskursivität. um einen rationalen Umgang mit subjek-
Denn der freie Meinungsstreit ist nur mög- tiven Wahrnehmungen, Wertungen und
lich, wenn die durch die Grundprinzipien Urteilen, bei dem ständig eine reflexive
freiheitlicher Verfassungen garantierte Distanz zu sich und zur Sache erarbeitet
gleiche Freiheit aller an ihm Beteiligten von werden muss. Dem subjektivistischen Zu-
allen anerkannt wird. 2) Identitätspolitische griff fehlt das reflektierte epistemologische
Positionen: Sander erklärt, dass derzeit Verstehen von Geschichte. Folglich muss
eine Vielzahl von Gruppen und Minder- im Geschichtsunterricht bewusst eine wis-
heiten, die sich als diskriminiert betrachten senschaftsorientierte Sprache eingefordert
oder denen ein solches Selbstverständ- und geschichtswissenschaftliches Denken
nis von identitätspolitischen Akteuren gelernt werden. Diskursivität, Auseinander-
zugeschrieben wird, versuchen ihre Inte- setzung, Argumentation, Widerlegung und
ressen durchzusetzen. Dabei wird diesen Streit um Positionen sind konstituierend
Gruppen einerseits eine kollektive Identität für die Geschichtswissenschaft. Schuli-
unterstellt, andererseits dürfen deren Au- sche Geschichte nimmt genau diese Idee
thentizität und die damit begründeten An- auf. Nach dem Zusammentragen eines
sprüche nicht in Frage gestellt werden. Mit Sachverhalts erfolgt das Erarbeiten eines
Ansprüchen auf Authentizität, Identität und Sachurteils in einem diskursiven Prozess,
Verletzlichkeit wird versucht, offene Dis- worauf schließlich ein Werturteil begründet
kursräume einzuschränken, Rederechte und eine Position bezogen wird. Das Ziel
zu vergeben und dabei Deutungshoheiten eines solchen Geschichtsunterrichts ist
durchzusetzen. Für die politische Öffent- es, die Fähigkeiten der Schülerinnen und
lichkeit in der Demokratie ist dies eine Schüler zur reflektierten Prüfung ihrer eige-
gefährliche Entwicklung, denn es werden nen perspektivischen Voraussetzungen
unverhandelbare Sichtweisen postuliert, sowie ihr selbstreflexives Denken über die
was zu einer Diskursverweigerung führen Geschichte und Vergangenheit mit Blick
kann. Sander sieht in beiden Problemfel- auf ihr künftiges, selbständiges Handeln in
dern interessante Gegenstände für politi- der Welt zu fördern.
sche Bildung, die jedoch mit erheblichen Katja Siepmann widmet sich in ihrem
Herausforderungen für die Professionalität Beitrag dem Literaturunterricht, in dem
von Lehrerinnen und Lehrer verbunden sich junge Menschen mit Werken der Li-
sind. Doch gerade im Sinne der Förderung teratur aus Geschichte und Gegenwart
258 Pädagogische Rundschau 3 / 2021
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0auseinandersetzen sollen. Literaturunter- Lernen als „Grundkonzept einer diskursi-
richt will Gesprächsanlässe ermöglichen, ven Didaktik“ zurück.
die das Denken anregen, neue Perspek- Abschließend greift der Text von Roland
tiven aufzeigen sowie Irritationen von Ver- Reichenbach grundsätzliche Fragen auf,
trautem hervorrufen. Im Gespräch werden die die Begründung des didaktischen
unterschiedliche Bedeutungen und das Prinzips der Diskursivität relativieren. Er
gemeinsame Bemühen um ein Verständnis weist auf Probleme und Grenzen hin,
des Textes sichtbar. Siepmann fokussiert die bedacht werden müssen, wenn die
auf das didaktische Verfahren des litera- Potentiale, die in einer diskursiven Ausge-
rischen Gesprächs und betont, dass sich staltung von Lehr- und Lernprozessen ge-
literarische Texte einem unmittelbaren Ver- borgen liegen, nicht überschätzt werden
stehen und einer eindeutigen Auslegung sollen. Gerade in der deutschsprachigen
entziehen. Im Literaturunterricht existiert Bildungstradition könnten solche Über-
folglich ein Spannungsfeld zwischen Ein- schätzungen vielfach erkannt werden.
deutigkeit und Offenheit – sowohl im Er führt aus, dass diskursive Tugenden,
Unterrichtsprozess als auch auf der Ebene die eigentlich Voraussetzung für rational
der Texte. Besonders relevant sind daher geführte Diskurse seien, sich als nicht
das In-Frage-stellen von Scheinklarheiten, selbstverständlich erweisen könnten, weil
das Aushalten offener Fragen und das Fin- sie die Bereitschaft einschlössen, sich
den verschiedener Wahrheiten, das Prü- kraft besserer Argumente überzeugen
fen von Weltdeutungen sowie der Umgang zu lassen. Verstehen und Einverstanden
mit Pluralität, Fremdheit und Dissens. Im sein seien nicht identisch. Dies hat auch
literarischen Unterrichtsgespräch wird das mit der ambivalenten Bedeutung von Ver-
literarische Lernen durch Erfahrung von stehensprozessen zu tun, die einerseits
Pluralität, Widersprüchlichkeit, Ambiva- auf die Herstellung eines Einverständnis-
lenz und Alterität im Zuge eigener Identi- ses zielen und damit eine potentielle Ver-
tätsentwicklung möglich. schmelzung von Perspektiven anstreben.
Philippe Wampfler verweist aus me- Andererseits müssten sie strukturell als
diendidaktischer Perspektive auf die Kampfansage begriffen werden, weil man
doppelte Positionalität in Bezug auf eine im Diskurs eben gegeneinander und nicht
Kultur der Digitalität. Einerseits ist die miteinander argumentiere. Im Grunde
Positionalität durch Algorithmen gegeben sei das Ideal einer symmetrischen Kom-
und bestimmt die Position des Users. An- munikation im Diskurs gekennzeichnet
dererseits ist die argumentative Positio- durch ein zu hohes Vertrauen in die Er-
nalität ein Bildungsziel und erfordert eine reichbarkeit eines Konsenses, weshalb,
didaktische Inszenierung. Folglich bezieht so Reichenbach, Diskursfähigkeit eine
sich eine diskursive Didaktik in einer Kultur „Dissenstauglichkeit“ einschließen müsse.
der Digitalität stets auf beide Dimensionen Die Ausführungen Reichenbachs, die weit
und auf deren Zusammenspiel. Wampf- über pädagogische Kontexte hinaus be-
ler optiert für einen handlungsorientierten deutsam sind, werfen deshalb Fragen auf,
Umgang mit dieser doppelten Positionali- die auch für eine Diskursive Didaktik hoch
tät und fordert: Nur wer unterschiedliche relevant sind und die verdeutlichen, dass
Verhaltensweisen im Netz erprobt, Reak- auch in Schule und Unterricht eine Streit-
tionen darauf wahrnimmt und Zusammen- kultur vonnöten ist, die die wechselseitige
hänge reflektiert, kann nachhaltig digitale Dynamik der Erarbeitung von Konsens und
Anwendungen nutzen. Dabei greift er auf Dissens als konstitutiven Bestandteil von
Urs Rufs und Peter Gallins Dialogisches Bildungsprozessen begreift.
3 / 2021 Pädagogische Rundschau 259
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0Anmerkungen 2/2009; Bergmann, Klaus (2008): Multi-
perspektivität. Geschichte selber denken
1 Vgl. z.B. Giel, Klaus / Hiller, Gotthilf G. u.a. (2. Aufl.). Schwalbach/Ts: Wochenschau;
(1974ff): Stücke zu einem mehrperspekti- Urs Ruf und Peter Gallin (1999): Dialogi-
vischen Unterricht. 10 Bde. Stuttgart: Klett; sches Lernen in Sprache und Mathematik.
Köhnlein, Walter / Marquardt-Mau, Brunhilde / Band I. Seelze: Klett/Kallmeyer; Zabka, Tho-
Schreier, Helmut (Hrsg.) (1999): Vielperspek- mas (2020): Gespräche über Literatur. In:
tivisches Denken im Sachunterricht. Bad Heil- Praxis Deutsch, H. 280, S. 4-11.
brunn: Klinkhardt; Duncker, Ludwig / Sander, 3 Gruschka, Andreas (2011). Verstehen leh-
Wolfgang / Surkamp, Carola (Hrsg.) (2005): ren: Ein Plädoyer für guten Unterricht. Stutt-
Perspektivenvielfalt im Unterricht. Stuttgart: gart: Reclam, S. 155f.
Kohlhammer; Sander, Wolfgang (2009): 4 Bauer, Thomas (2018): Die Vereindeutigung
Bildung und Perspektivität. Kontroversität der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit
und Indoktrinationsverbot als Grundsätze und Vielfalt. Ditzingen: Reclam, Sonderaus-
von Bildung und Wissenschaft. In: Erwä- gabe S. 13.
gen – Wissen – Ethik, 20. Jahrgang, H. 2, 5 Vgl. Bauer 2018, ebd.
S. 239-248; Mathis, Christian / Duncker, Lud- 6 Vgl. Bauer 2018, S. 13f.
wig (2017): Perspektivenwechsel als didakti- 7 Vgl. Bauer 2018, S.14.
sche Kategorie. Zur Qualität von Lehrwerken 8 Vgl. Bauer 2018, S. 82.
für den Sachunterricht. In: Giest, Hartmut / 9 Vgl. hierzu Duncker, Ludwig / Popp, Walter
Hartinger, Andreas / Tänzer, Sandra (Hrsg.): (1998) (Hrsg.): Fächerübergreifender Unter-
Vielperspektivität im Sachunterricht. Bad richt in der Sekundarstufe I und II. Prinzipi-
Heilbrunn: Klinkhardt, S. 66-73. en, Perspektiven, Beispiele. Bad Heilbrunn:
2 Vgl. z.B. Martens, Ekkehard / Schreier, Hel- Klinkhardt; Duncker, Ludwig / Popp, Walter
mut (1994) (Hrsg.): Philosophieren mit Schul- (1997) (Hrsg.): Über Fachgrenzen hinaus.
kindern. Philosophie und Ethik in Grundschule Chancen und Schwierigkeiten des fächer-
und Sekundarstufe I. Heinsberg: Dieck; vgl. übergreifenden Lehrens und Lernens. Band
u.a. die Diskussion zum Thema „Bildung und 1: Grundlagen und Begründungen; Band 2
Perspektivität – Kontroversität und Indoktrina- (1998): Anregungen und Beispiele für die
tionsverbot als Grundsätze von Bildung und Grundschule. Heinsberg: Dieck.
Wissenschaft“ in Erwägen – Wissen – Ethik
260 Pädagogische Rundschau 3 / 2021
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0Sie können auch lesen