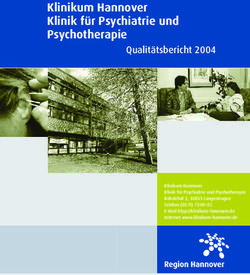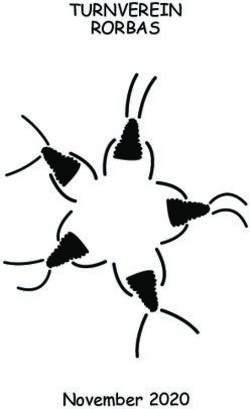Durchfall erkrankungen - beim Schwein Ursachen und Abwehrstrategien - MSD Tiergesundheit
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Darmgesundheit
beginnt in der
„Kinderstube“.
N eugeborene Ferkel haben zum Zeitpunkt
der Geburt ein wenig ausgereiftes
Immunsystem* und sind somit besonders
anfällig für Krankheiten. Erst ab der siebten Darmerkrankungen gehören
bis neunten Lebenswoche sind die lympha- zu den wirtschaftlich bedeu-
tischen Einrichtungen*, die der Abwehr von tendsten Problemen in der
Krankheitserregern dienen, im Darm des Fer-
Schweineproduktion. Die häufigs-
kels voll ausgereift. Eine ausreichende Menge
von Biestmilch in den ersten Lebensstunden ten Erreger von Durchfall beim
ist für das Ferkel überlebenswichtig. Die neugeborenen Ferkel sind immer
Biestmilch (= Kolostrum) enthält Antikörper*, noch enterotoxische* E. coli-
die das Ferkel in den ersten Lebenstagen und
und Clostridien-Infektionen.
-wochen schützen. Im Idealfall so lange, bis es
eine eigene Immunität ausgebildet hat.
Diese Broschüre soll Ihnen einen Überblick
über die wichtigsten Ursachen von Durchfall
und Vermeidungsstrategien geben.
Ihre MSD Tiergesundheit
i
Die mit Sternchen (*)
markierten Wörter
werden auf Seite 38
im Glossar erläutert.
2Inhalt
Der Magen-Darm-Trakt von Schweinen ................. 4
Durchfall – ein Problem mit vielen Ursachen ........ 6
Erreger-Übersicht .............................................. 7
Bakteriell:
E. coli ....................................................... 8
Colienterotoxämie ................................... 10
Cl. perfringens ......................................... 11
Lawsonia intracellularis ............................ 12
Salmonellen ............................................. 14
Brachyspiren ............................................ 16
Viral:
Circoviren................................................. 18
Rotaviren .................................................20
Coronaviren .............................................22
Parasitär:
Kokzidien des Schweins ..........................24
Schweinepeitschenwurm ........................25
Schweinespulwurm .................................26
Knötchenwurm des Schweins .................27
Faktorenerkrankung
Metritis-Mastitis-Agalaktie (MMA) ...........28
Fütterung .................................................................30
Management ...........................................................34
Glossar.....................................................................38
3Der Magen-Darm-Trakt von Schweinen1
D as Schwein besitzt einen einhöhligen Magen, der von drüsenloser und drüsenhaltiger Magen-
schleimhaut ausgekleidet wird. Mit dem Dünndarm schließt sich der längste Abschnitt des
Verdauungskanals an, bestehend aus Duodenum* (0,7–1 m), Jejunum* (15–20 m) und Ileum*
(1,5–2,5 m). Das Ileum verfügt über die im gesamten Darmtrakt stärkste Muskelschicht und zu-
dem über einen wesentlichen Teil des im Darm befindlichen Immunsystems (Peyer'sche Platten).
Die Darmschleimhaut von Dünn- und Dickdarm weist Unterschiede in ihrer Gestalt auf: Ausstül-
pungen und Einziehungen im Dünndarm, nur Einziehungen im Dickdarm.
Die Proteinverdauung beginnt bereits im sauren Milieu des Magens mit dem Abbau durch Enzyme
(Peptidasen). Die weitere Verdauung der Proteine durch Enzyme des Magen- und Bauchspeichel-
sekrets findet vorwiegend im Dünndarm statt. Ein nicht unbedeutender Anteil der Proteinverdau-
ung entfällt auf die Verdauung und Resorption körpereigenen Proteins (quantitativ in
etwa die gleiche Menge Protein wie pro Tag über das Futter zugeführt wird!).
Zähne Speicheldrüse
Die wichtigsten aus der Nahrung aufgenommenen Fette sind Triacylgly-
cerine (mengenmäßig größter Anteil), Phospholipide und Cholesteri-
ne. Eine Verdauung der Triacylglycerine beginnt bereits im Magen
und setzt sich im Dünndarm fort (Emulgation durch Gallensäuren
und Phospholipide*).
Im Dünndarm findet der überwiegende Anteil der enzyma-
tischen Verdauung und Aufnahme der Nährstoffe statt. Koh-
lenhydrate, Proteine und Fette werden hier der Aufnahme
zugänglich gemacht. In der Gruppe der Kohlenhydrate stellen
Stärke, Zucker und Milchzucker die wichtigsten beim Schwein
zu verdauenden Nährstoffe dar. Im Vergleich zu anderen Tier-
arten weist das Schwein eine sehr effektive Stärkeverdauung
auf. Wird die Verdauungskapazität im Dünndarm diesbezüglich
dennoch überschritten, so erfolgt eine gewisse Kompensation
durch bakteriellen Abbau von Kohlenhydraten im Dickdarm. Zudem
findet hier der Transport von Wasser und Elektrolyten durch die Darm-
schleimhaut statt. Speziell beim Schwein findet sich ein großer Teil des
gesamten Darminhalts im Dickdarm (5 % des Körpergewichts).
Zunge
4Die von vorne nach hinten im Darmtrakt ansteigenden Keimzahlen erreichen im
Dickdarm Werte von bis zu 1011 Keimen/g Darminhalt. Als Nährstoff für deren
Wachstum dienen in erster Linie Reststärke und pflanzliche Zellwandbestandteile,
die im Dünndarm nicht abgebaut werden konnten.
Leber und
Speiseröhre Gallenblase Dünndarm Dickdarm Rektum
Bauch- Ileum*
speichel-
drüse
Magen
5Durchfall – ein Problem
mit vielen Ursachen
D urchfall kann in fast jeder Altersgruppe zum Problem werden.
Bestimmte Erreger treten beim Schwein typischerweise in einer
bestimmten Altersgruppe auf und verursachen zu diesem Zeitpunkt die
größten klinischen Schäden. Werden Schweine einer anderen Alters-
gruppe infiziert, kann die Infektion u. U. völlig symptomlos verlaufen.
Unter den infektiösen Durchfallerregern spielen bakterielle, virale und
parasitäre Ursachen gleichermaßen eine Rolle.
So unterschiedlich die Ursachen auch sind, eine gute Stallhygiene und
gutes Management sind bei der Bekämpfung nicht zu vernachlässigen.
Durchfall darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden, denn schon
im Saugferkelalter werden die Weichen für gesunde und frohwüchsige
Tiere gestellt.
Einen Überblick über die am häufigsten auftretenden Erreger, die damit
zusammenhängenden Symptome sowie die betroffenen Altersklassen gibt
die nachfolgende Tabelle.
6Erreger-Übersicht 2
Erreger Altersgruppe Symptome
Escherichia coli Neugeborene 1–4 Tage alt; 1–3 wässriger, gelblicher Durchfall, Flüssigkeitsmangel,
(ETEC/EPEC) Wochen nach dem Absetzen plötzliche Todesfälle
Clostridium schaumiger Kot, auch wässrige oder schleimige
1–14 Tage (selten älter)
perfringens Typ A Beschaffenheit möglich
blutig-wässrige Durchfälle, abgestorbene Gewe-
Clostridium
1–14 Tage (selten älter) befetzen; plötzliche Todesfälle ohne vorherigen
perfringens Typ C
Durchfall möglich
Bakteriell
breiig-wässriger Kot; bei blutiger Ausprägung:
Lawsonia
Aufzucht bis Endmast teerfarbener Durchfall, blasse Tiere, Schwäche und
intracellularis
Koordinationsstörungen
Aufzucht bis Endmast (selten variabel: wässrig, schleimig-blutig;
Salmonella spp.
schon vor dem Absetzen) oft symptomloser Verlauf
Brachyspira ab einem Lebensalter von 6 Wo-
pastöse, unspezifische Durchfälle
pilosicoli chen bis etwa 4 Monaten
Brachyspira pastöse, unspezifische Durchfälle, gelegentlich
Aufzucht bis Endmast
hyodysenteriae auch schleimig-blutig; Lethargie
breiig-wässriger Kot, evtl. in Verbindung mit
PCV2 Aufzucht bis Endmast
Kümmern
1–7 Tage alte Tiere, am häufigsten wässriger bis pastöser Durchfall, Erbrechen;
Viral
Rotavirus
im Alter von 2 bis 3 Wochen auch symptomlose Erscheinung möglich
Coronaviren wässriger Durchfall mit schnellem Flüssigkeits-
alle Altersgruppen
(TGE/PED) mangel; oft auch Erbrechen
Peitschenwurm Aufzucht bis Endmast milder, unspezifischer Durchfall
Kokzidien 5–21 Tage (gelegentlich älter) wässriger, gelblicher Durchfall, Flüssigkeitsmangel
oft symptomlos bis auf Leistungseinbußen;
Spulwurm alle Altersgruppen selten ist die Ausscheidung ausgereifter Parasitär
Wurmstadien sichtbar
junge Tiere bei hochgradigem Befall: Entwicklungs-
vor allem bei Läufern, Mast- störungen, Blutarmut, blutiger Durchfall; Sauen:
Knötchenwurm
schweinen und Sauen Gewichtsverlust, verminderte Rauscheanzeichen,
Milchrückgang, verminderte Wurfleistung
Faktorenerkrankung
Sauen: unspezifischer Symptomenkomplex, erhöh-
Metritis-Mastitis-Agalaktie (MMA)
te Körperinnentemperatur, verminderter Durst, Ge-
als Ursache für mangelnde Kolostrumversorgung
säugeveränderungen, Anzeichen für Milchmangel
Neben den infektiösen Ursachen können auch nicht infektiöse Ursachen eine Rolle spielen (z. B. Futterzusammen-
setzung oder Qualität). Generell ist bei Saugferkeldurchfällen auch der Gesundheitsstatus der Sauen zu betrachten.
7Bakterielle Erreger
E. coli 3
Vorkommen/Ursache
• überall vorkommend, zur Darmflora gehörend
• Aufnahme erfolgt oral aus der Umwelt.
• enterotoxische* E. coli (ETEC): für den Großteil
der Saugferkeldurchfälle verantwortlich
- ETEC können sich mit ihren Fimbrien*
(überwiegend F4) an die Rezeptoren von
Darmzellen heften und dort vermehren.
- Normalerweise werden sie durch
mütterliche Antikörper neutralisiert, bevor
sie sich ansiedeln können.
• ETEC können Enterotoxine* produzieren ń
massive Abgabe von Flüssigkeit ins Innere des
Darms ń Elektrolytmangel ń Austrocknung;
evtl. Endotoxinschock* durch massenhaft sich
vermehrende Bakterien
• Erkrankung kann auch erst nach dem Absetzen
auftreten, wenn mütterliche Antikörper abgebaut
sind, aber noch keine eigene schützende
Immunität besteht.
Diagnostik
Symptome • beweisend: hohe E. coli-Gehalte im oberen
• betroffen sind: Saug- und Absetzferkel Dünndarmbereich bei frisch getöteten Ferkeln
• breiiger bis dünnflüssiger Kot; Durchfall durch • erste Hinweise: hämolysierende* E. coli in den
aktive Abgabe von Flüssigkeit, daher i. d. R. Kotproben
keine Schädigung des Darms • krankmachende Eigenschaften durch
Serotypisierung bestätigt: O-Antigen, Fimbrien-
Nachweis (F4, F5, F6, F41) und Enterotoxine LT
und ST
8Flagellen-Antigen:H
Somatisches
Antigen:O
Prophylaxe und Therapie
• akut betroffene Tiere: antibiotisch behandeln;
Flüssigkeitszufuhr
• Wichtigster Aspekt der Bekämpfung ist die
Prophylaxe über Impfstoffe.
• Biestmilchversorgung sicherstellen (!) Kapselantigen:K
• MMA-Prophylaxe
• Optimierung von Hygiene und Stallmanagement
Adhäsionsfaktoren (F4ab,
F4ac, F5 und F6)
9Bakterielle Erreger
Ödemkrankheit 3 • Typisch ist die froschartige Haltung der
Vordergliedmaßen und der Hintergliedmaßen,
Colienterotoxämie wenn sich das Tier in Bauchlage befindet.
• Bewusstseinseintrübung
Vorkommen/Ursache • Ödeme auf Augenlidern und Nasenrücken
• durch EDEC (die Ödemkrankheit verursachende • häufig tödlicher Verlauf
E. coli) ausgelöst
• weite Verbreitung
Diagnostik
• hohe Beständigkeit in der Umwelt
• Ödeme an Augenlider und Nasenrücken sind
• gehäuftes Vorkommen in bestimmten Regionen charakteristisch.
• Aus dem Kot gesunder Sauen gelangt der Keim in • bakteriologische Untersuchung sowie die
den Bereich der Ferkel: Bestimmung des E.coli Stammes
- Ab der dritten Lebenswoche werden im
Dünndarm der Ferkel F18-Rezeptoren
ausgebildet, an die sich die EDEC mittels Prophylaxe und Therapie
Fimbrien* anheften können.
• hochgradig betroffene Ferkel: keine Heilung
• EDEC können Enterotoxine* produzieren, die in möglich
Folge Durchfälle auslösen können. Das Stx2-Toxin*
• ansonsten parenteral* Antibiotika (z. B.
wird durch die Darmschleimhaut aufgenommen,
Enrofloxacin)
wo es zu Störungen der Blutgefäße führt, so dass
Plasma austritt und die ersichtlichen Ödeme in • Keimdruck senken; Hygiene
allen Geweben verursacht. • Futter ansäuern; Steigerung des Rohfasergehalts
• Zugelassener Impfstoff verhindert Klinik
Symptome
• tritt etwa 10–14 Tage nach dem Absetzen auf:
- Zu diesem Zeitpunkt haben sich so viele
EDEC an die Dünndarmwand angeheftet,
dass die Menge des gebildeten Shigatoxins
ausreicht, um klinische Symptome
hervorzurufen.
10Cl. perfringens 3 • Nekrosen* der
Schleimhaut; es kommt
letztendlich zu einer
nicht rückgängig
Vorkommen/Ursache zu machenden
• weit verbreitet; Cl. perfringens Typ A und Darmschädigung
Typ C spielen bei den Clostridien-Infektionen und infolgedessen
des Schweins die größte Rolle: zum Tod nach
wenigen Stunden.
- Cl. perfringens Typ C produziert ȕ1- und ȕ2-
Toxine. • chronisch:
Durchfall (grau-
- Cl. perfringens Typ A produziert Į undȕ2-
gelblich, grießig)
Toxine.
• Kommen auch im Darm gesunder Schweine vor:
- Bei älteren Tieren werden die Toxine durch Diagnostik
Trypsin inaktiviert.
• Kottupfer
- Neugeborene Ferkel nehmen mit der
• evtl. Sektion
Biestmilch jedoch Trypsininhibitoren* auf, die
• bakteriologische Untersuchung
die mütterlichen Antikörper vor Verdauung
schützen sollen. • Toxingennachweis mit PCR (Į, ȕ1)
• Infektion der Ferkel über den Kot des Muttertieres
Prophylaxe und Therapie
Symptome • bei seit Längerem bestehender nekrotisierender
Darmentzündung: ungünstige Prognose
• Gasbildung, schaumiger Kot, krankhafte
Veränderung der Darmwand • antibiotische Behandlung mit einem magensaft-
resistenten Penicillin oder Amoxicillin bei
• ȕ1-Toxin schwerwiegender in der Wirkung als
vermutlich infizierten, aber noch nicht erkrankten
Į-Toxin:
Buchtengenossen
- Folge der ȕ1-Toxine: nekrotisierende*
• Prophylaxe:
Darmentzündung
- Impfung! Für Cl. perfringens Typ A ist ein
• Typ C: Blutiger Kot in den ersten Lebenstagen
Impfstoff erhältlich. Für Cl. perfringens
ist charakteristisch.
Typ C sind mehrere Impfstoffe in
Kombination mit E. coli erhältlich.
- Hygiene, gründliche Reinigung
11Bakterielle Erreger
Lawsonia
intracellularis 4 –
Erreger der PIA*
Erreger
• Lawsonia intracellularis
• Bakterium: gram-negativ, nicht sporenbildend,
kapsellos
• Bakterium vermehrt sich in den Darmzellen. Darm unverändert
Vorkommen/Ursache
• weltweit und überall vorkommend
• orale Aufnahme über Kot
• v. a. bei Absetzferkeln und Läuferschweinen
• Zielzellen sind die Darmzellen, vor allem des
Ileums, aber auch von Dünndarm, Blinddarm und
Dickdarm; diese reifen nicht mehr aus und teilen
sich unkontrolliert ĺ krankhafte Vermehrung
unreifer Darmzellen mit dem Bild der PIA (Porzine
Intestinale Adenomatose)
• Nach der Regeneration der Darmschleimhaut
kommt es zu einer fibrinösen Entzündung*, die sich
ggf. zu einer nekrotisierenden Enteritis* (NE) oder
zu einer regionalen Ileitis* (RI) entwickeln kann.
- subklinischer oder milder Verlauf: Leistungs-
Symptome einbußen, Auseinanderwachsen
• verschiedene Verlaufsformen: - subklinisch schwerer Verlauf: Appetitlosigkeit
- chronisch: unkomplizierter Verlauf, meist und wiederkehrende Durchfälle, allerdings
Absetzferkel und jüngere Mastschweine moderater Durchfall, breiig bis wässrig, ohne
betroffen Blut und Schleim
12Pathologie
• häufigste Erscheinungsform: PIA
- Verdickung der Darm-
schleimhaut, v. a. im Ileum
(„hirnwindungsartig“)
- massive Vermehrung und
Verdickung der Darmzellen mit
Verlust der Becherzellen
• Bei NE können die Nekrosen die
Zellwucherung überlagern (hellgelbe
Herde in der Darmschleimhaut).
• Bei RI stellt sich das Ileum als ver-
dicktes, starres Rohr da.
• Bei der blutigen Darmentzündung
(hämorrhagische Enteropathie) sind
neben der schnellen Vermehrung
von Gewebe massive Blutungen ins
Darminnere zu beobachten.
Diagnostik
• Klinik und Pathologie
• Histologie oder Immunhistologie
Darm, verändert • Blutuntersuchungen
• Erregernachweis qualitativ oder
quantitativ (PCR) aus dem Kot
• diverse weitere Methoden
- akuter Verlauf: i. d. R. ältere Mastschweine
oder Jungsauen betroffen, die noch keine Prophylaxe/Therapie
ausreichende Immunität aufbauen konnten;
• Impfung
der Kot kann teerfarben oder wässrig-blutig
sein; teilweise schwere Störung des Allge- • antibiotische Therapie (z. B. Tylosin,
meinbefindens und Gefahr des Kollapses Tiamulin), ausreichend lang!
durch Volumenmangel; Sterblichkeit bis 50 %. Mindestens 14 Tage
13Bakterielle Erreger
Salmonellen 3
Vorkommen/Ursache
• weltweites Vorkommen
- überleben jahrelang in trockener Umgebung;
durch Staub wiederkehrende Infektionen
möglich
• Entstehung einer Salmonelloseĺ
- hohe Keimbelastung und Resistenzschwä-
che der Tiere durch Stress (unter Stress
kann eine massive Erregerausscheidung
einsetzen)
- Ausscheidung mit Unterbrechungen
- Dauerausscheider
• beim Schwein vorkommend: Salmonella cholerae-
suis und typhimurium; für die Lebensmittelhygie-
ne bedeutend: S. typhimurium
Symptome
• selten: Ausbruch einer klinischen Salmonellose
beim Schwein Diagnostik
• meist orale Aufnahme, aus der sich eine Allge- • Erregernachweis mit Resistenztest; Achtung:
meininfektion, eine Entzündung des Dünn- und Ausscheidung mit Unterbrechungen und
Dickdarms oder eine Mischform entwickelt intrazelluläre* Lokalisation der Erreger
• Allgemeininfektion: Salmonellen gelangen
ins Blut ĺ Entzündungskaskade ĺ hohes
Fieber, Mattigkeit, Zyanosen*; Schock, Husten/ Prophylaxe und Therapie
erschwerte Atmung; Durchfall teilweise blutig, Tod • subklinische/chronische Träger aus dem
• S. typhimurium: Durchfall durch massive Flüssig- Betrieb entfernen
keitsausschüttungen
14• bei akuter Salmonellose: Antibiotika (Ceftiofur, En-
rofloxacin), allerdings mit parallelem Resistenztest
Meldepflicht bei kulturellem
• Impfung, Behandlung, Elimination der Daueraus-
scheider
Nachweis in Schweine- und
• Optimierung der Betriebshygiene; Futterum-
Kotproben sowie bei klinischer
stellung (gröbere Struktur, Einsatz organischer Salmonellose!
Säuren)
• Grundsätzlich Faktoren abstellen, die das
Schweine-Salmonellen-Verordnung
Immunsystem der Tiere schwächen.
• Mutterschutzimpfung
15Bakterielle Erreger
Brachyspiren
(Schweinedysenterie) 4
Erreger
• Brachyspira hyodysenteriae
• Bakterium: gram-negativ, zwingend ohne
Sauerstoff lebend, intrazellulär
• drei weitere, nicht zwingend krankmachende
Brachyspiren: B. pilosicoli (Spirochätenkrankheit),
B. hampsonii, B. suanatina
Vorkommen/Ursache
• weltweit verbreitet
• orale Aufnahme ĺ Ansiedlung des Erregers in
den Darmzellen, v. a. in den Becherzellen des
Dickdarms ĺ Schleimproduktion
• Entzündung der Darmschleimhaut ĺ gestörte
Funktionen im Dickdarm
• resistenzmindernde Faktoren ĺ Minderung der
Mastleistungĺ leichter Durchfall
• Letztlich zerstören die Erreger die Darmzellen
und brechen in tiefere Darmschichten ein ĺ
fibrinöse Entzündung ĺ Fibrinflocken im Kot; bei
• Kot: Schleimbeimengungen, Fibrin, zementfarben
stärkeren Gefäßschädigungen Blutungen möglich.
• Bei B. hyodysenteriae kann es zu massivem
blutigen Durchfall kommen.
Symptome
• dünnflüssiger Kot, der Dickdarm entleert sich
Pathologie
• eingefallene Flanken, Abmagerung
• straßenpflasterartige Veränderung der Darm-
schleimhaut
16Bildqualität
gering
Diagnostik
• Klinische Symptome sind charakteristisch:
Häufig Mischinfektionen und auf-
eingefallene Flanken, dünnflüssiger, ablaufender grund der unspezifischen Symp-
Kot; Fibrin-, Schleim- oder Blutbeimengungen im Kot.
tome keine klare Abgrenzung zu
• Kotproben: PCR, Bakterielle Untersuchung anderen Erregern möglich!
Prophylaxe/Therapie:
• Tiamulin und Valnemulin
• Hygiene, Desinfektion
17Bakterielle
Virale Erreger
Erreger
Circoviren Vorkommen/Ursache
(PCV2-assoziierte Enteritis*) 3 • weltweit und überall
• v. a. bei Absetzferkeln und Läuferschweinen
• Monoinfektion oder Mischinfektion mit anderen
Erreger Darmerregern
• porcines Circovirus Typ 2 ĺ Auslöser der PCVD
• ggf. ohne gleichzeitige Symptome von PMWS
(PCV2-Disease) = verschiedene Krankheitsbilder
(Postweaning Multisystemic Wasting Syndrom =
unter Beteiligung von PCV2
Kümmern)
- u. a. auch die PCV2-assoziierte Entzündung
des Verdauungstraktes
• kleinstes Virus beim Schwein Symptome
• unbehülltes DNA-Virus • unspezifische Durchfallsymptomatik
(dünnbreiiger bis wässriger Kot)
• Zielzellen: Zellen des Immunsystems
18Pathologie Diagnostik
• mit dem bloßen Auge ähnlich einer wuchernden • Klinik und Pathologie
Veränderung des Darms:
• Gewebeuntersuchungen
- verdickte Schleimhaut, vergrößerte
• Blutuntersuchung mit Nachweis von Antikörpern
Darmlymphknoten
• Erregernachweis (PCR)
• mikroskopisch eine entzündliche Veränderung des
Darms mit Verkümmerung der Darmzotten und
absterbenden Bereichen
Prophylaxe/Therapie
• Optimierung von Managementmaßnahmen
• Impfung
• Therapie von zusätzlich auftretenden Infektionen
19Bakterielle
Virale Erreger
Erreger
Rotaviren 3
(Rotavirus-Infektion)
Erreger
• Rotavirus, Familie der Reoviridae
• unbehüllte Viren mit doppelsträngiger RNA
• Einteilung in 7 Gruppen (A bis G), beim Schwein
kommen die Gruppen A bis C und E vor
Vorkommen/Ursache
• weltweit vorkommend bei Mensch und Tier
• orale Aufnahme, dann Vermehrung in den
Darmzellen; es kommt zur Verkümmerung der
Darmzotten
• nach überstandener Infektion vollständige Immu-
nität gegen alle Serotypen
• Der wirksame Schutz der Saugferkel ist abhängig
von der Menge der vom Muttertier übertragenen
Antikörper.
• sehr frühe Infektionen bei fehlender Immunität
Symptome der Sauen/schlechter Biestmilch
• Erkrankung i. d. R. im Alter zwischen 2 und 8
• Symptome: Apathie, Erbrechen, Durchfall mit
Wochen
wässrigem bis pastösem Kot von weiß-gelber
• Verkümmerung ist bei jüngeren Tieren stärker oder grau-grüner Farbe
ausgeprägt ĺ ausgeprägtere Klinik.
• Erkrankungsrate und Verluste abhängig von Alter,
• In vielen Herden kommen Rotaviren andauernd zeitgleich ablaufenden Infektionen und Manage-
vor, sodass die Infektion oft unterschwellig vor- ment (Umgebungstemperatur)
handen ist.
20Pathologie Prophylaxe/Therapie
• sowohl mit dem bloßen Auge als auch bei Gewebe- • Keine kommerziell zugelassenen Impfstoffe für
untersuchungen nicht von Coronavirus-Infektionen Schweine in Deutschland erhältlich; lediglich für
zu unterscheiden Rinder gibt es entsprechende Impfstoffe.
• Immunisierung von Jungsauen und tragenden
Sauen durch Kotkontakt
Diagnostik
• Management! Biestmilch, Klima, Hygiene
• Sinnvoll ist nur der direkte Erregernachweis.
• Absetzen von Milchaustauschern und Starterfut-
tern, um dem Durchfall entgegenzuwirken
• ggf. die bakteriellen Sekundärinfektionen
behandeln
21Bakterielle
Virale Erreger
Erreger
Coronaviren 3
Beim Schwein kommen drei unterschiedliche Corona-
viren vor, die folgende Krankheitsbilder hervorrufen:
• Vomiting and Wasting Disease
(VWD = Erbrechen und Kümmern)
• Porcine Enzootische Diarrhoe
(PED = Durchfall des Schweins, der in allen
Altersgruppen auftritt)
• Transmissible Gastroenteritis
(TGE = ansteckende Magen-Darm-Entzündung)
Vomiting and Wasting Disease
• Vorkommen: selten, und dann vor allem bei Saug-
ferkeln
• Erreger: hämagglutinierendes* Enzephalomyelitis-
Virus
• Die Infektion von Nervenknoten im Magen führt
zum Verschluss des sogenannten Magenpförtners,
der den Magen gegenüber dem Darm abschließt. • Übertragung über oralen Kontakt mit Kot; Virus-
Die Tiere sind nicht in der Lage, Nahrung aufzu- vermehrung in den Dünndarmzellen
nehmen bzw. würgen einen Großteil der aufge- • Klinische Symptome sind ähnlich wie bei der TGE.
nommenen Nahrung hoch. Es kommt zu einer Leitsymptom: wässriger Durchfall
Ausdehnung des Magens, die Tiere magern ab und
• Diagnostik: Virusnachweis oder Nachweis von
verenden schließlich.
Antikörpern
• keine Therapie möglich
Transmissible Gastroenteritis
Porcine Enzootische Diarrhoe • Nur noch sporadisch vorkommend; eine Mutation
• kann alle Altersgruppen betreffen, Todesfälle bei hat zu einem weniger pathogenen Virus geführt.
Saugferkeln durch Austrocknung Dieses ist weit verbreitet und hat eine „natürliche“
Immunität bewirkt.
• Überträger sind infizierte Tiere und Gegenstände
(Stiefel, Arbeitsgerät etc.).
22• kann alle Altersstufen betreffen Prophylaxe/Therapie
• übelriechender, wässriger Kot; keine Blutbei- • keine kommerziell zugelassenen Impfstoffe für
mengungen Schweine in Deutschland erhältlich; nur Rinder-
impfstoffe zugelassen
• bei Saugferkeln deshalb besonders kritisch, weil
der hochgradige Durchfall zum Austrocknen und • Immunisierung von Jungsauen und tragenden
letztendlich zum Kreislauf- und Nierenversagen Sauen durch Kotkontakt
führt; Sterblichkeit bei der Altersgruppe der bis zu
• Management! Kolostrumaufnahme, Klima, Hygiene
14 Tage alten Ferkel liegt bei 100 %
• Absetzen von Milchaustauschern und Starterfuttern,
• Überlebende Tiere zeigen häufig in der Folge
um dem Durchfall entgegenzuwirken
Leistungsreduktion.
• ggf. die gleichzeitig ablaufenden bakteriellen
• Diagnose durch direkten Virusnachweis
Infektionen behandeln
23Parasitäre Erreger
Kokzidien des
Schweins
(Isospora suis) 3
Erreger
• Isospora suis ist ein Verursacher für Entzün-
dungen des Verdauungstraktes bei Saugferkeln
im Alter von 2 bis 3 Lebenswochen.
• hohe Widerstandsfähigkeit, rasche Weiter-
entwicklung, massive Ausscheidung durch
betroffene Tiere
Vorkommen/Ursache
• Hauptansteckungsquelle: ältere Ferkel und
Sauen, verunreinigte Buchten
• Nach der oralen Infektion werden die infektiösen
Wurmeier freigesetzt, dringen in die Schleimhaut
Diagnostik
des Dünndarms und vermehren sich in den Zellen • Kottupfer von Ferkeln, die die Infektion bereits
der Darmmukosa ĺ Zottenzerstörung ĺ vermin- überstanden haben, sind am ehesten geeignet.
derte Aufnahme von Nährstoffen.
• Relativ lange Nachweiszeit führt häufig zu
• Wegbereiter für Clostridien und Rotaviren, weil falschen negativen Ergebnissen.
diese leichteren Zugang zu den tieferen Darm-
schichten erhalten
Prophylaxe/Therapie
• vorsorgliche Behandlung in der ersten
Symptome
Lebenswoche (Toltrazuril)
• Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten der
• tägliche Reinigung der Buchten
ersten Symptome 3–4 Tage
• Bekämpfung von Fliegen und Schadnagern (Über-
• Übelriechende, pastös-wässrige
träger); Einsatz geeigneter Desinfektionsmittel
Durchfälle
• Austrocknung, Ferkel nehmen kaum zu
• Grad der Symptome ist altersabhängig.
24Schweine-
peitschenwurm
(Trichuris suis) 3
Erreger
• schlanker, ca. 0,4 cm langer Fadenwurm
Vorkommen/Ursache
• vor allem bei Läufern, Mastschweinen und Sauen
• bohrt sich in die Schleimhaut des Dickdarms und
saugt dort Blut
• Verbreitung der sehr widerstandsfähigen Eier (in
feuchten Ausläufen jahrelang infektiös) mit dem Kot
• in bestimmten Gebieten gehäuft und immer wieder
vorkommend
• Aus den aufgenommenen Eiern entwickeln sich
Larven, diese schlüpfen im Dünndarm. Es folgt eine
zweiwöchige Gewebepassage. Im Dickdarm bohren
sich die Larven dann in die Schleimhaut und saugen
dort Blut.
Diagnostik
Symptome • siehe Pathologie
• Blutarmut bei hochgradigem Befall • Kotuntersuchung: Nachweis von typischen
zitronen-förmigen Eiern
• übelriechender, dünnbreiiger Durchfall
• Abmagerung, Bauchwassersucht
Prophylaxe/Therapie
Pathologie • Entwurmung, Stallhygiene, Stallmanagement
• Nachweis von Peitschenwürmern, die
aus der Schleimhaut ragen
25Parasitäre Erreger
Schweine-
spulwurm
(Ascaris suum) 3
Erreger
• Fadenwurm
Vorkommen/
Ursache
• alle Altersklassen betroffen; in
bestimmten Gebieten gehäuft und
immer wieder vorkommend
Pathologie
• Milchflecken (Leber)
• Verbreitung über Kot
• punktförmige Blutungen (Lunge und Leber)
• Spulwurmeier sind sehr widerstandsfähig ge-
gen Umwelteinflüsse und Desinfektionsmittel
und können bis zu 10 Jahre infektiös bleiben.
Diagnostik
• Aus den Eiern des Spulwurms entwickeln
sich nach der oralen Aufnahme Larven, die • Kotuntersuchungen
im Körper des Wirtstieres ein Wanderstadium • Nachweis von Würmern
durchmachen. Dabei passieren sie auch die
• Milchflecken sind beweisend.
Leber (typische Veränderungen hier: Milch-
flecken/Milk Spots) und die Lunge.
Prophylaxe/Therapie
Symptome • Sauen vor dem Einstallen ins Abferkelabteil
waschen und entwurmen.
• klinische Symptome vor allem bei Ferkeln und
in der Vormast: • Bestandsbehandlungen
- Blutarmut, verzögertes Wachstum; bei • Rein-Raus-Verfahren mit entsprechenden
starkem Befall: Husten, Atemnot und Reinigungs- und Desinfektionsprogrammen
Fieber, Durchfall Achtung: Auf die Wahl eines geeigneten
Desinfektionsmittels achten!
26Knötchenwurm
des Schweins
(Oesophagostomum
dentatum) 3
Erreger
• schlanker, ca. 1,5 cm langer Fadenwurm
Vorkommen/Ursache
• vor allem bei Läufern, Mastschweinen und Sauen
• ernährt sich von Dickdarmgewebe
• Verbreitung der Eier (monatelang überlebensfähig)
mit dem Kot
• Befallsrate steigt mit dem Alter an.
Symptome Quelle: Prof. Dr. H. Mehlhorn, Heinrich Heine Universität
• junge Tiere bei hochgradigem Befall: Entwick-
lungsstörungen, Blutarmut, blutiger Durchfall
• Sauen: Gewichtsverlust, verminderte Rauschean-
zeichen, Milchrückgang, verminderte Wurfleistung
Diagnostik
• Sektion: Nachweis von Würmern und Knötchen
• Kotuntersuchung: Eier
Pathologie
• Knötchen in der Schleimhaut verschiedener Darm-
abschnitte, hervorgerufen durch Immunreaktionen Prophylaxe/Therapie
des Körpers, wenn die Larven in die Darmschleim- • Entwurmung, Stallhygiene, Stallmanagement
haut eindringen
27Faktorenerkrankung
Metritis-Mastitis-
Agalaktie (MMA) 4
Qualität und Quantität von Biestmilch sind bei
Saugferkeldurchfällen unbedingt zu berücksichtigen.
Eine wichtige Ursache für eine mangelnde
Biestmilchversorgung ist die MMA.
• Faktorenerkrankung, die durch Milchmangel
(Hypogalaktie) gekennzeichnet ist
• Ursache sind von bestimmten Bakterien gebildete
Giftstoffe, die zu einer entzündlichen Reaktion
führen.
• Hauptentstehungsorte der Giftstoffe:
- Verstopfung im Darm
- Gebärmutterentzündung (verschleppte
Geburten, geburtshilfliche Eingriffe)
- Entzündung von Harnblase und Harnröhre
- Gesäugeentzündung
• Es gibt verschiedene begünstigende Faktoren,
wie zum Beispiel:
- Infektionen des Harn- und Gesäugeveränderungen, verminderter
Geschlechtstraktes Fresslust, verändertem Wochenfluss und
- Nachgeburtsverhalten Apathie
- Anzeichen für Milchmangel sind
ausschlaggebend: Die Ferkel sind unruhig
Symptome und weisen Kampf- und Bisspuren vom
Gerangel um das Gesäuge auf. Aufgrund
- ein insgesamt unspezifischer
von Hunger werden vermehrt ungeeignete
Symptomenkomplex von erhöhter
Materialien aufgenommen. Betroffene
Körperinnentemperatur (Gelegentlich
Tiere zeigen eingefallene Flanken, gräuliche
kann auch eine Erhöhung der
Hautfarbe, sind matt und fallen schließlich
Körpertemperatur während der
ins Koma.
Laktation auftreten.), veränderter
Kotbeschaffenheit, vermindertem Durst,
28Prophylaxe - Rationsgestaltung; Calcium/Phosphor-
Versorgung– beachten; Verdauungsstörungen
- Vermeidung von Geburtskomplikationen
vermeiden
wie eine verlängerte Abferkeldauer oder
Infektionen durch Geburtshilfe-Eingriffe (ggf. - Vorbeugung von Harnwegsinfektionen (bspw.
auch Nachgeburtsbehandlungen festlegen) Wasserversorgung, -qualität, -akzeptanz)
- Keimdruck in der Umgebung senken
(Hygiene!)
Therapie
- Stallmanagement optimieren (Sauen
- Beim Auftreten der ersten Symptome
waschen, Wasser zur freien Verfügung,
nach dem Abferkeln sollte eine sofortige
Rein-Raus-Verfahren, Bewegung, Raufutter
Therapie, bestehend aus Antibiotika und
zugeben etc.)
entzündungshemmenden Präparaten,
erfolgen, um ein Einstellen der Milch-
produktion zu verhindern.
29Nicht infektiöse Ursachen
Fütterung 5, 6, 7
Eine leistungsfähige Ferkelfütterung muss zum Ziel haben, die Aufzucht der Ferkel
möglichst problemlos (unter Vermeidung von fütterungsbedingtem Durchfall) mit
hohen täglichen Zunahmen und geringen Aufzuchtverlusten durchzuführen.
Folgende Fütterungsziele müssen angestrebt werden:
1. Schnelle und hohe Kolostrumaufnahme
• innerhalb der ersten 2–3 h (spätestens nach 12 h)
• mindestens 250–300 g Kolostrum je Ferkel
Zusammensetzung von Kolostral- und Normalmilch
Stunden nach dem Werfen Normal-
Geburt 3 6 12 24 milch
Fett in % 7,2 7,3 7,8 7,2 8,7 7–9
Eiweiß in % 18,9 17,5 15,2 9,2 7,3 5–6
Lactose in % 2,5 2,7 2,9 3,4 3,9 5
Quelle: nach Kirchgeßner
Der hohe Eiweißgehalt des Kolostrums ist entscheidend – über 55 % des Eiweißes
sind Globuline (Antikörper).2. Frühzeitige Gewöhnung an pflanzliche,
stärkereiche Nahrung
(Enzymtraining)
Enzymaktivität (Lactase, Maltase, Pepsin, Trypsin und Chymotrypsin)
Amylase
(Stärke)
Lactose
(Milchzucker)
Maltose
(Zucker)
Lipase
(Fett) Pepsin u.
Trypsin
(Eiweiß)
Quelle: nach Kirchgeßner
1 2 3 4 5 6 7
Alter (Wochen)
In den Verdauungssäften der neugeborenen Ferkel sind hauptsächlich Milcheiweiß, Milchfett
und Milchzucker spaltende Enzyme vorhanden. Dieses Enzymmuster orientiert sich physio-
logisch an der Zusammensetzung der Sauenmilch in den ersten Tagen post partum. Deshalb
können die Ferkel in den ersten Lebenstagen aufgrund der fehlenden Enzymausstattung
Energie und Protein aus pflanzlichem Futter nicht ausreichend nutzen.
Um die Ferkel optimal auf das Absetzen (Umstellung auf pflanzliche Nahrung) vorzubereiten,
ist ein Enzymtraining außerordentlich wichtig (siehe Abbildung Enzymaktivität).
31Nicht infektiöse Ursachen
Praktische Hinweise zur Fütterung
1. Diätabsetzfutter zur Darmstabilisierung in der Absetzphase bei
Durchfallproblemen
Ein sehr kritischer Zeitraum ist die Anfangsphase nach dem Absetzen. Die Ferkel sollten in dieser Phase ein Futter
bekommen, an das sie bereits gewöhnt sind (Absetzfutter bereits eine Woche vor dem Absetztermin den Ferkeln in
der Abferkelbucht anbieten). Ein spezielles Absetzfutter (viele hochverdauliche Komponenten), Milchprodukte, aufge-
schlossener Weizen etc. erleichtern den Übergang von der Milchnahrung zur festen Nahrung. Bei Umstellungsproble-
men bietet sich zum Absetzen ein spezielles Diätfutter mit mehr darmstabilisierenden Elementen an.
Diätfutter für die Altersgruppe der 8–12 kg schweren Ferkel
Energie Lysin/ME Rohprotein
Lysin g Rohfaser g Calcium g Phosphor g Verd. P g
ME/MJ g/MJ g
13,0 1,00 13,0 165 mind. 40 6,5 5,0 3,3
Quelle: DLG Information 1/2008
2. Parameter, die bei Diätfuttereinsatz beachtet werden sollten
a. Reduktion der Säurebindungskapazität des eingesetzten Futters
Säurebindungskapazität (< 700 meq/kg) wird erreicht durch Rohproteinabsenkung, pufferarmes Mineralfutter
(Säurebindungskapazität < 5000 meq/kg). Pufferarmes Mineralfutter beinhaltet z. B. organische saure Mineralstoff-
verbindungen, Magnesium-Natrium-Calcium-Phosphat sowie Monocalciumphosphat und ist im Einsatzumfang bei
Calciumcarbonat und Magnesiumoxid begrenzt. Reduzierte Calciumgehalte (< 7 g/kg), Säurezulage und Einsatz von
freien Aminosäuren.
b. Erhöhung der Nährstoffverdaulichkeit (Verhinderung ernährungsbedingter Verdauungsstörungen)
Energieträger: aufgeschlossenes Getreide, Getreidequellmehle, Lactose, Pflanzenöle
Proteinträger: Blutplasma, Eipulver, hydrolisierte Proteine, Milchprodukte, Kartoffeleiweiß, Sojaproteinkonzentrate
c. Förderung der Darmmotorik (Nahrung für die Darmmikroorganismen im Dickdarm)
Gerüstkohlenhydrate: Gerste, Hafer, Lignocellulose, Obsttrester, Sojaschalen, Traubenkernmehl, Trockenschnitzel,
Kleien
d. Senkung des pH-Wertes, Aktivierung von Verdauungsenzymen, Hemmung von Mikroorganismen in
Futter und Magen
Organische Säuren und deren Salze, z. B. Ameisen-, Benzoe-, Fumar-, Propion-, Sorbinsäure, und deren Gemische
und mittelkettige Fettsäuren, z. B. Butter-, Linolensäure
e. Stärkung der Hauptflora bei gleichzeitiger Hemmung der Begleit- und Schadflora
Probiotika: Milchsäurebakterien, sporenbildende Keime, Hefezellen
32f. Unterstützung des Enzymsystems durch Abbau von pflanzlicher Stärke und
Nicht-Stärke-Polysacchariden (NSP)
Enzyme; Amylasen, Glucanasen, Xylanasen
g. Abbau zu flüchtigen Fettsäuren mit Hemmwirkung auf potentielle pathogene Keime
wie z. B. E. coli, Salmonellen und Clostridien
Prebiotika (Oligosaccharide) wie z. B. Fructo-Oligosaccharide, Galacto-Oligosaccharide und Mannan-Oligosaccharide
h. Erwartung gesundheitsstabilisierender und leistungsfördernder Effekte
Phytobiotika = Kräuter und Gewürze, z. B. Oregano, Thymian, Zimt, Knoblauch sowie deren Extrakte und daraus
gewonnene ätherische Öle
Die hier aufgeführten Punkte stellen das heute verfügbare Instrumentarium von Fütterungsmaßnahmen zur Unter-
stützung der Verdauungsfunktionen bei Ferkeln und zur Vorbeugung fütterungsbedingter Durchfallerkrankungen dar.
Grundsätzlich gibt es aber kein allgemeingültiges Patentrezept.
Es ist immer unter den einzelbetrieblichen Bedingungen zu entscheiden, ob und ggf. welche der hier aufgeführten Maß-
nahmen ergriffen werden sollen. Schwachstellenanalysen helfen hier oftmals, die entscheidenden Lücken aufzudecken.
Es sind immer auch Impfmöglichkeiten sowie Verbesserungsmöglichkeiten im Management (Futter-, Trog- und Stall-
hygiene, Lüftung, Temperatur) miteinzubeziehen.
So groß ist der Unterschied zwischen Sauenmilch und Ferkelfutter:
Sauenmilch Ferkelfutter
Protein Stärke
Lactose Protein
Asche Fett
Fett Zucker
Faser
Asche
Milchsäurebildung Salzsäurebildung
Quelle: Bernd Grunhaupt; Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
33Nicht infektiöse Ursachen
Management 5, 8
Neben fehlerhaften Futtermischungen und unpassenden Fütterungs-
strategien hat der Komplex Haltungs- und Hygienemanagement eine
herausragende Bedeutung zur Vermeidung von Verdauungsstörungen.
10 Managementmaßnahmen zur Vermeidung von
Verdauungsstörungen:
1. Einstallen der Sauen
• Gereinigter und desinfizierter Abferkel- und Flatdeckstall
(wenn möglich Leerstehzeiten ausschöpfen)
• Verwendung von geeigneten Desinfektionsmitteln (DVG-Listung)
• Auf ausreichende Konzentration und Einwirkzeiten des Desinfekti-
onsmittels achten!
(Vorreinigung des Stalls mit fettlösendem Schaumreiniger!)
• Sauen/Ferkel vor dem Einstallen mit geeignetem Mittel waschen;
nicht in der sauberen Abferkel- oder Flatdeckbucht!
2. Wasserversorgung
• Vor(!) dem Aufstallen der Tiere prüfen
• Altes Wasser aus der Leerstehzeit ablaufen lassen.
• Durchflussrate für Saugferkel 0,4–0,5 l/min; Durchflussrate für
Absetzferkel 0,5–0,7 l/min; Durchflussrate für Sauen 2,5–3,0 l/min
• Wasserversorgung auch während der Säugephase/Flatdeckphase
regelmäßig prüfen.
• Eventuell den Sauen in der ersten Woche nach dem Abferkeln
zusätzlich Wasser in den Trog füllen. Den Ferkeln am Absetztag
ebenfalls zusätzlich Wasser oder Elektrolytlösung anbieten.
• Wasserleitungen regelmäßig mit geeigneten Mitteln reinigen.
Biofilm!
• Wasserqualität mindestens einmal im Jahr untersuchen, auch bei
Fernwasser.
Hinweis für gute Wasserversorgung: Würden Sie dieses Wasser
selbst trinken?3. Stalltemperatur/Lüftung
• Im Abferkelstall maximal 21 °C; Temperatur im Ferkelnest 32–35°C.
Achtung: Die Tagesschwankungen im Nest können erheblich sein!
Seitenlage Bauchlage Nestrandlage Streulage Haufenlage
ideal noch gut zu warm viel zu warm zu kalt
kein Regelungsbedarf Regelungsbedarf
• Unterkühlung als Ursache für Saugferkeldurchfall oft unterschätzt!
• Liegeverhalten der Ferkel im Nest beobachten: Unterkühlung als Ursache für Saugferkeldurchfälle oft
unterschätzt, Tagesschwankungen oft erheblich, Ferkelnester sind aufgrund der Variabilität einzeln zu
betrachten! Messungen der Temperatur in den Nestern vor dem Abferkeltermin.
• Im Flatdeck: Einstalltemperatur 28 °C. Achtung! Auch der Boden soll 28 °C haben.
Je Flatdeckwoche -1 °C. Keine Zugluft, keine Undichtigkeiten im Stall, z. B. Wanddurchbrüche,
Gülleschieber.
4. Neugeborenenversorgung
• Ferkel sofort nach der Geburt mit Trockenpulver oder Einwegtüchern abreiben:
- Diese Maßnahme beugt dem Wärmeverlust vor. Neugeborene Ferkel haben wenige Energie-
reserven.
• Orientierungslose Ferkel an das Gesäuge ansetzen.
• Nabelschnur nicht abreißen, sondern abwarten, bis die Nabelschnur austrocknet. Eventuell Nabelschnur
mit Jodlösung desinfizieren.
5. Biestmilchversorgung
Eine Muttersau hat im Durchschnitt 3,0–3,5 kg Biestmilch.
Bei 250–300 g Biestmilchaufnahme pro Ferkel ergibt sich eine optimale Versorgung mit Biestmilch
von ca. 14 Ferkeln.
35Nicht infektiöse Ursachen
Bei großen Würfen und längeren Geburten Splitsäugen anwenden (die erstgeborenen Ferkel
werden in das Ferkelnest weggesperrt).
6. Buchtenhygiene und Sauenkontrolle
• Regelmäßig Kot aus den Abferkelbuchten entfernen.
• Keine feuchten Ecken in der Bucht. Feuchtigkeit mit Einstreupulver binden.
• Temperatur der Sauen in den ersten drei Tagen nach der Geburt prüfen und ggf. Sauen
behandeln (Milchleistung!).
7. Ferkel anfüttern
• Ab der zweiten Woche kleine Mengen Prestarter anbieten (mehrmals täglich frisch).
• Bei großen Würfen ab dem zweiten Tag nach der Geburt mehrmals täglich Ferkelmilch
mit anbieten, dabei aber auf die Hygiene achten (Milchschalen mehrfach entleeren und
täglich reinigen).
• Bereits am ersten Tag nach der Geburt frisches Wasser (Traubenzuckerlösung) anbieten
(Hygiene beachten).
• Bereits eine Woche vor dem Absetztermin das Absetzfutter zusammen mit Prestarter
anbieten. Achtung! Nichts ist ein besseres Nährmedium für Keime als eine verschmutzte
Anfütterungs-Milchschale.
8. Absetzen
• Das Absetzen den Ferkeln so stressfrei wie irgend möglich gestalten.
• Wurfgeschwister zusammen lassen, so wenig Würfe wie möglich mischen.
• Bei bekannten Problemen mit Absetzdurchfall die Ferkel am Absetztag nicht impfen
(zusätzlicher Stress).
• Rein-Raus-Verfahren strikt einhalten.
• Gut erreichbares schmackhaftes Futter und Wasser anbieten. Achtung! Breiautomaten
nicht zu stramm einstellen, kleine Ferkel müssen sich erst an die Technik gewöhnen!
• Durch Zufütterung von Flüssigfutter in den ersten Tagen nimmt die Futteraufnahme zu.
Mehrmals täglich Flüssigfutter über einen separaten Trog in der Nähe des normalen
Futters anbieten.
36• Viele Ferkel lernen erst nach dem Absetzen zu fressen. Es kann bis zu drei Tagen dauern, bis die letzten
Ferkel ihr erstes Trockenfutter zu sich nehmen. Sie lernen das Fressen vor allem, indem sie es sich von
ihren Stallgenossen abschauen. Im Dunkeln sehen die Ferkel dies nicht. Deshalb in den ersten drei Tagen
nach dem Absetzen das Licht anlassen.
• Eventuell in den ersten Tagen nach dem Absetzen ein Tier- Fressplatz- Verhältnis von 1 : 1 anbieten
(ggf. zusätzliche Futterschalen). Dies entspricht dem gemeinsamen Säugen an der Mutter und die Ferkel
gehen dadurch schneller an das Futter.
• Finden Sie in den ersten Tagen die sogenannten „Futterverweigerer“ (Kennzeichen: hohle Flanken, ge-
sträubte Haare, tief liegende Augen). Die Futterverweigerer in eine separate Bucht verbringen und dort
mit zusätzlich Flüssigfutter, Prestarter und frischem Wasser zum Fressen bringen. Manchmal kann es
helfen, die Tiere kurz mit der Schnauze in den Trog zu tauchen!
• In den ersten Tagen nach dem Absetzen den Kot der Tiere beobachten und bei zu dünnem Kot ggf. reagie-
ren. Es muss nicht immer gleich antibiotisch sein, manchmal reicht auch die zusätzliche Gabe von Rohfa-
ser, z. B. Luzernegrünmehl.
9. Tierbeobachtung
Gehen Sie grundsätzlich mit „offenen Augen“ durch das Flatdeck. Achten Sie auf die Tiersignale (Liegeverhal-
ten, eingefallene Flanken, tiefliegende Augen), diese zeigen Ihnen, ob sich ein Tier wohl oder unwohl fühlt.
10. Unterstützung
Wenn im Stall Probleme auftreten, unterstützen Sie auch gerne die tierärztlichen Beraterinnen und Berater
unseres Technical Service.
37Glossar
Glossar
A Fimbrien: Haarähnliche Anhangsgebilde mancher
Bakterien, mit denen sich diese an Oberflächen heften
Antikörper: Proteine, die im Körper als Reaktion auf
können.
bestimmte Stoffe (= Antigene) gebildet werden. Sie
dienen der Immunabwehr.
G
D Gram-negativ: Die Gramfärbung ist eine spezielle
Art, Bakterien im Labor anzufärben. Aufgrund ihrer
Duodenum: Zwölffingerdarm
äußeren Zellwand erscheinen die Bakterien nach der
E Anfärbung im Mikroskop entweder bläulich (gram-
positiv) oder rötlich (gram-negativ).
Endotoxinschock: Endotoxine sind Bestandteile der
Zellwand mancher Bakterien. Werden diese Bestan- H
teile in großer Zahl und plötzlich freigesetzt (z.B. durch
Hämagglutinierend: Blutverklumpend
Absterben vieler Bakterien), dann kann es u.a. zur
Störung des Herz-Kreislaufsystems und einer Störung Hämolysierend: Die roten Blutkörperchen schädi-
der Blutgerinnung kommen. Die Gesamtheit dieser gend, so dass der Blutfarbstoff austritt.
Störungen wird als Endotoxinschock bezeichnet.
I
Enterotoxine: Es handelt sich um Proteine, die von
Ileum: Ein Darmabschnitt, der als "Krummdarm" oder
manchen Bakterienarten oder -stämmen abgesondert
"Hüftdarm" bezeichnet wird.
werden und die Hauptursache für deren Pathogenität
darstellen. Immunsystem: Die Summe der Abwehrmechanis-
men, mit denen der Körper eingedrungene Krank-
Enterotoxisch: Für den Darm gifitg
heitserreger bekämpft.
Enterotoxizität: Eine giftartige Wirkung verschiedener
Intrazellulär: Innerhalb einer Zelle
Substanzen (sog. Enterotoxine) auf den Darmtrakt, die
zu einer vermehrten Ausscheidung von Flüssigkeit aus J
der Darmwand führt. Es gibt verschiedene Krankheits-
Jejunum: Zwölffingerdarm
erreger, die Enterotoxine bilden können (z. B. E.coli).
L
F
Lymphatische Einrichtungen: Sind Bestandteil des
Fibrinöse Entzündung: Entzündung, bei der es durch
lymphatischen Systems und stellen einen Teil des
Schädigung der Blutgefäße zu einem Austritt von
Immunsystems dar.
Blutplasma und dem darin enthaltenen Fibrinogen
(ein Stoff, der bei der Blutgerinnung eine Rolle spielt) N
kommt. Das Fibrinogen legt sich als Netz auf den
Nekrose: Gewebetod, Zelltod
Entzündungsort.
Nekrotisierend: Nekrose, also Zelltod, hervorrufend
38P S
Parenteral: Unter Umgehung des Darms; beschreibt Stx2-Toxin: Protein, welches von einer bestimmten
den Vorgang, auf dem Stoffe in den Körper gelangen, Art von E.coli Bakterien produziert wird. Hat auf Zellen
ohne den Darm zu passieren. eine gifitge Wirkung.
Pathogen: Pathogenität ist die grundsätzliche Fähig- T
keit von infektiösen Organismen (z. B. Viren oder Bak-
Trypsininhibitoren: Stoffe, die die Wirkung des
terien) einen anderen Organismus krank zu machen.
Enzyms Trypsin (ein Verdauungsenzym) hemmen.
PCV2-assoziierte Enteritis: PCV2 bedingte Darment-
zündung Z
Zyanose: Blaufärbung der Haut, der Schleimhäute,
PIA – Porzine intestinale Adenomatose: Verdickun-
Lippen oder Fingernägel; entsteht in der Regel durch
gen und Faltenbildungen der Darmschleimhaut. Diese
mangelnde Sauerstoffversorgung des Blutes.
Symptome können bei einer Infektion mit Lawsonia
intracellularis auftreten.
R
Regionale Ileitis (RI): Entzündung des Ileums
(Krummdarm/Hüftdarm), die auf eine Region des
Darms beschränkt ist.
39150626.D.AT.Januar2020(1.000)122-DE-POR-191200009 Quellen und weiterführende Literatur 1 Mischok, J. (2015): Vergleichende Untersuchungen zur Nährstoffverdaulichkeit und zur Empfänglichkeit für eine experimentelle Salmonelleninfektion bei Lawsonieninfektionen junger Schweine, Diss. , Institut für Tierernährung, Tierärztliche Hochschule Hannover, S. 23 ff. 2 Straw, B. et al. (2006): Diseases of Swine; 9th Edition,Blackwell Publishing, 49-50 3 Reiner , G. (2015): Krankes Schwein, kranker Bestand; Ulmer Verlag, Stuttgart; 76-81,140-150,157-163, 213-217 4 Große Beilage, E., Wendt, M. (Hrsg.) (2013): Diagnostik und Gesundheitsmanagement im Schweinebestand, Ulmer Verlag, Stuttgart; 305- 317 5 DLG-Arbeitskreis Futter und Fütterung (2008): Empfehlungen zur Sauen- und Ferkelfütterung, 1/2008 6 Kirchgessner, M. (1997): Tierernährung, Leitfaden für Studium, Beratung und Praxis; 8. Auflage DLG-Verlag Frankfurt (Main);220- 232 7 Grünhaupt, B. (2011): Optimierte Leistungsfütterung bei Ferkeln; Vortrag);Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Bildungs- und Beratungszentrum Fritzlar 8 Scheepens, K., Van Engen, M., De Vries, A. (2008): Ferkel Praxisleitfaden für erfolgreiche Ferkelaufzucht; Roodbont Verlag; 16-49 Urheberrechtlich geschützt © 2020 Intervet International B.V., ein Tochterunternehmen der Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA. Alle Rechte vorbehalten. Die Wissenschaft für gesündere Tiere Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | www. msd-tiergesundheit.de Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien | www. msd-tiergesundheit.at
Sie können auch lesen