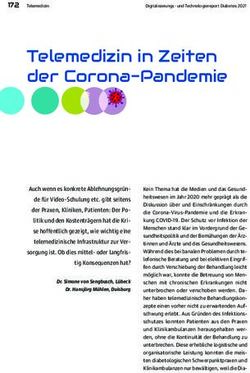Empfehlungen zur Erstversorgung des Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma bei Mehrfachverletzung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Seite 39 - 45 27.10.2003 10:41 Uhr Seite 1
VERBANDSMITTEILUNGEN
Empfehlungen zur Erstversorgung des Patienten
mit Schädel-Hirn-Trauma bei
Mehrfachverletzung*)
Erarbeitet von
dem Wissenschaftlichen Arbeitskreis Neuroanästhesie der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und
Intensivmedizin,
der Arbeitsgemeinschaft Intensivmedizin/Neurotraumatologie der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie
und der Sektion Rettungswesen und Katastrophenmedizin der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für
Intensiv- und Notfallmedizin zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie sowie der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie unter Beteiligung der Fachgesellschaften für Ophthalmologie, Urologie, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.
Erstversorgung des Patienten mit Schädel-Hirn- Polytraumatisierten konkurrierende Behandlungs-
Trauma bei Mehrfachverletzung prinzipien gegenüberstehen können. So steht ein
Der Wissenschaftliche Arbeitskreis Neuroanästhesie Therapieziel der Behandlung des Schädel-Hirn-
der DGAI und die Arbeitsgemeinschaft Intensiv- Traumas, die Stabilisierung des arteriellen
medizin/Neurotraumatologie der DGNC unterhalten Mitteldruckes über 90 mmHg, der bei penetrierendem
eine Arbeitsgruppe "Neurotrauma", die unter ande- Bauchtrauma propagierten ”tolerierten Hypovol-
rem Empfehlungen zur Versorgung hirnverletzter ämie” (3) entgegen. Gleiches gilt für die Kombination
Patienten erarbeitet. Die von dieser Arbeitsgruppe aus Schädel-Hirn- und Thoraxtrauma: Exemplarisch
erstellten "Leitlinien zur Primärversorgung von seien die Maßnahmen Beatmung, permissive
Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma" sind 1997 in Heft Hyperkapnie und Hypothermie genannt.
2 dieser Zeitschrift (2a) veröffentlicht worden. Das Für das Ergebnis richtungweisend ist die frühe post-
Schädel-Hirn-Trauma (SHT) bestimmt bei polytrau- traumatische Phase, ”the golden hour of shock”.
matisierten Patienten die Prognose, deshalb erschien Voraussetzung für ein rationales Versorgungskonzept
es notwendig, Empfehlungen zur Erstversorgung ist die kritische Standortbestimmung klinischer
mehrfachverletzter Patienten mit SHT zu formulie- Verfahren auf der Basis physiologisch-pathophysiolo-
ren. Dem interdisziplinären Ansatz der Versorgung gischer Erkenntnisse im Sinne der Evidence-based
entsprechend wurden diese Empfehlungen in Medicine.
Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachgesell- Erarbeitet wurde die vorliegende Empfehlung von
schaften und der Deutschen interdisziplinären den o.g. Organisationen. Sie baut auf der von den erst-
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) genannten Arbeitsgruppen veröffentlichten Leitlinie
erarbeitet. Primärversorgung des Patienten mit schwerem
Schädel-Hirn-Trauma auf (2 a, b).
Die Empfehlung zur Erstversorgung des Patienten mit
Vorwort Schädel-Hirn-Trauma bei Mehrfachverletzung wendet
sich an alle mit der Akutversorgung dieser Patienten
Trauma ist die häufigste Todesursache in der befaßten Berufsgruppen. Ziel der Empfehlung ist die
Altersgruppe der ein- bis 34jährigen (29). Bis zum Verbesserung der Versorgung des polytraumatisierten
Jahre 2020 wird weltweit eine Zunahme traumabe- Patienten mit vermutetem oder gesichertem Schädel-
dingter Todesfälle von 5,1 auf 8,4 Millionen jährlich Hirn-Trauma in der Akut- und der frühen
prognostiziert (21). Von allen Traumen hat das Postakutphase auf der Grundlage eines interdiszi-
Polytrauma die ungünstigste Prognose; schließt das plinären Behandlungskonzeptes.
Verletzungsmuster ein Schädel-Hirn-Trauma ein, so ist Die Empfehlung basiert auf dem derzeitigen Stand
dieses in der Regel prognoselimitierend (19, 28). gesicherter Erkenntnisse. Es liegt in der Natur der
Wenn die Prävention versagt, steht eine menschlich, Sache, daß derartige Leitlinien in unregelmäßigen
sozial und ökonomisch außerordentlich belastende Abständen überarbeitet werden müssen; für Hinweise
Behandlung an – häufig mit ungewissem Ausgang. Das zur Fortschreibung sind die beteiligten Arbeits-
Continuum von der präklinischen Primärversorgung gruppen dankbar.
bis zur Rehabilitation ist nur bei interdisziplinärer
Durchführung erfolgversprechend, weil sich bei
1. Organisation und Struktur der
Erstversorgung
*) Am 06.11.1998 vom Engeren Präsidium der DGAI und am
05.11.1999 vom Präsidium der DIVI gebilligt. Erscheint auch als
Ergänzungslieferung zu den „Entschließungen, Empfehlungen, 1.1 Wege zum Krankenhaus
Vereinbarungen, Leitlinien“ von H. W. Opderbecke und W. Wege zum Krankenhaus müssen eindeutig und klar
Weißauer (Hrsg.). gekennzeichnet, ausreichend beleuchtet und jederzeit
© Anästhesiologie & Intensivmedizin 2000, 41: 39-45
Blackwell Wissenschafts-Verlag GmbH. 39Seite 39 - 45 27.10.2003 10:41 Uhr Seite 2
Verbandsmitteilungen
freigehalten werden. Der Landeplatz für Rettungs- 1.3.3 Grundausstattung des Schockraums
hubschrauber ist räumlich möglichst eng an den 1.3.3.1 Ausstattung Anästhesiologie
Schockraum anzubinden. Narkosebeatmungsgerät (nach DIN-EN 740)
Überwachungsgeräte (EKG-, Puls-, Blutdruck-
1.2 Schockraum monitor [für blutige und unblutige Messung],
Im Schockraum sind alle räumlichen, medizintechni- Kapnometer, Pulsoxymeter)
schen und personellen Voraussetzungen gegeben, um Notfallmedikamente und Infusionswagen
jederzeit eine dem Verletzten angemessene Erst- 2 Absauggeräte
versorgung zu gewährleisten. Dies bedeutet: Defibrillator
unverzügliche Wiederherstellung und Aufrecht- Katheter- und Punktions-Sets
erhaltung der Vitalfunktionen (Atmung, Kreislauf) Sets für die Atemwegssicherung
Diagnostik, Bewertung und Akutbehandlung von Spritzenpumpen (mindestens 2)
Funktionsstörungen der lebenswichtigen Organ- Wärmegeräte für Patienten
systeme (Schädel, Thorax, Abdomen). Wärmegeräte für Infusionen
Wärmegeräte für Blut und Blutbestandteile.
1.3 Organisatorische Voraussetzungen
1.3.1 Alarmierung des Krankenhauses 1.3.3.2 Ausstattung chirurgische Fächer
Im Krankenhaus ist eine zentrale Anlaufstelle für Röntgenstrahlendurchlässige, mobile, verstellbare
Notfälle einzurichten. In dieser zentralen Anlaufstelle Schockraumtrage
ist für die Alarmierung ein Telefon mit bekannter Sonograph
Rufnummer für Rettungsleitstellen und Rettungs- Röntgengerät
dienste ("Rotes Telefon") ständig zu besetzen. Dopplersonograph
Versehentlich dezentral gemeldete Patienten sind Fertige griffbereite Notfall-Sets für
sofort an diese Zentrale zu melden und weiterzuleiten. Beckenzwinge
Die zentrale Anlaufstelle übernimmt: Blasenkatheter
die Aufnahme der Basisdaten* Bronchoskopie
die Alarmierung des Schockraum-Basisteams Koniotomie (Tracheotomie)
(1.3.4) Kraniotomie
in Abhängigkeit vom Verletzungsmuster in Laparotomie
Absprache mit dem verantwortlichen Arzt die Tamponaden des Nasen-Rachen-Raumes
zusätzliche Alarmierung des erweiterten Schock- Thorakotomie
raum-Basisteams (1.3.4). Thoraxdrainage
Venae sectio
Die Alarmierung erfolgt unverzüglich (zentraler Verbrennung
Gruppenruf). Wundversorgung (große und kleine)
Zervikalorthese (verschiedene Größen)
1.3.2 Räumliche und apparative Voraussetzungen Schienenmaterial.
Der Schockraum ist in die zentrale Notaufnahme zu
integrieren. Er hat eine Mindestgröße von 25 m2 je 1.3.4 Schockraum-Team
Behandlungsplatz. Zu fordern sind eine zentrale Das Schockraum-Team arbeitet kooperativ und kolle-
Gasver- und -entsorgung, eine Notstromversorgung, gial. Innerhalb des Teams übernimmt ein Arzt, der in
Ausstattung mit mindestens zwei getrennt voneinan- der Versorgung mehrfachverletzter Patienten beson-
der anwählbaren, fernamtsberechtigten Telefonen. In ders erfahren ist, die Koordination der Abläufe von
unmittelbarer Nähe befinden sich: Diagnostik und Therapie (32).
Raum für Noteingriffe Das Basisteam des Schockraums (Tab. 1) ist rund um
Konventionelle Röntgeneinheit mit Durchleuch- die Uhr für die Erstversorgung der Verletzten einsatz-
tungsmöglichkeit bereit und gewährleistet die (operative) Versorgung.
Gerät(e) zur sofortigen Analyse von Blutgasen und Es erwartet den Verletzten im Schockraum. Bei
Bestimmung von Hämoglobin, Hämatokrit, Bedarf wird es im Einvernehmen mit dem
Natrium, Kalium und Blutzucker Schockraum-Koordinator durch Mitglieder des erwei-
Computertomographie (günstig: Spiral-CT) terten Schockraum-Teams (Tab. 2) ergänzt.
Angiographie-Einheit.
Weitere Voraussetzungen sind die ständige Bereit- 2. Übergabe des Patienten durch den
schaft/Verfügbarkeit von Labor (Tab. 7) und Blutbank/ Notarzt
-depot.
Die Übergabe des Patienten in der Notaufnahme ist
wesentlicher Schnittpunkt der Behandlungskette (2a,
b; 9). Bei Eintreffen des Patienten wird daher ein ärzt-
* Anzahl und Altersgruppen der Verletzten, Transportart, Art liches Mitglied des Schockraum-Teams vom
des Unfalls, Verletzungsmuster, Zustand der Vitalfunktionen, Notarzt/Rettungspersonal mündlich und schriftlich
Maßnahmen (Intubation), voraussichtliche Eintreffzeit über den Patienten informiert (Tab. 3). Die schrift-
Anästhesiologie & Intensivmedizin 2000, 41: 39-45
40Seite 39 - 45 27.10.2003 10:41 Uhr Seite 3
Schädel-Hirn-Trauma
Tabelle 1: Zusammensetzung des Schockraum- Tabelle 3: Obligate Informationen für die Übergabe
Basisteams des Patienten
Disziplin Qualifikation Anzahl Unfallzeitpunkt/-hergang
Art des Unfalls
Ärztliches Personal
Besondere Rettungssituation
Anästhesiologie Facharztqualität 1-2
Chirurgie/Unfallchirurgie Facharztqualität 1-2
Eigen-, Fremdanamnese (Vorerkrankungen)
Neurochirurgie
(Neurologie) Facharztqualität 1
Verletzungsmuster
Pflegepersonal
Notaufnahme Pflegekraft 2 Verdachtsdiagnosen (z.B. Blutungen, Aspiration,
Anästhesie Fachpflegekraft 1-2 Intoxikation)
Technisches Personal Untersuchungsergebnisse
Radiologie MTA 1 Atmung
Sonstige Transportaufgaben, Kreislauf
Reinigung 1 Initialer neurologischer Befund (Bewußtseinslage,
Motorik, Pupillenbefund)
Periphere Durchblutung
Tabelle 2: Zusammensetzung des erweiterten Schmerzlokalisation
Schockraum-Basisteams
Therapie
Disziplin Qualifikation Anzahl
Beatmung (Intubation, Respiratordaten)
Ärztliches Personal Lagerung (Vakuummatratze)
Augenheilkunde Facharztqualität 1 Immobilisierung (HWS, Extremitäten)
Gefäßchirurgie Facharztqualität 1 Thoraxdrainage
HNO-Heilkunde Facharztqualität 1 Venenzugänge
Kinderchirurgie Facharztqualität 1 Medikation (Dosis, Zeitpunkt)
MKG-Chirurgie Facharztqualität 1
Radiologie Sonstige Daten
(Neuroradiologie) Facharztqualität 1 Patientendaten (Name, Anschrift, Angehörige)
Thoraxchirurgie Facharztqualität 1 Transport
Urologie Facharztqualität 1 Vergebliche Punktions- und Intubationsversuche
Pflegepersonal
OP-Personal Fachpflegekraft,
ggf. ergänzt durch Schriftliche Dokumentation (empfohlen: auf dem
fachspezifisches DIVI-Protokoll (8)1).
OP-Personal mind. 2
Technisches Personal
Labor, Blutbank,
Radiologie MTA mind. 1
3. Erstversorgung
Die Erstversorgung gliedert sich in mehrere
Behandlungsphasen und umfaßt auch die Maßnahmen
liche Übergabe erfolgt anhand eines standardisierten der Notfalldiagnostik.
Protokolls (empfohlen: DIVI-Notarztprotokoll (8)1).
Dieses ist lesbar und vollständig auszufüllen. Name 3.1 Reanimationsphase
und Adresse des Notarztes/Rettungspersonals sind les- In der Reanimationsphase werden die Maßnahmen
bar im Protokoll anzugeben. getroffen, die der unmittelbaren Wiederherstellung
Der umfassenden Darstellung des neurologischen und Stabilisierung der Vitalfunktionen sowie der
Befundes ist besondere Sorgfalt zu widmen. Dieser Blutstillung dienen (5, 7, 18).
muß die Bewußtseinslage, Motorik (Beurteilung nach
der Glasgow-Koma-Skala) und Pupillenmotorik ent- 3.2 Operative Phase I (12, 26, 27, 33)
halten. Es ist zu vermerken, ob Besonderheiten vorla- Auf die Reanimationsphase folgt je nach dem klini-
gen, die den neurologischen Befund beeinflußt haben schen Bild und einer prioritätenabhängigen
könnten (Intoxikation, Hypoxämie, Hypotonie u.a.). Akutdiagnostik die operative Phase I. In dieser wird
Während der Transportphase eingetretene Änderun- die unmittelbare Bedrohung operativ beseitigt (26).
gen des Befundes sind zu dokumentieren. Mehrere vital bedrohliche Verletzungen müssen ggf.
simultan versorgt werden.
Die Reihenfolge der Untersuchungen richtet sich nach
1
) Siehe auch nachstehende Veröffentlichung in diesem Heft. den klinischen Verdachtsmomenten, weil jede einzelne
Anästhesiologie & Intensivmedizin 2000, 41: 39-45
41Seite 39 - 45 27.10.2003 10:41 Uhr Seite 4
Verbandsmitteilungen
Blutung für sich unmittelbar lebensbedrohlich sein
Tabelle 5: Indikationen für Eingriffe der operativen
kann. Anhaltspunkte ergeben sich aus dem
Phase II
Unfallhergang, dem Verlauf der Vitalfunktionen und
der Kontrolle des neurologischen Status (der Weitere intrakranielle Verletzungen (z.B. Impres-
Bewußtseinslage, Pupillenweite und –reaktion, und sionsfrakturen, direkt offenes Schädel-Hirn-Trauma,
der motorischen Funktionen). Kontusionen)
Epidurale und akute subdurale Hämatome sind im all- Gefäßverletzungen
gemeinen sofort operationsbedürftig, wenn folgende Zunehmende Rückenmarkkompression
Befundkonstellation vorliegt: Drohendes Kompartmentsyndrom
Bewußtlosigkeit oder zunehmende Bewußtseins- Viszerale Verletzungen ohne Massenblutung
störung Grob dislozierte Beckenfraktur
einseitige Pupillenerweiterung Offene Frakturen
Hemiparese. Ausgedehnte Weichteilverletzung
Instabile Wirbelsäulenverletzung
Im Computertomogramm findet sich dann eine Geschlossene Frakturen der langen
Verlagerung der Mittellinienstrukturen und Kompres- Röhrenknochen (insbesondere des Femur und des
sion der basalen Zisternen. Humerus)
Bei Bewußtlosigkeit und Verdacht auf Schädel-Hirn- Offene Mittelgesichts- und Unterkieferfrakturen
Trauma ist eine sofort operationspflichtige intrakrani- Bulbus-/Orbitaverletzungen
elle Blutung so lange anzunehmen, bis sie nachgewie- Verletzungen des Urogenitaltraktes
sen oder ausgeschlossen ist (Tab. 4). Perforationen der Luft- und Speisewege/Fremd-
körper
Tabelle 4: Untersuchungen zum Nachweis von
Blutungen
3.5 Weitere operative Phasen
Intrakranielle Blutung: kraniale Computertomo- Diese schließen sich nach hinreichender Stabilisierung
graphie des Zustands des Patienten gegebenenfalls an die
Erstversorgung an.
Intrathorakale Blutung: Röntgenaufnahme a.p.,
ggf. Spiral-CT 3.6 Zugänge, Blutabnahmen, Diagnostik
Die Instrumentierung, Blutentnahme und Diagnostik
Intraabdominelle Blutung: Sonographie, ggf. Spiral- erfolgen während der Phasen 3.1 bis 3.3.
CT
3.6.1 Zugänge, Blutabnahmen
Patienten mit Mehrfachverletzungen und Schädel-
Die Reihenfolge der zu ergreifenden Maßnahmen Hirn-Trauma werden mit zwei bis drei großlumigen
wird durch das Schockraum–Team festgelegt. peripher-venösen Zugängen versorgt, die sicher fixiert
werden. Bei extremer Kreislaufzentralisation kann ein
3.3 Stabilisierungsphase mehrlumiger zentraler Katheter plaziert werden. Die
Sobald die therapeutischen Ziele der operativen Phase Anlage eines Blasenkatheters ist obligat. Eine arteriel-
I erreicht sind, beginnt die Stabilisierungsphase. In le Kanüle wird gelegt, wenn dies ohne
dieser werden Sekundärschäden, wie z.B. Zeitverzögerung möglich ist. Eine großlumige
Blutgerinnungsstörungen nach Behandlung o.g. Magensonde wird transnasal plaziert, wenn keine
Blutungen oder eine ausgeprägte Hypothermie Hinweise auf Frakturen der Frontobasis oder des
(Kerntemperatur unter 32OC), korrigiert. Die Mittelgesichts vorliegen (Tab. 6). In unklaren
Reevaluierung leitet die operative Phase II ein. Situationen wird sie transoral plaziert.
3.4 Operative Phase II Tabelle 6: Zugänge
Dringlichkeit, Reihenfolge und Ausmaß der Eingriffe
in der operativen Phase II sowie die Organisation der 2-3 großlumige periphervenöse Zugänge
Weiterbehandlung werden in Absprache mit den Arterielle Kanüle
beteiligten Disziplinen festgelegt. Limitierend für den Ggf. zentraler Venenkatheter
Umfang der Eingriffe sind die vitalen Funktionen Blasenkatheter
Atmung und Kreislauf sowie das Ausmaß und der Magensonde
Verlauf der zerebralen Schädigung.
Um sekundäre Hirnschäden (intrakranielle
Blutungen, Kongestion, Ödem, hämorrhagische Sofort nach Eintreffen im Schockraum werden
Kontusionen) einzugrenzen, sind die in Tabelle 5 auf- Blutproben zur Bestimmung der wichtigsten
geführten Eingriffe zeitlich und methodisch zu Laborwerte (Tab. 7) und Kreuzblut zur Bereitstellung
begrenzten. Andere Eingriffe als die in Tabelle 5 von mindestens 5 Erythrozytenkonzentraten entnom-
genannten werden zu einem späteren Zeitpunkt (siehe men. Die Proben sind sofort mit Entnahmezeitpunkt
3.5) durchgeführt. und Identität zu kennzeichnen und weiterzuleiten. Bei
Anästhesiologie & Intensivmedizin 2000, 41: 39-45
42Seite 39 - 45 27.10.2003 10:41 Uhr Seite 5
Schädel-Hirn-Trauma
Tabelle 7: Laborbestimmungen Tabelle 9: Hinweise auf eine intrakranielle
Druckerhöhung
Kleines Blutbild (Hämoglobin, Hämatokrit,
Leukozyten, Thrombozyten) Klinisch:
Arterielle Blutgasanalyse Bewußtseinsstörung, Anisokorie, Hypertonie bei
Elektrolyte (Natrium, Kalium, Kalzium) Bradykardie, Strecksynergismen
Blutgruppe
Computertomographisch:
Gerinnungsstatus (mit Quick, PTT, PTZ als Minimum)
Raumfordernde intrakranielle Blutung
Harnstoff, Kreatinin, Blutzucker
Verstrichenes Kortexrelief
GOT, GPT, γGT, LDH, CK
Einengung der Ventrikel und/oder der perimesenze-
phalen Zisternen
speziellen Fragestellungen werden diese obligaten Kontusionen mit perifokalem Ödem
Laborbestimmungen durch fakultative Tests
(Bestimmung des Alkohols im Blut, Drogenscreening,
Schwangerschaftstest) ergänzt. neurologischer Verschlechterung sowie gegebenen-
falls vor längeren extrakraniellen Eingriffen auch
3.6.2 Diagnostik früher.
Parallel zu den obligaten Blutuntersuchungen und der
Anlage von Zugängen wird bei jedem Patienten die 3.6.2.1 Intrakranieller Druck
Diagnostik der Akutperiode durchgeführt - soweit 3.6.2.1.1 Indikationen zur Messung (6, 22, 30, 24)
nicht schon in der Reanimationsphase geschehen. Die Die gezielte Senkung des erhöhten intrakraniellen
Reihenfolge der diagnostischen Maßnahmen (Tab. 8) Druckes setzt dessen kontinuierliche Messung voraus.
wird in Absprache mit dem Schockraum-Team festge- Anhaltspunkte für einen erhöhten intrakraniellen
legt. Druck ergeben sich aus der Bewußtseinslage, dem
Verlauf des neurologischen Befundes und dem
Tabelle 8: Diagnostik während der Akutphase Läsionstyp im CT. Die Indikation zur intrakraniellen
Druckmessung ist im allgemeinen bei bewußtlosen
Röntgenaufnahme des Thorax (a.p.) Patienten bzw. bei höchstens 8 Punkten auf der
Röntgenaufnahme der gesamten Wirbelsäule Glasgow-Koma-Skala und einem pathologischen CT
(in 2 Ebenen) gegeben.
Röntgenaufnahme des Beckens (a.p.)
Sonographie des Abdomens 3.6.2.1.2Verfahren
Computertomographie des Schädels einschließlich Der intrakranielle Druck kann an verschiedenen
des kranio-zervikalen Übergangs (günstig: Spiral-CT) Meßorten registriert werden. Vor- und Nachteile der
verschiedenen Meßorte sind in Tabelle 10 wiederge-
geben.
Ein primär unauffälliges kraniales Computer- An das Meß- und Registriersystem sind folgende
tomogramm schließt eine sekundäre intrakranielle Anforderungen zu stellen:
Blutung nicht aus (9, 11, 12, 15, 20, 23, 24, 31). Daher Validität des Meßwertes (Tab. 11)
wird bei bewußtlosen/sedierten Patienten nach späte- Kontinuierliche Registrierung in Kurvenform
stens 6 Stunden ein Kontroll-CT durchgeführt, bei (Papier oder Monitor)
Tabelle 10: Vor- und Nachteile der ICP-Messung in Abhängigkeit vom Meßort
Lokalisation Vorteile Nachteile
Ventrikulär Rekalibrierung möglich; bei Systemen Infektions- und Punktionsrisiko, Gefahr der
mit extrakraniellem Druckaufnehmer sind Verstopfung des kommunizierenden Systems,
Liquordrainage und Bestimmung von bei engen Ventrikeln ist die Punktion
Compliance/Elastance möglich; genau. erschwert.
Parenchymatös Ubiquitäre Plazierung ist möglich. Das System ist nicht rekalibrierbar;
Die Trepanation ist kleiner als beim Ventrikel- Infektions- und Punktionsrisiko.
katheter.
Subdural Ausweichmöglichkeit, wenn andere Technische und methodische Meßfehler sind
Verfahren nicht möglich sind. häufig; das System ist nicht rekalibrierbar
Epidural Relativ einfach durchführbar, Infektions- Technische und methodische Meßfehler sind
gefahr gering. häufig, das System ist nicht rekalibrierbar,
die Kurve ist gedämpft
Anästhesiologie & Intensivmedizin 2000, 41: 39-45
43Seite 39 - 45 27.10.2003 10:41 Uhr Seite 6
Verbandsmitteilungen
Tabelle 11: Meßtechnische Anforderungen an ICP- Tabelle 12: Transport
Monitore (nach AAMI*)
Spezielle Trage
Meßbereich: 0 - 100 mmHg
Zusatzausstattung (fahrbar)
Meßgenauigkeit: ± 2 mmHg im Bereich Transportrespirator
von 0 - 20 mmHg Absaugeinheit
Monitoring-Einheit (siehe unten)
Maximaler Meßfehler: 10 % im Bereich
Spritzenpumpen
von 20 - 100 mmHg
Notfallmedikamenten-Set
* Brown E: Intracranial pressure monitoring devices, Druckinfusions-Einheit
Association for the Advancement of Medical Reanimations-Set
Instrumentation. 3330 Washington Boulevard, Suite Monitoring
400, Arlington, VA 22201-4598, 1988 (nach 18). EKG/Defibrillator
nicht invasive Blutdruckmessung
invasive Druckmessung (Blutdruck, ICP)
Bei Monitorsystemen Speicherung der Werte Pulsoxymetrie
Ausreichende mechanische Stabilität Kapnometrie (17)
Einfaches Entfernen bzw. Auswechseln.
Personelle Voraussetzung
Arzt mit intensivmedizinischer Qualifikation
Die intrakranielle Druckmessung wird im Rahmen der Pflegekraft mit intensivmedizinischer Qualifikation
Operation einer akuten raumfordernden Blutung Pflegekraft in der Notaufnahme
angelegt, sonst sobald dies in der Operativen Phase II
ohne zusätzliche Gefährdung des Patienten möglich
ist.
3.6.2.1.3 Behandlung 3. Bickell WH, Wall MJ, Pepe PE et al.: Immediate versus
Verschlechtert sich die Bewußtseinslage des Patienten delayed fluid resuscitation for hypotensive patients with
und treten Zeichen der Einklemmung (Anisokorie, penetrating torso injuries. N Engl J Med 331: 1105 - 1109
(1994)
Hemiparese oder Strecksynergismen) als Hinweis auf
4. Brandt M, Schwab R, Eck J et al.: Eine neue Beatmungs-
eine intrakranielle Drucksteigerung auf, ist die und Überwachungseinheit für innerklinische Transporte von
Kurzinfusion von Mannitol (0,3 - 1,5 g/kg KG über 15 Notfallpatienten. Notfallmed 13: 575 - 577 (1987)
min) indiziert. Für Patienten mit Schädel-Hirn- 5. Bullock R, Chesnut RM, Clifton G et al.: Guidelines for
Trauma ist die Wirksamkeit einer speziellen the management of severe head injuries. Eur J Emerg Med
Medikation (z.B. mit Kortikosteroiden, Kalziumant- 2: 109 - 127 (1996)
agonisten, Barbituraten, Trispuffer) im Sinne einer 6. Clark WC, Mühlbauer MS, Lowrey R et al.: Complica-
Ergebnisverbesserung nicht belegt. tions of intracranial pressure monitoring in trauma patients.
Neurosurg 25: 20 - 24 (1989)
7. Dinkel M, Hennes J: Innerklinische Akutversorgung des
Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma. Anästh Intensivmed 39:
4. Transport und Überwachung im 399 - 412 (1998)
8. DIVI: Das bundeseinheitliche Protokoll der Deutschen
Krankenhaus Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (DIVI).
Anästh Intensivmed 2000, 41: 46-49
Das Schockraum-Team muß die Versorgung so planen, 9. Domenicucci M, Signorini P, Strzelecki J et al.: Delayed
daß nur ein Minimum an Transporten notwendig wird, posttraumatic epidural hematoma. A review. Neurosurg Rev
um ein zusätzliches Transporttrauma zu vermeiden (1, 18: 109 - 122 (1995)
4, 10, 14, 16, 25). Die Ausstattung der Transportmittel 10. Engelhardt W: Innerklinische Transporte von Patienten
mit erhöhtem intrakraniellem Druck. Anästh Intensivmed
(Tab. 12) orientiert sich an den Normen DIN EN 1789,
38: 385 (1997)
794-3, 740, 864 und 865 (inner- und außerklinisch). 11. Foroglou G, Patsalas I, Kontopoulos B: The timing of CT.
Neurosurg Rev 12: S169 - S174 (1989)
12. Gutman MB, Moulton RJ, Sullivan I et al.: Relative inci-
Literatur dence of intracranial mass lesions and severe torso injury
after accidential injury: implications for triage and manage-
1. Andrews PJD, Piper IR, Dearden NM et al.: Secondary ment. J Trauma 31: 974 - 977 (1991)
insults during intrahospital transport of head-injured pa- 13. Harloff M: Nadelöhr Krankenhauseinweisung. Notarzt 8:
tients. Lancet 335: 327 - 330 (1990) 165 - 166 (1992)
2. Arbeitsgemeinschaft Intensivmedizin und Neuro- 14. Huf R, Madler C, Maiwald G et al.: Intensiv-
traumatologie der Deutschen Gesellschaft für Neuro- Transporthubschrauber - Konzept und Realisierung. Notarzt
chirurgie und Wissenschaftlicher Arbeitskreis Neuro- 9: 2 - 6 (1993)
anästhesie der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie 15. Huneidi AH, Afsahar F: Delayed intracerebral haemato-
und Intensivmedizin: Leitlinien zur Primärversorgung von mas in moderate to severe head injuries in young adults. Ann
Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma. (a) Anästh Intensivmed R Coll Surg Engl 74: 345 - 349 (1992)
38: 89 - 93 (1997) (b) Zbl Neurochir 58: 13 - 17 (1997) 16. Hurst JM, Davis K, Branson RD et al.: Comparison of
Anästhesiologie & Intensivmedizin 2000, 41: 39-45
44Seite 39 - 45 27.10.2003 10:41 Uhr Seite 7
Schädel-Hirn-Trauma
blood gases during transport using two methods of ventila- treated between 1972 and 1991 at a German level I trauma
tory support. J Trauma 29: 1637 - 1640 (1989) center. J Trauma 38: 70 - 78 (1995)
17. Jantzen J-P, Hennes HJ: Präklinische Kapnometrie - ein 29. Rivara FP, Grossman DC, Cummings P: Injury preven-
richtungweisender Fortschritt. Notfallmed 12: 450 - 456 tion. First of two parts. N Engl J Med 337: 543 - 548 (1997)
(1991) 30. Saul TG, Tucker TB: Effect of intracranial pressure moni-
18. Joint Section on Neurotrauma and Critical Care. toring and aggressive treatment on mortality in severe head
Guidelines for the management of severe head injury. 1. injury. J Neurosurg 56: 498 - 503 (1982)
1995. New York, Brain Trauma Foundation. 31. Sprick C, Bettag M, Bock WJ: Delayed traumatic
19. Lehr D, Baethmann A, Reulen HJ et al.: Management of intracranial hematomas - a clinical study of seven years.
patients with severe head injuries in the preclinical phase: a Neurosurg Rev 12: S228 - S230 (1989)
prospective analysis. J Trauma 42: S71 - S75 (1997) 32. Committee on Trauma, ACS: Resources for optimal care
20. Miller EC, Derlet RW, Kinser D: Minor head injury: Is of the injured patient: 1999. The American College of
computed tomography always necessary? Ann Emerg Med Surgeons, Chicago, 1998
27: 290 - 294 (1996) 33. Thomason M, Messick J, Rutledge R et al.: Head CT scan-
21. Murray C, Lopez AD: Alternative projections of mortali- ning versus urgent exploration in the hypotensive blunt trau-
ty and disability by cause 1990 - 2020: global burden of dis- ma patient. J Trauma 34: 40 - 45 (1993)
ease study. Lancet 349: 1498 - 1505 (1997) 34. White RJ, Likavec MJ: The diagnosis and initial manage-
22. Narayan RK, Kishore PR, Becker DP: Intracranial pres- ment of head injury. N Engl J Med 327: 1507 - 1511 (1992)
sure: to monitor or not to monitor? J Neurosurg 56: 650 - 659 35. Winchell RJ, Hoyt DB, Simons RK: Use of computed
(1982) tomography of the head in the hypotensive blunt-trauma
23. Nelson JB, Bresticker MA, Nahrwold DL: Computed patient. Ann Emerg Med 25: 737 - 742 (1995).
tomography in the initial evaluation of patients with blunt
trauma. J Trauma 33: 722 - 727 (1992)
24. O´Sullivan MG, Statham PF, Jones PA et al.: Role of
intracranial pressure monitoring in severely head-injured
Korrespondenzadressen:
patients without signs of intracranial hypertension on initial
computerized tomography. J Neurosurg 80: 46 - 50 (1994) Prof. Dr. J.-P. Jantzen
25. Pehl S, Brost F, Jantzen JP et al.: Innerklinischer Transport Klinik für Anaesthesiologie und Intensivmedizin
von Intensivpatienten: Erste Erfahrungen. Notfallmed 14: Klinikum Hannover Nordstadt
949 - 954 (1988) Haltenhoffstraße 41
26. Prall JA, Nichols JS, Brennan R et al.: Early definitive D-30167 Hannover
evaluation in the triage of unconscious normotensive blunt
trauma patients. J Trauma 37: 792 - 797 (1994) Prof. Dr. J. Piek
27. Prough DS, Lang J: Therapy for patients with head inju-
ries: Key parameters for management. J Trauma 42: S10 - S18
Neurochirurgische Klinik
(1997) Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
28. Regel G, Lobenhoffer P, Grotz M et al.: Treatment results F.-Sauerbruch-Straße 8
of patients with multiple trauma: an analysis of 3406 cases D-17487 Greifswald.
Anästhesiologie & Intensivmedizin 2000, 41: 39-45
45Sie können auch lesen