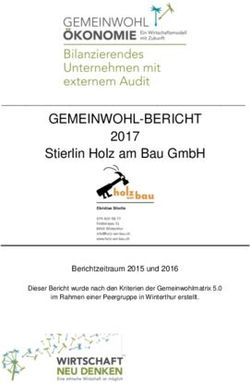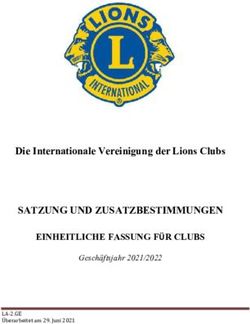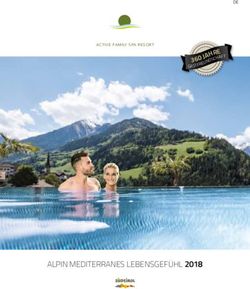Ergebnisprotokoll Runder Tisch Lünen-Süd - Stadt Lünen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Projektbeirat Lünen-Süd
Vorsitzender Reinhold Bauhus 25.02.2019
Ergebnisprotokoll Runder Tisch Lünen-Süd
Datum: 20. Februar 2019
Ort: Dammwiese 8, Aula der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
Beginn: 19.00 Uhr
Tagesordnung
TOP 1 - Begrüßung
TOP 2 – „Campus Lünen-Süd“ / Entwicklungen rund um die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
TOP 3 – Perspektive Stadtteilmanagement
TOP 4 – Sachstandsbericht Stadtumbau Lünen-Süd (Neuigkeiten aus den Projekten)
TOP 5 – Sonstiges
TOP 1 – Begrüßung
Herr Bauhus (Vorsitzender Projektbeirat Lünen-Süd) eröffnet die Sitzung des Runden Tisches und
begrüßt alle Anwesenden.
TOP 2 – „Campus Lünen-Süd“ / Entwicklungen rund um die Käthe-Kollwitz-
Gesamtschule
Herr Bauhus (Vorsitzender Projektbeirat) erläutert anhand von Präsentationsfolien die Idee des
„Campus Lünen-Süd“. Die Präsentation ist als Anlage beigefügt.
Im Anschluss daran stellt Herr Jürgens anhand von Präsentationsfolien die öffentlichen
Investitionen auf und im Umfeld der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule strukturiert dar. Die
Präsentation ist als Anlage beigefügt.
Reaktionen und Nachfragen der Anwesenden:
Die Bereitstellung neuer Infrastrukturen und die „Campus Lünen-Süd“-Idee wird von den
Anwesenden positiv gewertet. Die Schaffung moderner Infrastrukturen wird als große Chance
für den Stadtteil (harter Standortfaktor) gesehen. Unter den Anwesenden gibt es mit einer
privaten Volleyballgruppe weitere Interessenten zur Nutzung der Sporthalle.
Die Anwesenden weisen darauf hin, dass für die geplanten öffentlichen Investitionen auf und im
Umfeld des Geländes ein stimmiges Verkehrskonzept erarbeitet werden muss, um v.a. den
Nutzungen, aber insbesondere auch den Anwohnern, gerecht zu werden. Im Bereich der
Dammwiese gibt es heute einen hohen Parkdruck, der mit den geplanten Entwicklungen gelöst
werden sollte. Die Verwaltung weist zunächst einmal darauf hin, dass sich die Planungen erst
ganz am Anfang befinden. Insbesondere die Freiflächen, darunter eben auch die
Stellplatzanlagen und die Verkehrsabwicklung, sollen in einem transparenten Prozess,
gemeinsam mit der Öffentlichkeit, entwickelt werden. Darüber hinaus wird die Verwaltung
Neuigkeiten über das Stadtteilbüro sowie über den Runden Tisch in die Öffentlichkeit
transportieren.
Eine Verlagerung der Erschließung der Sporthalle über den Karl-Kiem-Weg wird vom Runden
Tisch begrüßt. Es wird angeregt, ob die Kita ggf. auch über den Karl-Kiem-Weg erschlossen
werden kann. Darüber hinaus herrscht Unklarheit darüber, wieso die Kindertagesstätte auf
Seite 1 von 4Projektbeirat Lünen-Süd
Vorsitzender Reinhold Bauhus 25.02.2019
diesem Standort entstehen soll und nicht auf der gerodeten Fläche im Einfahrtsbereich des Karl-
Kiem-Wegs. Die Verwaltung informiert darüber, dass die Kita immer auf dem eingezeichneten
Standort unter dem Arbeitstitel „Kita Bahnstraße“ geplant war. Auf der gerodeten Fläche im
Einfahrtsbereich des Karl-Kiem-Weges war die Kita nie geplant, da sich die Fläche im
Privateigentum befindet und der Eigentümer andere Nutzungsinteressen (Weidefläche) verfolgt.
Die Planungen zur Kita können bei ZGL eingesehen werden.
Es wird angeregt, die gerodete Fläche oder andere Flächen in dem Gebiet während der
Baumaßnahmen vorübergehend als Parkplatzflächen zur Verfügung zu stellen. Die Fläche
befindet sich im Privateigentum. Der Eigentümer verfolgt andere Nutzungsinteressen
(Weidefläche). Eine öffentliche Nutzung ist daher ausgeschlossen.
Es wird nachgefragt, wie die Abwicklung der Vielzahl von Maßnahmen erfolgen soll, ohne den
Schulbetrieb und die Anwohner zu stören. Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen,
dass Beeinträchtigungen nicht verhindert werden können. Im Rahmen der Planungen der
einzelnen Projektbausteine gilt es, die Baustellen so abzuwickeln, dass selbstverständlich
möglichst geringe Beeinträchtigungen für den Schulbetrieb und für die Anwohner entstehen.
Es wird angeregt, auch den Bereich der Bushaltestelle am Karl-Kiem-Weg zu überplanen, da
diese Situation vollkommen unbefriedigend ist. Herr Bauhus gibt den Hinweis, dass zeitnah
zunächst einmal das alte Bushaltestellenhäuschen abgebaut wird.
Es wird zudem angeregt, ob insb. bei Veranstaltungen die Poller am Ende der Adolf-Damaschke-
Straße zwischen Oberstufengebäude und Mensa entfernt werden könnten, um so ein wenig den
Parkdruck auf der Straße Dammwiese zu verringern. Um keine Durchfahrt zu ermöglichen, sollen
die Poller auf der Dammwiese weiterhin stehen bleiben.
TOP 3 – Perspektive Stadtteilmanagement
Herr Börner (stellv. Vorsitzender Projektbeirat) informiert darüber, dass das Stadtteilbüro Lünen-
Süd nach aktuellem Stand Ende 2019 schließen wird. Da die Stadtteilentwicklung in Lünen-Süd
jedoch noch nicht abgeschlossen ist und diverse Projekte noch anstehen, spricht sich der
Projektbeirat dafür aus, das Stadtteilmanagement weiter fortzuführen. Die Verwaltung soll die
Möglichkeiten der Verlängerung prüfen und die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Alle
Anwesenden sprechen sich anschließend einstimmig dafür aus, dass der verlesene Brief (s.
Anlage zum Protokoll) offiziell an die Verwaltung übergeben wird. Die Verwaltung wird die
Möglichkeiten der Verlängerung prüfen und entsprechend darüber informieren.
TOP 4 – Sachstandsbericht Stadtumbau Lünen-Süd
Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen
Die Projekthomepage Lünen-Süd (https://www.luenen.de/mein-luenen-sued/) wurde ebenso im
Zuge der Umstellung des Internetauftritts der Stadt Lünen neu gestaltet. Die Seite ist bereits
online, steht jedoch erst in Kürze wieder mit dem gesamten Funktionsumfang zur Verfügung.
Das Stadtteilmanagement verschickt den 1. Newsletter im Jahr 2019 im Frühling.
Seite 2 von 4Projektbeirat Lünen-Süd
Vorsitzender Reinhold Bauhus 25.02.2019
In den vergangenen Wochen gab es Abstimmungstermine unterschiedlichster Akteure zu den
geplanten Veranstaltungen im Stadtteil. Eine Terminliste wurde zwischenzeitlich auf der
Homepage der Stadtteilentwicklung veröffentlicht.
Haus- und Hofflächenprogramm
Aktuell wurden bereits 12 Förderanträge bewilligt; davon wurden bereits 10 umgesetzt. Weitere
Anträge befinden sich in Vorbereitung. 60.000 Euro Fördermittel sind bereits ausgegeben oder
durch Zuwendungsbescheide gebunden; 90.000 Euro stehen somit noch zur Verfügung.
In der vergangenen Woche ging darüber hinaus ein Informationsschreiben an die Eigentümer
förderfähiger Objekte raus. Dabei wird auf die Endlichkeit der Förderung und die Frist der
Antragsstellung bis Ende 2019 hingewiesen. Je nachdem wie die Resonanz auf das Schreiben ist,
sollten bestimmte Eigentümer (bspw. im Bereich zwischen REWE und Alsenstraße) noch einmal
über die Quartiersarchitektin kontaktiert werden. Eine Gebietserweiterung wird zunächst einmal
nicht in Betracht gezogen. Im Frühling sollte diese Möglichkeit jedoch noch einmal eruiert
werden.
Städtebauförderanträge Programmjahr 2019
Für das Programmjahr 2019 endet die Frist für die Städtebauförderanträge erst am 28. Februar.
Demnach werden aktuell die Antragsunterlagen zusammengestellt. Für Lünen-Süd wird die
Stadt für dieses Programmjahr ausnahmsweise zwei Anträge zur Städtebauförderung stellen.
Zum einen wird der jährliche Antrag für Förderung aus dem Städtebauförderprogramm
„Stadtumbau West“ innerhalb des zugesagten Finanzrahmens für Lünen-Süd. Beantragt wird
darin zum einen die Durchführung der Maßnahme „Neugestaltung der Eingänge zum Südpark“
(Maßnahme des Masterplan „Öffentliche Räume Lünen-Süd“). Für die Antragsstellung wurde ein
Vorentwurf mit Kostenschätzung erstellt (s. Maßnahmenbeschreibung in der Anlage). Die
Planung betrachtet die standortgerechte pflanzliche und damit gestalterische Neugestaltung der
vier Eingänge Wagner Str., Derner Str., Schottweg Nord und Schottweg Süd. In diesem
Förderantrag wird zusätzlich die Zweckänderung bereits bewilligter Mittel aus einem alten
Zuwendungsbescheid zugunsten einer extern begleiteten Konzeptphase für den „Campus
Lünen-Süd“ beantragt.
In einem zweiten Antrag für Förderung aus dem neuen Städtebauförderprogramm „Zukunft
Stadtgrün“ wird der Versuch unternommen, die „Neugestaltung des Ziethenparks“ (ebenfalls
eine Maßnahme des Masterplans „Öffentliche Räume“) zu beantragen. Da es sich hier um eine
Förderung als „On-Top-Maßnahme“ und damit außerhalb des zusagten Finanzrahmens für
Lünen-Süd handelt, sind die Förderaussichten aktuell unklar. Der Ziethenpark soll als Spiel-,
Sport- und Freizeitfläche für unterschiedlichste Generationen und Nutzergruppen sowie als
grüne Ergänzung zum Bürgerplatz qualifiziert werden. Auch hier wurde für die Antragsstellung
ein Vorentwurf mit Kostenschätzung erarbeitet (s. Maßnahmenbeschreibung in der Anlage)
TOP 5 – Sonstiges
Nutzung des Bürgerplatz
Es will sich eine Initiative bilden, die sich mit der Durchführung von Trödel- oder Bauernmärkten
auf dem Bürgerplatz auseinandersetzt.
Seite 3 von 4Projektbeirat Lünen-Süd
Vorsitzender Reinhold Bauhus 25.02.2019
Stadtteilkonferenz
Auf Initiative von Frau Bock (Integrationsmanagement Lünen-Süd) wurde eine
Stadtteilkonferenz ins Leben gerufen, die sich mehrmals jährlich zu sozialen Themen im Stadtteil
austauscht. Es handelt sich um ein offenes Forum. Die Stadtteilkonferenz findet in diesem Jahr
am 18. Mai, 03. September und 12. November, jeweils um 09:30 Uhr in den Räumlichkeiten der
Caritas Boutique (Jägerstraße 50 a) statt.
Trauerhalle
Für die Überdachung vor der Trauerhalle des Friedhofs wurden laut Herrn Wolf 60.000 Euro in
den städtischen Haushalt eingestellt.
Bus.Hör.Stelle
An der Bushaltestelle gegenüber dem Bürgerplatz hat die VKU eine sogenannte Bus.Hör.Stelle
installiert, die aber (noch) nicht in Betrieb ist. Für eine Inbetriebnahme ist die VKU zuständig.
Nächster Termin Runder Tisch
Der nächste reguläre Runde Tisch findet am Donnerstag, 13. Juni 2019 um 19.00 Uhr statt.
Die Räumlichkeit sowie die Themen werden, wie gewohnt, noch bekanntgegeben.
Der Protokollant weist noch einmal darauf hin, dass zukünftig eine halbe Stunde vor dem
Runden Tisch (18:30 Uhr) Herr Lollert / Herr Szymkowiak (Stadtteilbüro) und Herr Jürgens
(Stadtplanung Lünen) für Anliegen / Beschwerden genereller Art aus dem Stadtteil zur
Verfügung stehen. So wird sich der Runde Tisch zukünftig auf Themen des Stadtumbauprozesses
Lünen-Süd konzentrieren.
Aufgestellt, Lünen, 06.03.2019
gez.
Reinhold Bauhus
Seite 4 von 4Schule steht für bunte Lern- und Lebensräume
Erst die Schaffung von Lern- und Lebensräumen ● ermöglicht die Durchführung pädagogisch sinnvoller Aktionen und Maßnahmen ● macht Schule zu einem Ort, mit dem sich wirklich alle identifizieren können. Aktionstag „Schule ohne Rassismus“ 3. Juni 2015
Wie zum Beispiel
Dafür gibt es schon
unser modernes
„rollende Klassenzimmer“,
viele gute Ansätze.
dass flexibel an sinnvolle
pädagogische und didaktische
Anforderungen angepasst
werden kann.Berufsorientierung in der Mensa
Bikeraum und Werkstatt
Käthe-Forum
Mensa Käthe-Café Arbeits-/Ruheräume
ZWISCHEN ARBEIT U N D R U H E S TA N D
Volkshochschule Lünen
Verkehrs- übungsplatz
energetische Versorgung
und barrierefreier Umbau
Abriss/Neubau oder
Abriss/Neubau oder
Sanierungder
Sanierung derSporthallen
Sporthalle
Entwicklung
des Schulhofs
Neubau einer
Musikinseltemporäre Nutzung der
ehemaligen Overbergschule
durch die KKG für den
MusikunterrichtEntwicklung Halde Victoria III/IV: Neugestaltung der Halde für Freizeit und Naherholung (u.a.Bikepark, neuer Rundweg)
Waldwiesen- Schneise
Pumptrack
Dirtline
Biketrail / Abfahrt Grill / Bühne Ruhepunkte
Zentrum für Nachnutzung der ehem.
therapeutisches Pestalozzischule:
Reiten Multikulturelles Forum
Sportplatz VfB Lünen, Versorgungsbereich an der
Nutzung als Sport- und Jägerstraße mit u.a. REWE
Freizeitfläche und RossmannCampus Lünen Süd ist ein Verbund von Angeboten für Lernen Freizeit Bildung Betreuung
Unsere Angebote
Berufs- und
im Überblick: Studienorien-
tierung
Konzerte Werken
Musik Naherholung
Ballspiele Vorführungen Fortbildungen
Lesungen
Abenteuersport Begegnung
Mountainbiking Ausstellungen Weltladen
Bewegung Kleingarten
Inline-Skating Kunst/Darstellen Ernährung
und GestaltenRäume schaffen
und gestalten:
ist essentielle Voraussetzung für
Bildung und guten Lebensstandard..Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!Stadtteilentwicklung
Lünen-Süd
Entwicklungen auf dem Gelände der KKG
Runder Tisch Lünen-Süd, 20.02.2019
18.02.2019 Stadtplanung (4.1) Seite 1Käthe-Kollwitz-Gesamtschule 18.02.2019 Stadtplanung (4.1) Seite 2
Entwicklungen rund um die KKG
Abriss D-Trakt / Abriss Schwimm-
und Ringerhalle
(ZGL-/SLG-Maßnahme)
• ab Osterferien 2019
• Objekte sind stark bergbaugeschädigt
• D-Trakt bereits heute leergezogen
(Musikräume übergangsweise in der
alten Overbergschule)
• Schwimm- und Ringerhalle aktuell noch
für schulische Zwecke sowie vom VfK
Lünen genutzt
– VfK Lünen nutzt übergangsweise die Turnhalle
auf dem Gelände der ehem. Paul-Gerhard-
Schule
18.02.2019 Stadtplanung (4.1) Seite 3Entwicklungen rund um die KKG
Neugestaltung Halde Victoria III/IV
• Städtebauförderung („Soziale Stadt
Gahmen“)
• Abschluss 1. BA (Nordost-Zuwegung,
Waldschneise, Promenade) im Dezember
2018
• aktuell Vergabe der Bauleistungen für
die Ruhepunkte (Fertigstellung bis Mai
2019)
• aktuell Vorbereitung der Vergabe der
Bauleistungen für die Bikeanlagen
(Fertigstellung bis Ende 2019)
– Beteiligungsaktionen geplant
• Abschluss der Maßnahme bis Ende 2019
18.02.2019 Stadtplanung (4.1) Seite 4Entwicklungen rund um die KKG
Neubau Sporthalle Dammwiese
(ZGL-/SLG-Maßnahme)
• bis Ende 2020
• politischer Beschluss zur Umsetzung
einer 4-Feldsporthalle mit 480
Tribünenplätzen und Vorraum an einem
anderen Standort auf dem Areal mit
bereichsweiser 2. Ebene mit Platz für
Ringkampf- und Judomatten und
Sondernutzungsräumen für den VfK
Lünen sowie angebauter
Umkleideräume für den VfB Lünen
• neuer Standort im Bereich der heutigen
Schwimm- und Ringerhalle
• verkehrliche Erschließung über den Karl-
Kiem-Weg
• Mehrzweckhallencharakter
18.02.2019 Stadtplanung (4.1) Seite 5Entwicklungen rund um die KKG
Neubau Kindertagesstätte
(ZGL-/SLG-Maßnahme)
• bis Mitte 2020
• Standort nördlich der alten Sporthalle
Dammwiese
• verkehrliche Erschließung über die
Dammwiese
18.02.2019 Stadtplanung (4.1) Seite 6Entwicklungen rund um die KKG
Abriss alte Sporthalle Dammwiese
(ZGL-/SLG-Maßnahme)
• nach Fertigstellung der neuen
Sporthalle
18.02.2019 Stadtplanung (4.1) Seite 7Entwicklungen rund um die KKG
Energetische Sanierung /
barrierefreier Umbau des
Hauptgebäudes
(ZGL-Maßnahme)
• bis Ende 2021
• Städtebauförderung („Stadtumbau West
Lünen-Süd“)
• Vergabe Projektsteuerungsleistungen
abgeschlossen
• aktuell Vorbereitung der Vergabe der
Planungsleistungen
18.02.2019 Stadtplanung (4.1) Seite 8Entwicklungen rund um die KKG
Neubau Musikinsel
(ZGL-Maßnahme)
• Standortsuche nicht abgeschlossen
18.02.2019 Stadtplanung (4.1) Seite 9Entwicklungen rund um die KKG
Freiflächenentwicklung
• Wo wird zukünftig der Schulhof sein?
– Schulhofneugestaltung mit
Städtebaufördermitteln geplant)
• Wo werden Stellplätze errichtet?
• Wo gibt es sonstige Nutzungen auf den
Freiflächen (bspw. Außenfläche
Sporthalle)?
18.02.2019 Stadtplanung (4.1) Seite 10Käthe-Kollwitz-Gesamtschule 2024 18.02.2019 Stadtplanung (4.1) Seite 11
Website Stadtplanung:
https://www.luenen.de/stadtplanung/index.php
Website Stadtteilentwicklung Lünen-Süd:
https://www.luenen.de/sued/
VIELEN DANK FÜR DIE
AUFMERKSAMKEIT
18.02.2019 Stadtplanung (4.1) Seite 12Lünen, den 28.02.2019
Projektbeirat Lünen-Süd
1. Vorsitzender Reinhold Bauhus
2. Vorsitzender Dieter Börner
Reinhold Bauhus, Dammwiese 8, 44532 Lünen
An
Thomas Berger und Tim Jürgens
Stadtplanung
Stadt Lünen
Willy-Brandt-Platz 5
44532 Lünen
Perspektive Stadtteilmanagement
Sehr geehrter Herr Berger, sehr geehrter Herr Jürgens,
wie Sie wissen ist Ende 2019 für den Stadtentwicklungsprozess Lünen-Süd ein wichtiger
Zeitpunkt. Der Dezember markiert das Ende des Förderzeitraums „Stadtumbau West Lünen-
Süd“. Zwar können über den Stadtumbau initiierte und finanzierte Projekte wie etwa die
umfangreiche Aufwertung der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule auch über Ende 2019 hinaus
umgesetzt werden, allerdings muss das Stadtteilbüro Lünen-Süd mit unseren beiden
Stadtteilmanager bis zu diesem Zeitpunkt seine Arbeit einstellen.
Da der Aufwertungsprozess Lünen-Süds mit der Fertigstellung des Bürgerplatzes Ende 2017
erst richtig begonnen hat und zahlreiche wichtige Projekte noch nicht angegangen wurden
(z.B. Entwicklung des Campus Lünen-Süd, mit diversen Teilthemen wie bauliche Aufwertung
der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Turnhalle, Verkehr, Nutzerkonzeption, Verbindung zum
Stadtteil, etc.), Tunneldurchstich Preußenbahnhof, energetische Quartiersentwicklung)
möchten wir anregen, dass eine Verlängerung des Stadtteilmanagements um zwei Jahre
beantragt wird.
Für die weiterhin erfolgreiche Umsetzung ist es maßgeblich, dass den ehrenamtlichen
Kapazitäten im Stadtteil und den hauptamtlichen Ressourcen in der Stadtverwaltung Lünen
weiterhin die Institution Stadtteilbüro zur Verfügung steht. Diese hat sich in den letzten
Jahren als zentrale Stütze des Prozesses erwiesen. Projektbeirat und Runder Tisch haben
sich in ihren letzten Sitzungen, in diesem Monat, einstimmig dafür ausgesprochen, die
Existenz der Stadtteilbüros über Ende 2019 hinaus zu gewährleisten.
Wir möchten Sie bitten, die Weiterführung möglich zu machen bzw. alle nun notwendigen
Schritte für den Weiterbetrieb kurzfristig zu veranlassen.
Glückauf,
Reinhold Bauhus und Dieter BörnerNeugestaltung Eingänge Südpark – Lünen
ERLÄUTERUNGSBERICHT
ZUR MAßNAHME (STAND 15.02.2019)
Proj.-Nr.: 01-2019
Bauvorhaben: Neugestaltung Eingänge Südpark
Eingang Wagnerstraße
Eingang Dernerstraße
Eingang Am Schottweg
Eingang Hundeplatz
Bauherr: Stadt Lünen
Willy-Brandt-Platz 5
44532 Lünen
Abgabedatum: 18.02.2019
Blattwerk
Landschaftsarchitekten & Ingenieure
Pestalozzistraße 13
42899 Remscheid
T: 02191 | 6943070 F: 02191 | 6943075Erläuterungsbericht zur Maßnahme Seite 1 Inhaltsverzeichnis 1. Anlass/ Aufgabenstellung .................................................................................................. 2 2. Planerische Grundlagen .................................................................................................... 2 3. Natürliche Grundlagen ...................................................................................................... 3 4. Stadträumliche Situation ................................................................................................... 4 5. Das allgemeine Gestaltungskonzept des Volkspark um 1910 - 1920 ............................... 4 6. Planungsansätze für die Gestaltung der Eingänge zum Südpark ..................................... 6 7. Kostenschätzung ............................................................................................................. 14 8. Zusammenfassung .......................................................................................................... 14 blattwerk
Erläuterungsbericht
zur Maßnahme Seite 2
1. Anlass/ Aufgabenstellung
„Das Stadtumbaugebiet „Lünen-Süd“ ist im Jahr 2014 in das Städtebauförderprogramm
„Stadtumbau West“ des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen worden. Ein Schwer-
punkt der strategischen, städtebaulichen und freiraumbezogenen Entwicklung liegt auf der
Qualifizierung des öffentlichen Raumes im Stadtteil, d.h. neue Ideen sollen sich nicht nur auf
klassische Grün- und Platzflächen beschränken, sondern auch Straßenräume, Fuß- und
Radwege und die so genannten „halböffentlichen Räume“, beispielsweise Flächen des Woh-
numfeldes mit einbeziehen.“1
In dem Zusammenhang erarbeitete die Stadt Lünen einen Masterplan „Entwicklung und Ver-
netzung öffentlicher Räume“, Lünen-Süd. In diesem Masterplan ist auch der Südpark als
eine öffentliche Grünanlage des Stadtteils „Lünen-Süd“ und hier insbesondere die Herausar-
beitung der Eingänge zum Südpark, Bestandteil städtebaulicher/stadträumlicher Entwick-
lung. Dabei weist der Südpark einen starken Bezug zu den angrenzenden Siedlungsflächen
auf.
Der Masterplan entwickelt für das Leitbild „Grün“ das Bild eines so genannten „Landschafts-
bandes mit Schlaufen“. Teil dieses Leitbildes bildet die Aufwertung der Eingänge des
Südparks durch die Ausbildung von markanten Eingangssituationen. Im Zusammenhang mit
dem Handlungsfeld „Fuß- und Radwege“ bekommt der Zugang zum Südpark von der Straße
Am Schottweg eine besondere Bedeutung.
Die Stadt Lünen schrieb insbesondere auf dieser Grundlage freiraumplanerische Leistungen
für die Gestaltung der Parkeingänge aus. Mit der Bearbeitung dieser Planungsaufgaben
wurde das Planungsbüro Blattwerk, Remscheid, beauftragt.
2. Planerische Grundlagen
Der Planung liegen insbesondere folgende durch die Stadt Lünen bereitgestellten Unterlagen
zugrunde:
• Übersichtskarte über Flurstücke; ohne Datum; Posteingang blattwerk am 07.02.2019
• Stadtgrundkarte und Kataster Südpark; Maßstab 1:2.000 der Stadt Lünen; Datum
07.01.2019
• B-Plan Nr.: 169; „Jägerstraße“ 1. Änderung
• Leitungsauskünfte der Stadtwerke Lünen GmbH für einen begrenzten Umfang des
Plangebietes vom 08.01.2019
• Masterplan „Entwicklung und Vernetzung öffentlicher Räume“ in Lünen-Süd; Ent-
wurfsstand 05.11.2018
1
siehe Masterplan „Entwicklung und Vernetzung öffentlicher Räume“ in Lünen Süd; Entwurfsstand 05.11.2018; S.5
blattwerkErläuterungsbericht
zur Maßnahme Seite 3
Für die Erarbeitung wurden zusätzlich die nachfolgenden Unterlagen herangezogen:
• Landschaftsplan Nr. 1; Raum Lünen, Kreis Unna Stand 12/1985, i.d.F. Februar 2012
• aktuelle Luftbilder, Topografische Karten, historische Karten, Freizeitinformationen,
Kataster, etc.
• Integriertes Stadtentwicklungskonzept Lünen-Süd (ISEK-2011); Konzeptstudie Lü-
nen-Süd (2014), Karte Programmgebiet Stadtumbau-West; www.luenen.de/sued/
• „Siedlungskultur in Quartieren des Ruhrgebietes“ – Preußen-Kolonien Lünen-Süd;
www.metropoleruhr.de
• Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands; Bundesanstalt für Landes-
kunde und Raumforschung; Bad Godesberg
• Siedlungskultur in Quartieren des Ruhrgebietes als Teil eines Interkommunalen
Handlungskonzeptes, hier Lünen, Lünen Süd, Ziehtenstraße „Preußen-Kolonie“,
Stadt Hamm (Stadtplanungsamt) für die beteiligten Kommunen, Wohnungsgesell-
schaften und den RVR, Dortmund 31.07.2017
3. Natürliche Grundlagen
Naturräumlich befindet sich das Bearbeitungsgebiet im Raum der „Hellwigbörden“. Wesent-
lich an der Bodenschichtung des Raumes ist Löß in unterschiedlichen Mächtigkeiten. Der
Raum präsentiert sich westlich von Lünen als eine langgestreckte flache Bodenwelle.
Das Klima der „Hellwigbörden“ kann in seiner Gesamtheit als maritim angesehen werden.
Jedoch und abhängig von Geländeformen sind kontinentale Ausprägungen festzustellen.
Die natürlichen Waldgesellschaften waren in den „Hellwigbörden“ standortangepasst vielfäl-
tig. Heute lassen nur noch wenige Waldreste diese Vielfalt erahnen.
Der Südpark kann topographisch in folgende zwei Teile gegliedert werden, deren Trennlinie
Nord-Ost/ Süd-West ausgerichtet ist:
• den höher liegenden Teil von der Dernerstraße bis etwa in den Raum des Teiches
und
• den durch Entwässerungsgräben gekennzeichneten tiefer liegenden Teil.
Im topographisch höher gelegenen Teil des Südparks würde sehr wahrscheinlich ein Über-
gang zwischen der natürliche Waldgesellschaft einer Assoziation von Quercion pubescenti-
petreae (West-submediterrane Flaumeichenwald) stocken können. An ihn schließt sich nach
Nord-Westen auf den bodenfeuchteren Flächen ein Areal an, auf dem sich ein Betulo-
Quercetum roboris (Birken-Stieleichenwald) herausbilden könnte.
blattwerkErläuterungsbericht
zur Maßnahme Seite 4
Im Raum des Hundeplatzes tritt als bestimmende Baumart Betula pubescens (Moorbirke)
auf. Die Strauchschicht unter den Birken wird durch Wallhecken ruderaler Gebüsche gebil-
det, die sich sehr wahrscheinlich aus Rubus gratus und R. plicatus (beides Arten der Brom-
beere) zusammensetzen.
4. Stadträumliche Situation
Der Südpark wurde unmittelbar an der Kolonie „Oberbecker“ angelegt. Diese Kolonie geht
auf die durch die Zeche „Preußen“ zurückgehende notwendig gewordene Siedlungsentwick-
lung zurück. Die regelmäßige Kohleförderung begann bei der Zeche „Preußen“ 1897/1904.
Die Stilllegung erfolgte 1929.
Der Bau der Kolonie „Oberbecker“ begann kurz nach 1900 als die sogenannte dritte Preu-
ßen-Kolonie. Die Siedlung besteht aus zwei Teilen, wobei der Teil II, unmittelbar am
Südpark, einen Grundgedanken der Gartenstadt umsetzt. Dieser Grundgedanke der Garten-
stadtideologie basiert darauf, dass der Gemeinschaftsgedanke unter den Siedlern, der durch
eine entsprechende Organisation des Lebensalltags in der Siedlung gefördert werden sollte2.
Darunter sind insbesondere zwei Aspekte zu sehen:
• Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit sollten optisch durch eine einheitliche Ge-
staltung der Siedlung unterstrichen werden und
• Innerhalb bzw. unmittelbar angrenzend sollte eine zentrale Fläche, ein Veranstal-
tungsort für zahlreiche kulturelle Aktivitäten für die Allgemeinheit nutzbar sein.
Bei der Entwicklung zentraler Anlagen spielten dabei die Bodenpreise eine entscheidende
Rolle, sodass nicht selten am Rand der Siedlungen ein Stadtteilpark entstand. So auch hier
in Lünen der Südpark.
5. Das allgemeine Gestaltungskonzept des Volkspark um 1910 - 1920
Als ein Volkspark kann „nur diejenige öffentliche Parkanlage bezeichnet werden, die im Ge-
gensatz zu den meisten bisherigen öffentlichen Parks nicht nur den gelegentlichen Spazier-
gängen dient, sondern den Volksmassen und allen Kreisen der Bevölkerung zu jeder Jah-
reszeit Raum und Gelegenheit bietet zum Aufenthalt im Freien, zum Sichausleben in Spiel
und Sport ebenso wie zum beschaulichen Ausruhen.“3 Danach sollte ein Volkspark folgende
Elemente enthalten bzw. gestalterische Konzepte umsetzen:
• schattige Alleen mit entsprechenden Platzerweiterungen,
• sonnige, weite Spielwiesen von schattenspendenden, breiten Alleen umschlossen,
die die Wiesen zu Räumen abschließen,
• Spiel- und Turnplätze für kleinere Kinder
2
vgl. Meiner 1936; 32f.
3
siehe Lesser, Ludwig auf dem Brandenburgischen Städtetag 1910; hier aus seinem Vortrag über Gestaltungs-
und Nutzungskonzeptionen des zukünftigen Volksparks
blattwerkErläuterungsbericht
zur Maßnahme Seite 5
• Licht- und Luftbad, Sandspielplatz für die Kleinsten,
• Wasserflächen,
• Unterkunftshallen, Trinkbrunnen, Erfrischungshäuschen, Abortanlagen
• Musiktempel, Vogelhäuser und Tiergehege
Zur Bepflanzung wird ausgeführt:
• Pflanzen bilden das wichtigste und hauptsächlichste Element; sie müssen sich aber
in Auswahl und Verwendung dem Zweck des Volksparks unterordnen,
• Besondere Blumengärten, wie z. B. Rosengärten, Staudengärten, Steingärten oder
Wassergärten, sind von dichten Hecken oder anderen Anpflanzungen umgeben,
• Ansonsten bestehen die übrigen Parkbereiche aus Grün, die um den sonnigen Wie-
sen genügend Raum zu lassen, hauptsächlich als Rahmen des Volksparks dienen,
• Möglichst viele einheimische Pflanzen, aber auch bei uns winterharte Bäume, Gehöl-
ze, Stauden und Blumenzwiebeln verwenden.
Leberecht Migge führt dazu aus: „Unsere [Volks-]Massen wollen kein Strauch- und Baum-
museum in dem Park, der ihnen gehört; sie verlangen mit Recht, seine Einrichtung aktiv
ausnutzen zu dürfen und nicht nur zu besehen.“4
Die Einbindung von reformtypischen Gestaltungselementen in die Landschaft bzw. Umge-
bung zählte zum obersten Gestaltungsprinzip: „Sich der Umgebung anzupassen, in die
Landschaft einzubringen, ist erstes Gebot […], den richtigen Blick für die Besonderheit der
Anlage zu haben, geschickt auszunutzen, das wichtigste Erfordernis […].“ 5 So erschließt
sich, dass trotz der Typologie nicht jeder Volkspark gleich aussah, sondern durch den Topos
beeinflusst wurde.
Des Weiteren treten bei den Volksparks eine schlichte Formensprache, eine klare Raum-
struktur und die Verwendung von einfachen Baumaterialien in den Fokus der Gestaltung.
Durch eine zweckorientierte Ausstattung der Flächen und Verzicht auf schmückendes, land-
schaftliches Grün, die Verwendung einfacher Elemente und Materialien, einfache Ausstat-
tung und aus der Funktion abgeleitete Formgebung sollte eine Realisierbarkeit der Anlagen
durch deren Rentabilität gewährleistet werden.6
Dennoch sollte nach Ansicht Ludwig Lessers, der 1928 sein Buch „Volksparke heute und
morgen“ veröffentlichte, nicht auf „schöne Bäume und Blütensträucher, duftende Rosen und
farbenglühende Stauden“ verzichtet werden. Er forderte aber, dass diese Pflanzen so ver-
wendet werden sollten, dass „sie voll und ganz den sozialen Zwecken“ dienen.7 Abgesehen
4
siehe Migge, Leberecht (1913). Die Gartenkultur des 20. Jahrhunderts. Jena: Eugen-Diederichs
5
vgl. Ostrop (1928) S. 52
6
vgl. Störmer & Wimmel (1994) S. 13
7
vgl. Lesser (1928) S. 31
blattwerkErläuterungsbericht
zur Maßnahme Seite 6
von den Blumenpflanzungen in den Sondergärten der Volksparks, sollten die Anpflanzungen,
um den sonnigen Wiesen möglichst viel Raum lassen und damit ihrer freien Benutzung,
hauptsächlich als Rahmen des Volksparkes Verwendung finden; vor allem sollte auf den
Gebrauch vieler einheimischer Pflanzen geachtet werden.8
Zur Betonung der Hauptachse und Flächen wurden Alleen und Hecken, zur Raumbildung
Baumgruppen aus überwiegend heimischen, den klimatischen und geologischen Verhältnis-
sen entsprechenden und bewährten Parkbäumen verwendet.
Die Materialien der in den Anlagen integrierten Baulichkeiten wurden aus heimischen Mater-
ialien, wie z. B. Ruhrkohlensandstein in Dortmund, oder falls örtliche Vorkommen an Kies
und Sand vorhanden waren, in Beton ausgeführt. Die Wege wurden preiswert als wasserge-
bundene Decken hergestellt.
6. Planungsansätze für die Gestaltung der Eingänge zum Südpark
Die erarbeitete Vorplanung befasst sich mit den Eingängen des Südparks in Lünen. Die Par-
keingänge wurden, da sie keine eigenständigen Bezeichnungen führen, wie folgt unterglie-
dert:
• Wagnerstraße,
• Dernerstraße,
• Am Schottweg und
• Eingang Hundeplatz.
Bei der Aufgabenstellung stand die Aufwertung der Eingänge mit Hilfe von Staudenpflanz-
ungen im Vordergrund. Insoweit wurden für die Planung Wegebauarbeiten durch die Stadt
Lünen ausgeschlossen.
Die „Keimzelle“ des Südparks ist nach den vorliegenden historischen Karten sehr wahr-
scheinlich ein kleines Waldstück, um das der Park herum entwickelt worden ist. Der Park-
raum des Südparks stellt sich heute seinem Charakter nach als ein in den Wald hinein gear-
beiteten Park dar. Diese Situation hat dazu geführt, dass z.T. sehr großflächig Aufwuchs die
Raumstruktur verwischte. Alleen, wertvolle Einzelgehölze und Baumgruppen sind zum Teil
durch aufgewachsene Sämlinge überformt. Die Stadt Lünen hat diesen Umstand erkannt
und versucht seit Jahren dagegen anzugehen.
Dennoch trägt der Parkraum vorwiegend den Charakter eines Waldes. Damit gibt der Ort die
Wachstumsbedingungen für die bei der Umgestaltung der Parkeingänge auszuwählende
Pflanzenzusammensetzung vor. Die Lebensbedingungen sind dabei folgende:
• Standort: feucht bis mäßig feucht, in den nordwestlichen
Teilen teilweise mäßig nass
8
vgl. Lesser (1928) S. 33
blattwerkErläuterungsbericht
zur Maßnahme Seite 7
• Säurebereich:
- im nordwestlichen Teil wahrscheinlich sauer bis mäßig sauer
- im südöstlichen Parkteil mäßig sauer bis schwach sauer
• Beleuchtungsstärke: bei voller Belaubung beträchtlich gedämpft; im
Jahresverlauf ändert sich die spektrale Zusam-
mensetzung des Lichts
• Boden- Lufttemperatur: Lufttemperatur schwankt im Tages- und
Jahreslauf weniger stark als in der offenen Land-
schaft
• Luftfeuchtigkeit/
Sättigungsdefizit: geringe Schwankungen; der Unterwuchs spricht
weniger auf die Kontinentalität des allgemeinen
Klimas an
• Bestrahlung: an Sonnentagen sind kurzfristige Schwankungen
der Bestrahlung kleinerer Flächen möglich. Damit
Änderung in der Luftfeuchtigkeit. Die punktuelle
starke Besonnung lässt Temperatur und Sätti-
gungsdefizit am Waldboden rasch ansteigen.
Dies wird für manche Pflanzen zum begrenzen-
den Wachstumsfaktor.
• Niederschläge: Durch das vom Kronendach abtropfende Wasser
(Bestandsniederschlag) lösen sich von den
Zweigen und Blättern Nähr- und Schadstoffe.
Deshalb ist dieses Wasser oft saurer und reicher
an Schwermetallen aber auch an Kalium.
• Wasserentzug: Baumschicht und Unterwuchs konkurrieren um
Wasser und Nährstoffe.
• Blattstreu: Flachwurzelnde Pflanzen nehmen durch die
Zersetzung des Laubes Nährstoffe auf.
• Strauchschicht: Fast alle Sträucher haben ihr Wachstums- und
Verbreitungsoptimum außerhalb des Waldschat-
tens; d.h. es gibt fast keine Arten, die im Wald-
schatten besser gedeihen als im Freiland. Aller-
dings „vertragen“ einige Arten den Waldschatten
besser als andere (z.B. Daphne mezereum, Ri-
bes uvacrispa, Viburnum opulus, Rubus caesius
u.a. Arten von Rubus, Ribes alpinum). Mit Si-
blattwerkErläuterungsbericht
zur Maßnahme Seite 8
cherheit ist Forsythia intermedia (Eingang
Schottstraße), Berberis ssp. (Eingang Derner-
straße), für die Pflanzung im Wald nicht geeignet.
Diese Wachstumsbedingungen und die Ideen und planerischen Ansätze aus der Zeit der
Entstehung des Südparks führen zur Umsetzung des auf den Plänen fixierten Pflanzenspekt-
rums. Dieses wurde noch einmal an die jeweiligen kleinräumigen Besonderheiten der einzel-
nen Eingänge angepasst.
Die Grundsätze der angestrebten Gestaltung der einzelnen Eingänge werden nachfolgend
erläutert. Dabei weisen die Pläne Maßnahmen in unterschiedlicher Zuordnung aus, die in
den Plänen zusätzlich farblich unterschieden sind. Darunter sind folgende zu verstehen (Die
nachfolgende Farbgebung der Anstriche entspricht der Farbgebung der in den Plänen be-
schriebenen Maßnahmen.):
• Maßnahmen, die Bestandteil des Förderantrages sind,
• Spezielle flankierende Maßnahmen, die nicht Bestandteil des Förderantrages sind
und die durch die Stadt Lünen selbst und im Zusammenhang mit der Umsetzung der
durch die Förderung möglich werdenden Maßnahmen umgesetzt werden, sowie
• Maßnahmen, die der Entwicklung des Parks dienen und aus der fachlichen Sicht des
Freiraumplaners empfohlen werden. Diese Maßnahmen werden in den nächsten Jah-
ren durch die Stadt Lünen umgesetzt um die Aufenthaltsqualität des Parkes und sei-
ne räumliche Qualität weiter zu entwickeln.
In diesem Erläuterungsbericht werden ausschließlich die Maßnahmen beschreiben die
Bestandteil des Förderantrages sind.
Die einzelnen Maßnahmen sind in den Plänen dargestellt und beschrieben, sodass hier im
Erläuterungsbericht spezielle Hinweise und Erläuterungen unterbleiben können. Dabei sind
die Parkzugänge Wagnerstraße und Dernerstraße völlig anders zu behandeln als die Zu-
gänge Am Schottweg und am Hundeplatz.
Während die Eingänge Wagnerstraße und Dernerstraße mehr urbanen Charakter tragen und
bei Ihnen die bewusste gärtnerische Gestaltung im Vordergrund steht, dominiert bei den bei-
den anderen Zugängen der großzügige, landschaftliche Eindruck des Überganges zwischen
der offenen landwirtschaftlich genutzten Landschaft und dem bewusst gestalteten Raum des
Südparks.
1. Eingang Wagnerstraße
Dieser Parkzugang ist dadurch gekennzeichnet, dass er von der Kreuzung Wagnerstraße/
Freiligrath Straße kaum wahrgenommen werden kann. Der Zugang ist durch einen asphal-
tierten, schmalen Durchgang zwischen Hecken aus Carpinus betulus (Hainbuche) geprägt.
blattwerkErläuterungsbericht zur Maßnahme Seite 9 Bild 1: Eingang zum Südpark von der Wagnerstraße aus gesehen Die gestalterische Grundidee verfolgt das Ziel den Zugang zum Park durch ein angemesse- nes Hinweisschild an der Wagnerstraße erlebbar zu machen. Erst nachdem man diesen Durchgang durchquert hat, betritt man den Park. Bild 2: Blick aus dem Park in Richtung Wagnerstraße Die Planung sieht vor, nach dem Durchgang beidseitig des Weges Staudenflächen zu entwi- ckelt. Dabei bestimmen unmittelbar nach dem Durchgang Solitärstauden das Bild und bilden so den Auftakt zum Parkraum. Die Pflanzungen sind wie folgt zu beschreiben: blattwerk
Erläuterungsbericht
zur Maßnahme Seite 10
• Nördlich des Weges: Bepflanzung mit niedrigen Bodendecker in die Gräsertuffs und
hohe Solitärstauden eingestreut sind.
• Südlich des Weges: Entwicklung einer flächigen niedrigen Bepflanzung mit Bodende-
ckern, in die Gruppen und kleine Flächen mittelhoher Stauden sowie höhere Soli-
tärstauaden und Gräser eingestreut werden. Dabei erfolgt eine Höhenstaffelung, die
beginnend am Weg niedrig ist und zu den Hecken aus Carpinus betulus (Hainbuche)
höher werden. Die Hecke fungiert dabei als gestalterischer Hintergrund.
2. Eingang Dernerstraße
Der Parkzugang von der Dernerstraße ist allgemein davon geprägt, dass der Park als sol-
cher kaum wahrgenommen werden kann. Vielmehr vermittelt der Eingang durch die Domi-
nanten entlang der Straße stehenden Straßenbäume, Platanus acerifolius (Platanen), den
Eindruck es handele sich um sogenanntes Abstandsgrün. Der Eindruck wird durch die dichte
waldartige Struktur des Parks in diesem Raum noch verstärkt.
Hinzu kommt die auf beiden Seiten des Parkzuganges stehende wegweisende Beschilde-
rung eines privaten Unternehmers. Die Schilder entfalten eine solche Dominanz, dass der
Park gänzlich in den Hintergrund tritt.
Bild 3: Blick auf den Parkeingang von der Dernerstraße aus gesehen
Aus den Gründen sollen folgende Leistungen umgesetzt werden:
• Fällung und Rodung des dichten Unterwuchses bis in eine Tiefe von ca. 10 – 15 m
(davon sind bereits durch die Stadt Lünen ca. 5 – 8 m gerodet. Ziel sollte es sein eine
sogenannte halboffene Waldentwicklungsphase zu erhalten und langfristig zu si-
blattwerkErläuterungsbericht
zur Maßnahme Seite 11
chern.
• Entwicklung eines neben dem Gehweg verlaufenden breiten Banketts mit einer
Querneigung von ca. 10% und eine demgemäßen Bepflanzung dieses Streifens.
Damit wird der vor den sich nördlich an den Park anschließenden Gebäuden Charak-
ter weiterentwickelt. Es soll eine großzügig wirkende Fläche entstehen.
• Die Pflanzung wird als Schattenpflanzung mit Bodendecker entlang des Gehweges,
kleineren in diese Flächen eingestreute Tuffs mit Gräsern und einer das „Rückgrat“
bildenden Gehölzpflanzung entwickelt.
3. Eingang Am Schottweg
Dieser Parkraum verfügt über eine Besonderheit. Unmittelbar im Umfeld zu dem Eingang
stehen kapitale Quercus robur (Sieleichen). Einige stellen Naturdenkmale dar und stehen als
solche unter Schutz. Hinzu kommt eine vom Eingang nach Norden führende Pflanzung der
gleichen Baumart entlang der Straße Am Schottweg.
Bild 4: Parkeingang Am Schottweg; links des Einganges stehen Quercus robur (Stieleichen)
blattwerkErläuterungsbericht
zur Maßnahme Seite 12
Bild 5: links im Bild ebenfalls Quercus robur (Stieleichen). Rechts im Bildhintergrund eine
Quercus robur (Stieleichen) die als Naturdenkmal geschützt ist. Den Weg begleitend ein
Entwässerungsgraben
Damit bestanden aus dem Park hinaus in die freie Landschaft und von dort in den Park hin-
ein Blickbeziehungen. Diese Blickbeziehungen sind heute durch unkontrollierten Aufwuchs
gestört, können aber durch geeignete Maßnahmen wiederhergestellt und erhalten werden.
Hinzu kommt eine weitere Besonderheit. Aus dem Inneren des Parks und die Wegeverbin-
dung Am Schottweg begleitend gibt es eine Vielzahl von Entwässerungsgräben. Sie sind für
eine fachgerechte Initialbepflanzung prädestiniert. Im Einzelnen werden die Pflanzungen
folgendermaßen entwickelt:
• Die Pflanzungen werden unter den Betula pubescens (Moorbirke) beidseitig des We-
ges flächig entwickelt. Sie setzten sich vorrangig aus wintergrünen Bodendeckern
sowie höheren Blüten- und Blattstrukturstauden (Gräser, Farne) zusammen.
• Zum Zugangsweg läuft die Pflanzung mit niedrigen Flächendeckern aus.
• Es wird mit den Staudenpflanzungen ein Übergang zu den vorhandenen waldartigen
Strukturen geschaffen.
• An Gehölzrändern werden abwechslungsreiche und geschwungene Strukturen mit
Gehölzbuchten und –inseln herausgearbeitet.
• Entlang der Gräben werden standortangepasste Großstauden gepflanzt, um diese
Gräben zusätzlich zu einem gestalteten Element der Landschaft werden zu lassen.
Dabei bilden unregelmäßige punktuelle oder Pflanzungen in Gruppen mit wechseln-
der Dichte den Schwerpunkt.
blattwerkErläuterungsbericht
zur Maßnahme Seite 13
• Entwicklung sogenannter Mantelgesellschaften
4. Eingang Hundeplatz
Dieser Eingang ist durch im Charakter von Alleen gepflanzten Betula pubescens (Moorbirke)
geprägt. Sie bilden weithin sichtbar einen Rahmen und markieren den Zugang zum Hunde-
platz. Um den Parkeingang herauszuarbeiten wird auf den Bestand an Acer platanoides
(Platanenblättriger Ahorn) und Quercus robur (Stieleiche) unmittelbar am Parkeingang zu-
rückgegriffen.
Die drei einzelnen Bäume werden herausgestellt. Dafür sind folgende Maßnahmen erforder-
lich:
• zurückdrängen der Waldkante,
• Beseitigung des Aufwuchses von Sämlingen unter den Bäumen um dem sogenann-
ten „Herausdunkeln“9 von Lebensgemeinschaften entgegenzuwirken und
• die Aufastung der Bäume auf eine Höhe von ca. 2,5 m über der Oberkante des Bo-
dens.
Bild 4: Links im Bildvordergrund die drei herauszustellenden Bäume. Im Bildhintergrund die
Betula pubescens (Moorbirke)
9
Darunter wird verstanden, dass sich durch das Wachstum der Bäume die Kronen schließen. So nimmt die
Besonnung von Teilen des Waldbodens zunehmend ab und es verschwinden insbesondere auch sogenannte
Pioniergesellschaften, da ihnen das zur Photosynthese benötigte Lichtspektrum nicht mehr zuteil wird.
blattwerkErläuterungsbericht
zur Maßnahme Seite 14
Diese Maßnahmen sind geeignet den Parkeingang zu markieren. Flankiert werden diese
Maßnahmen durch die Herstellung einer Wiesenfläche unter den Bäumen. In die Wiesenflä-
che werden standortangepasste Großstauden gesetzt. Auch hier stellen die Stauden eine
Initialpflanzung dar.
Für die Entwicklung der Parkeingänge ist nicht nur die Kontrolle des Aufwuchses von Säm-
lingen entscheidend. Zusätzlich sollten bei den Parkeingängen Am Schottweg und am Hun-
deplatz die Mähzeitpunkte der Wiesenränder an den Standort angepasst werden. Dabei
könnte die erste Mahd um Fronleichnam (ca. um den 20. Juni) liegen und die zweite Mahd
im August/ Anfang September. Dabei bleiben die Großstauden jedoch stehen und werden
erst im Frühjahr des darauffolgenden Jahres gärtnerisch behandelt.
7. Kostenschätzung
Bestandteil der Gesamtunterlage ist eine Kostenschätzung nach DIN 267-1-2008-12. Infor-
mationen zu den ermittelten Kosten können dort entnommen werden.
8. Zusammenfassung
Die hier vorgestellte Vorplanung für die Parkeingänge zum Südpark Lünen sind Teil der
Maßnahmen des Masterplans „Entwicklung und Vernetzung öffentlicher Räume“ in Lünen-
Süd. Ihre Umsetzung dient der freiraumbezogenen Entwicklung des Quartiers und des öf-
fentlichen Raumes.
Dazu werden in die bestehende Parkstruktur des Südparks hinein, Pflanzungen entwickelt,
deren Ziel zum einen darin besteht die Parkzugänge aufzuwerten und zum anderen durch
die Initialpflanzungen eine Eigendynamik zuzulassen. Neben der Ästhetik können so gleich-
zeitig Defizite der natürlich biologischen Vielfalt in dem sensiblen Übergangsbereich zwi-
schen dem Wald und den angrenzenden Freiräumen hier insbesondere im Bereich Am
Schottweg beseitigt werden. Die Pflegeingriffe der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege
sollten so organisiert werden, dass neben der eigentlichen Pflege die Leistung des Gärtners
nämlich die Beobachtung der natürlichen Entwicklungsabläufe der Pflanzungen nicht unter-
lassen wird um so nachhaltig auf diese Entwicklungen eingehen zu können.
Dazu werden von der Stadt Lünen unterstützende Maßnahmen ergriffen um dem Projekt
zusätzlichen Schub zu geben und um den Erfolg der Maßnahmen abzusichern.
aufgestellt, Remscheid, den 18.02.2019:
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Stallmann
Landschaftsarchitekt AKNW
Anlage: Kostenschätzung
blattwerkST-Freiraum Landschaftsarchitekten _________________________________________________________________________________________________ Ziethenpark, Lünen-Süd Erläuterungsbericht Der Ziethenpark liegt im Süden der Stadt Lünen im Stadtteil Lünen-Süd. Zentral in Lünen-Süd gelegen bildet er zusammen mit dem Friedhof-Süd im Osten des Parks einen wichtigen Grünzug im Stadtteil. Nordöstlich des Parks liegt die Ziethensiedlung, die als alte Bergbausiedlung noch heute an die Bergbaugeschichte der Stadt erinnert. Südlich des Ziethenparks verläuft mit der Zechenbahntrasse eine wichtige Radwegeverbindung, die den Stadtteil mit dem Datteln-Hamm- Kanal und dem dortigen Freiraumsystem verbindet. Südwestlich in direkter Nähe des Parks liegt der im Jahr 2018 neu errichtete Bürgerplatz. Zusammen mit dem Ziethenpark bildet der Platz die kommunikative Mitte des Stadtteils. Aufgrund der Überalterung der vorhandenen Ausstattung soll der Ziethenpark im Rahmen der Stadtentwicklung Lünen-Süd modernisiert werden. Diese Modernisierung hat auch zum Ziel, das vorhandene urbane Grün aufzuwerten und somit gesunde Lebensbedingungen für die Bevölkerung im Stadtteil Lünen-Süd zu schaffen. Die zentrale Idee Zentraler Bestandteil der Neuplanung sind der Erhalt und die Sicherung des alten und vitalen Baumbestands vor allem im südlichen Teil des Ziethenparks. Ein Baumwipfelkletterpark soll künftig in diesem alten Baumbestand ein attraktives Spielangebot für die Kinder und Jugendlichen schaffen und als Alleinstellungsmerkmal eine Landmarke für den Stadtteil bilden. Ein Spielturm in Form eines idealisierten Förderturms ermöglicht den Aufstieg in die Baumwipfel. Eine Jugendecke ergänzt das Angebot für diese Altersgruppe. Mit einer großzügigen Aufenthaltsfläche und gemeinsamen Angebote für die Menschen aller Generationen richtet sich die Neugestaltung des Ziethenparks an den gesamten Querschnitt der Lüner Bevölkerung. Die Spiel- und Bewegungsfläche Für das neu geplante Baumwipfelklettern bleibt der alte und vitale Baumbestand erhalten und wird für die Plattformen zwischen den Kletteranlässen genutzt. Der Kletterpfad wird innerhalb eines geschlossenen Systems aus Netzröhren in ca. 5-8 Metern Höhe liegen, wodurch auf Fallschutzmaterial im Wurzelbereich der Bäume verzichtet werden kann. Innerhalb dieses Systems sollen verschiedenen Kletteranlässe liegen, die bewusst unterschiedlich sind sowohl im Schwierigkeitsgrad als auch in der Transparenz nach unten. Erreicht werden kann der Baumwipfelkletterpfad über einen Spielturm. Dieser soll im unteren Bereich barrierefrei erreich- und bespielbar sein, um allen Kindern und Jugendlichen in Lünen-Süd das Spiel im Turm zu ermöglichen. Zudem soll im unteren Bereich am Turm ein bodennaher Kletterparcours zu finden sein, der es den jüngeren Kindern ermöglicht, erste Kletterübungen und –erfahrungen zu machen. Aus dem Spielturm heraus sollen eine Riesenrutsche von oben und eine barrierefrei erreichbare kleine Rutsche in eine Fläche aus Holzhackschnitzeln führen. Ein kleiner Sandspielbereich als Kleinkinderspielplatz ergänzt das Spielangebot im Ziethenpark. Für die Jugendlichen soll es zusätzlich eine Jugendecke mit Jugendbänken geben, welcher überdacht ist und somit auch bei schlechtem Wetter einen Treffpunkt für die Jugendlichen bietet. Für den Aufenthalt werden Sitzbänke sowohl im Schatten als auch in der Sonne aufgestellt und geben so den Eltern, Senioren und Seniorinnen die Möglichkeit, sich im Ziethenpark aufzuhalten. Das Erschließungssystem Die heutige Wegestruktur des Ziethenparks bleibt erhalten. Allerdings werden die Wege mit einer Asphaltdecke versehen, die eine barrierefreie Erschließung ermöglicht. An den Wegen sollen Bänke zum Aufenthalt einladen. Eine großzügig befestigte Fläche im Übergang zwischen Bürgerplatz und Ziethenpark soll als Treffpunkt der Generationen gemeinsames Spiel und Bewegung ermöglichen. Bänke ermöglichen den Aufenthalt und Spielpunkte geben Senioren und
ST-Freiraum Landschaftsarchitekten _________________________________________________________________________________________________ Seniorinnen Anlass zur Bewegung. Die Spielanlässen sind so konzipiert, dass sich alle Generationen gemeinsam bewegen können und zusammen spielen. Alle Zugänge werden aufgewertet und barrierefrei gestaltet. Zudem wird der heutige Eingang aus Richtung des Friedhofs etwas nach Norden verlegt. So wird ein bereits heute bestehender Trampelpfad aufgenommen und als neuer Eingang befestigt und ausgebaut. Ein neues Beleuchtungskonzept an der Zechenbahntrasse erhöht das Sicherheitsgefühl der RadfahrerInnen und sonstigen NutzerInnen. Die Einbindung Für die weitere Planung ist ein intensiver Austausch aller NutzerInnen und Akteure geplant. Für die Neugestaltung ist zusätzlich ein Beteiligungsverfahren für die Kinder und Jugendlichen vorgesehen, um durch die aktive Einbindung dieser Nutzergruppe einen wichtigen Identifikationspunkt im Stadtteil zu schaffen. Die Aufwertung des Ziethenparks als innerstädtische Grünfläche sichert den Vegetationsbestand, trägt zur Verbesserung des Stadtklimas bei und steigert somit die Wohn- und Lebensqualität der Bevölkerung in Lünen-Süd. Als grüner Gegenpol zum Bürgerplatz ist der Ziethenpark als Standortfaktor für den Stadtteil von hoher Bedeutung. Aufgestellt, 19.12.2018 Alina Meyer
Sie können auch lesen