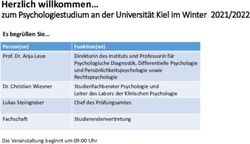Erkenne dich selbst! - Albert-Schweitzer-Schule
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
M 1: Erkenne dich selbst! – Magritte: Die verbotene Reproduktion
Der belgische Surrealist René Magritte (1898–1967) verdeutlichte die Wirklichkeit in seiner Kunst,
indem er diese verfremdete. Dieser Technik bedient er sich auch in seinem Bild „Verbotene
Reproduktion“. In diesem Bild nimmt ein Mann vor einem Spiegel die Perspektive des
Bildbetrachters ein.
Erkenne dich selbst!
Bild: „Die verbotene Reproduktion“ (1937) von René Magritte (1898–1967).
Aufgabe:
Versetzen Sie sich in die Lage des Mannes vor dem Spiegel. Welche Gedanken und Gefühle
bewegen Sie, wenn Sie Ihr Spiegelbild aus der Perspektive des Betrachters wahrnehmen?
Verfassen Sie einen inneren Monolog.M 2: Identität – einen Begriff definieren
Die Frage danach, was die eigene Identität ausmacht, ist so alt wie die Menschheit selbst. Es
gehört zur Conditio humana, zu den Grundbedingungen des Menschseins, sich selbst zu definieren
und im Einklang mit sich und seinem Umfeld zu sein.
Der Begriff „Identität“ leitet sich ab vom Lateinischen īdem
„derselbe“, ĭdem „dasselbe“. Er bezeichnet die
Übereinstimmung mit dem, was man ist oder als was man
bezeichnet wird. Auf sozialer Ebene bedeutet dies, so zu
sein, wie man von anderen gesehen wird, und sich auch
selbst so wahrzunehmen. Identitätsbildung findet sowohl
äußerlich als auch innerlich statt.
© Thinkstock/iStock.
1. Äußere Identitätszuweisung orientiert sich meist an
festgelegten Rollen. Diese basieren auf äußeren
Merkmalen wie z. B. Geschlecht, Hautfarbe, Religion,
Kleidung, Verhalten oder Aussehen. Aufgrund von
Klischees kann es zu positiven oder negativen
Zuordnungen kommen.
2. Die innere Identitätsbildung findet im Abgleich mit unseren Interessen und Wünschen statt.
Hierbei orientieren wir uns zwar auch an der Außenwelt, bewerten diese aber. Wir übernehmen
Einstellungen und/oder Verhaltensweisen von Vorbildern oder Freunden. Zugleich grenzen wir
uns auch ab, beispielsweise von unseren Eltern. So entwickeln wir allmählich eine Vorstellung
von uns selbst.
Identitätsfindung ist ein fortdauernder Prozess. Je nach Situation und Beeinflussung aus dem
Umfeld kommen mal die einen, mal die anderen Teile der Identität zum Vorschein. Identitätsfindung
ist ein Akt sozialer Konstruktion. Immer geht es um die Herstellung einer Passung zwischen dem
inneren Erleben einer Person und der äußeren Wahrnehmung durch andere. Die Notwendigkeit
einer gelungenen Identitätskonstruktion speist sich aus dem menschlichen Grundbedürfnis nach
Anerkennung vor sich selbst und von seinem sozialen Umfeld. Insofern stellt sie häufig eine
Kompromissbildung zwischen Eigensinn und Anpassung dar.
Aufgaben
1. Lesen Sie den Text. Arbeiten Sie die darin genannten Prozesse der Identitätsbildung heraus.
Benennen Sie im Zuge dessen dafür entscheidende Faktoren.
2. Formulieren Sie Beispiele für positive und negative Zuschreibungen bestimmter Gruppen bzw.
bestimmter äußerer Merkmale und Verhaltensweisen.
Beispiele für positive Zuschreibungen Beispiele für negative Zuschreibungen
– –
– –
– –
– –M 3: Wer macht mich zu dem, der ich bin?
Sehen mich die anderen, wie ich bin? Oder erscheine ich in ihren Augen als jemand, der ich nicht
sein will? Wer macht mich zu dem, der ich bin? Und wie entkomme ich der Fremdbestimmung
durch andere? Betrachten Sie die nachfolgenden Bilder. Formulieren Sie jeweils einen passenden
Titel.
Mein Titel: ________________________________________________
Mein Titel: ______________________________________________________ © Thinkstock/iStock.
Aufgaben
1. Was denkt/fühlt der blaugraue Pinguin?
2. Was denken/sagen die anderen Pinguine, die neben ihm stehen?
3. Was denkt/fühlt die Marionette?
4. Formulieren Sie für jedes Bild einen Titel.M 4: Das bin ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht!
Laura hat das Abitur in der Tasche. Endlich ist sie frei, zu tun und zu lassen, was sie will – so
dachte sie jedenfalls. Aber ganz frei ist man wohl nie, oder?
Laura ist 18 und mit der Schule fertig. Sie will das Gymnasium verlassen und
– wie ihre beste Freundin – eine Lehre anfangen. Nie mehr lernen, endlich frei
sein. Heute Abend finden die Entlassungsfeier und der Abschlussball statt.
Zwei Ereignisse, auf die sie sich seit Monaten freut. Nun steht sie vor dem
Kleiderschrank und überlegt, was sie anziehen soll.
Eigentlich wollte sie – wie ihr modisches Vorbild Avril Lavigne – ein schwarzes,
ein wenig zerrissenes Shirt, eine Karoleggins und Chucks anziehen. Sie hatte
sich mit ihren Freundinnen abgesprochen. Diese hatten die Idee, „den lahmen
Haufen mal ein wenig aufzumischen“.
Allerdings steht auf der Einladung: „Um
Abendgarderobe wird gebeten!“ Auch ihr Freund Tim erwartet sie im
langen Kleid. Er selbst und alle anderen Freunde kommen im
Anzug. Sie freuen sich schon darauf, endlich mal in schicken
Klamotten auszugehen. Zigarren inklusive.
© Thinkstock/iStock.
Als sie Shirt und Leggings vor dem Spiegel anprobiert, kommt ihre Mutter
rein. „Das kann doch nicht dein Ernst sein? Was sollen die Lehrer denn
von dir denken? Und Oma und Opa? Die fallen doch vor Schreck tot um“,
sagt sie.
Und jetzt?
Aufgaben:
1. Wer hat Erwartungen an das Ich?
2. Welche Eigenschaften muss eine Person aufweisen, um mit dem Rollendruck
umzugehen?
3. Wofür sollte Laura sich Ihrer Meinung nach entscheiden?
M 5: Immanuel Kant: Das Bewusstsein von mir selbst
Immanuel Kant (1724–1804) unterteilt das Selbst in ein materielles Ich, dem der Mensch als Objekt
entspricht, und ein geistiges Ich, das seine eigenen Gedanken, Gefühle und seine Situation
reflektieren kann.
Ich bin mir meiner selbst bewusst, ist ein Gedanke, der schon ein zweifaches Ich enthält, das Ich
als Subjekt, und das Ich als Objekt. Wie es möglich sei, dass ich, der ich denke, mir selbst ein
Gegenstand (der Anschauung) sein, und so mich von mir selbst unterscheiden könne, ist
schlechterdings unmöglich zu erklären, obwohl es ein unbezweifeltes Faktum ist. [...] Es wird
dadurch aber nicht eine doppelte Persönlichkeit gemeint, sondern nur Ich, der ich denke und
anschaue, ist die Person, das Ich aber des Objektes, was von mir angeschaut wird, ist, gleich
anderen Gegenständen außer mir, die Sache.
Text: Immanuel Kant: Theorie-Werkausgabe. Band VI: Schriften zur Metaphysik und Logik. Hrsg. von Wilhelm Weischedel.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1968. S. 60.
Aufgabe:
Wie thematisiert Kant die Doppelrolle des IVorschlag für ein mögliches Tafelbild?M 6: Schaubild Aufgabe: Erläutere, wie die die unterschiedlichen Personen und Instanzen Druck auf dein Ich ausüben.
M 7a: Gustav Klimt: Der Kuss Was mögen die beiden im Bild sich zu sagen haben? Was beschäftigt sie in diesem Moment? Betrachten Sie das Bild und fassen Sie Ihre Gedanken in Form eines fiktiven Dialoges zusammen. Der Kuss von Gustav Klimt, (1907/1908). Aufgabe: Betrachten Sie das Bild. Verfassen Sie anschließend einen möglichen Dialog zwischen den beiden Liebenden.
M 7: Max Frisch: Gespräch zwischen Andri und Barblin
Das Drama Andorra von Max Frisch (1911–1991) erzählt von dem jungen Mann Andri, der von
seinem Vater unehelich mit einer Ausländerin gezeugt wurde und deshalb als dessen jüdischer
Pflegesohn ausgegeben wird. Die Andorraner begegnen ihm daraufhin mit den typischen Vorurteilen,
die sie Juden gegenüber haben. Andri beginnt, diese allmählich auf sich selbst zu übertragen.
Zweites Bild
Andri und Barblin auf der Schwelle vor der Kammer der Barblin.
Barblin: Andri, schläfst du?
Andri: Nein.
Barblin: Warum gibst du mir keinen Kuss?
5 Andri: Ich bin wach, Barblin, ich denke.
Barblin: Die ganze Nacht?
Andri: Ob’s wahr ist, was die andern sagen.
Barblin hat auf seinen Knien gelegen, jetzt richtet sie sich auf, sitzt und löst ihre Haare.
Andri: Findest du, sie haben Recht?
10 Barblin beschäftigt sich mit ihrem Haar.
Vielleicht haben sie recht ...
Barblin: Du hast mich ganz zerzaust.
Andri: Meinesgleichen, sagen sie, hat kein Gemüt.
Barblin: Wer sagt das?
15 Andri: Manche.
Barblin: Jetzt schau dir meine Bluse an!
Andri: Alle.
Barblin: Soll ich sie ausziehen?
Barblin zieht ihre Bluse aus.
20 Andri: Meinesgleichen, sagen sie, ist geil, aber ohne Gemüt, weißt du –
Barblin: Andri, du denkst zu viel!
Barblin legt sich wieder auf seine Knie.
Andri: Ich lieb dein Haar, dein rotes Haar, dein leichtes warmes bitteres Haar, Barblin, ich
werde sterben, wenn ich es verliere.
25 Andri küsst ihr Haar. [...]
Barblin: Küss mich!
Andri: Ich muss ja dankbar sein!
Barblin: Ich weiß nicht, wovon du redest.
Andri: Von deinem Vater. Er hat mich gerettet, er fände es sehr undankbar von mir, wenn ich
30 seine Tochter verführte. Ich lache, aber es ist nicht zum Lachen, wenn man den
Menschen immerfort dankbar sein muss, dass man lebt.
Pause
Vielleicht bin ich drum nicht lustig.
Barblin küsst ihn.
35 Bist du ganz sicher, Barblin, dass du mich willst?
Barblin: Warum fragst du das immer?
Andri: Die andern sind lustiger.
Barblin: Die andern!
Andri: Vielleicht haben sie Recht. Vielleicht bin ich feig, sonst würde ich endlich zu deinem
40 Alten gehen und sagen, dass wir verlobt sind. Findest du mich feig? [...]Barblin: Ich geh nicht mehr aus dem Haus, damit sie mich in Ruh lassen. Ich denke an dich,
Andri, den ganzen Tag, wenn du an der Arbeit bist, und jetzt bist du da, und wir sind
allein – ich will, dass du an mich denkst, Andri, nicht an die andern. Hörst du? Nur an
mich und uns. Und ich will, dass du stolz bist, Andri, fröhlich und stolz, weil ich dich liebe
45 vor den andern.
Andri: Ich habe Angst, wenn ich stolz bin.
Barblin: Und jetzt will ich einen Kuss.
Andri gibt ihr einen Kuss.
Viele, viele Küsse!
50 Andri denkt.
Ich denke nicht an die andern, Andri, wenn du mich hältst mit deinen Armen und mich
küssest, glaub mir, ich denke nicht an sie.
Andri: – aber ich.
Barblin: Du mit deinen andern die ganze Zeit.
55 Andri: Sie haben mir wieder das Bein gestellt.
Eine Turmuhr schlägt.
Ich weiß nicht, wieso ich anders bin als alle. Sag es mir. Wieso? Ich seh’s nicht ... [...]
Barblin: Lass uns schlafen.
Text: Max Frisch: Andorra. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
© Foto: Barbara Braun: Szene aus „Andorra“ von Max Frisch. Inszenierung des Berliner Ensembles von Claus Peymann. Zu sehen sind Judith
Strößenreuter und Felix Tittel.
Aufgaben:
1. Vergleichen Sie das Gespräch zwischen Andri und Barblin mit Ihrem Gespräch zum
vorhergehenden Bild (Gustav Klimt). Benennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
2. Begründen Sie die unterschiedlichen Gesprächsverläufe.
3. Benennen Sie die Wünsche Andris und Barblins an den jeweils anderen.M 8: Das Tier in mir Der Mensch – vernunftbegabt oder triebgesteuert? Betrachten Sie das nachfolgende Bild. Aufgaben: 1. Beschreiben Sie das Bild . 2. Vermuten Sie, welches Menschenbild in diesem Bild dargestellt werden soll.
M 9: Sigmund Freud: Die psychische Struktur des Menschen
Sigmund Freud (1856–1939), der Begründer der Psychoanalyse, gilt als einer der einflussreichsten
Theoretiker des 20. Jahrhunderts. Er entwickelte ein Modell von einer dreiteiligen psychischen
Struktur des Menschen, gemäß dem die sogenannten Instanzen (Über-Ich, Ich, Es) auf das
Verhalten des Menschen Einfluss nehmen.
Zur Kenntnis dieses psychischen Apparates sind wir durch das
Studium der individuellen Entwicklung des menschlichen Wesens
gekommen. Die älteste dieser psychischen Instanzen nennen wir
das ES; sein Inhalt ist alles, was ererbt, bei Geburt mitgebracht,
5 konstitutionell festgelegt ist, vor allem also die aus der
Körperorganisation stammenden Triebe. [...]
Unter dem Einfluss der uns umgebenden realen Außenwelt hat ein
Teil des ES eine besondere Entwicklung erfahren, die von nun an
zwischen ES und Außenwelt vermittelt. Diesen Bezirk des
10 Seelenlebens nennen wir das ICH. [...] Es hat die Aufgabe der
Bild: Max Halberstadt.
Selbstbehauptung, erfüllt sie, indem es nach außen die Reize
kennenlernt, Erfahrung über sie aufspeichert (im Gedächtnis),
überstarke Reize vermeidet (durch Flucht), mäßigen Reizen
begegnet (durch Anpassung) und endlich lernt, die Außenwelt in
15 zweckmäßiger Weise zu seinem Vorteil zu verändern (Aktivität);
nach innen gegen das ES, indem es die Herrschaft über die
Triebansprüche gewinnt, entscheidet, ob sie zur Befriedigung Siegmund Freud – Begründer der
zugelassen werden sollen, diese Befriedigung auf die in der Psychoanalyse
Außenwelt günstigen Zeiten und Umstände verschiebt oder ihre
20 Erregungen überhaupt unterdrückt. [...]
Als Niederschlag der langen Kindheitsperiode, während der der werdende Mensch in Abhängigkeit
von seinen Eltern lebt, bildet sich in seinem ICH eine besondere Instanz heraus, in der sich dieser
elterliche Einfluss fortsetzt. Sie hat den Namen des ÜBER-ICHs erhalten. Insoweit dieses ÜBER-
ICH sich vom ICH sondert und sich ihm entgegenstellt, ist es eine dritte Macht, der das ICH
25 Rechnung tragen muss.
Eine Handlung des ICHs ist dann korrekt, wenn sie gleichzeitig den Anforderungen des ES, des
ÜBER-ICHs und der Realität (Außenwelt) genügt, also die Ansprüche miteinander zu versöhnen
weiß. Die Einzelheiten der Beziehung zwischen ICH und ÜBER-ICH werden durchwegs aus der
Zurückführung des Verhältnisses des Kindes zu seinen Eltern verständlich. Im Elterneinfluss wirkt
30 natürlich nicht nur das persönliche Wesen der Eltern, sondern auch der durch sie fortgeführte
Einfluss von Familien-, Rassen- und Volkstraditionen sowie die von ihnen vertretenen
Anforderungen des jeweiligen sozialen Milieus. Ebenso nimmt das ÜBER-ICH im Laufe seiner
individuellen Entwicklung Beiträge späterer Fortsetzer und Ersatzpersonen der Eltern auf, wie
Erzieher, öffentliche Vorbilder, in der Gesellschaft verehrter Ideale.
35 Man sieht, dass ES und ÜBER-ICH bei all ihrer fundamentalen Verschiedenheit die eine
Übereinstimmung zeigen, dass sie die Einflüsse der Vergangenheit repräsentieren, das ES den
der ererbten, das ÜBER-ICH im Wesentlichen den der von anderen übernommenen, während das
ICH hauptsächlich durch das selbst Erlebte und Aktuelle bestimmt wird.
Text: Sigmund Freud: Abriss der Psychoanalyse. In: Gesammelte Werke. Band 17: Schriften aus dem Nachlass 1892–1939.
Hrsg. von Anna Freud. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1993. S. 67 ff.
Aufgaben:
1. Gestalten Sie ein Schaubild, das Freuds Seelenmodell veranschaulicht.
2. Erklären Sie die Funktionen der einzelnen Instanzen (auch anhand eigener Beispiele).Abschließende Aufgabe: Nehmen Sie zu folgender Aussage begründet Stellung: Identität ist das Ergebnis aus dem Zusammenspiel unserer unbewussten Triebe und der Erwartungen der Eltern!
Sie können auch lesen