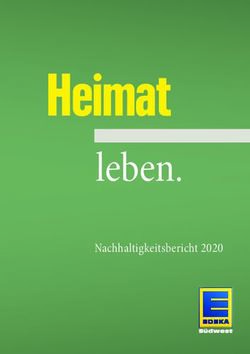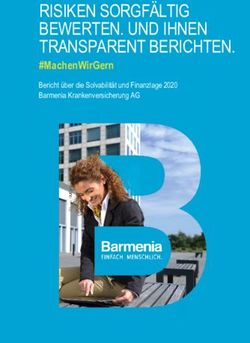EU SAMMELKLAGE UND UMWELTRECHT - JKU ePUB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Eingereicht von
Patrick Kornfeind
Institut für Umweltrecht
Beurteilerin
Univ. Prof.in Dr.in Erika Wagner
Linz, Oktober 2021
_____________________
EU SAMMELKLAGE
UND UMWELTRECHT
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Magister der Rechtswissenschaften
im Diplomstudium
Rechtswissenschaften
JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Österreich
jku.atEIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG
Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde
Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich
oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.
Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.
Linz, 6.10.2021
Unterschrift:
1Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ................................................................................................................... 4
2. Gerichtsbarkeit........................................................................................................... 5
2.1. Abgrenzung ÖR und ZR ...................................................................................... 5
2.2. Verfassungsrechtliche Garantien ......................................................................... 5
2.3. Verfahrensarten ................................................................................................... 6
2.4. Ordentliche Gerichte ......................................Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.5. Sachliche Zuständigkeit .................................Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.6. örtliche Zuständigkeit .....................................Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.7. Parteien und Verfahrensbegriffe .......................................................................... 6
2.8. Verbandsklage nach aktuellem Recht ................................................................. 7
2.9. Verbandsklageverfahren VKI gegen AWD ........................................................... 9
2.10. VW Abgas-manipulations-Skandal .................................................................... 11
2.11. Musterfeststellungsklage ................................................................................... 12
2.12. Ende der VW Saga in Österreich ....................................................................... 13
2.13. Erkenntnisse aus der VW Causa ....................................................................... 14
3. Die neue Sammelklage der EU ................................................................................ 15
3.1. RL als Grundbaustein schafft notwendige Basis ............................................... 15
3.2. Eckpfeiler und wesentliche Standards ............................................................... 16
3.3. Europäischer Verbraucherschutz wird ausgedehnt oder erst geschaffen .......... 17
4. Rechtsbehelfe bringen große Neuerung .................................................................. 18
4.1. opt in / opt out .................................................................................................... 19
4.2. Spezifisches zum Verfahren .............................................................................. 20
4.3. Grenzüberschreitende Verbandsklagen ............................................................ 21
4.4. Resümee ........................................................................................................... 22
5. Täuschungen zu Lasten der Umwelt und menschlichen Gesundheit ...................... 25
5.1. NGO Foodwatch ................................................................................................ 25
5.2. Täuschung im VW Abgas-manipulations-Skandal ............................................. 29
5.3. Aus Fehlern der Vergangenheit lernen und eine einheitliche Basis schaffen .... 31
6. Neue EU Sammelklage in der Praxis ....................................................................... 33
6.1. VKI klagt nach neuer Sammelklage ................................................................... 33
6.2. Umweltschutzorganisation klagt VW.................................................................. 34
7. Die Sammelklage im Kampf gegen den Klimawandel ............................................. 36
7.1. Der Klimawandel ist seit Jahren Realität ........................................................... 36
7.2. Prognosen für Österreich laut Greenpeace-Report ........................................... 37
27.3. Folgen des Klimawandels in Österreich............................................................. 38
7.4. Bringt „climate emergency“ Abhilfe? .................................................................. 39
7.5. Österreich hinkt seit Jahren hinterher ................................................................ 40
7.6. Was kann der einzelne Bürger tun, um zu einer besseren Umwelt zu gelangen? .. 40
7.7. Gemeinsam klagen für eine besser Zukunft ...................................................... 42
7.8. Klimaklagen nehmen weltweit zu ....................................................................... 43
7.9. Klimaklage in Deutschland ................................................................................ 43
7.10. Klimaklage in den Niederlanden ........................................................................ 45
7.11. Klimaklage österreichischer Prägung ................................................................ 46
7.12. Chance auf echte Klimaklage in Österreich ....................................................... 47
7.13. Klimaschutz als Grundrecht einklagen ............................................................... 51
7.14. Resümee zum Klimaschutz ............................................................................... 54
31. Einleitung
Im Jahr 2018 hat die EU-Kommission den Entwurf einer Richtlinie lautend „New Deal For
Consumers“ vorgestellt. Mit dieser RL möchte die Union eine Verbandsklage zum Schutz der
Kollektivinteressen von Verbrauchern auf europäischer Ebene einführen. Da es auf Grund
voranschreitender wirtschaftlicher Globalisierung und Digitalisierung immer öfter zu Verstößen
des Unionsrechts kommt, sollen mit der Verbandsklage die Kollektivinteressen von Verbrauchern
besser geschützt werden. Der grenzüberschreitende Handel nimmt stetig zu, dadurch sind bei
Unternehmensverstößen oftmals Verbraucher aus mehreren Mitgliedsstaaten betroffen.
Europaparlament und Mitgliedstaaten haben sich im Sommer 2020 auf die Richtlinie geeinigt und
möchten mit dieser die kollektiven Interessen der Verbraucher in Europa einheitlich stärken. Sie
erinnert zum Teil an die deutsche Musterfeststellungsklage, welche ihren Ursprung im VW-Abgas-
Skandal fand. Die österreichische Rechtsordnung kannte bis dato nur die Sammelklage
österreichischer Prägung, welcher der VKI eigens für das Zivilverfahren gegen AWD ins Leben rief.
In den letzten 2 Jahren sorgen NGO´s als Verbandskläger vermehrt durch Klimaklagen gegen den
Klimawandel für Aufsehen. Zuletzt brachte Greenpeace 2019 mehrere Klimaklagen bennant als
Sammelklagen vor den VfGH ein und sorgte in Österreich für eine Premiere. Auch der im selben
Jahr in Österreich beschlossene „climate mergency“ soll endlich den lange geforderten Schutz der
österreichischen Umwelt erbringen.
Aber was sieht die RL im Detail vor, wo liegt der Unterschied zur aktuellen Sammelklage, wie ist
die Klagebefugnis nach der Aktuellen Rechtslage, weshalb brachte der VW Skandal die
Musterfeststellungsklage hervor, wieso bringen NGO´s vermehrt Klimaklagen ein und was ist eine
Klimaklage überhaupt? Diese Themen möchte ich auf den folgenden Seiten näher erörtern.
42. Gerichtsbarkeit
2.1. Abgrenzung ÖR und ZR
Zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der österreichischen Gerichtsbarkeit. Alle Studenten und
Absolventen kennen das Prüfungsfach Zivilprozessordnung (ZPO), gelehrt wird dort das
Zivilgerichtsverfahren (ZGV) einschließlich der dortigen Rechtsmittel. Im öffentlichen Recht
entscheiden in zweiter Instanz nach den Verwaltungsbehörden die Verwaltungsgerichte. Eine
Sammelklage vor einem Verwaltungsgericht kennt die österreichischen Rechtsordnung bis dato
nicht, die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird näher unter 8.11. erörtert. Umweltrechtliche
Bestimmungen findet man sowohl im öffentlichen Recht als auch im Zivilrecht. Nach den
bekannten Abgrenzungstheorien wie die Interessenstheorie, Subjektionstheorie und
Subjektstheorie kann ein Sachverhalt aber sowohl im öffentlichen Interesse als auch im privaten
Interesse liegen.
2.2. Verfassungsrechtliche Garantien
Die Zivilgerichtsbarkeit findet ihren Ursprung in der österreichischen Bundesverfassung. Die
österreichischen Gerichte und deren Richter dürfen natürlich nicht nach dem Zufallsprinzip oder
gar nach Willkür über eine beliebige Angelegenheit entscheiden. Jeder Mensch hat ein Recht auf
einen gesetzlichen Richter. Es handelt sich dabei um ein Grundrecht1, welches in der
Bundesverfassung unter Art 83 Abs 2 und 87 Abs 3 B-VG als verfassungsrechtlich garantierte
Rechte zu finden sind.
Auch die unmittelbar im Verfassungsrang stehende EMRK garantiert2 in Art. 6 Abs 1 einen
gesetzlichen Richter sowie ein faires Verfahren durch rechtliches Gehör und eine angemessene
Verfahrensdauer. Der Anwendungsbereich bezieht sich auf civil rights. Weitere
verfassungsrechtliche Garantien3 wären die Weisungsfreiheit, Unabsetzbarkeit sowie
Unversetzbarkeit eines Richters nach Art 87 und 88 B-VG. Die Mündlichkeit und Öffentlichkeit des
Verfahrens ist in Art 90 B-VG garantiert und Art 91 B-VG regelt die Volksmitwirkung in Form von
Laienrichter.
1 Kodek/Mayr, Zivilprozessrecht5 (2021), Rz 42.
2 Kodek/Mayr, Zivilprozessrecht5 (2021), Rz 49.
3 Kodek/Mayr, Zivilprozessrecht5 (2021), Rz 40.
52.3. Verfahrensarten vor den Zivilgerichten
Folgende Gesetze regeln die unterschiedlichen Verfahren: Für streitige Angelegenheiten ist die
ZPO zuständig und außerstreitige Angelegenheiten werden im Außerstreitgesetz geregelt. Die
Gerichtsbesetzung wird vom Gerichtsorganisationsgesetz (GOG) geregelt und die Zuständigkeiten
fallen in die Jurisdiktionsnorm (JN).
Das streitige Erkenntnisverfahren ist der Regelfall, wird mit Klage eingeleitet und in den meisten
Fällen mit Urteil beendet, aber auch ein Beschluß, sowie ein Vergleich und auch eine
Klagerücknahme sind möglich.
Außerstreitige Verfahren haben entgegen dem Wortlaut sehr wohl einen streitigen Charakter,
größter Anwendungsbereich sind familienrechtliche Angelegenheiten, also Obsorge und
Unterhaltsstreitigkeiten. Auch sind Grundbuch und Firmenbuchangelegenheiten im Verfahren
außer Streit zu behandeln.
2.4. Parteien und Verfahrensbegriffe
Die Parteien im streitigen Verfahren heißen Kläger30 und Beklagter4, gibt es auf einer Seite
mehrere Personen so werden diese als Streitgenossen5 bezeichnet. Auch kennt die ZPO
Nebenparteien wie Zeugen, Sachverständige oder Dolmetscher.
Alle natürlichen sowie juristische Personen können Parteien in einem Verfahren sein und sind
somit parteifähig6. Gerade im Prozessrecht gibt es unterschiedliche Voraussetzungen an diversen
Fähigkeiten. Von der Parteifähigkeit ist die Prozessfähigkeit7 zu unterscheiden, mit dieser können
entweder eigenständig oder durch einen selbst gewählten Vertreter Prozesshandlungen33
vorgenommen werden.
Prozesshandlungen können etwa ein zu stellender Antrag sein, aber auch ein Rechtsmittel fällt
darunter. Nicht alle natürlichen Personen sind prozessfähig. Diese wird oft als das prozessuale
Gegenstück zur Handlungsfähigkeit bezeichnet oder auch als prozessuale Handlungsfähigkeit.
Nach der ZPO ist jemand prozessfähig, wenn er nach bürgerlichen Recht verpflichtungsfähig ist,
somit voll geschäftsfähige Personen und alle mündige Minderjährige. Diesen Personen steht es
auch zu, in eigener Person rechtswirksame Prozesshandlungen vorzunehmen und somit ihre
Postulationsfähigkeit auszuüben. Dies gilt allerdings nicht bei Rechtsanwaltszwang. In diesem Fall
4 Kodek/Mayr, Zivilprozessrecht5 (2021), Rz 292.
5 Kodek/Mayr, Zivilprozessrecht5 (2021), Rz 322.
6 Kodek/Mayr, Zivilprozessrecht5 (2021), Rz 304.
7 Kodek/Mayr, Zivilprozessrecht5 (2021), Rz 307.
6darf nur der anwaltliche Vertreter Prozesshandlungen vornehmen. Aus dem Zivilrecht ist bestens
bekannt, das juristische Personen selbst nicht handlungsfähig sind und nur durch ihre Organe tätig
werden können, ebenso ist es mit der Prozesshandlung. Ein weiterer prozessualer Begriff wäre
die Prozessstandschaft8. Die Prozessstandschaft darf unter keinen Umständen mit der
Verbandsklage verwechselt werden.
Bei einer Prozessstandschaft prozessiert jemand in eigenem Namen über ein fremdes Recht.
Wichtig dabei ist, dass der Prozessstandschaftler selbst Prozesspartei ist und nicht bloß ein
Vertreter wie ein Rechtsanwalt. Gerade kennzeichnungstypisch für die Prozessstandschaft ist das
auseinanderfallen der Prozessführungsbefugniss von der Sachlegitimation. In Österreich ist eine
erwählte, ausgesuchte oder auch gewillkürte Prozessstandschaft verboten. Das Recht zur Klage
ist also streng mit dem materiell-rechtlichen Anspruch gebunden.
Ausnahmen gibt es aber bei Abtretung eines Anspruchs. Hier wird der Anspruch einer Forderung
des Gläubigers direkt an den neuen Gläubiger abgetreten z.B. die Inkassozession.
Weitere Ausnahmen sieht das Gesetz in einigen Fällen vor, z.B. nach § 84 Abs 5 AktG, hier dürfen
Gläubiger Ersatzansprüche der Gesellschaft gegen die Vorstandsmitglieder geltend machen.
Solche Ausnahmen sind selten und in der österreichischen Rechtsordnung kaum zu finden.
2.5. Verbandsklage nach aktuellem Recht
Die Verbandsklage9 ist aktuell, also noch vor Umsetzung der EU Richtline nur in wenigen
Sondergesetzen geregelt, die wichtigsten Bestimmungen wären § 14 UWG und § 28 bis § 30
KSchG.
Wie oben erwähnt ist die Verbandsklage unter keinen Umständen mit der Prozessstandschaft zu
verwechseln, sie ist nämlich gerade kein Unterfall von dieser. Nur jene soeben genannten
Bestimmungen erlauben es explizit, einen im öffentlichen Interesse stehenden Verband (das
können Körperschaften und oftmals auch ein Verein sein) fremde Rechte geltend zu machen. Bei
dem Recht handelt es sich nicht um die Verletzung eigener Rechte, sondern um Rechte, welche
die Allgemeinheit betreffen. So können Verbände nach § 14 UWG dem unlauteren Verhalten von
Unternehmen entgegentreten. Generell ist das Verfahren einer Verbandsklage im UWG
weitgehend geregelt. Auch der § 30 KSchG verweist auf einzelne Bestimmungen des UWG, sodaß
diese Verfahrensbestimmungen im Konsumentenschutz sinngemäß anzuwenden sind.
Für den einzelnen Bürger gerade in der Praxis sehr beliebt und relevant, der
8 Kodek/Mayr, Zivilprozessrecht5 (2021), Rz 296-299.
9 Kodek/Mayr, Zivilprozessrecht5 (2021), Rz 509.
7Unterlassungsanspruch nach § 28 KSchG, welcher 2013 um § 28a erweitert wurde.
So bestimmt der Abs 1 des § 28 KSchG, „wer in geschäftlichen Verkehr allgemeine
Geschäftsbedingungen gegenüber den Verbraucher verwendet, welche gegen ein gesetzliches
Verbot, gegen die guten Sitten verstoßen oder solche Bedingungen für den geschäftlichen
Verkehr empfiehlt, kann auf Unterlassung geklagt werden“.
In § 28a Abs 1 KSchG listet einige Tatbestände auf, zu erwähnen wären Verbrauchergeschäfte
wie Haustürgeschäfte; außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge, der
Verbraucherkredit, Abschlüsse mittels Fernabsatz, Dienstleistung der Vermögensverwaltung,
wenn der Unternehmer gegen Gebote und Verbote auf Grund der Richtlinie 2006/123 EG10 bei
der Erbringung von Dienstleistungen im Binnenmarkt verstößt, Informationspflichten verletzt
und dadurch jeweils die allgemeinen Interessen der Verbraucher beeinträchtigt.
Wie man erkennen kann handelt es sich um Verbraucherschutzbestimmungen, welche durch die
voranschreitende Digitalisierung notwendig wurden und durch Umsetzungen verschiedener EU
RL in den noch jungen Sondergesetzen wie FAGG, FernFinG, HIKrG, VKrG ihre Regelung fanden.
§ 29 abs 1 KSchG zählt die Wirtschaftskammer Österreich, die Bundesarbeiterkammer, der
österreichische Landarbeiterkammertag, die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammer
Österreichs, den Österreichischen Gewerkschaftsbund, den Verein für Konsumenteninformation
kurz VKI und den Österreichischen Seniorenrat als Berechtigte auf. Die soeben aufgezählten
Einrichtungen können eine Klage auf Unterlassung bei Gericht einbringen. Nur eine
Unterlassungsklage ist möglich, da der Verstoß schon gegeben sein muß und auch eine
Wiederholungsgefahr besteht.
Vorrangiges Ziel der Verbandsklage ist es die Verwendung von, sowie die Berufung auf, als auch
die Empfehlung unlauterer Vertragsklauseln schon möglichst im vorhinein zu verhindern. Somit
sind Urteile für den beklagten Unternehmer einerseits Sanktion und andererseits für potentielle
Anwender ähnlicher Vertragsklausel mit einer präventiv Funktion behaftet und sollen somit eine
abschreckende Wirkung nach sich ziehen.
Nach § 30 Abs 1 KSchG iVm § 25 Abs 3 UWG hat nämlich das Gericht bei berechtigten Interesse
und auf Antrag der obsiegenden Partei das Urteil innerhalb einer bestimmten Frist auf Kosten des
Gegners zu veröffentlichen. Gerade die Urteilsveröffentlichung dient dem Schutz des
Konsumenten über die Gesetz- und Sittenwidrigkeit bestimmter Geschäftsbedingungen und
10 Richtlinie 2006/123/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über die
Dienstleistungen im Binnenmarkt.
8Geschäftspraktiken informiert zu werden. Auch ist es möglich zeitgleich mit der Klage auf
Unterlassung eine einstweilige Verfügung zu beantragen.
Seit der Jahrtausendwende besteht für den einzelnen Verbraucher die Möglichkeit seine
Ansprüche an den Verein für Konsumentenschutz abzutreten. Im Jahr 2004 kam es mit der
Einführung des § 501 ZPO zu einer neuen Regelung. Mit der Verbands-Muster-Klage11 wollte der
österreichische Gesetzgeber den immer lauter werdenden Ruf nach Prozessführung von
Musterprozessen41 fördern. Das größte Problem war, dass die meisten
Verbraucherrechtstreitigkeiten einen zu geringen Streitwert hatten, um letztendlich im
Rechtsmittelverfahren vor dem OGH zu gelangen. Die Folge war eine unterschiedliche
Rechtsprechung von den unterschiedlichen Gerichten über ähnliche Vertragsklauseln. Wenn nun
der VKI oder ein anderer in § 29 KSchG genannter Verband mehrere abgetretene Ansprüche nach
§ 502 Abs 5 Z 5 ZPO geltend macht, kann dieser mit den verbundenen Streitwerten mit einer
Revision an den OGH gelangen. Die Verbands-Muster-Klage wurde nach Prüfung auch vom VfGH
als verfassungskonform anerkant12. Die Weiterentwicklung der Verbands-Muster-Klage durch
den VKI nennt sich Sammelklage. Namensgetreu sammelt der VKI Gestaltungsrechte wie etwa
die Preisminderung und ebenso Ansprüche auf Schadenersatz von mehreren Verbrauchern gegen
ein und denselben Unternehmer. Diese sogenannte objektive Klagehäufung (siehe sogleich unter
2.9), bei der ein Kläger gegen einen Beklagten mehrere einzelne Ansprüche in einer Klage
gesammelt geltend macht, wurde vom OGH letztendlich als gesetzeskonform13 angesehen.
2.6. Verbandsklageverfahren VKI gegen AWD
Für das größte nationale Sammelklageverfahren sorgte der VKI bereits im Jahr 2009, indem er
eine Sammelklage gegen AWD beim Handels Gericht Wien14 einbrachte. AWD15 war in den 2000er
Jahren der größte Finanzdienstleister in Österreich. In den Beratungsgesprächen versprachen
dessen Finanzierungsberater transparente und risikoarme Veranlagungen. Das Unternehmen war
seinerzeit in aller Munde und überzeugte viele Verbraucher durch häufige Medienpräsenz. Als
Jahre später einige Verbraucher ihre Auszahlung begehrten, waren oftmals deren Gelder und
Finanzberater zum Großteil verschwunden. Einige Verbraucher klagten das Unternehmen direkt,
11
Deixler-Hübner/Meisinger, Sammelklage, (Stand 06.11.2020, Lexis Briefings in lexis360.at).
https://360.lexisnexis.at/d/lexisbriefings/sammelklage/h_80001_4915132519621747337_cb45890898
12 VfGH 15.12.1994, G 126/93, VfSlg 13.989/1994.
13 OGH 31.3.2005, 3 Ob 275/04v, RIS-Justiz RS0119940.
14 HG Wien 16.11.2009, 43 Cg 81/09y, ecolex 2010, 450.
HG Wien 14.9.2010, 47 Cg 77/10s, KRES 10/276.
15 Der Standard, unzählige Prozesse gegen AWD, 20. Mai 2005.
https://www.derstandard.at/story/2045632/unzaehlige-prozesse-gegen-awd
9andere wiederrum wollten sich der Gefahr der Prozesskosten nicht aussetzen und wendeten sich
an den VKI. Dieser ließ sich Schadenersatzforderungen von über 100 Verbrauchern per
Inkassozession abtreten. Der VKI klagte auf fast 2 Millionen Schadenersatz, begründet wurde dies
mit der Verletzung der Aufklärungspflichten durch Informationsmangel sowie Verletzung der
Sorgfaltspflichten, da das Veranlagungsrisiko verharmlost wurde. Neben dem Verfahren selbst,
sorgte auch die Bezeichnung „Sammelklage österreichischer Prägung16“ für viel Aufsehen und
läutete zugleich das größte Zivilverfahren in der österreichischen Geschichte ein. Die Klage wurde
auf § 227 ZPO gestützt, welcher eine objektive Klagehäufung voraussetzt. Das OLG Wien17 als
Rekursgericht traf eine reformierende Entscheidung und definierte die Anforderungen des § 227
ZPO für eine gemeinsame Anspruchsgeltendmachung. Vorausgesetzt ist ein
prozessökonomischer Vorteil, dieser ergibt sich aus einem gemeinsamen Beweisverfahren und
einer erhöhten Rechtssicherheit, welche eine einheitliche Beurteilung vergleichbarer
Sachverhalte verlangt. Die Wertzuständigkeitsgrenzen werden durch § 227 Abs 2 ZPO
ausnahmsweise durchbrochen, wobei Ansprüche, welche nach § 49 Abs 1 Z 1 JN eigentlich dem
Bezirksgericht sachlich zugeteilt sind, im konkreten Fall den Prozess führendem Gericht
zukommen.
Weiters stützte sich das OLG Wien auf § 45 JN, welcher besagt, dass nach Beginn der
Streitanhängigkeit die sachliche Zuständigkeit des Gerichts nicht mehr anfechtbar ist. Damit ist
die Zuständigkeit bei Zuständigerklärung des Erstgerichts in Stein gemeißelt. Nur wenn sich das
Gericht für unzuständig erklärt, ist eine Anfechtung der Entscheidung und eine Befassung der
höheren Instanz und letztendlich eine OGH18 Entscheidung möglich. Somit wurde die
„Sammelklage österreichischer Prägung“ erst durch den Finanzdienstleistungsskandal und der
folgenden Klageeinbringung seitens VKI möglich gemacht. Durch teleologische Interpretation des
§ 227 ZPO des OLG Wien und Bestätigung des OGH, wurde die Klage für rechtmäßig und tauglich
erklärt. Die Klage kann von allen in § 29 KSchG aufgezählten Rechtsträgern eingebracht werden.
Die in der österreichischen Gerichtsbarkeit erwähnte gewillkürte Prozessstandschaft wird in
Österreich nach wie vor abgelehnt. Auch sah das HG keinen Verstoß gegen das Quota-litis-
Verbot19 nach § 879 Abs 2 Z 2 ABGB, da ein Prozessfinanzierer eingeschaltet wurde.
16 Fucik/Konecny/Lovrek/Oberhammer, Zivilverfahrensrecht - Jahrbuch 2010, Österreichische Sammelklage
und § 227 ZPO, Seite 247.
17 OLG Wien 22.2.2010, 2 R 243/09h-18, JAP 2009/2010/26.
18 OGH 12.07.2005, 4 Ob 116/05w, SZ 8/206.
19 des Bundesverfassungsgericht
https://360.lexisnexis.at/d/artikel/slonina_hg_wien_vki_prozessfinanzierungsmodell_fur/z_zak_2012_8_Zak_
2012_08_322_d3886f9e0f
102.7. VW Abgas-manipulations-Skandal
Sucht man nach einer Sammelklage, welche auch den Umweltaspekt miteinbezieht, so führt der
Weg schnell zum deutschen VW Konzern. Der VW Abgas-manipulations-Skandal20 ist wohl jedem
bekannt, war er doch in den Medien in aller Munde. In Deutschland wurde die
Musterfeststellungsklage im Jahr 2018 im Zuge des VW-Diesel-Skandals eigens geschaffen. Eine
kurze Chronologie der Geschehnisse! Im Jahr 2015 warf die amerikanische Umweltbehörde
Enviromental Protection Agency (EPA)21 dem deutschen VW Konzern vor, den Schadstoffausstoß
der Konzernautos (VW, Audi, Skoda, Seat) am Prüfstand zu manipulieren. EPA konnte beweisen,
dass der NOx (Stickstoffoxid) Ausstoß im gewöhnlichen Straßengebrauch 40x höher ist. Die
Fahrzeugsoftware manipulierte den Ausstoß, in dem diese erkannte, wann ein Fahrzeug
behördlich getestet wurde. Bei NOx handelt es sich um ein lungenschädigendes giftiges Gas,
welches nicht mit dem CO2 (Treibhausgas) verwechselt werden darf. Weltweit gab es über 11
Millionen geschädigte Verbraucher, welche sich von VW betrogen fühlten, hatte man sich doch
oftmals aus persönlichen Umweltschutzinteressen für ein umweltschonendes Fahrzeug
entschieden. Am schnellsten einigte sich VW im Land der Sammelklagen, nämlich der USA und
zwar mit einer Zahlung von einer horrenden Summe über 25 Milliarden Euro mit
Anwaltskanzleien und staatlichen Behörden. Da das Schadenersatzrecht in den Staaten einen
Strafschadenersatz (punitive damages)22 möglich macht, sind diese Beträge keine Seltenheit. Nur
zu gut kennt man hohe Entschädigungssummen für beispielsweise eine verbrannte Zunge, nach
einem zu heiß übergebenen McDonald´s Kaffee23 oder für eine nachgewiese Krebserkrankung
durch ein Medikament eines Pharmaerzeugers24. Hinzuweisen sei aber darauf, dass der
Strafschaden jedoch nur bei außergewöhnlich grob schuldhaftem und vorsätzlichem Verhalten
zugesprochen werden kann. Da die Ausgangslage für den VW Konzern bei Betrugsnachweis schon
fest stand, war dieser darauf erpicht das US-Verfahren schnellstmöglich abzuschließen.
Währenddessen ziehen sich europäische Verfahren seit Jahren in die Länge, statt
Schadenersatzzahlungen wurden Kunden mit der Abhilfe eines Softwareupdates25 abgespeist. In
Deutschland bot der VW Konzern den konkreten Verbrauchern, welche kurz vor einem
20 CLLB Rechtsanwählte München – Berlin, https://www.diesel-abgasskandal.de/aktueller-stand/
21
https://https://www.epa.gov.
22 Welser/Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht Band II14 (2015), RZ 1335.
23 Der Standard, Heißer Kaffee verschüttet, erneut Klage in USA gegen Mcdonald´s, 21. Jänner 2014.
https://www.derstandard.at/story/1389857775948/heisser-kaffee-verschuettet-erneut-klage-in-usa-gegen-mcdonalds
24 Die Presse, Krebs durch Glyphosat-erster US Prozess gegen Monsanto, 19.6.2018.
https://www.diepresse.com/5449493/krebs-durch-glyphosat-erster-us-prozess-gegen-monsanto
25 Der Standard, VW sind laut Gericht trotz Software Updates mangelhaft, 27. November 2019.
https://www.derstandard.at/story/2000111598362/vw-sind-laut-gericht-trotz-software-updates-mangelhaft
11Instanzenzug an das BGH standen, eine hohe Vergleichssumme26 an. Auch in Österreich kam es
zu keiner Verfahrensdynamik, es dauerte Monate bis der VKI vom Bundesministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz die Erlaubnis einer Planung einer Sammelklage
gegen VW erteilte. Als besondere Erschwernis erwies sich die örtliche Zuständigkeit, ein
gemeinsamer Verbrauchergerichtsstand für die ca. 10.000 auf Österreich verteilten Verbraucher
war nicht möglich. Da sich der VKI auf den Gerichtsstand des Schadensorts stützte, mußten die
Klagen österreichweit bei allen 16 Landesgerichten27 eingebracht werden. Das LG Korneuburg
und Wiener Neustadt verneinten die internationale Zuständigkeit und wiesen die Klagen zurück28.
Das HG Wien und das LG Wels ließen einen Zwischenstreit29 über die Frage der internationalen
Zuständigkeit zu. Eine diesbezügliche Entscheidung dauert idR mehrere Monate, wenn nicht sogar
Jahre, die klagenden Verbraucher laufen zusätzlich Gefahr einer Verjährung bei einer möglichen
Zurückweisung der Klage durch die Gerichte. Allerdings beträgt die Verjährungsdauer in
Österreich bei sittenwidriger Täuschung 30 Jahre. Mehr dazu unter 2.9.
2.8. Musterfeststellungsklage
Deutschland war der Staat mit der höchsten Zahl an geschädigten Verbrauchern. Der Ruf nach
einem neuen Gesetz, welches den unzähligen Geschädigten einen durchsetzbaren Anspruch
verschaffen sollte wurde immer größer. Im Sommer 2018 erließ der deutsche Bundestag das
Gesetz zur Einführung einer zivilrechtlichen Musterfeststellungsklage30, welches am 1.11.2018 in
Kraft trat. Noch am selben Tag brachte der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) eine
Musterfeststellungsklage gegen den VW Konzern ein. Für eine kostenlose Beteiligung ohne
jegliches Risiko bedurfte es einer Anmeldung in das neue Klageregister des Bundesamts für Justiz.
Mit der Anmeldung trat Verjährungshemmung ein, auch österreichische Geschädigte konnten
somit am Verfahren teilnehmen. Im Februar 2020 wurde ein Vergleich31 zwischen den VZBV und
26 Wiener Zeitung, Dieselbetrug darf sich nicht lohnen, 5.12.2019.
https://www.wienerzeitung.at/themen/recht/recht/2041300-Dieselbetrug-darf-sich-nicht-lohnen.html
27 Der Standard, VKI bringt 16 Sammelklagen ein, 17.9.2018.
https://www.derstandard.at/story/2000087531807/vw-nicht-zu-vergleich-bereit-vki-bringt-16-sammelklagen-ein
28 VKI, VW-Sammelklagen: zwei Erstgerichte verneinen Zuständigkeit, 28.2.2019.
https://verbraucherrecht.at/vw-sammelklagen-zwei-erstgerichte-verneinenzustaendigkeit/
4145?cHash=X&id=49&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4328
29 Der Standard, Zuständigkeit heimischer Gerichte in VW Abgasskandal weiter offen, 26. 2. 2019.
https://www.derstandard.at/story/2000098646081/zustaendigkeit-heimischer-gerichte-in-vw-abgasskandal-
weiter-offen
30 Der Standard, Mammutprozess geben VW könnte zu Vergleichswelle führen, 1. 11 2018.
https://www.derstandard.at/story/2000090465779/deutsche-verbraucherzentralen-bringen-klage-gegen-vw-auf-den-
weg
31 Verbraucherzentrale, Vergleich zwischen vzbv und Volkswagen steht Klage zurückgenommen, 7.9.2020.
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/vergleich-zwischen-vzbv-und-
volkswagen-steht-klage-zurueckgenommen-29738
12VW vereinbart. Die Musterfeststellungsklage wurde zurückgenommen und das Verfahren war ab
da beendet. Die geschädigten Verbraucher, welche den Vergleich akzeptieren, haben einen
Anspruch auf durchschnittlich 15 % des Kaufpreises. Der VW Konzern rechnet insgesamt mit einer
Schadensumme von 830 Millionen Euro.
2.9. Ende der VW Saga in Österreich
Während Geschädigte aus Österreich zumindest mit der deutschen Sammelklage eine brauchbare
grenzüberschreitende Lösung geboten wurde, mußten VKI anhängende Kläger ebenfalls bis ins
Jahr 2020 auf eine positive Entscheidung warten. Das Landesgericht Klagenfurt32 war eines der 16
anhängigen Gerichte, dieses stellte dem EuGH im April 2019 die Vorabentscheidungsfrage
bezüglich der Zuständigkeit der österreichischen Gerichte. Da der Gerichtsstand an den Eintritt
des Schadensorts knüpft, war eine diesbezügliche konkrete Rechtsprechung des EuGH mit
Spannung erwartet worden.
Zur Festlegung des Schadenortes hätte es viele Interpretationsmöglichkeiten gegeben, am
Herstellungsort, also die Fahrzeugfabrik selbst, einige liegen außerhalb Deutschlands, sogar
außerhalb von Europa, fast immer werden Karosserie und Motor in unterschiedlichen Ländern
produziert. Die Intransparenz wäre enorm gewesen und hätte wieder zu unzähligen
Gerichtszuständigkeiten geführt. Auch der Ort, an dem die manipulative Software entwickelt
worden ist, wäre eine denkbare Möglichkeit gewesen. VW verwies immer wieder darauf, dass der
Konzern seinen Sitz in Deutschland habe und auch die Software dort seinen Ursprung fand, womit
der Gerichtsstand wieder in Deutschland gewesen wäre.
Im Sommer 2020 traf das Höchstgericht in Luxemburg eine wegweisende Entscheidung33. Der
EuGH34 interpretierte den Ort der Verwirklichung des Schadens sehr weit und somit zugunsten
aller europäischer Verbraucher, der Schadensort liege nämlich im MS, in dem das Auto gekauft
wurde. Der EuGH definierte den Schaden nämlich im Kaufpreis selbst, der über dem tatsächlichen
Wert lag, daran ändere auch nichts, dass die Fahrzeuge bereits beim Einbau der manipulierenden
Software „mit einem Mangel behaftet waren“. Auch hielt der EuGH fest, dass beim Verkauf von
manipulierten Fahrzeugen „der Schaden des Letzterwerbers weder ein mittelbarer Schaden noch
32 OGH 5.7.2019, 4 Ob 119/19g, ecolex 2019/337.
33 EuGH 09.07.2020, C-343/19, Zak 2020/442.
34 Der Standard, EuGH bestätigt Zuständigkeit österreichischer Gerichte im VW Dieselskandal, 9.Juli. 2020.
https://www.derstandard.at/story/2000118600975/eugh-bestaetigt-zustaendigkeit-oesterreichischer-gerichte-
im-vw-dieselskandal
13ein reiner Vermögensschaden ist und beim Erwerb eines solchen Fahrzeugs von einem Dritten
eintritt“.
Weiters hob der EuGH Richter in seinem Urteil hervor, dass der VW-Konzern „Fahrzeuge
systematisch und langwierig in Verkehr brachte, welche durch Motorsteuerungssoftware explizit
auf Täuschung programmiert wurden“ und betonte die „absichtlich arglistige Täuschung der
Genehmigungsbehörde durch strategische Entscheidungen des Unternehmens“. „Ein solches
Verhalten sei mit den grundlegenden Werten der Rechts- und Sittenordnung nicht vereinbar.“,
hieß es in der Urteilsbegründung.
Mit seiner Interpretation und Auslegung von Schaden, Feststellung der absichtlichen arglistigen
Täuschung und deren Unvereinbarkeit mit der Rechts- und Sittenordnung, öffnet der EuGH
Verbrauchern und Verbänden sämtliche Türen für Klagen im eigenen Land und trifft zugleich eine
rechtliche Zuordnung für das Verhalten des VW-Konzerns. Nun kann der VKI mit über 10.000
Geschädigten seine 16 Sammelklagen nach fast 2 jährigen Stillstehen wieder in Angriff nehmen.
Die zuständigen Gerichte können sich nun endlich der Sache selbst zuwenden und bei ihren
Entscheidungen bzw. vor allem bei den Schadensummen an der Musterfeststellungsklage
orientieren.
2.10. Erkenntnisse aus der VW Causa
Als Resümee gilt es nun folgendes festzuhalten; während in der USA der VW Abgas-
manipulations-Skandal mit einer 25 Milliarden Klage schnell entschieden war, dauerte es bis ins
Jahr 2020 bis europäische Verbraucher einen Schadenersatz zugesprochen bekamen. Erst unter
öffentlichem Druck und darauf folgender Einführung der Musterfeststellungsklage Ende 2018 war
eine für alle geschädigten Verbraucher entwickelte Möglichkeit geschaffen worden. Durch die
Schädigung unzähliger Verbraucher wurde ein Rechtsinstrument 3 Jahre später überhaupt erst
geschaffen, es bedurfte somit eines Anlaßfalls mit massiver Auswirkung. Der Schadenersatz von
VW is in Höhe von einer Milliarde Euro prognostiziert worden. Dies sind nicht einmal 4% von der
amerikanischen Strafsumme, obwohl die Anzahl der US Geschädigten im Verhältnis zu den EU
Verbrauchern weit geringer ist. Anlaßfallbezogen und erst 3 Jahre nach Aufkommen des Skandals
mit viel Druck durch die Gesellschaft wurde die Musterfeststellungsklage spät aber immerhin
entwickelt. Diese erwies sich letztendlich als tauglichstes Mittel, um zu einem Schadenersatz nach
deutscher Rechtslage zu gelangen.
143. Die neue Sammelklage der EU
3.1. RL als Grundbaustein schafft notwendige Basis
Die Europäische Kommission, auch als Hüterin der Verträge bezeichnet, machte am 11. März 2018
von ihrem Initiativrecht im EU- Gesetzgebungsverfahren Gebrauch.
Sie übergab dem Parlament und Rat den Richtlinien Vorschlag
über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung
der Richtlinie 2009/22/EG35
Ab Einbringung des Vorschlages kam es zu vielen Tagungen und es dauerte schließlich 2 Jahre bis
sich der Rat der EU am 30.6.2020 auf die Einführung einer EU Verbandsklage 36 mittels Richtlinie
einigte. Die Mitgliedstaaten haben wiederum 2 Jahre Zeit, die RL in nationales Recht zu gießen.
Die RL ist sehr einfach aufgebaut. In der anfänglichen Begründung werden Gründe und Ziele für
den Vorschlag genannt. Weiters wird auf die Rechtsgrundlage sowie auf die Subsidiarität und die
Verhältnismäßigkeit der zu erreichenden Ziele hingewiesen.
Die Richtline selbst besteht aus insgesamt 3 Kapiteln mit insgesamt 26 Artikel
Kapitel 1: Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
Kapitel 2 : die Regelung der Verbandsklagen selbst
Kapitel 3: Schlußbestimmungen
Alle Bestimmungen der 26 Artikel hier aufzuzählen, würde den Rahmen der Diplomarbeit
sprengen. Ich möchte eine Zusammenfassung der Möglichkeiten, Neuerungen und Änderungen
der RL geben und auch eigene Gedanken erläutern.
Schon beim ersten Mal Lesen der RL kann man das große Potential an Möglichkeiten für eine
europaweite Umsetzung einer Verbandsklage erkennen.
Eigentlich nur schwer vorstellbar ist, dass eine einheitliche Verbandsklage für die Europäische
Union erst im Jahr 2020, das Licht der Welt erblickt. Läßt man die Personenverkehrsfreiheit außen
vor, so bleiben mit der Dienstleistungsverkehrsfreiheit, der Kapitalverkehrsfreiheit und der
Warenverkehrsfreiheit, 3 der 4 Grundfreiheiten, welche regelrecht nach dem rechtlichen
Konstrukt einer Verbandsklage rufen.
35 Vorschlag (EU) 2018/0089 der Europäischen Kommission vom 11.4.2018 für eine Richtline des Europäischen
Parlaments und des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur
Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG.
36 Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2020 über
Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie
2009/22/EG.
153.2. Eckpfeiler und wesentliche Standards
Was in den Vereinigten Staaten an der Tagesordnung steht, wird in Europa tatsächlich erst 2022
umgesetzt werden. Allerdings wird sich die Europäische Verbandsklage deutlich von den
Sammelklagen der USA unterscheiden. Dort kann nämlich jeder Rechtsanwalt eine Sammelklage
bei Gericht einbringen, in Europa wird statt dessen das aktuelle österreichische Prinzip auf die EU
ausgedehnt. Für eine Klageeinbringung bedarf es nämlich eine Verbraucherorganisation oder
eines ähnlichen Gebildes, nur diese sind dazu legitimiert (Art 4 Abs1 RL). Auch dürfen diese
Organisationen keinen wirtschaftlichen Zweck verfolgen (Art 4 Abs 3 lit. c RL). Weiters werden
Anforderungen an die Zulässigkeit geknüpft, welche jederzeit von einer Behörde geprüft werden
können (Art 5 Abs 3 RL). Zum Teil strengeren Sonderkriterien unterliegen Organisationen bei
Erhebung von grenzüberschreitenden Verbandsklagen also jene, die in ihren Mitgliedsstaat
registriert sind und Sammelklage in einem andern MS erheben. Weitere Voraussetzungen wären
ausnahmslose Gemeinnützigkeit und einjähriges Tätigsein im konkreten Schutzbereich des
Verbraucherschutzes (Art 4 Abs 1 Lit. a RL). Gegen Mitgliedsbeiträge oder Gebühren für konkrete
Verbandsklagen ist nichts einzuwenden, allerdings dürfen diese nicht einem Erwerbszweck gleich
kommen, sondern müssen für die Interessen der Verbraucher genutzt werden (Art 20 Abs 3 RL).
Die Festlegung der Kriterien für innerstaatliche Streitigkeiten liegt in der Hand des
Mitgliedstaates und kann dieser für sein Hoheitsgebiet anders regeln. Dies geht sogar soweit,
dass für den Einzelfall Einrichtungen ernannt werden können (Art 4 Abs 6 RL). Um Unklarheiten
oder gar Mißbrauch vorzubeugen, bestimmt sich die Kommission selbst zur Führung eines
elektronischen Index, in dem alle befähigten Einrichtungen der jeweiligen Mitgliedstaaten
aufgelistet werden (Art 5 Abs 5 RL). Auch die Mitgliedstaaten sind zur Führung eines
Verzeichnisses von Informationen über legitimierte Organisationen berechtigt (Art 5 Abs 2 RL).
Weiters kann die Öffentlichkeit Einsicht in ein laufendes Verfahren nehmen oder sich über den
Ausgang eines beendeten Verfahrens erkundigen (Art 13 Abs 1 RL). Damit sind auch die durch
Dritte zur Verfügung stehende finanziellen Mittel zu nennen. Eine Prozessfinanzierung verstößt
in Österreich nach herrschender Ansicht dann nicht gegen das Quota-litis Verbot, wenn das
Finanzierungsunternehmen lediglich die Prozesskosten trägt, aber keine Rechtsberatung
übernimmt37. Die Richtline erlaubt dies bei ausreichender Transparenz der Gelder von Dritten an
die Einrichtung und das Gericht kann eine Offenlegung38 verlangen (Art 7 Abs 3).
37 Wolfgang Kolmasch, 21.4.2021, Zak 2021/184, Heft 6/2021.
https://lesen.lexisnexis.at/_/kein-quota-litis-verbot-fuer-prozessfinanzierer/artikel/zak/2021/6/Zak_2021_06_184.html
38 Christoph Schubert, 8.Juli 2020, Drohen amerikanische Verhältnisse?/Stellungnahme.
163.3. Europäischer Verbraucherschutz wird ausgedehnt oder erst geschaffen
Nachdem eine RL zur Umsetzung gewählt wurde, bleibt es den Mitgliedsstaaten selbst
überlassen, die bestmögliche Implementierung in das nationale Recht zu finden. Somit kann der
Staat frei wählen, welche qualifizierten Einrichtungen39 für eine Verbandsklage in Frage kommen.
Die Benennung einer Umweltschutzorganisation als zulässiges Gebilde für Verbandsklagen
obliegt somit dem österreichischen Parlament (Art 4 Abs 1 RL).
Somit ist die europäische Verbandsklage mit der US amerikanischen Sammelklage nicht
vergleichbar40. Die EU Sammelklage schützt den Verbraucher vor Rechtsstreitigkeiten, welche ein
Rechtsanwalt auch mit wenig/ohne Erfolgschancen oder gar mißbräuchlich führen könnte. Die
Einführung der EU Verbandsklage hat einen erweiterten Verbraucherschutz zum Ziel und soll
nicht zu einer europaweiten Ertragshäufung für Rechtsanwälte führen. Damit sich dieses
hinreichende Schutznetz über Europa spannt, bedarf es an gewissen einheitlichen Standards in
den Mitgliedstaaten. Einige verfügen bis dato über gar keine Möglichkeit einer Sammelklage,
andere regeln diese zwar, aber oftmals nur spärlich und die Paragraphen können ähnlich der
österreichischen Rechtslage an einer Hand abgezählt werden. Nachdem eine RL zu Umsetzung
gewählt wurde, bleibt es den Mitgliedsstaaten selbst überlassen, die bestmögliche Umsetzung in
bestehendes Verfahrensrecht zu wählen oder gar ein neues eigenes Verfahren umzusetzen.
Wichtig wäre darauf hinzuweisen, daß die Verbandsklage nicht nur bei einem
grenzüberschreitenden Sachverhalt zur Anwendung kommt. Die umgesetzten Inhalte der RL
umfassen sowohl innerstaatliche als auch grenzüberschreitende Streitigkeiten, eine
Inländerdiskriminierung sowie Ausländerdiskriminierung ist daher ausgeschlossen. Somit
profitiert der einzelne EU-Bürger, vor allem in jenen MS, in denen bis dato keine Verbandsklage
möglich war. Weiters garantieren die Mindeststandards den einzelnen Verbraucher eine
einheitliche Verfahrensgarantie und sorgen für ein schnelleres Verfahren, ohne
Rechtsnachforschung, ob eine Verbandsklage im MS überhaupt möglich ist.
https://www.deutscheranwaltspiegel.de/anwaltspiegel/verbandssanktionengesetz/drohen-amerikanische-
verhaeltnisse-20605/
39 Noerr 25.11.2020, Unter 3. Klagebefugnis qualifizierter Einrichtungen und Notwendigkeit eines Verbrauchermandats.
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/rechtsrahmen-fur-europaische-verbandsklage-verabschiedet
40 VKI Mitgliedstaaten einigen sich auf EU-Sammelklage, 5. Absatz.
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20191129_OTS0027/mitgliedstaaten-einigen-sich-auf-eu-sammelklage
174. Rechtsbehelfe bringen große Neuerung
Die mit der Klage verbundenen Rechtsbehelfe können auf Unterlassung (Art 8 RL) oder auf
unterschiedliche Arten der Wiedergutmachung (Art 9 RL) gerichtet sein . Auch hier bleibt es den
Mitgliedstaaten vorbehalten, spezifischere Regelungen zu treffen.
Bei der Unterlassung kann es sich um eine einstweilige oder endgültige Verfügung handeln (Art
8 Abs 1 lit a u. b). Die Unterlassungsklage zielt auf Beendigung oder Verbot einer Vorgehensweise
ab. Ebenso kann nach Streitbeendigung das Urteil, wie nach aktueller Rechtslage, veröffentlicht
werden und sorgt wiederum für demonstrative Wirkung. Wird urteilswidrig weiterhin gegen die
Unterlassung verstoßen, so kann der Mitgliedstaat die darauf folgenden Sanktionen selbst
wählen, eine Geldstrafe schreibt die RL aber in jeden Fall vor (Art 14 Abs 2 RL). Weiters schreibt
die RL vor, dass das Verfahren besonders zügig geführt werden soll (Art 12 Abs 1 RL). Ist besondere
Dringlichkeit geboten und somit ein schneller Handlungsbedarf gefordert, so hat der MS dafür ein
eigenes Eilverfahren zu gewährleisten (Art 12 Abs 2 RL). Die vorgesehene Unterlassungsklage
erinnert stark an die Klage auf Unterlassung nach KSchG. Der Verband muß keinen tatsächlichen
Schaden geltend machen, auch kommt es nicht zu Beweisschwierigkeiten bzgl. Vorsatz oder
Fahrlässigkeit. Beides ist nicht relevant für das Unterlassungsverfahren, es muß betroffene
Personen geben, welche in ihren Rechten gestört werden. Diesen rechtswidrigen Störfaktor gilt
es dazulegen und wiederum schnellstmöglich zu unterlassen.
Nicht zwingend vorgesehen ist der Versuch einer anfänglichen außergerichtlichen Einigung,
jedem Mitgliedstaat bleibt es überlassen, ob er den jeweiligen Verbänden eine diesbezügliche
Möglichkeit einräumt. Hingegen sieht die Richtlinie explizit vor, dass bei einem anhängigen
Unterlassungsverfahren, die Verjährungsfristen der einzelnen beteiligten Verbraucher in Bezug
auf dessen eingeklagten Ersatzansprüche, gehemmt oder unterbrochen werden (Art 11 RL). Diese
Schutzregelung kennt man aus dem nationalen Verfahren, mit Ausnahme der missbräuchlich
geführten Klage.
Die wohl größte Neuerung bringt wohl der zweite Rechtsbehelf mit sich (Art 9 Abs 1 RL). Die RL
spricht hier von Abhilfemaßnahmen und nennt Wiedergutmachungsmaßnahmen,
Entschädigung, Reparatur, Ersatz, Preisminderung, Vertragskündigung oder Rückerstattung
des bereits gezahlten Preises, soweit dies angemessen und nach nationalen Rechtsvorschriften
möglich ist. Diese Behelfe sind im materiellen Recht sichergestellt. Wie bereits oben erläutert,
steht der Verbraucherorganisation aus jetziger Rechtslage nur die Klage auf Feststellung und
Unterlassung zu, mit der Umsetzung der RL darf eine qualifizierte Einrichtung erstmals direkt auf
18Schadensersatz klagen. Im Unterschied zur Unterlassungsklage muß hier die Organisation den
Anspruch auf Wiedergutmachung konkreter41 nennen, es bedarf zumindest einer Gruppe von
Verbrauchern, deren konkrete Schädigung bewiesen werden muß. In der Regel wird es sich um
gröbere Eingriffe als im Unterlassungsverfahren handeln, demzufolge werden Entschädigungen
erwartet und das Verfahren muß aufwendiger geführt werden. Eindringlich weist die RL aber
darauf hin, dass die genannten Rechtsbehelfe einen Strafschadenersatz (Erwägungen Abs 42 RL),
sogenannter „punitive damage“, nicht ermöglichen.
4.1. opt in / opt out
Keine einheitliche Regelung42 sieht die RL für die Frage vor, ab wann eine qualifizierte
Organisation eine Sammelklage für Verbraucher einbringen darf (Art 9 Abs 2 RL). Darf sie das nur
mit Ermächtigung der betroffenen Verbraucher, also wenn von diesen die Verbandsklage explizit
gefordert wird, so wird dies opt in genannt. Die Alternativvariante wäre, dass die betroffenen
Verbraucher generell an der Verbandsklage beteiligt sind, möchte ein Verbraucher das nicht, muß
er von sich aus tätig werden und die Nichtteilnahme an der Klage bekanntgeben, dies wird opt
out genannt. Während im ersten Fall der Verbraucher für die Sammelklage erstmals tätig werden
muß, so ist er im zweiten Fall auch als untätiger im Verfahren dabei, möchte er dies nicht, muß er
wiederum doch tätig werden. Da es in diesem Bereich an einer Harmonisierung fehlt, werden
wohl beide Varianten in den MS vertreten sein.
Zwingend und ebenfalls rechtskonform mit nationalen Bestimmungen, legt die Richtline fest, dass
ein einmal in Anspruch genommener Rechtsschutz über eine Organisation, nicht mehr vom
einzelnen Verbraucher über die individuelle Rechtsverfolgung geltend gemacht werden kann (Art
9 Abs 4 RL). Der Verbraucher müsse sich somit vorab überlegen, ob er seinen potentiellen
Anspruch in fremde Hände legt oder selbst einklagen möchte. Der einzelne kann somit nicht im
Anschluß an einem verlorenen Prozess eines Verbandes einwenden, dass er eine andere
Argumentationsweise gewählt hätte. Allerdings kann der einzelne seinen individuellen Anspruch
sehr wohl geltend machen, wenn dieser über den von dem Verband geltend gemachten Anspruch
hinaus geht. Denkbar wäre hier, dass sich der Verband bei der Schadensforderung am größten
41 Noerr 25.11.2020, Klagebefugnis qualifizierter Einrichtungen u. Notwendigkeit eines Verbrauchermandats, 2. Absatz.
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/rechtsrahmen-fur-europaische-verbandsklage-verabschiedet
42 Noerr 25.11.2020, Klagebefugnis qualifizierter Einrichtungen u. Notwendigkeit eines Verbrauchermandats, 3. Absatz.
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/rechtsrahmen-fur-europaische-verbandsklage-verabschiedet
19Teil seiner Mitglieder orientiert und individuell stärkere betroffene Verbraucher somit
beschnitten werden.
4.2. Spezifisches zum Verfahren
Auch stellt die RL fest, dass die im Verbandsklageprozess ergangene Entscheidung nicht als case
law für gleiche oder ähnliche Verfahren anzusehen ist. Sehr wohl können aber die Beteiligten
eines anhängigen Verfahrens, Entscheidungen aus einem ähnlichen beendeten Verfahren als
Beweismittel vorbringen (Art 18 RL). Auch wenn das angloamerikanische case law
Entscheidungssystem keine Anwendung im europäischen Raum findet, so sind die Gerichte gut
beraten, der letztgerichtlichen Entscheidung bei gleichen oder ähnlichen Verfahren zu folgen.
Damit die einzelnen Organisationen die gemeinsamen Interessen der Verbraucher überhaupt
wahrnehmen und somit schützen können, bedarf es an gewissen prozessualen Befugnissen.
Schon die RL an sich bestimmt, dass den qualifizierten Einrichtungen die Rechte und die Pflichten
einer Verfahrenspartei zukommen (Art 4 Abs 1 und Art 7 Abs 1 RL). Auch dürfen die MS den
Verbraucher selbst bestimmte Rechte und Pflichten im Verbandsklageverfahren zusprechen (Art
4 Abs 4 RL). Die RL weist aber darauf hin, dass dem Verbrauchern aber keinesfalls dieselben
Rechte einer Partei zukommt. Ob und wie der österreichischen Gesetzgeber dies im nationalen
Recht regeln wird, ist äußerst Interessant. Die ZPO kennt bis dato Hauptparteien, Nebenparteien,
Zeugen und Sachverständige. Welche Neuerungen bezüglich Rechte und Pflichten den
Verbrauchern zukommen werden, bleibt abzuwarten. Diese haben doch ihre Ansprüche an den
Verband eigens abgetreten, wobei Pflichten trotz Abtretung noch bedenklicher erscheinen.
Weiters muß die Organisation bereits mit Klageeinbringung dem Gericht die Nennung der
konkreten Verbraucher vorlegen. Erst daraufhin prüft das Gericht die
Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Verbandsklage. Zu denken wäre, ob die Organisation
generell dazu berechtigt ist, eine Verbandsklage zu erheben, also im Verzeichnis der Kommission
eingetragen ist.
Die RL hält fest, dass bei unzulässiger oder offensichtlicher unbegründeter Klage, diese schon in
einem frühen Verfahrensstadium abgewiesen werden soll (Art 7 Abs 7 RL).
Weiters sieht die RL vor, dass Vergleiche über Abhilfemaßnahmen von den qualifizierten
Einrichtungen mit den Schädiger geschlossen werden dürfen, welche für den einzelnen
Verbraucher bindende Wirkung haben (Art 11 Abs 1 RL). Den Mitgliedstaaten steht es aber offen
eine Regelung zu treffen, die dem einzelnen Verbraucher selbst die Entscheidung überlässt, ob er
den Vergleich annimmt oder ablehnt. Infolge darf das Gericht den Vergleich prüfen. Erst nach
20dessen Zustimmung zieht der Vergleich rechtliche Wirkung nach sich (Art 11 Abs 2 RL). Den
Gerichten steht es zu, den Vergleich abzulehnen, falls dieser gegen zwingende Bestimmungen des
nationalen Rechts verstößt. Hervorzuheben ist, dass es die RL den MS ermöglicht, Bestimmungen
zu erlassen, bei dem das Gericht trotz beiderseitiger Einigung zwischen dem Verband und den
Schädiger, den Vergleich mit der Begründung ablehnen kann, dass es sich um keinen fairen
Vergleich handelt. Dass die Gerichte den Konsens der streitenden Parteien overrulen dürfen, ist
außergewöhnlich. Festzuhalten ist aber, dass in der RL nicht von einem unfairen Vergleich zu
Lasten der Verbraucher die Rede ist. Somit bleibt die Unabhängigkeit der Gerichte gewahrt, m.M.
wäre hierbei an die Gesetzes- und Sittenwidrigkeiten zu denken, welche ja amtswegig
wahrzunehmen sind. Weiters verweist die RL, dass die unterlegene Partei die gesamten
Verfahrenskosten zu tragen hat (Art 12 Abs 1). Der einzelne Verbraucher wird dahingehend
geschützt, das dieser selbst keine Kosten am Verfahren tragen muß, wobei die RL Ausnahmen bei
fahrlässig oder gar vorsätzlich verursachten Kosten anordnet (Art 12 Abs 1 u. Abs 2 RL). Auch in
Hinblick auf die Transparenz gibt die RL Vorgaben, so sind die MS verpflichtet, dass die
qualifizierten Einrichtungen an die betroffenen Personen Informationen bereitstellen müssen
(Art 12 Abs 3 RL).
So haben die Verbände in erster Linie auf deren Homepage Informationen über den Inhalt der
Verbandsklage selbst, den aktuellen Stand, sowie deren Ergebnisse offenzulegen (Art 13 Abs 3
RL). Die Informationspflicht kann aber genauso dem Schädiger auferlegt werden. Die
Verbraucherorganisation kann den Unternehmer verpflichten, dass dieser auf dessen Kosten
Urteile oder durch das Gericht bestätigte Vergleiche betroffenen Verbrauchern zukommen läßt,
sofern diese nicht schon anderweitig verständigt wurden.
Bezüglich Beweismittel gibt es auch eine spezifische Regelung. Wenn die
Verbraucherorganisation bereits ausreichende Beweise und Tatsachen vorgelegt hat, welche die
Zulässigkeit einer Verbandsklage rechtfertigen und zugleich auf weitere Beweismittel hinweisen,
welche der Kontrolle des Beklagten unterliegen, so kann das Gericht anordnen, diese vorzulegen
(Art 18 RL).
4.3. Grenzüberschreitende Verbandsklagen
Auch regelt die RL noch eigens die grenzüberschreitenden Verbandsklagen (Art 6 RL). Hier
müssen die Mitgliedstaaten erforderliche Maßnahmen treffen, damit qualifizierte Einrichtungen
eines anderen Mitgliedstaates, welche in diesem die Voraussetzungen für eine
grenzüberschreitende Verbandsklage erfüllen, auch vor innerstaatlichen Gerichten
21Sie können auch lesen