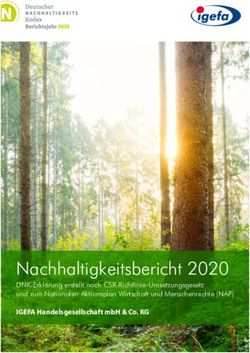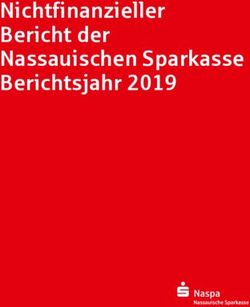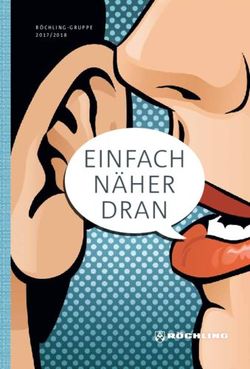EXOSKELETTE IN PRODUKTION UND LOGISTIK Grundlagen, Morphologie und Vorgehensweise zur Implementierung - TÜV Austria
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
EXOSKELETTE IN PRODUKTION UND LOGISTIK Grundlagen, Morphologie und Vorgehensweise zur Implementierung In Kooperation:
inhalt
1 Motivation: Warum Exoskelette? 4
2 Gesundheit und Krankheitsursachen 5
2.1 Demografischer Wandel in Österreich 5
2.2 Risikofaktor körperliche Arbeit 6
2.3 Krankenstände als Resultat in Österreich 7
3 Exzellenz in der Arbeitsgestaltung 8
3.1 Nachhaltige Arbeitsgestaltung 9
3.2 Innovationstrends der Arbeitsgestaltung 10
3.3 Assistenzsysteme im Arbeitssystem der Zukunft 11
4 Technologie Exoskelett 13
4.1 Technische Funktions- und Wirkweisen und sowie Grundkonzepte 13
4.2 Marktübersicht 13
4.3 Morphologie 14
4.4 Fazit zur Anwendung von Exoskeletten in der Industrie 15
5 Safety und Security 17
5.1 Normen und Richtlinien 17
5.1.1 Übersicht der Normen und Richtlinien für Exoskelette 17
5.1.2 Anforderungen an die Entwicklung von Exoskeletten 18
5.1.3 Anforderungen für Anwender von Exoskeletten 18
5.2 Gefährdungsbeurteilung und Methoden zur Absicherung 19
5.2.1 Kompatibilität mit Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 19
5.2.2 Arbeitsplatzgestaltung 19
5.2.3 Security in Design und Anwendung 20
6 Einsatz und Anwendung 21
6.1 Use-Case-Analyse in ausgewählten Unternehmen 22
6.1.1 HARTL HAUS Holzindustrie GmbH 24
6.1.2 ENGEL AUSTRIA GmbH 26
6.1.3 Wacker Neuson SE 28
6.2 Fazit zu den Exoskeletten 30
6.2.1 Fazit Exoskelett Paexo Shoulder der Firma Ottobock 30
6.2.2 Fazit Exoskelett Laevo 30
6.3 Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken 31
6.4 Vorgehen und Empfehlungen zur Einführung 31
7 Quick-Check zur industriellen Potenzialbestimmung 33
8 Fazit und Ausblick 36
9 Literaturverzeichnis 37
2EXOSKELETTE
IN PRODUKTION UND LOGISTIK
Grundlagen, Morphologie und Vorgehensweise zur
Implementierung
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Philipp Hold
Fabian Ranz MSc.
Fabian Holly BSc.
Fraunh o fer A u s tri a
G eschäf tsb e r eic h P r od u k t i on s - u n d L ogistikm a n a geme n t
G eschäf tsb e r eic h A d va n c e d In d u s t r i a l M a n a geme n t
Dipl.-Ing. Merim Cato
Dipl.-Ing. Alexandra Markis
Ing. Andreas Oberweger
TÜV AUSTR I A
G eschäfts fel d I n d us t r y & E n e r g y
Ing. Wolfgang M. Baumann
a wb Sc h rau b tec h n ik - u n d In d u st r ie b e d a r f G mbH
31
Motivation:
Warum
Exoskelette?
A u to mati s i e r u n g , R o b o t e r, D ig it a lisier ung. Dies e Sc hlagw ör t er s ind allgegenw är t ig in der I ndus-
tri e, u n d vi e le ro r t s e r le ic h t e r n n e u e n Tec hnologien bereit s die Auf gaben am Ar beit s pla tz. An-
s tren g en d e m a n u e lle T ä t ig k e it e n n e hm en jedoc h noc h im m er einen großen Ant eil in Produkti on
u n d L o g i s ti k e in . M it a r b e it e r in n e n u nd M it ar beit er in Unt er nehm en w erden vor dies em Hi nter-
g ru n d z u n ehm e n d d ire k t m it n e u e n As s is t enzs ys t em t ec hnologien, den s ogenannt en Exoskel et-
ten , au s g erü s t e t . D ie se a m K ö r p e r g e t r agenen St üt zs t r ukt uren reduzieren durc h elekt r ische oder
mec h an i s c h e U n t e r s t ü t z u n g d ie a u f den M it ar beit er innen und M it ar beit er w ir kende Belastung
u n d verri n g e r n G e f a h re n v o n Ve r le t z ungen durc h kör per lic he Beans pr uc hungen.
Exoskelette haben sich als hochtechnische Hilfsmittel in der Laut David Minzenmay, Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut
Rehabilitation etabliert. Doch zunehmend setzt sich die Techno- für Produktions- und Automatisierungstechnik (IPA), summie-
logie auch in der Arbeitswelt der Produktion durch. In Produk- ren sich Krankenstände aufgrund von MSE in Deutschland auf
tions-, aber auch in Logistikbereichen sorgen Exoskelette dafür, rund 125 Mio Tage pro Jahr, was einen Wertschöpfungsverlust
dass körperliche Aktivitäten erleichtert werden. In der Produkti- von rund 22,7 Mrd € verursacht. Unter Berücksichtigung die-
on und Logistik ist die physische Belastung auf Mitarbeiterinnen ser Zahlen relativiert sich die Investition für den Arbeitgeber.
und Mitarbeiter oft sehr hoch. Diese gefährdet langfristig nicht Eine Studie von ABI Research prognostiziert für das Jahr 2025
nur die Gesundheit, sondern auch die Produktivität und Effizi- ein potenzielles Marktvolumen für Exoskelette von 1,8 Mrd $.
enz der Mitarbeiter. Besonders leistungsgewandelte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter überschreiten oft ihre Belastungsgrenze, Was lange Zeit nur Science-Fiction war, findet zunehmend
z. B. wenn schwere Gegenstände zu bewegen sind. Durch seinen Weg in die Realität. Neue Technologien im Bereich der
den Einsatz von Exoskeletten sind vorhandene körperliche Sensorik sowie der Digitalisierung ermöglichen eine Kombina-
Beschwerden besser ausgleichbar, und Haltungsschäden sowie tion aus Roboter und Mensch und schaffen neue Anwendun-
körperliche Verschleißerscheinungen sind von Anfang an auf ein gen auch in Produktion und Logistik. Im industriellen Bereich
Minimum reduzierbar. Wenn Arbeitsplätze aufgrund örtlicher befinden sich die Exoskelette noch in einem frühen Entwick-
Gegebenheiten nicht ergonomisch optimierbar sind, hilft das lungsstadium. Doch erste Systeme haben bereits Serienreife
Exoskelett, ein Gleichgewicht herzustellen, indem bestimmte erlangt, und erste Industrieunternehmen beginnen, diese
Körperregionen stabilisiert und Kraftanstrengungen verringert Systeme im laufenden Betrieb einzusetzen.
werden. Hier gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten.
In diesem Whitepaper wird aufgezeigt, in welchen Anwen-
Nach wie vor befürchtete hohe Anschaffungskosten hindern dungsbereichen Exoskelette bereits einsetzbar sind, was bei
derzeit Unternehmen, sich dem Thema Exoskelette anzuneh- der Implementierung und Nutzung vor allem im Hinblick auf
men. Eine Studie der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt das Thema Safety und Security zu berücksichtigen ist und wel-
(AUVA) aus dem Jahr 2018 zeigte jedoch, dass in Österreich che Erfahrungen erste Anwendungsunternehmen im Rahmen
21,4 % aller Krankenstandstage auf eine Erkrankung des einer Kurzstudie gesammelt haben. Es hilft vor allem Klein-
Muskel-Skelett-Systems (MSE) zurückzuführen sind. Durch- und Mittelbetrieben, einen effizienten Einstieg in das Thema
schnittlich fallen auf jeden Krankenstand 15,8 Kranken- Exoskelette in Produktion und Logistik zu finden.
standstage. Vor allem die Beschäftigte und der Beschäftigte
der Altersgruppe 50 bis 64 Jahre sind dabei betroffen. Das
entspricht einem Drittel aller Ausfälle.
42
Gesundheit
und
Krankheits-
ursachen
Einen der zentralen Trends in Europa stellt der demografische Wandel dar, welcher im Folgenden auf
die Entwicklung der Strukturen von Altersgruppen, sowie das Verhältnis von Geschlechter n bezogen
wird. Statistik Austria zeigte auf, dass sich das Durchschnittsalter in Österreich allein in den letzten
zehn Jahren um 1,6 Jahre erhöht hat. Folgerichtig führt diese Entwicklung auch zu einem höheren
Durchschnittsalter Beschäftigter in österreichischen Industrieunter nehmen (Quelle: Statistik Austria,
2019a). Bereits heute ist der Begriff des sogenannten leistungsgewandelten Mitarbeiters weite
verbreitet. Dieser Begriff beschreibt nach Adenauer (2004) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche
aufgrund körperlicher-, verletzungs- oder altersbedingter Einschränkungen ihre Arbeitsaufgabe gar
nicht mehr oder nur teilweise ausführen können). Der Zusammenhang zwischen dem Demografischen
Wandel, der leistungsgewandelten Mitarbeiter sowie der hohen Anzahl der Kranken-
stände, vor allem aufgrund von Muskel-Skeletterkrankungen in Österreich, wird vor dem Hintergrund
der Notwendigkeit ergonomischer Arbeitssystemgestaltung im Folgenden dargestellt.
gesundheit und krankheitsursachen
2.1 Demografischer Wandel in aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Alter zwischen 30
Österreich und 44 Jahren noch 38,9 %, wird dieser Anteil bis zum Jahr 2050
auf 35,4 % gesunken sein, während sich der Anteil aller erwerbs-
Aktuelle demografische Untersuchungen in Österreich zeigen tätigen Personen über 45 Jahre von 36,1 % im Jahr 2011 auf 41,8
auf, dass die Durchschnittsbevölkerung in Österreich auch in % im Jahr 2050 erhöhen wird (Quelle: Statistik Austria, 2019c).
den kommenden Jahren stetig älter wird. Von 2011 bis 2060 Entwicklung der Erwerbspersonen 2017 bis 2080
wird der Prozentsatz der über 45-Jährigen von 36,1 % auf nach breiten Altersgruppen (laut Trendvariante)
5,0
in Mio
41,8 % ansteigen. 4,5
Lebensjahre 4,0
Männer 99 Frauen
95 3,5
90
3,0
85
80 2,5
75
70
2,0
65 1,5
60
55 1,0
50
0,5
45
40 0,0
35 2017 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080
30
2060 50-Jährige und Ältere 30- bis 39-Jährige
25
2030 40- bis 49-Jährige 15- bis 29-Jährige
20
15 2018
10
Abbildung 2: Erwerbsprognose 2018 (Quelle: Statistik Austria, 2019c).
5
0
80 000 60 000 40 000 20 000 0 0 20 000 40 000 60 000 80 000
Personen Personen Es ist als zentraler Einfluss auf österreichische Produktionsunterneh-
men festzuhalten, dass mit stetig steigender Zunahme des Anteils
Abbildung 1: Bevölkerungspyramide 2018, 2030, 2060 (Quelle: Statistik Austria, 2019b).
fazit
älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb zu rechnen
Diese Entwicklung hat einen signifikanten Einfluss auf die erwerbs- ist, wodurch das Potenzial der gesamten Belegschaft stärker von
entscheidender Bedeutung sein wird, als es heute der Fall ist.
tätige Bevölkerung. Betrug im Jahr 2011 der prozentuale Anteil
52
Gesundheit
und
Krankheits-
ursachen
2.2 Risikofaktor körperliche Arbeit Unfallgefahren. Schmerzen im Bereich des Rückens stellen mit
Abstand das größte Gesundheitsproblem dar. Fast ein Drittel
42,5 Stunden leisten vollbeschäftigte Österreicher durch- der befragten Personen (32,2 % bzw. 329 100 Personen) gab
schnittlich pro Woche (Eurostat, 2018). Allein dieser erbrachte an, im Jahr vor der Befragung arbeitsbedingte Rückenproble-
Zeitaufwand macht die Arbeitswelt zu einem der zentralsten me gehabt zu haben, 19,0 % (193 600 Personen) berichteten
Lebensbereiche des Menschen und prägt seine Lebensgestal- über Probleme mit dem Nacken, den Schultern, den Armen
tung erheblich. Die im Beruf vorherrschenden Arbeitsbedin- oder Händen und 16,3 % (166 300 Personen) über Probleme
gungen schaffen somit eine signifikante Grundlage nicht nur mit den Hüften, Beinen oder Füßen. Während Männer häu-
für das mentale Wohlergehen, sondern auch für die körperli- figer über Rückenprobleme (33,7 % vs. 30,6 % der Frauen)
che Gesundheit des Menschen. Arbeitsbedingte Belastungen oder Hüft- und Fußprobleme (18,1 % vs. 14,3 % der Frauen)
haben jedoch auch das Potenzial, sich negativ auf die Mitar- klagten, gaben Frauen deutlich häufiger Probleme mit dem
beiterinnen und Mitarbeiter auszuwirken. Die Konsequenzen Nacken, den Schultern, den Armen oder Händen an (23,4
reichen von der Entwicklung psychischer Probleme bis hin zu % vs. 14,9 % der Männer). Unter den befragten Erwerbs-
körperlichen Erkrankungen. tätigen waren mit 26,8 % Land- und Forstwirte/-wirtinnen
am häufigsten von arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen
Eine Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria betroffen, mit 19,5 % folgt die Baubranche sowie mit 18,5
im Jahr 2013 ergab, dass etwa 80 % aller Erwerbstätigen am % das Gesundheits- und Sozialwesen. Der Wirtschaftszweig
Arbeitsplatz einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind (Statistik Warenherstellung befindet sich mit 14,7 % auf dem neunten
Austria, 2013). So gaben etwa sieben von zehn Erwerbstäti- Platz, gereiht nach den Wirtschaftszweigen Dienstleistungen
gen an, körperlichen Risiken und vier von zehn Erwerbstäti- (17,8 %), Beherbergung und Gastronomie (16,7 %), Verkehr
gen, psychischen Risiken am Arbeitsplatz ausgesetzt zu sein. und Lagerei (16,3 %), öffentliche Verwaltung, Verteidigung
Die häufigsten körperlichen Erkrankungsrisiken sind hierbei und Sozialversicherung (15,7 %), Bergbau und Gewinnung
Überanstrengung der Augen, ergonomische Risiken und von Steinen und Erden (14,7 %).
0% 10 % 20 % 30 % 40 %
fazit
Knochen-, Gelenk- oder Muskelproblemen (Rücken) 32,2 %
Knochen-, Gelenk- oder Muskelprobleme (Nacken, Schulter, Arme, Hände) 19,0 %
Knochen-, Gelenk- oder Muskelprob-
leme zählen zu den häufigsten arbeits-
Knochen-, Gelenk- oder Muskelprobleme (Hüfte, Beine, Füße) 16,3 %
bedingten Gesundheitsproblemen auch
Stress 5,7 %
in Österreich. Diese Gesundheitspro-
Andere Gesundheitsbeschwerden 5,0 %
bleme äußern sich vor allem in Form
Depressionen, Angstzustände 4,9 % von Rückenschmerzen und weiteren
Atemprobleme, Probleme mit der Lunge 4,4 % Muskel-Skeletterkrankungen (MSE)
Herzkrankheit, Herzinfarkt, andere Herz-Kreislauf-Probleme 4,4 % von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2,2 %
in Produktionsunternehmen. Zu MSE
Magen-, Leber-, Nieren- oder Verdauungsbeschwerden
zählen Erkrankungen der Wirbelsäule,
Probleme mit dem Gehör 1,5 %
der Gelenke sowie deren muskuläre
Infektionskrankheiten (Viren, Bakterien, Pilze) 1,5 %
und sonstige Strukturen. Darüber
Überanstrengungen, Ermüdung der Augen 1,3 %
hinaus hängen sie eng mit physischen
Kopfschmerzen 1,0 % Fehlbeanspruchungen beziehungswei-
Hautprobleme 0,8 % se biomechanischen Überlastungen
In Prozent der Erwerbstätigen mit Gesundheitsproblem(en) zusammen.
Abbildung 3: Arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme (Quelle: Statistik Austria, 2013).
62.3 Krankenstände als Resultat 100 Sonstige
Krankheiten
in Österreich 90
80
Psychische und
Verhaltensstörungen
70 Krankheiten des
Anteile in Prozent
Kreislaufsystems
Rückenschmerzen stellen die häufigsten Gesundheitsbe- 60
Krankheiten des
50
einträchtigungen dar. Sie gelten auch weltweit als „Global- Atmungssystems
40 Krankheiten des
Burden-of-Disease-Faktor Nr.1”; rund 1,76 Mio Menschen in 30
Verdauungssystems
Österreich litten im Jahr 2014 daran. Dicht dahinter folgen 20
Krankheiten des
Muskel-Skelett-Systems
Allergien (rund 1,75 Mio Menschen), Bluthochdruck (rund 1,5 10 Verletzungen und
Vergiftungen
0
Mio Menschen) und Nackenschmerzen (rund 1,3 Mio Men- 1994 2000 2005 2010 2017
Jahre
schen) (BMGF, 2016).
Abbildung 4: Krankenstandstage nach Krankheitsgruppen (WIFO, 2018).
Sowohl Rücken- als auch Nackenschmerzen können durch
Muskel-Skeletterkrankungen ausgelöst werden. Darunter Nach Schätzungen des Bundesministeriums für Soziales, Ge-
gesundheit und krankheitsursachen
werden Erkrankungen des sogenannten Stütz- und Bewe- sundheit, Pflege und Konsumentenschutz (siehe https://www.
gungssystem, sowie die der Muskeln, Gelenke, Sehnen und sozialministerium.at/Ministerium/Kontakt/Impressum.html) und
Bänder verstanden. Zu den arbeitsbedingten Muskel-Skeletter- der Statistik Austria betrugen 2015 die volks- und betriebswirt-
krankungen zählen unter anderem (DGUV, 2019): schaftlichen Kosten im Zusammenhang mit Unfällen und Krank-
n Bandscheibenbedingte Wirbelsäulenerkrankungen heiten unselbstständiger Beschäftigter rund 9,1 Mrd €, wobei
n Gonarthrose rund 3,5 Mrd € direkte Kosten (direkte Zahlungen) und rund 5,6
n Karpaltunnel-Syndrom Mrd € indirekte Kosten (Wertschöpfungsverluste, u. a. aufgrund
n Hypothenar-Thenar-Hammer-Syndrom geringerer Produktivität) darstellen (WIFO, 2018). Abbildung 5
verdeutlicht die Krankenstandsquote nach Alter und Geschlecht.
Über alle Altersgruppen hinweg lassen sich 21,4 % aller
Krankenstandstage in Prozent des Jahresarbeitsvolumens
Krankenstandstage und 15,8 % aller Krankenstände auf 8
eine Erkrankung des Muskel-Skeletts-Systems zurückführen. 7
Ein Drittel aller krankheitsbedingten Ausfälle aufgrund von 6
Muskel-Skeletterkrankungen (MSE) betrifft die Beschäftigte 5
und der Beschäftigte in der Altersgruppe 50 bis 64 Jahre. Nur 4
10 % der Krankenstandstage aufgrund von MSE fallen auf 3
junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (AUVA, 2019). 2
1
0
Bis 19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 und
älter
Männer Altersgruppen in Jahren
Frauen
Abbildung 5: Krankenstandsquote nach Alter und Geschlecht (WIFO, 2018).
Ergonomische Arbeitssystemgestaltung beinhaltet somit nicht nur
fazit
das Potenzial, die „Arbeitsbedingungen für Industrieunternehmen“
zu verbessern, sondern auch die volks- und betriebswirtschaftlichen
Kosten zu senken und dadurch die Produktivität zu erhöhen.
73
Exzellenz in
der Arbeits-
gestaltung
Gru n d l eg en d st e h t d e r B e g r iff A r b e it s ges t alt ung als ein Sam m elbegr iff f ür alle M aßnahmen und
S trateg i en z u r G e s t a lt u n g v o n A r b e its s ys t em en, Ar beit s abläuf en und Ar beit s bedingungen. Es
wi rd z wi s c he n k o r re k t iv e r, p r ä v e n t iv e r, pros pekt iver, diff erenzieller und dynam is c her Arbei tsge-
s tal tu n g u n t e r s c h ie d e n (U lich , 1 9 9 4 ).
Korrektive Arbeitsgestaltung wird notwendig, wenn ergo- Bei allen Maßnahmen und Strategien zur Gestaltung von
nomische, physiologische, psychologische und sicherheits- Arbeitssystemen steht der Mensch neben betriebswirtschaft-
technische Anforderung in der Planung nicht oder nicht lichen Aspekten im Zentrum der Betrachtung. Humanität und
angemessen berücksichtigt wurden. Präventive Arbeitsgestal- Betriebswirtschaftlichkeit haben die Aufgabe, im Sinne einer
tung beschreibt eine planerische Vorwegnahme möglicher ergonomischen Arbeitsgestaltung synchron miteinander zu
physischer oder psychischer Schädigungen und Beeinträch- agieren. Zentrale Kriterien humaner Arbeitsgestaltung wurden
tigungen am Arbeitsplatz. Wird im Vorfeld die präventive bereits von Rohmert (1984), von Bachmann (1978) und von
Arbeitsgestaltung ausreichend berücksichtigt, ersetzt dies die Hacker (1980) aufgezeigt. Dabei stehen folgende Kriterien
korrektive Arbeitsgestaltung weitgehend. Die prospektive Ar- im Zentrum: Ausführbarkeit, Erträglichkeit, Schadlosigkeit,
beitsgestaltung bezieht sich auf Strategien zur Schaffung von Zumutbarkeit, Belastbarkeit, Beeinträchtigungsfreiheit, Zufrie-
persönlichkeitsförderlichen Arbeitstätigkeiten, respektive das denheit, Einstellungs- und Persönlichkeitsförderlichkeit.
Schaffen von Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung
im Stadium der Planung von Arbeitssystemen. Differenzielle Nach Zwart et al. (1996) hängen physische Beanspruchungen
Arbeitsgestaltung beschreibt das Bilden und Bereitstellen von von Körperhaltungen, den angewandten Kräften, den wir-
gleichzeitigen Angeboten verschiedener Arbeitsstrukturen, kenden Arbeitsbedingungen, physischen Arbeitsbelastungen
zwischen denen die Beschäftigten wählen können. Dynami- und von den individuellen Entscheidungsfreiräumen ab. Die
sche Arbeitsgestaltung ermöglicht bestehende Arbeitsstruk- aus den Beanspruchungen resultierenden gesundheitlichen
turen zu erweitern beziehungsweise neue zu schaffen, um Auswirkungen führen, wie das Altern, zu einer Änderung des
einen Lernfortschritt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu physischen Arbeitsvermögens. Folgende Grafik stellt diese
gewährleisten (Ulich, 1994). Zusammenhänge dar.
Physische Belastung, Aktuelle Haltungen, Bewegungen, Kurzfristige physische Langfristige gesundheitliche
Entscheidungsfreiräume Arbeitsbedingungen angewandte Kräfte Beanspruchung Auswirkungen
Physisches Arbeitsvermögen
Altern
Abbildung 6: Zusammenhänge zwischen Altern und physischen Arbeitsbelastungen (Zwart et al.,1996).
Auf welcher Grundlage eine nachhaltige Arbeitsgestaltung haltigen Beitrag für eine humane und gleichzeitig betriebs-
basiert, sowie welche technischen Innovationen und Assistenz- wirtschaftliche Arbeitsgestaltung liefern, ist im Folgenden
systeme, zu denen auch Exoskelette gehören, einen nach- dargestellt.
83.1 Nachhaltige Arbeitsgestaltung rischen Strukturen verknüpft. Das MTO-Konzept stellt den zent-
ralen Bezugsrahmen zur Gestaltung von Arbeitssystemen dar.
Nachhaltige Arbeitsgestaltung folgt einem nachhaltigen Produk- Durch das MTO-Konzept wird verdeutlicht, dass die Ge-
tivitätsmanagement. Dieses wiederum folgt der Annahme, dass
d soziale
erfolgreiche Unternehmen sich unter sonst gleichen Bedingungen he un Um
rlic we
tü Markt
Na lt
kaum durch die Qualität der Ressourcen Technologie, Betriebs-
mittel und Rohstoffe, jedoch grundlegend durch die Qualität der Mensch
Ressource Mensch (die Beschäftigte und der Beschäftigte) und die
Wirksamkeit der sie unterstützenden Organisation unterscheiden. Aufgabe
Die Produktivitätsdefinition im klassischen Sinne ist demnach in- Organisation Technik
sofern Mittel zum Zweck, als dass sie kein betriebswirtschaftliches
Letztziel, jedoch ein Mittel zur Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit, Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit ist (Bokranz, 2012).
Abbildung 8: Das MTO-Konzept: Mensch, Technik und Organisation in einer Wechselwir-
Exzellenz in der Arbeitsgestaltung
kungsbeziehung.
Produktions-
Langfristige Geschäfts- Innovations- vorbereitung und
Businessziele strategie Marktstellung fähigkeit Implementierung
staltung von Arbeitssystemen in Produktionsunternehmen
Prozess-
Leistung organisation ausschließlich dann zum angestrebten Erfolg führt, wenn
Produktivität
Beschäftigte Betriebsmittel Rohstoffe Qualitäts- menschliche, technische und organisatorische Aspekte in
fähigkeit
einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Dabei
Leistung und Materialfluss und
Leistung und
Leistungsbereitschaft der
Arbeitnehmer Instandhaltung der
Materialanforderungen Supply Chain
werden folgende Schnittmengen unterschieden:
Arbeits-/Sachmittel
Lieferzeit und
Kapazität und Auslastung
Materialwert
von Kapazitäten
Verfügbare Kapazitäten
und Auslastung von
n Mensch und Technik: Diese Schnittmenge adressiert die
Kapazitäten Materialeigenschaften
Arbeitsorganisation und Marktwert
Mensch-Maschine-Interaktion beziehungsweise die Schnittstel-
le zwischen Mensch und Maschine.
Abbildung 7: Erklärungsmodell Produktivität (Bokranz, 2012).
Wie Abbildung 8 darstellt, ist der Mensch neben Technik n Mensch und Organisation: Diese Schnittmenge adressiert
und Organisation das zentrale Stellglied zur Realisierung von die Rolle des Menschen im Arbeitssystem der Montage.
Produktivität in Produktionsunternehmen. Dieser Zusammen-
hang wird durch das sogenannte MTO (Mensch-Technik- n Technik und Organisation: Diese Schnittmenge adressiert
Organisation)-Konzept verdeutlicht. Das MTO-Konzept ist als das soziotechnische System. Dies bedeutet die Organisation von
soziotechnisches Analyse-, Bewertungs- und Gestaltungskon- Menschen (Werkern) und mit diesen verknüpften Technologien
zept zu verstehen, in welchem Mensch, Technik und Organisa- im Arbeitssystem der Montage, welche in einer bestimmten Wei-
tion im Hinblick auf die Erfüllung einer Arbeitsaufgabe in einer se strukturiert sind, um ein spezifisches Ergebnis zu produzieren.
abhängigen Wechselwirkungsbeziehung zueinander stehen. Die
Arbeitsaufgabe verknüpft dabei den sozialen mit dem techni- Bei der Gestaltung von Arbeitssystemen ist für synchroner Stei-
schen Teil eines Arbeitssystems und verbindet den Menschen gerungen von humanorientierten und betriebswirtschaftlichen
fazit
mit organisatorischen Strukturen. Der Arbeitsaufgabe kommt Produktivitätseffekten stets das MTO-Konzept zu beachten. Dieses
gilt ergänzend als Design-Grundsatz für die Implementierung und
dabei eine zentrale Rolle zu, indem diese das soziale und
Nutzung innovativer Technologien in Arbeitssystemen der Zukunft.
technische Teilsystem sowie den Menschen mit den organisato-
93
Exzellenz in
der Arbeits-
gestaltung
3.2 Innovationstrends der Arbeits- bei qualitätskritischen Prozessen unterstützt. Die Integration
gestaltung von Assistenzsystemen in klassische Montagesysteme führt zu
einem steigenden Digitalisierungs- und Vernetzungsgrad, wo-
Durch steigende Produktindividualisierung wird in der produ- durch Assistenzsystemen eine zentrale Rolle im Kontext Cyber-
zierenden Industrie vermehrt das Konzept der sogenannten physische Montagesysteme zukommt. Exoskelette gliedern
Mixed-Model-Montage verfolgt, mit dem Ziel kapazitätsaus- sich dabei in den Kontext von Assistenzsystemen ein. Durch
lastend, flexibel und wandlungsfähig eine Vielzahl gleich- künstliche Exoskelette werden dabei vor allem anspruchsvolle
artiger Produkte einer Produktfamilie, aber auch vermehrt individuelle Lösungen möglich, mit deren Hilfe leistungsge-
unterschiedliche Produkte verschiedener Produktfamilien zu minderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unterstützung
montieren. Hierdurch resultiert eine zunehmende Komplexität erhalten. Die Forschung und Entwicklung zu Exoskeletten ist
in Bezug auf die Koordination von Informations- und Material- vor allem in den USA und Japan fortgeschritten, in den USA
flüssen. Vielfach geht mit dieser Form der Montagegestaltung auch für den militärischen Bereich (acatech, 2016).
ein hoher Anteil von Montagetätigkeiten einher, deren Auto-
matisierung nicht wirtschaftlich ist und vom Menschen durch- Cyber-physische Systeme (CPS) realisieren eine Verbindung
geführt wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen zwischen der physikalischen und der digitalen Welt. Dabei
den Anforderungen nach Flexibilität und Wandlungsfähigkeit bauen CPS auf eingebettete Systemen auf (engl. embedded
des Konzepts der „Mixed-Model-Montage“ folgen, woraus systems), welche über einen Sensor Daten einer physikalischen
ein erhöhtes Risiko für kognitive, psychische aber auch physi- Umgebung erfassen, diese mittels eines Mikroprozessors
sche, Belastungen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verarbeiten und über Aktuatoren auf physikalische Vorgänge
resultiert. Die Integration von Assistenzsystemen wirkt diesen einwirken. Sie sind mittels digitaler Netze miteinander verbun-
Herausforderungen entgegen (Fast-Berglund et al., 2013). den und können auf weltweit verfügbare Daten und Dienste
zugreifen. CPS sind als (technisch) nicht abgeschlossene Syste-
Die allgemeine Zielsetzung von Assistenzsystemen ist, die Dis- me definiert und sind durch einen hohen Grad der Vernetzung
krepanz zwischen der menschlichen Leistungsfähigkeit sowie zwischen der physischen, sozialen und virtuellen Welt gekenn-
-fertigkeit und der von einer Arbeitsaufgabe geforderten zeichnet (Geisberger et al., 2012). Durch die Integration von
Anforderung zu minimieren – mit dem Ziel, sowohl die Pro- CPS in Montagesystemen entstehen sogenannte Cyber-phy-
duktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die sische Montagesysteme (CPMS). Es wird vorausgesagt, dass
des gesamten Arbeitssystems nachhaltig zu sichern. Assis- CPMS in der Lage sind, Herausforderungen volatiler Märkte
tenzsysteme verfügen vor diesem Hintergrund über eine Art wirtschaftlich zu begegnen und gleichzeitig auf ergonomische
Regelfunktion, indem sie die von einer Aufgabe geforderten sowie im Hinblick auf eine alters- und alternsgerechte Arbeits-
Anforderungen mit der individuellen menschlichen Leistungs- gestaltung einzugehen (Dombrowski et al., 2013).
fertigkeit ausgleichen (Spillner, 2015). Allgemein werden im
Kontext der Montage zwei grundlegende Arten von Assistenz-
systemen unterschieden: zum einen eine technische Assistenz,
z. B. in Form kooperierender oder auch kollaborierender
Robotiksysteme, und zum anderen in Form einer digitalen
Assistenz (Informationsassistenz), welche den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Wesentlichen durch die Repräsentation
von Informationen sowie durch elektronische Absicherung
10Assembly Cell
3.3 Assistenzsysteme im Arbeitssystem
der Zukunft
Human Motion Intelligent
Capture Equipment
Intelligent
Die Bandbreite von Auswahlmöglichkeiten an digitalen (Hold,
Collaborative
Containers Robot 2017) und technischen (Ranz, 2018) Assistenzsystemen für
Digital Assisted die Produktion ist groß. Sie reicht vom Einsatz intelligenter
Worker
Informationssysteme mit Darstellungsformen, wie Augmented
Autonomous
Vehicle Reality, bis hin zu intelligenten Mensch-Roboter-Interaktionen
in Fertigung, Montage und Logistik. Die Art des Assistenz-
systems variiert dabei je nach Anforderungsniveaus der
Arbeitsaufgaben, welche grundlegend wie folgt eingeteilt
werden (BMAS, 2018):
Niedrig: Systeme geben entweder reine Handlungsanwei-
Exzellenz in der Arbeitsgestaltung
Abbildung 9: Aspekte eines Cyber-physischen Montagesystems (Erol et al., 2016). n
sungen für einfache Arbeitssituationen oder unterstützen die
Assistenzsysteme werden in Arbeitssystemen der Zukunft einen Ausführung von Bewegungen.
zentralen Gestaltungsgegenstand einnehmen. Neben digitalen,
informatorischen Assistenzsystemen finden bereits heute vielfältige
technische Assistenzsysteme, wie z. B. in Form von kooperativen
n Mittel: Systeme können bei regelbasierten Entscheidungen
und kollaborativen Robotiksystemen, Einzug in Produktionsunter- mittlerer Komplexität unterstützen und Empfehlungen an den
fazit
nehmen. Durch Exoskelette als weitere Form technischer Assistenz- Nutzer kommunizieren.
systeme wird die Mensch-Maschine-Interaktion auf eine neue Stufe
gehoben.
n Hoch: Systeme können bei regelbasierten Entscheidungen
hoher Komplexität bzw. bei auf Expertise basierenden Ent-
scheidungen unterstützen und Empfehlungen an den Nutzer
kommunizieren.
n Variabel: Systeme können bei Handlungen und Entschei-
dungen unterschiedlicher Komplexität unterstützen bzw. auch
regelbasierte kognitive Tätigkeitsbestandteile übernehmen.
Darüber hinaus lassen sich Assistenzsysteme in Wahrneh-
mungsassistenzsysteme, Entscheidungsassistenzsysteme und
Ausführungsassistenzsysteme einteilen (Klocke, 2017):
n Wahrnehmungsassistenzsysteme sind: Arbeitshilfen,
welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mithilfe von Aug-
mented Reality unterstützen (z. B. Datenbrillen oder Pick-by-
Voice-Systeme).
113
Exzellenz in
der Arbeits-
gestaltung
n Entscheidungsassistenzsysteme verwenden Echtzeit-
Exoskelette werden unaufhaltsam als Assistenzsysteme in Arbeits-
daten und erstellen so Prognosen bezüglich Prozessverhalten systemen der Zukunft Einzug halten. Die Diversität dieser Systeme
bzw. Prozessergebnissen. wird Produktionsunternehmen genauso wie digitale und roboter-
gestützte Assistenzsysteme vor die Herausforderung stellen, das
richtige System für die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
n Ausführungsassistenzsysteme haben das Ziel, Arbeitsbe-
in Bezug auf die richtige Unterstützung zu identifizieren. Dabei
lastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu reduzieren, gilt es, die Frage richtig zu beantworten, was bei der Auswahl von
und assistieren somit auch in ergonomischer Hinsicht. Mit
fazit
Exoskeletten von zentraler Bedeutung ist und wie dabei vorgegan-
dieser Art der Unterstützung lässt sich neben der Ergonomie gen werden kann, um humanorientierte und betriebswirtschaftliche
Ziele gemeinsam zu erreichen.
auch die Ausführungsgeschwindigkeit sowie die Präzision der
Tätigkeit beeinflussen.
In Arbeitsumgebungen, in denen viel gehoben, getragen
oder über Kopf gearbeitet wird und technische Hilfsmittel wie
Stapler oder Kräne aus technischen Gründen nicht anwendbar
sind, stellt der Einsatz von Exoskeletten eine Möglichkeit dar,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Arbeit zu ent-
lasten. Dieses Ausführungsassistenzsystem ist eine am Körper
getragene Stützstruktur, die durch eine (elektro-)mechanische
Unterstützung die Belastung auf den Körper oder auf Teile
des Körpers reduziert und somit die Gefahr von Verletzungen
verringert. Exoskelette als technische Assistenzsysteme eröff-
nen dabei die Möglichkeit einer Verbesserung der Arbeits-
sicherheit, besonders bei Tätigkeiten, bei denen aufgrund
der Spezifik der Arbeitssituation, (z. B. Zugänglichkeit des
Arbeitsbereichs, Art des Arbeitsmittels bzw. Arbeitsgegen-
stands) bisher keine oder nur unzureichende technische Hilfs-
mittel, z. B. beim Heben schwerer Lasten oder bei Arbeiten
in Zwangshaltung, eingesetzt werden können. Exoskelette
ermöglichen eine stärkere Entlastung des Muskel-Skelett-
Systems bei spezifischen Tätigkeiten. Einschlägige wissen-
schaftliche Begleitstudien, z. B. in den Bereichen Arbeits-
medizin, Biomechanik/Arbeitsphysiologie, Sicherheitstechnik,
stehen jedoch erst am Anfang (Ottobock, 2018). Doch ähnlich
wie bei digitalen und robotergestützen Assistenzsystemen ist
die Vielfalt des Marktangebots bereits stark ausgeprägt und
stellt Produktionsunternehmen vor die Herausforderung, das
richtige System, eine geeignete Aufgabe und die richtigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf die richtige
Unterstützung zu identifizieren.
124
Technologie
Exoskelett
Be i Exo s kel etten ha n d e lt e s s ic h u m m e c h a nis c he G er üs t e, bes t ehend aus St reben, G elenken
und Ac h s en , s o wi e – b e i a k t iv e n E x o sk e le t t en – Ac hs ant r ieben. Dies e ahm en den m ens c hlic hen
Körperb au n ac h u nd w e rd e n v o m M e n s c h e n w ie ein Anzug angezogen oder ein Ruc ks ac k um ge-
schna l l t. D as Gewi c h t d e r S t ü t z s t r u k t u r la s t et dabei, m it Aus nahm e von akt iven G anzkör per aus-
f ührun g en , z u r Gän z e a m Tr ä g e r. D e sh a lb k om m en haupt s äc hlic h leic ht e M at er ialien w ie K uns t-
st off e o d er A l u mi niu m z u m E in sa t z .
4.1 Technische Funktions- und Wirk- ein integrierter Akku in der Stützstruktur oder das Exoskelett ist
weisen und sowie Grundkonzepte direkt am Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus kann der
Antrieb auch pneumatisch erfolgen. Ähnlich wie bei elektrisch
Grundsätzlich lassen sich Exoskelette hinsichtlich ihrer Art der betriebenen Varianten gibt es auch hierbei eine Unterteilung
Kraftunterstützung in zwei Typen unterteilen: passive und in stationäre (Druckluftsystem) und instationäre (Gasflaschen)
aktive Exoskelette. Passive Exoskelette unterstützen den Träger Versorgungen.
anhand mechanischer Hilfsmittel wie z. B. durch Feder- oder
Seilzugsysteme. Energie wird mechanisch mittels Federn 4.2 Marktübersicht
Technologie Exoskelett
gespeichert, wobei die potenzielle Energie, mit der die Federn
bei einer bestimmten Bewegung eines Körperteils vorge- Der globale Markt für Exoskelette wächst kontinuierlich.
spannt werden, in weiterer Folge den Mitarbeiterinnen und Während derzeit erst etwa 7 000 Exoskelette weltweit (Stand
Mitarbeiter bei der Gegenbewegung unterstützt. Auftretende 1. Februar 2019) im Einsatz sind, wird für die kommenden
Belastungen werden somit wie durch eine Art Gegengewicht Jahre ein rasantes Absatzwachstum prognostiziert. Der Absatz
aufgefangen, Bewegungen werden in der Belastungsrichtung von 2015 bis 2017 stieg um jährlich etwa 40 % – von 2 500
infolgedessen erleichtert und der Komfort am Arbeitsplatz Einheiten im Jahr 2015 auf etwa 5 000 verkaufte Einheiten
wird erhöht. Da diese Assistenzsysteme ohne den Einsatz von im Jahr 2017. 2025 sollen voraussichtlich bereits 1 100 000
Motoren, Sensorik sowie deren Stromversorgung arbeiten, ist Exoskelette verkauft werden (Statista, 2016).
deren Aufbau meist deutlich einfacher als jener von aktiven
Exoskeletten. Die Abbildung 10 gibt einen Einblick in das geschätzte Absatz-
wachstum.
Aktive Exoskelette bieten dem Anwender eine aktive mecha- 120 000
110 000
tronische Kraftunterstützung bei einzelnen oder kombinierten 100 000
physischen Belastungsfaktoren. Da sie pneumatisch oder durch 90 000
80 000
Motoren betrieben werden, über eine Stromversorgung verfü- 70 000
gen und meist modular aufgebaut und erweiterbar sind, weisen 60 000
50 000
sie eine wesentlich höhere Komplexität auf. Die Mechanismen 40 000
30 000
wirken an den Gelenken oder anderen neuralgischen Punkten
20 000
des Trägers und erlauben daher einen weitgehend höheren Un- 10 000
0
terstützungsgrad. Jedoch erhöht der kompliziertere Aufbau das 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Eigengewicht des Anzugs stark. Die Energieversorgung erfolgt
Abbildung 10: Absatz von Exoskeletten bis 2025 (Statista, 2016).
bei aktiven Exoskeletten meist elektrisch. Entweder befindet sich
134
Technologie
Exoskelett
Eine Weiterentwicklung der zunächst primär für militärische konzipiert. Eine weitere Vorreiterrolle im Bereich industriell
Anwendungen und den Einsatz in der Weltraumrobotik ent- einsatzfähiger Exoskelette übernimmt die ursprünglich mit
wickelten Exoskelette fand für die Rehabilitation und Unter- Prothesen und orthopädischen Produkten bekannt gewordene
stützung bewegungseingeschränkter Menschen statt. Deshalb Firma Ottobock mit Sitz in Duderstadt. Das im Oktober 2018 in
bedient derzeit eine große Anzahl der sich auf dem Markt Serie gegangene passive Exoskelett Paexo Shoulder unterstützt
befindenden Hersteller von Exoskeletten den Gesundheitssek- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem bei anstrengenden
tor. Erst in jüngster Vergangenheit wurden Exoskelette auch Überkopfarbeiten in der Produktion und in der Montage.
für Unternehmen der produzierenden Industrie interessant.
Hier sind vor allem leicht anwendbare Exoskelette, wie z. B.
der „Chairless Chair“ der Firma noonee oder das Gurtsystem
„rakunie“ von Morita bereits in großer Zahl im Einsatz.
© German Bionic Cray X © Paexo Shoulder der Fima Ottobock
Abbildung 12: Beispiele für aktives und passives Exoskelett.
Unterschiedlichen Konzipierungen, Funktionen, Anwendungs-
bereiche und technische Ausprägungen von Exoskeletten
werden im folgenden AbschnittMorphologie deutlich.
4.3 Morphologie
Der Aufbau des Exoskeletts ist von der Anwendung sowie der
Abbildung 11: Technologie- und Marktübersicht passiver und aktiver Exoskelette.
zu unterstützenden Körperregion abhängig. Hierbei sind Exo-
skelette in Bezug auf ihre Kraftunterstützung in zwei Typen zu
Abbildung 11 zeigt diverse Hersteller, eingeteilt in die Bereiche unterteilen – passive und aktive Exoskelette. Abgesehen von der
Medizin, Militär und Industrie. Nach eigenen Angaben brachte Unterscheidung zwischen diesen beiden Typen sind Exoskelette
Anfang 2018 der Augsburger Robotikspezialist German Bionic nach dem aktuellen Kenntnisstand weiter zu unterteilen.
als erster deutscher Hersteller ein aktives Exoskelett in Seri-
enfertigung. Das German Bionic Cray X wurde speziell für die n Antrieb: Während aktive Exoskelette ihre Kraftunterstüt-
manuelle Handhabe von schweren Gütern und Werkzeugen zung elektrisch oder pneumatisch erbringen, passiert dies bei
14den passiven Varianten mechanisch, z. B. mittels Federn oder Dimension Ausprägung
Seilsystemen.
Grundprinzip
n Energieversorgung: Passive Exoskelette benötigen keine Aktiv Passiv
externe Energieversorgung. Bei aktiven Exoskeletten wird zwi-
Antrieb
schen mitzutragenden Elementen wie Akkus oder Gasflaschen
Elektrisch Pneumatisch Mechanisch
und stationären Versorgungen wie Stromnetz oder Druckluft-
Energie-
systemen unterschieden. versorgung/
speicherung
Akku Druckluft Stromnetz Feder
n Unterstützte Körperregionen: Bereits erhältliche Exoske-
Unterstützte
lette gibt es für Hände, Arme, Schultern, Rumpf sowie Beine. Körperregion
Arme Hände Beine Schultern Rumpf
n Unterstützungsart: Exoskelette werden je nach ihrer Unterstützungs-
art
Unterstützungsfunktion unterteilt: die zur Kraftunterstützung,
Kraft Ausdauer Geschwindigkeit
die zur Erhöhung der Ausdauer des Trägers und die für eine
höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Eigengewicht
Technologie Exoskelett
< 2,5 kg 2,5–5 kg > 5 kg
n Gewicht: Aktive Exsoskelette wiegen aufgrund ihres kom-
Einsatzbereich
plexen Aufbaus (Sensorik, Motoren, Leitungen etc.) deutlich
Fertigung Montage Logistik Versand Schulung
mehr als die passiven. So wiegt z. B. das passive Exoskelett
„rakunie“ von Morita nur 0,25 Kilogramm, das aktive Torso- Anwendungs-
grund
Modul „Active Trunk“ von Robo-Mate mit 11 Kilogramm Haltungskorrektur Überkopfarbeit Hebeunterstützung
hingegen mehr als das 40-Fache.
Abbildung 13: Morphologie passiver und aktiver Exoskeltte für den Einsatz in Produktion
und Logistik.
n Einsatzbereich: In Industrie und Produktion können Exo-
skelette bei verschiedensten Tätigkeiten angewandt werden. 4.4 Fazit zur Anwendung von Exoskelet-
Typische Einsatzbereiche sind einerseits die Fertigung sowie ten in der Industrie
die Montage, andererseits die Logistik und der Versand. Auch
zu Schulungszwecken wie z. B. beim Training der richtigen Die Anwendung von Exoskeletten in Produktion und Logistik
Körperhaltung bei schweren Hebetätigkeiten (siehe Anwen- bewirkt eine Verbesserung der Arbeitssicherheit, insbesondere
dungsgrund) eignen sich Exoskelette. bei Tätigkeiten, welche schweres Heben, Zwangspositionen
oder lang andauernde Überkopfarbeiten fordern, und bei
n Anwendungsgrund: Leichte, passive Exoskelette dienen denen aufgrund ihrer Arbeitssituation bis dato keine oder nur
häufig zur Haltungskorrektur (beim Heben oder in Zwangsposi- bedingt technische Hilfsmittel eingesetzt werden konnten.
tionen) oder als Abstützung des Gewichts von Werkzeugen bei Exoskelette reduzieren vor allem jene auf den Körper des
Überkopfarbeiten (siehe Paexo Shoulder von Ottobock). Aktive Anwenders wirkenden Belastungen, welche zu arbeitsbeding-
Exoskelette bieten die Möglichkeit, den Träger bei Hebearbeiten ten Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems (MSE) führen
zu entlasten. (Ottobock, 2018). Gerade diese sind in Europa der häufigste
Grund für Arbeitsunfähigkeit und somit ein bedeutender Kos-
154
Technologie
Exoskelett
tenfaktor für Unternehmen und Gesundheitssysteme (WIFO,
2018). Im Gegensatz zur Anwendung von Exoskeletten im
medizinischen Bereich befinden sich Exoskelette im indust-
riellen Bereich noch in einer Einführungsphase. Einschlägige
wissenschaftlich belegte Langzeitstudien stehen noch aus.
Die folgende Tabelle zeigt Vor- und Nachteile von Exoskeletten
unter Beachtung des MTO-Konzepts (siehe oben).
Vorteile Nachteile
Mensch Leicht anwendbar Erhöhte Verletzungsgefahr bei
Stolper-, Sturz- und Rutschunfällen
Reduktion der Belastung auf den
Körper Einsatz an Drehmaschinen,
Fräsmaschinen, etc. ggfs. wegen
Positive Auswirkung auf Gesund- abstehender Komponenten nicht
heit und Arbeitsfähigkeit der möglich
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Technik Individuelle Anpassungsfähigkeit Noch keine standardisierte Gefähr-
an die menschliche Anthropo- dungsbeurteilung, da die Risiken
metrie und die auszuführende nicht ausreichend untersucht sind
Tätigkeit
Flexibler als andere technische
Hilfsmittel, wie Stapler oder Kräne
Organisation Geringere ungünstige Belastungen Hohe technologische Diversität
reduzieren die krankheitsbedingte führt zu Problemen in der Planung
Ausfallszeit
Derzeit noch keine Langzeitstudien
Gleichbleibende, etablierte verfügbar
Arbeitsprozesse werden nicht
beeinträchtigt
Erhöhte Produktivität durch
steigende Motivation und
geringeren Fehlzeiten
165
Safety und
Security
Um das Potenzial der Anwendung eines Exoskeletts voll ausschöpfen zu können und das Vertrau-
en in die Technologie herzustellen, ist eine sichere Gestaltung des Arbeitssystems unabdingbar.
In Anbetracht der intensiven physischen Interaktion zwischen führt infolge auch zu Anforderungen an den Datenschutz,
Mensch und Exoskelett ist es essenziell, in der Produktent- weil mit diesen sicherheitsrelevanten Daten auch solche mit
wicklungsphase, wie auch bei der Integration die mögli- Personenbezug entstehen und verarbeitet werden müssen. Bei
chen Safety-und-Security-Gefährdungen, die für den Träger der Einflussnahme auf die ursächlichen Funktionen des aktiven
entstehen können, sorgfältig zu analysieren und mögliche Exoskeletts kommen sowohl unberechtigter lokaler Zugriff
Restrisiken auf ein akzeptables Niveau zu reduzieren. Produkt- (falsche Berechtigungen, zugängliche Schnittstellen) als auch
hersteller von Exoskeletten sollten dazu bestimmte Assistenz- die Einflussnahme über das Netzwerk selbst als Angriffsvekto-
leistung, bestimmte Funktionalitäten und begrenzte Tätigkei- ren infrage. Daher sollten entsprechende Maßnahmen durch
ten im Sinne einer sicheren Entwicklung berücksichtigen. Die ein Sicherheitskonzept, welches Safety und Security integrativ
eigentliche betriebliche Tätigkeit und das gesamte Umfeld des betrachtet, definiert werden.
Arbeitsplatzes, sollten vom Betreiber und Anwender sicher
gestaltet werden. 5.1 Normen und Richtlinien
Safety und Security
Während Safety die sicherheitstechnischen Anforderungen Aktuell stehen nur wenige grundlegende gesetzliche Anfor-
der funktionalen Sicherheit beschreibt, adressiert die Security derungen und noch weniger unterstützende Normen und
potenzielle Gefährdungen der eingesetzten IT-Systeme. Bei der Richtlinien zur Verfügung, um Exoskelette sicher zu entwickeln
Betrachtung der funktionalen Sicherheit entstehen bei aktiven und anzuwenden. Prinzipiell wird bei der Betrachtung unter-
und passiven Exoskeletten aufgrund ihrer unterschiedlichen schieden, ob man Hersteller oder Betreiber ist und ob es sich
Bau- und Funktionsweisen unterschiedliche Anforderungen. um ein aktives oder passives Exoskelett handelt.
Passive Exoskelette unterstützen den Träger mithilfe von Feder-
oder Seilzugsystemen, wobei die gespeicherte Energie genutzt 5.1.1 Übersicht der Normen und
wird. Aktive Exoskelette hingegen besitzen eine mechatro- Richtlinien für Exoskelette
nische Kraftunterstützung, welche kabelgebunden ist oder
durch eine Batterie versorgt wird. Aufgrund der fortschreiten- Derzeit existiert keine gültige Produktnorm, die ausschließlich
den Digitalisierung in Unternehmen werden aktive Exoskelette oder dezidiert den Einsatz von Exoskeletten behandelt. Im
oftmals in das Unternehmensnetzwerk integriert, um z. B. die Rahmen eines kurzen Abschnitts werden aktive Exoskelette in
Verfügbarkeit überwachen und optimieren zu können. Diese der EN ISO 13482 „Roboter und Robotikgeräte – Sicherheits-
Integration hat wesentlichen Einfluss auf die IT-Security des anforderungen für persönliche Assistenzroboter“ erwähnt.
Unternehmens und allem voran auf die des Exoskeletts – und Die Norm setzt voraus, dass die Konstruktion inhärent sicher
damit zwangsläufig auch auf die physische Sicherheit des Trä- ist oder mittels technischer Schutzmaßnahmen so sicher ge-
gers. Eine drastische Auswirkung eines Security-Lecks wäre die staltet ist, dass die resultierenden Restrisiken ohne Weiteres
Einflussnahme auf die Bewegungssteuerung selbst. Weitere akzeptiert werden können.
Auswirkungen wären der Zugriff auf die Verfügbarkeit von
Nebenfunktionen, wie die Ferndiagnose des Energiehaushalts, Es obliegt dem Hersteller, nach der Risikobeurteilung aus einer
die Lokalisierung des Produkts und damit des Anwenders. Dies Reihe von sinngemäß anwendbaren Grundnormen passende
175
Safety und
Security
technische Lösungen zu extrahieren und im Konstruktionspro- größe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enorm wichtig.
zess anzuwenden. Die bereits tendenziell leichten, passiven Exoskelette sind
gemäß EN ISO 13482 so auszulegen, dass es z. B. zu keinen
5.1.2 Anforderungen an die Quetschungen, Schnittwunden oder Abschnürfungen durch
Entwicklung von Exoskeletten Riemen und Gurte kommt. Beim An- und Ablegen des Exo-
skeletts dürfen keine unkontrollierten Bewegungen durch die
Hersteller von Maschinen im industriellen Umfeld, zu denen gespeicherte Energie der vorgespannten Federn entstehen.
auch aktive Exoskelette zählen, müssen die Maschinenricht- Dies kann risikofrei durch z. B. Haken, Klettverschlüsse o. Ä.
linie 2006/42/EG erfüllen, um ein Produkt in Europa auf den sichergestellt werden. Außerdem sollte auf den sachgemäßen
Markt bringen zu dürfen. Dadurch wird sichergestellt, dass Gebrauch seitens des Herstellers hingewiesen werden.
Betreiber nur sichere Exoskelette erwerben können und
infolge sicher einsetzen können. Bei den konstruktionsbedingt schwereren aktiven Exoskeletten
muss auch die auf den Träger zusätzlich wirkende Belastung
Ergänzend zu den maschinellen Anforderungen stellt die EMV- berücksichtigt werden. Eine wesentliche Anforderung bei akti-
Richtlinie 2014/30/EU und bei eingebautem Funkmodul, wie ven Exoskeletten ist, dass sie während des An- bzw. Ablegens
z. B. WLAN, die RED-Richtlinie 2014/53/EU Anforderungen nicht unerwartet starten.
an die Produktgestaltung. In Abhängigkeit von der Betriebs-
spannung eines aktiven Exoskeletts kann zusätzlich noch die 5.1.3 Anforderungen für Anwender von
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU anzuwenden sein. Exoskeletten
Letzten Endes muss der Hersteller von aktiven Exoskeletten Aus nationaler Sicht müssen Arbeitgeberinnen und Arbeit-
deren CE-Konformität untersuchen und durch eine Konformi- geber in Österreich unabhängig von der Technologie und
tätserklärung bescheinigen. dem Assistenzumfang eines Exoskeletts das ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetz (ASchG) mit § 33 und § 35 und infolge die
Passive Exoskelette hingegen fallen nicht in die EU-Produk- dazugehörenden Verordnungen, wie die Arbeitsmittelver-
trichtlinie und müssen daher nicht zwingend CE-konform ordnung (AM-VO), berücksichtigen, um Gefährdungen für
entwickelt werden. Zum Schutz des Anwenders sind daher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Einsatz von
auch nicht zwangsläufig alle sicherheitsrelevanten Informa- Exoskeletten zu verhindern. Die Kernaussage daraus ist, dass
tionen über das Produkt und seine Verwendung verfügbar nur sichere Produkte (CE-Kennzeichnung, wo zutreffend) ver-
(Mindestinhalte von Betriebsanleitungen) und ohne Konfor- wendet werden dürfen und die Arbeit durch die Arbeitgeberin
mitätserklärung gibt es für den Betreiber keine Gewährleis- oder den Arbeitgeber sicher gestaltet und laut ASchG § 4 eine
tung, dass das Produkt auch tatsächlich sicherheitsgerichtet Arbeitsplatzevaluierung durchgeführt werden muss.
entwickelt und gebaut wurde. Damit fällt dem Betreiber eines
passiven Exoskeletts die größere Aufgabe und Verantwortung Die Einhaltung der Vorschriften fordert vom Betreiber eines
zu, nämlich die Durchführung einer detaillierten Arbeitsplatze- Arbeitsmittels eine entsprechende sicherheitstechnische Arbeits-
valuierung. platzevaluierung. Um eine Arbeitsplatzevaluierung sauber und
korrekt durchführen zu können, bedarf es einschlägigen Know-
Da ein Exoskelett wie ein Anzug am Körper anliegt, ist die hows in den Bereichen Safety sowie Security und fundierte
ergonomische Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Körper- Kenntnis über die Funktionsweise der eingesetzten Technologie.
185.2 Gefährdungsbeurteilung und (eng anliegend, isolierend etc.) nicht gegeben ist. Die PSA muss
Methoden zur Absicherung daher gegebenenfalls angepasst werden, damit sie weiterhin
ihren Zweck erfüllt, ohne die Bewegungsfreiheit des Anwenders
Als Verfahrensnorm für die Gefährdungsbeurteilung bei der zu beeinträchtigen. Vorgaben diesbezüglich bietet die PSA-
Produktentwicklung eignet sich die EN ISO 12100, die auch Verordnung (PSAV). Sinngemäß Gleiches gilt auch für spezielle
bei der Maschinenkonstruktion vorgesehen ist. Mit deren Arbeitskleidung, wie z. B. dicke Hosen und Jacken, Schürzen
Gefährdungslisten können die meisten Gefährdungen erkannt oder Overalls.
und mit den Anforderungen aus den entsprechenden gelten-
den Verordnungen wie z. B. mit der EMF-Verordnung (EMF: 5.2.2 Arbeitsplatzgestaltung
elektromagnetische Felder) abgeglichen werden. Bedingt durch
das Alter der Norm werden jedoch nicht alle heute bekannten Weitere Einflussfaktoren für die Sicherheit und die korrekte
Gefährdungen und genutzten Technologien behandelt und Funktion sind der Platzbedarf, das Arbeitsumfeld und der
auch nur solche beschrieben, die unmittelbar mit dem Arbeits- Einsatzort von Exoskeletten.
mittel oder der Tätigkeit am Arbeitsmittel zusammenhängen.
Hier gilt es durch entsprechende Expertise, Anpassungen und Während passive Exoskelette gut beherrschbare Anforde-
Erweiterungen bei der Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen. rungen an die Arbeitsplatzgestaltung stellen, sind aktive
Exoskelette im Vergleich zu passiven größer und stellenweise
Safety und Security
Neben der vorgesehenen betrieblichen Tätigkeit mit dem Exo- sperriger, wodurch die Interaktionsmöglichkeit mit Maschinen
skelett ist ergänzend die Betrachtung all jener Vorgänge durch oder eine unpassende Arbeitsraumgestaltung zu Problemen
eine Arbeitsplatzevaluierung erforderlich, die während der Zeit bei der Durchführung der Tätigkeiten führen kann. Zudem
der Verwendung auch noch vernünftigerweise vorkommen muss das zusätzliche Gewicht des Exoskeletts als Belastung für
können. Das beginnt mit der Verwahrung und den Vorkehrun- den Benutzer während seiner Anwendung, bei einem Sturz
gen beim An- und Ablegen des Exoskeletts und endet nicht oder Fall sowie beim Aufstehen berücksichtigt werden.
bei der Evakuierung und Vorkehrungen gegen Sturz und Fall.
Darüber hinaus gilt es im Sinne der ganzheitlichen Sicherheits- Bei Bedarf muss der Fluchtweg entsprechend gestaltet werden,
betrachtung Safety und Security und aufgrund der Wechsel- falls das Exoskelett nicht abgelegt werden kann, damit auch mit
wirkung zwischen der das Exoskelett tragenden Person und geringerer Gehgeschwindigkeit oder größeren Konturen in der
alle anderen Aspekten des ArbeitnehmerInnenschutzes (von vorgesehenen Zeit ein sicherer Ort erreicht werden kann. In die-
der Arbeitsstätte über technische Sicherheitsaspekte bis hin zur sem Zusammenhang müssen bei kabelgebundenen Systemen
Persönlichen Schutzausrüstung), diese sorgfältig zu betrachten. entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Für kabelge-
bundene und kabellose aktive Exoskelette müssen zudem die
5.2.1 Kompatibilität mit Persönlicher Einsatzdauer, die Energieversorgung und die Maßnahmen bei
Schutzausrüstung (PSA) Störung der Energieversorgung entsprechend dem Anwen-
dungszweck evaluiert und berücksichtigt werden.
Exoskelette als Assistenzsystem bietet aus ergonomischer
Sicht einen deutlichen Vorteil für die physische Entlastung der Die Gewährleistung der Funktionalität des Exoskeletts hängt in
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allerdings kann der Einsatz erster Linie von den Witterungs- und Umgebungsbedingungen
auch zu potenziellen Gefährdungen führen, wenn die Kompa- ab, wie z. B. Feuchtigkeit und Staub. Des Weiteren muss der
tibilität mit der PSA und ihren unterschiedlichen Eigenschaften Kontakt mit Arbeitsstoffen und die dadurch möglicherweise
19Sie können auch lesen