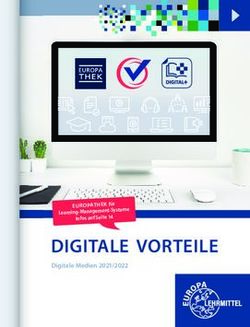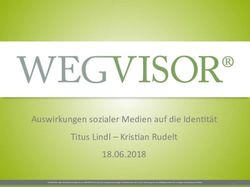Fachcurriculum des Städtischen Gymnasiums Gütersloh im Fach Deutsch
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Fachcurriculum des Städtischen Gymnasiums Gütersloh im Fach Deutsch für die Abiturjahrgänge ab 2021 (Stand Oktober 2021) Der Kernlehrplan Deutsch gibt für die Gestaltung des Fachcurriculums zu vermittelnde Kompetenzen (Grundkompetenzen und besondere Kompetenzen) und zu behandelnde inhaltliche Schwerpunkte aus vier Inhaltsfeldern vor. Die besonderen Kompetenzen resultieren hierbei aus der Vermittlung der Grundkompetenzen anhand von Unterrichtsgegenständen zu den inhaltlichen Schwerpunkten. Die Wahl der Unterrichtsgegenstände zu den Schwerpunkten ist der gemeinschaftlichen Entscheidung der Fachlehrer überlassen. Für die Curricula der Qualifikationsphase sind diese an die wechselnde Obligatorik des Zentralabiturs gebunden. Im folgenden Curriculum sind die zu vermittelnden Grundkompetenzen dem Stoffverteilungsplan vorangestellt und die zu vermittelnden besonderen Kompetenzen sind den Gegenständen zugeordnet, aus deren Behandlung sie sich ergeben. Die vier Inhaltsfelder sind in wechselnder Reihenfolge je nach Bedeutung für das Unterrichtsvorhaben als Aspekte 1 bis 4 der Gegenstände angegeben. Die inhaltlichen Schwerpunkte bei der Behandlung der Gegenstände sind den Themen oder deren Aspekten zugeordnet. Vom Schuljahr 2017/18 an sind in den Fachcurricula berufsorientierende Lernziele und Inhalte auszuweisen. Grundsätzlich dienen auch die Persönlichkeitsbildung und die Vermittlung der deutschen Hochsprache der Orientierung auf dem Ausbildungsweg. Sie sind aber nicht in erster Linie berufsbezogen, sondern Selbstzwecke. Besondere Bedeutung besitzt das Fach Deutsch natürlich für alle Studiengänge und Ausbildungen, die mit ihm inhaltliche Übereinstimmungen aufweisen, wie die Germanistik oder den Journalismus. Auf solche Sonderfälle sollen die Hervorhebungen aber nicht eingeschränkt sein. Im Folgenden sind also nur solche Inhalte und Ziele (durch den Zusatz „bo.“) gekennzeichnet, die in besonderem Maße allgemein berufsorientierend sind.
Curriculum für die Einführungsphase Zu vermittelnde Grundkompetenzen (bo.): Rezeption Die Schülerinnen und Schüler können… Methoden der Informationsentnahme aus mündlichen und schriftlichen Texten in verschiedenen medialen Erscheinungsformen sicher anwenden, aus Aufgabenstellungen Leseziele ableiten, fachlich angemessene analytische Zugänge zu Sprache, Texten, Kommunikation und Medien entwickeln, Verfahren der Textuntersuchung unterscheiden, diese angemessen einsetzen und die Ergebnisse zu einer Textdeutung zusammenführen, sprachliche Gestaltungsmittel, Texte, kommunikatives Handeln und mediale Gestaltung in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Kontext beurteilen, eigene und fremde Beiträge und Standpunkte überprüfen und kriteriengeleitet beurteilen. Produktion Die Schülerinnen und Schüler können… Schreibprozesse aufgaben- und anlassbezogen planen, gestalten und das Produkt überarbeiten, formal sicher und stilistisch angemessen eigene schriftliche und mündliche Texte dem kommunikativen Ziel entsprechend formulieren, eigene Positionen zu fachspezifischen Sachverhalten entwickeln und argumentativ vertreten, Formen des Sprechens in verschiedenen Kommunikationssituationen unterscheiden und Beiträge adressatenbezogen und zielgerichtet gestalten, Präsentationstechniken funktional anwenden, Rückmeldungen kriterienorientiert und konstruktiv formulieren.
1. Thema Musterfälle: Zu vermittelnde besondere Fähigkeiten und
Selbstfindung als Thema Fertigkeiten
der Gegenwartsprosa
Aspekt 1: Einführung in die o erzählende Texte unter Berücksichtigung
Texte Analyse von grundlegender Strukturmerkmale analysieren
Erzähltexten: o den Zusammenhang von Teilaspekten und dem
Kurzprosa oder Textganzen zur Bestimmung der Textbedeutung
Romanausschnitte der nutzen (bo.)
Gegenwart (auch in o beschreibende, deutende und wertende Aussagen
Verfilmung) und unterscheiden (bo.)
Rezensionen hierzu; o Fiktionalitätssignale identifizieren
Erzähltext aus einem o die Bedeutung historisch-gesellschaftlicher Bezüge
anderen Kulturkreis eines literarischen Werkes an Beispielen aufzeigen
(evtl. als Verfilmung)
o zwischen Ergebnissen textimmanenter
(Schwerpunkt:
Untersuchungsverfahren und dem Einbezug
Erzähltexte)
textübergreifender Informationen unterscheiden
o mithilfe textgestaltender Schreibverfahren
(Ergänzung, Weiterführung usw.) interpretieren
Aspekt 2: wertende Darstellung; o sprachliche Elemente im Hinblick auf informierende,
Sprache Autor, Erzähler und argumentierende oder appellierende Wirkungen
Erzählperspektive erläutern (bo.)
lineares Erzählen von o die Bedeutung sprachlicher Gestaltungsmittel für die
Strängen gleichzeitigen Textaussage erläutern (bo.)
Geschehens o Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung
überarbeiten (bo.)
(Schwerpunkt: o die Bedeutung sprachlicher Gestaltungsmittel für die
Funktionen und Textaussage erläutern (bo.)
Strukturmerkmale der o grammatische Formen identifizieren und deren
Sprache) funktionsgerechte Verwendung prüfen (bo.)
Aspekt 3: Einführung in die o Analyseergebnisse durch korrekte Textbelege
Kommu- Hermeneutik: Grenzen (Zitate, Verweise, Paraphrasen) absichern (bo.)
nikation der Verständigung o Kommunikationsprozesse anhand zweier
zwischen historischem Kommunikationsmodelle erläutern
Autor und Rezipient; o die Darstellung von Gesprächen in literarischen
die Abhängigkeit von Texten unter Beachtung von kommunikations-
Autor und Aussage vom theoretischen Aspekten analysieren
Entstehungs- u. o Kommunikationsstörungen identifizieren und das
Rezeptionskontext eigene Gesprächsverhalten reflektieren (bo.)
o verschiedene Strategien der Leser- bzw.
Hörerbeeinflussung in rhetorisch ausgestalteter
Kommunikation identifizieren (bo.)
o Beiträge und Rollen in Fachgesprächen sach- und
adressatengerecht gestalten (bo.)
o sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit auf
andere beziehen (bo.)
Aspekt 4: Sprache als Medium der o mediale Gestaltungen zu literarischen Texten
Medien Gedankenbildung und entwickeln
Selbstfindung; Literatur o Arbeitsergebnisse in kontinuierlichen und
als Medium kollektiver diskontinuierlichen Texten darstellen (bo.)
Erfahrung o die mediale Vermittlungsweise als konstitutiv für
Aussage und Wirkung herausarbeiten (bo.)2. Thema Die Bretter, die die Welt Zu vermittelnde besondere Fähigkeiten und
bedeuten: Ausdrucks- Fertigkeiten
mittel und Kommunika-
tionsformen im Drama
Aspekt 1: Einführung in die o dramatische Texte unter Berücksichtigung
Texte Dramenanalyse grundlegender Strukturmerkmale der literarischen
(möglichst i.Verb.m. Gattung analysieren und dabei eine in sich schlüssige
Theaterbesuch): Deutung entwickeln
Sophokles: „Antigone“; o Texte unter Berücksichtigung der Kommunikations-
die Aristotelische Theorie situation, des Adressaten und der Funktion gestalten
der Tragödie, ggf. im (bo.)
Vergleich zu Brechts o literarische Texte mithilfe textgestaltender
epischem Theater („Der Schreibverfahren (u.a. Ergänzung Weiterführung,
gute Mensch von Verfremdung) analysieren
Sezuan“) oder Lessing: o mediale Gestaltungen zu literarischen Texten
„Emilia Galotti“, Theorie entwickeln
des
bürgerl. Trauerspiels
Aspekt 2: monologische und o verschiedene Strategien der Leser- bzw.
Kommu- dialogische Rede; Hörerbeeinflussung in rhetorisch ausgestalteter
nikation (Schwerpunkt: Kommunikation identifizieren (bo.)
Gesprächsanalyse) o die Darstellung von Gesprächssituationen in
Sprechhandlungen (im literarischen Texten unter Beachtung von
Drama und in kommunikationstheoretischen Aspekten analysieren
Alltagssituationen) o Kommunikationsprozesse aus Alltagssituationen
untersuchen, Einführung anhand zweier unterschiedlicher
der Kommunikationsmodelle erläutern
Kommunikationsmodelle o den Verlauf fachbezogener Gesprächsformen
von Friedemann Schulz von konzentriert verfolgen (bo.)
Thun und Paul Watzlawick o sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit auf
andere beziehen, Fachgespräche und andere
Kommunikationssituationen sach- und
adressatengerecht gestalten (bo.)
o Kommunikationsstörungen bzw. die Voraussetzun-
gen für gelingende Kommunikation identifizieren
und Gesprächsverhalten reflektieren (bo.)
Aspekt 3: berichtende, o kriteriengeleitet eigene und fremde
Sprache argumentative, appellative Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen
und manipulative kommunikativen Kontexten (Gespräch, Diskussionen,
Sprachverwendung (bo.) Feedback zu Präsentationen) beurteilen
o Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten
kriterienorientiert analysieren und ein konstruktives
und wertschätzendes Feedback formulieren
(bo.)
Aspekt 4: Theater als Einrichtung Verbindung textanalytischer,
Medien exemplarischer historiographischer und ideologiekritischer Befunde
Darstellung und (bo.)
kollektiver
Meinungsbildung3. Sprechen und Sprache Zu vermittelnde besondere Fähigkeiten und
Thema Fertigkeiten
Aspekt Strukturmerkmale o Ebenen von Sprache unterscheiden
1: Texte u. Funktionen der Sprache, u.a.: (phonologische, morphematische,
Ferdinand de Saussure: Die Natur syntaktische, semantische und
des sprachlichen Zeichens (z.B. pragmatische Aspekte) (bo.)
anhand: Bichsel: Ein Tisch ist ein o komplexe kontinuierliche und
Tisch) diskontinuierliche Sachtexte mithilfe
Sprachgebrauch, textimmanenter Aspekte und
u.a. manipulativer Gebrauch (z.B. textübergreifender Informationen
Klemperer: Zur Sprache des Dritten analysieren (bo.)
Reiches) o Sachtexte in ihrer Abhängigkeit von
Situation, Adressat, und Textfunktion
unterscheiden (bo.)
o Textmuster bei der Erstellung von
analysierenden, informierenden,
argumentierenden Texten und beim
produktionsorientierten Schreiben
einsetzen (bo.)
Aspekt Aspekte der Sprachentwicklung, o Sprachvarietäten erläutern und deren
2: z.B. Funktion an Beispielen der Fachsprache
Sprach o Sprachvarietäten (u.a. beschreiben (bo.)
e Fachsprachen) o aktuelle Entwicklungen in der deutschen
o Soziolekt / Dialekt Sprache und ihre soziokulturelle Bedingtheit
o Sprachwandel (z.B. erklären
Kiezdeutsch, Anglizismen, Jargon)
Schwerpunkt: Arbeit mit
Sachtexten (z.B. argumentative
Texte zur Sprachpflege) (bo.)
Aspekt Gesprächsanalyse: o den Verlauf fachbezogener Gesprächs-
3: Ursachen und Aufklärung von formen konzentriert verfolgen (bo.)
Komm Missverständnissen o kriteriengeleitet eigene und fremde
u- Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen
nikatio kommunikativen Kontexten (Gespräch,
n Diskussion, Feedback zu Präsentationen)
beurteilen (bo.)
o Kommunikationsstörungen bzw. die
Voraussetzungen für gelingende
Kommunikation identifizieren und
Gesprächsverhalten reflektieren (bo.)
o sich explizit auf andere beziehen (bo.)
o sach- und adressatengerecht präsentieren
(bo.)
Aspekt Sprachliche Konventionen und o selbstständig Präsentationen unter
4: Einrichtungen als Konstituenten funktionaler Nutzung neuer Medien
Medie des Sprachsystems (Präsentationssoftware) erstellen (bo.)
n o die funktionale Verwendung von Medien für die
Aufarbeitung von Arbeitsergebnissen in einem
konstruktiven kriterienorientierten Feedback
beurteilen (bo.)4. Thema Medien Zu vermittelnde besondere Fähigkeiten und
Fertigkeiten
Aspekt 1: Formen, Wirkungsweisen o die mediale Vermittlungsweise von Texten –
Medien u. Funktionen klassischer audiovisuelle Medien und interaktive Medien- als
Massenmedien und konstitutiv für Gestaltung, Aussage und Wirkung
neuer interaktiver eines Textes herausarbeiten (bo.)
Medien (bo.) o Besonderheiten von digitaler Kommunikation (u.a.
(Schwerpunkte: Informa- Internet-Communities) als potentiell öffentlicher
tionsdarbietung in ver- Kommunikation (u.a. Verfügbarkeit, Aufhebung von
schiedenen Medien, Privatheit, Langfristigkeit, etwaige Konsequenzen für
Sendeformate in audio- Bewerbungssituationen) erläutern und beurteilen (bo.)
visuellen Medien, o ein typisches Sendeformat (z.B. Serie, Show,
digitale Medien u. ihr Ein- Nachrichtensendung) in audiovisuellen Medien in
fluss auf Kommunikation, Bezug auf Struktur, Inhalt und handelnde Personen
Sprachvarietäten am Bei- analysieren und Beeinflussungspotentiale in Bezug auf
spiel von Fachsprache), Nutzerinnen und Nutzer kriterienorientiert beurteilen
Texte zu Klassifikation u. (bo.)
Funktionsbestimmung o selbstständig und sachgerecht Arbeitsergebnisse in
von Medien; Form von diskontinuierlichen und kontinuierlichen
medienkritische Sach- Texten mithilfe von Textverarbeitungssoftware
texte (z.B. von Enzens- darstellen (bo.)
berger, Günther Anders,
Dieter E. Zimmer und
Norbert Bolz)
Aspekt 2: Erörternde Auseinander- o Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse
Kommu- setzung mit argumenta- sachgerecht protokollieren (bo.)
nikation tiven Sachtexten (z.B.
Vergleich und Diskussion
medienkritischer
Positionen) (bo.)
Aspekt 3: Sprachvarietäten am o unterschiedliche sprachliche Elemente im
Sprache Beispiel von Fachsprache Hinblick auf ihre informierende, argumentierende
(Sachtexte oder oder appellierende Wirkung erläutern (bo.)
literarische Texte über o
die Beeinflussung der
Sprache durch digitale
Medien) (bo.)
Aspekt 4: Sachtexte verschiedener o sachgerecht und kritisch zwischen Methoden
Texte Medien (bo.) der Informationsbeschaffung unterscheiden, für
fachbezogene Aufgabenstellungen in Bibliotheken
und im Internet recherchieren (bo.)
o Einübung von Arbeitstechniken zum
Verfassen informierender oder
argumentierenderTexte mithilfe von Materialien
(Aufgabentyp 4) (bo.)5. Thema Naturlyrik - Zu vermittelnde besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten
Wandel der
Naturlyrik in der Zeit
Aspekt 1: Einführung in o sprechgestaltende Mittel funktional in
Sprache die mündlichen Texten einsetzen (bo.)
Lyrikanalyse:
die Semantik
bildlicher
Ausdrücke;
berichtende und
darstellende,
expressive und
appellative
Sprachverwendung;
poetologische
Grundbegriffe
Aspekt 2: Natur-Lyrik o literarische Texte durch einen gestaltenden
Texte verschiedener Vortrag interpretieren
Epochen o die Bedeutung historisch-gesellschaftlicher
analysieren Bezüge eines literarischen Werkes an
Beispielen aufzeigen
o lyrische Texte unter Berücksichtigung grundlegender
Strukturmerkmale der literarischen Gattung analysieren
und dabei eine in sich schlüssige Deutung
(Sinnkonstruktion) entwickeln
Aspekt 3: Präsentation von o sach- und adressatengerecht – unter
Kommu- Gedichten; Referat Berücksichtigung der Zuhörermotivation –
nikation zum historischen- komplexe Beiträge (u.a. Referat,
ideologischen Arbeitsergebnisse) präsentieren (bo.)
Hintergrund o Mimik, Gestik, Betonung und Artikulation in
einzelner Werke eigenen komplexen Redebeiträgen funktional
einsetzen (bo.)
o selbstständig Präsentationen unter
funktionaler Nutzung neuer Medien
(Präsentationssoftware) erstellen (bo.)
o die funktionale Verwendung von Medien für
die Aufbereitung von Arbeitsergebnissen in
einem konstruktiven, kriterienorientierten
Feedback
beurteilen (bo.)
Aspekt 4: Medien o sachgerecht und kritisch zwischen Methoden
Medien historischer der Informationbeschaffung unterscheiden;
Information, z.B. für fachbezogene Aufgabenstellungen in
Internet (bo.) Bibliotheken
und im Internet recherchieren (bo.)Mögliche Aufgabenarten zu den Themen 1. Gegenwartsprosa Aufgabenart Typ A Analyse eines erzählenden Textes (ggf. mit weiterführendem I Schreibauftrag) Aufgabenart Typ B Vergleichende Analyse von erzählenden Texten ( ggf. I mit weiterführendem Schreibauftrag) Aufgaben Typ B Erörterung eines Sachtextes, z.B. einer Rezension mit Bezug art III auf einen Erzähltext (bo.) Aufgaben Typ B Vergleichende Analyse von Rezensionen eines Erzählwerkes art II ( ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag) 2. Drama Aufgabenart Typ A Analyse eines Dramenauszugs (ggf. mit I weiterführendem Schreibauftrag) Aufgabenart Typ B Vergleichende Analyse von dramatischen Texten ( ggf. I mit weiterführendem Schreibauftrag) Aufgaben Typ B Erörterung eines Sachtextes, z.B. einer Theaterkritik mit Bezug art III auf ein Drama Aufgaben Typ B Vergleichende Analyse von Theaterkritiken ( ggf. art II mit weiterführendem Schreibauftrag)
3.Sprechen und Sprache
Aufgaben Typ A Analyse eines Sachtextes zur Sprache (ggf. mit
art II weiterführendem Schreibauftrag) (bo.)
Aufgaben Typ B Erörterung eines Sachtextes zur Sprache in Bezug auf
art III einen literarischen Text (bo.)
Aufgaben Typ A Erörterung von Sachtexten zur Sprache (bo.)
art III
Aufgaben Materialgestütztes Verfassen eines Sachtextes zur Sprache (bo.)
art IV
4. Medien
Aufgaben Typ A Analyse eines Sachtextes zu Thema (ggf. mit weiterführendem
art II Schreibauftrag) (bo.)
Aufgaben Typ B Vergleichende Analyse von Sachtexten, z.B. medienkritischen
art II Texten mit unterschiedlicher Positionierung zu einem Thema
(bo.)
Aufgaben Typ A Erörterung von Sachtexten zu Medien (bo.)
art III
Aufgabent Materialgestütztes Verfassen eines Textes mit
yp IV fachspezifischem Bezug (bo.)
5.Naturlyrik
Aufgabenart Typ A Analyse eines Gedichts (ggf. mit weiterführendem
I Schreibauftrag)
Aufgabenart Typ B Vergleichende Analyse eines Gedichts mit einem anderen oder
I mit einem thematisch verwandten literarischen Text anderer Art
( ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag)
Aufgaben Typ B Erörterung eines Sachtextes, z.B. einer Rezension mit Bezug
art III auf einen lyrischen Text ( ggf. mit weiterführendem
Schreibauftrag)
Aufgaben Typ B Vergleichende Analyse von Gedichtrezensionen ( ggf.
art II mit weiterführendem Schreibauftrag)
Zentrale Klausur am Ende der Einführungsphase im Jahr 2022: Analyse eines
literarischen Textes (ggf. mit weiterführendem Schreibauftrag) zur Naturlyrik
© Gru/Kle, Oktober 2021Sie können auch lesen