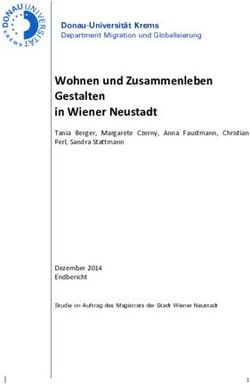FAHRPLAN NACHHALTIGE MOBILITÄT - Impulse und Potenziale für den Ausbau nachhaltiger Mobilität in der Region Stuttgart
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
W I R T S C H A F T S F Ö R D E R U NG R E G I O N S T U T T G A RT G M B H F R A U N H O F E R - I NS T I T U T F Ü R A RB E I T S W I RT S C HA F T U N D O R G A N I S A T I O N I A O P T V P L A N U N G T RA N S P O R T V E RK E H R A G FAHRPLAN NACHHALTIGE MOBILITÄT Impulse und Potenziale für den Ausbau nachhaltiger Mobilität in der Region Stuttgart
Inhalt
Einführung ....................................................................................................................... 2
i. Nachhaltige Mobilität in der Region Stuttgart – eine Einordnung ......................... 2
ii. Definition: Nachhaltige Mobilität .......................................................................... 3
iii. Leitlinien für nachhaltige Mobilität in der Zukunft ................................................ 3
iv. Wandlungstreiber einer nachhaltigen Mobilität .................................................... 4
v. Die Bedeutung eines Leitbilds für nachhaltige Mobilität ....................................... 4
1 Mobilität in der Region Stuttgart – Status quo .............................................. 5
1.1 Verkehrsaufkommen und Modal-Split .................................................................. 5
1.2 Konsequenzen (ökologisch, wirtschaftlich, sozial) ................................................. 6
1.2.1 Allgemeine Implikationen ..................................................................................... 6
1.2.2 Ökologische Aspekte ........................................................................................... 6
1.2.3 Wirtschaftliche Aspekte ....................................................................................... 7
1.2.4 Soziale Aspekte .................................................................................................... 8
1.3 Zuständigkeiten und aktuell laufende Planungen ................................................. 9
2 Aktionsfelder für nachhaltige Mobilität in der Region Stuttgart ................. 11
2.1 MIV .............................................................................................................................. 11
2.2 ÖPNV ........................................................................................................................... 11
2.3 Rad- / Fußverkehr ......................................................................................................... 11
2.4 Güter-verkehr ............................................................................................................... 12
2.5 Liefer-verkehr ............................................................................................................... 12
3 Instrumente für nachhaltige Mobilität in der Region Stuttgart ................... 13
3.1 Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ......................... 13
3.2 Intermodale Mobilitätsansätze ............................................................................. 13
3.3 Elektrifizierung des Antriebsstrangs ...................................................................... 14
3.4 Sozial integrative Ansätze .................................................................................... 14
3.5 Wirtschaftsförderung und -koordination .............................................................. 15
3.6 Verkehrsplanung .................................................................................................. 15
3.7 Stadt- und Regionalplanung ................................................................................. 16
4 Aktuelle Programme für nachhaltige Mobilität ............................................. 17
4.1 Übersicht über die heutigen Programme .............................................................. 17
4.1.1 Modellregion Elektromobilität Stuttgart ............................................................... 17
4.1.2 CARS - Clusterinitiative Automotive der Wirtschaftsförderung Region
Stuttgart 17
4.1.3 Nachhaltig Mobile Region Stuttgart (NaMoReg Stuttgart) .................................... 17
4.1.4 Landesinitiative Elektromobilität in Baden-Württemberg ...................................... 18
4.1.5 Nationale Programme .......................................................................................... 18
5 Fahrplan für nachhaltige Mobilität ................................................................. 20
5.1 Impulse für den regionalen Ausbau nachhaltiger Mobilität ................................... 20
5.2 Beispielmaßnahmen und zeitliche Einordnung ..................................................... 21
5.3 Regionaler Fahrplan für nachhaltige Mobilität ...................................................... 22
5.3.1 Schnittstellen mit „Nachhaltig Mobile Region Stuttgart‚ ..................................... 23
5.3.2 Schnittstellen mit dem Schaufensterprogramm der Bundesregierung ................... 24
5.3.3 Schnittstellen mit dem Spitzenclusterwettbewerb des BMBF ................................ 24
5.3.4 Schnittstellen mit den Leuchtturmprojekten der Bundesregierung ........................ 24
6 Anhang .............................................................................................................. 25ff
1Einführung
i. Nachhaltige Mobilität in der Region Stuttgart – eine Einordnung
Ebenso wie Mobilität ein Grundbedürfnis unserer Gesellschaft ist, ist sie auch Ausdruck unserer
individuellen Entscheidungsfreiheit und damit ein Kernelement unserer zivilisatorischen
Errungenschaften. Mobilität ist mehr als nur Verkehr. Sie garantiert uns, dass wir jederzeit den
Standort wechseln können, unabhängig von Zweck, Verkehrsmittel und Zeit.
Die Region Stuttgart ist eine der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas mit einer
überdurchschnittlich hohen Lebensqualität für ihre Bewohner. Als solche hat sie internationalen
Vorbildcharakter, muss aber auch die zukünftige Befriedigung der Bedürfnisse ihrer Einwohner
garantieren. Hierbei befindet sie sich in einem internationalen Wettbewerb um attraktive
Industriestandorte und Humankapital. Mobilität erfüllt dabei zwei Kernbedingungen für
Wirtschaft und Gesellschaft:
Mittels effizienter Infrastruktur bietet sie die Rahmenbedingungen für Logistik,
Güterverkehr und erfolgreichen Wirtschaftsaustausch.
Als Kernelement persönlicher und gesellschaftlicher Freiheit bietet Mobilität individuelle
und kollektive Entscheidungsfreiheit in der Fortbewegung.
Hierdurch steht Mobilität nicht nur im Zentrum regionaler Wirtschaftsplanung, sie hat
mindestens eine genauso große Rolle, wenn es um die Lebensqualität für Menschen in der
Region Stuttgart geht. Dabei ist Mobilität charakterisiert durch Anforderungen und Ansprüche
unterschiedlichster Gesellschaftsakteure. Die folgende Grafik verdeutlicht dieses Verhältnis:
Umwelt
Individuum /
Wirtschaft Gesellschaft
Politik
Abbildung 1: Die Dimensionen von Mobilität (Quelle: Fraunhofer IAO)
2Das Mobilitätssystem hat sich über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte gemäß den
politischen und gesellschaftlichen Prioritäten entwickelt. Bei derart unterschiedlichen und zum
Teil gegenläufigen Anforderungen war es unmöglich, alle Anforderungen gleichermaßen zu
berücksichtigen und ein perfekt ausbalanciertes System zu entwickeln. Der Status quo der
Mobilität in der Region Stuttgart ist deshalb gekennzeichnet durch einen Mangel an
Nachhaltigkeit – vor allem im Sinne der Schonung von natürlichen Ressourcen und der
Umweltfreundlichkeit.
Um langfristig allen Ansprüchen gerecht werden zu können, muss die Mobilität in der Region
Stuttgart in einen nachhaltigen Zustand überführt werden; einen Zustand, der alle
Anforderungen gleich stark berücksichtigt und die Mobilitätsgrundlage zukünftiger
Generationen wahrt.
ii. Definition: Nachhaltige Mobilität
Nachhaltige Mobilität in der Region Stuttgart ermöglicht soziale und wirtschaftliche
Entwicklung, schützt dabei die Gesundheit von Menschen und Umwelt und steigert die
Lebensqualität in der Region. Hierfür definieren wir nachhaltige Mobilität als ein System, das
wichtige Funktionen auf der sozialen, der ökologischen und der wirtschaftlichen Ebene
bereitstellt:
Nachhaltige Mobilität steht für eine wirtschaftliche Entwicklung der Region Stuttgart. Sie
schafft unternehmerische Perspektiven, ermöglicht soziale und wirtschaftliche
Verbindungen und steigert die Lebensqualität in der Region.
Nachhaltige Mobilität stellt sicher, dass alle Menschen in der Region Stuttgart
erschwinglichen Zugang zu einem effizienten Mobilitätssystem haben. Sie können ihr
bevorzugtes Transportmittel wählen und individuelle, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten werden gewährleistet.
Nachhaltige Mobilität sorgt dafür, dass Mensch und Umwelt nicht belastet werden,
indem sie Emissionen und Umweltverschmutzung auf die Tragfähigkeit der regionalen
Ökosysteme begrenzt, erneuerbare Ressourcen verwendet, den Verbrauch nicht-
erneuerbarer Ressourcen senkt sowie Lärmbelastung und Flächenverbrauch minimiert.
iii. Leitlinien für nachhaltige Mobilität in der Zukunft
Die Leistungsfähigkeit des regionalen Hauptstraßennetzes muss erhalten bleiben.
Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz oder Verringerung von Verkehrsbelastung
müssen am jeweiligen Bedarf entwickelt werden.
Ein effizienter ÖPNV mit hoher Taktfrequenz, attraktiven Preismodellen und Tarifen stellt
sicher, dass ein Maximum an Mobilität auch ohne Pkw gewährleistet wird.
Besonders in urbanen Zentren sind Belastungen durch motorisierten Verkehr (Lärm,
Emissionen) zu minimieren. Dabei steht die Lebensqualität der Bevölkerung im Fokus.
Die Potenziale neuer Mobilitätsformen auf Basis regenerativer Energien werden erkannt
und ausgeschöpft.
Der steigenden Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologie im
Mobilitätssektor wird Rechnung getragen.
Eine vernetzte Raumplanung, Stadtplanung und Verkehrsplanung bietet die Möglichkeit,
vorhandene Initiativen mit neuen Ansätzen zu verknüpfen.
3iv. Wandlungstreiber einer nachhaltigen Mobilität
Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung wird von Faktoren beeinflusst, die sich
oftmals nicht – oder nur schwer – beeinflussen lassen, allerdings eine große Auswirkung haben.
Der Mobilitätssektor unterliegt diesen Faktoren ebenso wie andere Wirtschaftszweige und
Gesellschaftsbereiche. Neben einigen bremsenden Elementen wie z.B. vordefinierten
Produktionsketten und bestehender Infrastruktur, lenken derzeit eine Vielzahl von Faktoren den
Mobilitätssektor in Richtung einer nachhaltigen Mobilität. Über eine Analyse dieser
Wandlungstreiber lassen sich Ansatzpunkte heraus kristallisieren, die eine effektive Intervention
zu Gunsten von nachhaltiger Mobilität, und hiermit eine große Hebelwirkung entfalten.
Die Wandlungstreiber lassen sich den Hauptbereichen Gesellschaft, Umwelt, Politik und
Wirtschaft zuordnen:
Abbildung 2: Wandlungstreiber für eine nachhaltige Mobilität (Quelle: Fraunhofer IAO)
v. Die Bedeutung eines Leitbilds für nachhaltige Mobilität
Eine nachhaltige Mobilität in der Region Stuttgart bedarf in erster Linie eines Leitbilds, einer
handlungsleitenden Vision. Nur wenn man gemeinsam die zukünftige Mobilität definiert, die
man sich für die Region Stuttgart wünscht, lässt sich strategisch planen und eine langfristige
Politik verfolgen. Nur dann können Projekte vor dem Hintergrund einer klaren
Entwicklungsrichtung entworfen und durchgeführt werden; und nur vor dem Hintergrund einer
stimmigen Zukunftsvision können getroffene Maßnahmen und Projekte eindeutig beurteilt
werden und Transparenz zu Programmen und Evaluationen gewährleistet werden.
Die Entwicklung eines Leitbilds der nachhaltigen Mobilität für die Region Stuttgart, das in alle
angrenzenden Sektoren (Energie, Stadtentwicklung, etc.) ausstrahlt, wird deshalb als zentrales
Moment für den Erfolg nachhaltiger Mobilität in der Region Stuttgart gesehen.
41 Mobilität in der Region Stuttgart – Status quo
1.1 Verkehrsaufkommen und Modal-Split
Die Region lebt nicht nur wesentlich vom Fahrzeugbau, ihre wirtschaftliche und soziale
Funktionsfähigkeit ist auch von der Mobilität in der Region und in die Region abhängig.
Gleichzeitig muss sie sich mit den Folgen der Ausübung der Mobilität, die sich in Verkehr und
dessen beeinträchtigenden Wirkungen erlebbar und spürbar macht, auseinandersetzen.
In der Region fallen jährlich im Personenverkehr der Einwohner der Region ca. 2,8 Mrd. Wege
an. Dazu kommen ca. 80 Mio. Wege, die von Pendlern, die außerhalb der Region leben, in die
Region zurück gelegt werden, sowie der schwer abzugrenzende Personenwirtschaftsverkehr
(z.B. Dienstleistungswege und Wege im dienstlichen Interesse) und ein starkes
Güterverkehrsaufkommen innerhalb der Region sowie in und aus der Region, deren Wirtschaft
immer noch zu einem Drittel von der Produktion bestimmt ist.
Dabei ist es insbesondere der Güterverkehr, der wegen diverser Entwicklungen wie die stärkere
Arbeitsteilung zwischen Produktionsstandorten (Beispiel in der Region: Automobilbau und
Zulieferbetriebe) und dem zunehmend globalisierten Handeln und Produzieren, noch weiter
stark wachsen wird. Es sind keineswegs die klassischen, immer wieder zitierten Wege zur Arbeit
und zur Ausbildung, die das Bild dominieren, wie aus der Verteilung der Wegezwecke ersichtlich
ist:
Wege nach Aktivitäten in der Region Stuttgart [in Mio.]
1200 1.040
1000
800
600 475 495
400 288
216 190
200 75
0
Arbeit dienstlich/ Ausbildung, Schule Einkauf Freizeit Bringen, Holen private Erledigung
geschäftlich (Service)
Abbildung 3: Gesamtwege nach Wegezwecken (Quelle: PTV AG)
Bemerkenswert ist dabei, dass insgesamt die Wegezwecke Freizeit und Einkaufen mehr als die
Hälfte aller Wege ausmachen. „Klassische‚ arbeits- und ausbildungsbedingte Pendlerwege und
beruflich motivierte Wege machen nur ca. 30% der Wegezwecke aus.
Von allen Wegen entfallen ca. 46% auf das Verkehrsmittel Pkw (als Fahrer), woraus eine
Verkehrsleistung von ca. 15,3 Mrd. Pkw-km resultiert. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche
tägliche Verkehrsmenge der Einwohner der Region von ca. 42 Mio. Pkw-km. Ca. 29% der Wege
werden nicht motorisiert zurückgelegt, 14,5 % der Wege werden im Öffentlichen Verkehr
zurückgelegt. Auch diese Wege erfordern motorisierte Fahrten mit unterschiedlichen
Fahrzeugen. Die Betriebsleistung in der Region Stuttgart umfasste 2009
Ca. 16,0 Mio. Zug-km der S- und Regionalbahnen
Ca. 15, 8 Mio. Wagen-km im Stadt- und Straßenbahnverkehr
Ca. 53,5 Mio. Bus-km
Dabei ist eine gewisse Trendwende in der Verkehrsnachfrage zu erkennen. Beim Vergleich der
Ergebnisse der Erhebungen des aktuellen Regionalverkehrsplans mit denen aus dem Jahr 1995
5zeigt sich, dass der Anteil des Pkw als Hauptverkehrsmittel zurück gegangen ist, während die
Verkehrsmittel des Umweltverbundes ihren Anteil erhöhten. Insbesondere ist es bemerkenswert,
dass der Anteil des Fahrrades anstieg, was angesichts der demografischen Entwicklung und der
im Allgemeinen in der Region eher fahrradunfreundlichen Topografie überraschend ist.
60
49,1
46,5
50
Wege in %
40
30
21,5
20,6
14,5
12,2
20
10,1
11
7,4
6,8
10
0,3
0,1
0
zu Fuß Fahrrad Pkw-Fahrer Pkw- ÖV Sonstiges
Mitfahrer
1995 2009/10
Abbildung 4: Entwicklung des Modal Split im Personenverkehr (Quelle: PTV AG)
1.2 Konsequenzen (ökologisch, wirtschaftlich, sozial)
1.2.1 Allgemeine Implikationen
Es ist trotzdem augenfällig, dass der Verkehr der Region Stuttgart nach wie vor in sehr hohem
Maße auf der Benutzung des Pkw basiert. Allerdings zeigen die beobachtbaren Veränderungen
und die Analyse der Nachfrage auf, dass es Spielräume für die Entwicklung einer nachhaltigeren
Verkehrsmittelnutzung gibt. Zum einen kann man aus dem hohen Anteil von Freizeit- und
Einkaufsverkehr auf eine relativ große Flexibilität und Variabilität schließen und zum anderen,
das ergibt sich auch aus einem Rückgang der spezifischen Motorisierung (1999 waren es noch
559 Pkw pro 1000 Einwohner in der Region , 2009 nur noch 535), schwindet die Fokussierung
auf den Pkw, wenn auch nur in bisher kleinen Dosen, nichtsdestotrotz aber messbar.
1.2.2 Ökologische Aspekte
Der Verkehr belastet die natürliche und soziale Umwelt, nicht nur in der Region, massiv. Auch
wenn sich in den letzten Jahrzehnten die technischen Randbedingungen hinsichtlich spezifischer
Emissionen stark verbessert haben, so wurden sie in der Regel durch das Wachstum der
Verkehrsleistung zu einem guten Teil kompensiert. Nach wie vor ist der motorisierte Verkehr
einer der Hauptverursacher der Luftschadstoffbelastung in den urbanen Räumen, verursacht
massive Beeinträchtigungen der Wohnqualität durch Lärm und andere Effekte, nehmen
Verkehrsanlagen wertvolle Flächen in Anspruch und beeinträchtigen verbliebene Naturräume.
Nicht zuletzt verbraucht Verkehr (knappe) fossile Energie und ist einer der großen Emittenten
von CO2.
Die Statistik für die Region Stuttgart weist eine CO2-Emission des Verkehrs im Jahre 2008 von
ca. 4,6 Mio. Tonnen jährlich aus. Der Verkehr ist damit für ca. 30% der CO2-Emissionen der
Region ursächlich und die Emissionen auf dem Niveau von 1990. Das Minderungsziel von 20%
der Emissionen des Jahres 1990 ist damit noch in keiner Weise absehbar. Davon machen bei
vorsichtiger Schätzung die Emissionen aus den Pkw-Fahrten der Einwohner der Region alleine
ca. 3 Mio. Tonnen aus (wenn man die ermittelte Fahrleistung zugrunde legt). Genauere und
aktuellere Zahlen liegen derzeit nicht vor.
6Abbildung 5: CO2-Emissionen in der Region Stuttgart nach Emittenten Gruppen [1000t/a]
Nimmt man zwei toxische Luftschadstoffe, zeigt sich eine noch deutlichere Rolle des Verkehrs als
Emittent: Die NOx-Emissionen sind genauso wie die von nicht ‚methanhaltigen flüchtigen
organischen Kohlenwasserstoffverbindungen‘ hauptsächlich vom Verkehr bestimmt.
Bei den NOx-Emissionen von ca. 30.000 t (!) in 2007 in der Region Stuttgart gingen mit 20.500 t
ca. 68% auf den Verkehr zurück und bei den erwähnten Kohlenwasserstoffen emittiert der
Straßenverkehr auch über 65% der Gesamtemissionen. Dabei wurden 2007 durch den
Straßenverkehr 5.100 Tonnen in der Region emittiert, davon allein ca. 1.600 Tonnen durch
Verdunstungsemission (z.B. beim Tanken und Verteilen von Kraftstoffen). Die durch
Abgasemissionen freigesetzten Kohlenwasserstoffe entstehen dabei überwiegend auf
Innerortsstraßen (2370 Tonnen/a)!1
1.2.3 Wirtschaftliche Aspekte
Die Region Stuttgart muss mit ihrer Vielzahl von regionalen Zentren, die untereinander stark
verflochten sind, besondere Anforderungen an die Durchlässigkeit und Erreichbarkeit stellen.
Zudem erfordert es die industrielle Produktion, insbesondere Güter an die unterschiedlichen
Produktionsstandorte möglichst widerstandsarm transportieren und die Produkte aus der Region
exportieren zu können. Dazu kommen der Personenwirtschaftsverkehr und der Lieferverkehr, die
essentiell für die wirtschaftlichen Aktivitäten sind.
Der Anteil des Wirtschaftsverkehrs wird auf ca. 20 bis 30% des Personenverkehrs geschätzt und
umfasst Personenwirtschaftsverkehr (z.B. Handwerker und andere Dienstleistende), Lieferverkehr
(inklusive der KEP (Kurier, Express- und Paketdienste)) sowie den eigentlichen Güterverkehr.
Dabei ist beim Lieferverkehr zwischen den unterschiedlichen Lieferfunktionen zu unterscheiden:
Die Lieferung von Waren und Lebensmitteln hat ganz andere Logistikanforderungen als die KEP
und beide wiederum unterscheiden sich grundsätzlich von den Entsorgungsdiensten.
Der „richtige‚ Güterverkehr (produktionsbezogene Warenströme) braucht nicht nur Zugang zu
den Produktionsstandorten, sondern auch und insbesondere Zugang zu den intermodalen
Schnittstellen (Flugzeug, Bahn und Binnenschiff). Die hohe Belastung der Straßennetze bewirkt
dabei zunehmende Schwierigkeiten, die notwendige Funktionalität im Hinblick auf ausreichende
Verlässlichkeit und Erreichbarkeit zur Verfügung zu stellen.
1
Quelle (alle Emissionen): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
71.2.4 Soziale Aspekte
Ein weiterer Aspekt des Verkehrs, und insbesondere des Güterverkehrs, ist sein hohes
Belastungspotenzial, das sich insbesondere für die Wohnbevölkerung an den besonders
belasteten Straßen ergibt. Daraus resultiert im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von
qualitativ hochwertigen Wohnstandorten u.U. eine „ungerechte‚ Verteilung der Lasten. Das ist
auch und besonders unter regionalen Anforderungen zu sehen. Die Ausweisung von
Gewerbeflächen in einem Teil der Region kann zu wachsenden Belastungen in anderen führen
und Maßnahmen in einzelnen Kommunen können solche „Schieflagen‚ weiter vergrößern. Der
regional integrierte und kooperative Umgang mit dem Güterverkehr ist daher nicht nur unter
dem Aspekt der Effizienz (und Minimierung der Verkehrsleistung des Güterverkehrs zu sehen,
sondern auch unter sozialen Gesichtspunkten.
Die Region Stuttgart sieht sich, wie andere Regionen auch, wenngleich in anderem Ausmaß,
zwei großen Trends gegenüber
Demographischer Wandel
Absehbare Verknappung und Verteuerung fossiler Brennstoffe
Wenn die Region auch prosperiert und daher nach wie vor leichte Zuwanderungsgewinne
„erzielt‚, wird sich doch der demografische Wandel mittelfristig auswirken. Der Anteil der nicht
erwerbstätigen älteren Bevölkerung wird zunehmen und das Mobilitätsmuster der Bevölkerung
wird sich ändern im Hinblick auf die Wegezwecke, die Motorisierung und die räumliche
Verteilung der Nachfrage
Die Entwicklung ist auch aus der Statistik der letzten Jahre bereits erkennbar. Auch wenn die
Zahl der Erwerbstätigen naturgemäß von der Zahl der Gelegenheiten (Arbeit) abhängt und sich
dabei ein enger Zusammenhang mit der Wirtschaftsentwicklung und der Zuwanderung ergibt,
zeigt sich doch eine klare Entwicklung zur Verringerung der Erwerbsquote (Anteil der
Erwerbstätige), die auf die Demographie zurückzuführen sein dürfte.
Abbildung 6: Entwicklung der Einwohner und Erwerbstätigen in der Region Stuttgart
Die Sicherstellung der Möglichkeit zur Teilhabe durch die Sicherstellung der Mobilität ist damit
auch unter der Prämisse zu betrachten, dass eine strukturelle Änderung entsprechende
Änderungen im Verkehrsangebot erfordert. Das gilt umso mehr, als absehbar ist, dass die
Verkehrsteilnahme mittels Pkw (zumindest mit Verbrennungsmotor), sich auch im Verhältnis
zum verfügbaren Einkommen immer stärker verteuern wird. Um die Einkommensschwachen
und die Älteren nicht von der Mobilität auszuschließen, sind entsprechende Angebote
zumindest aufrecht zu erhalten.
8Im Jahr 2009 wurden im VVS 609,3 Mio. € für den ÖPNV aufgewendet. Bei einem
(vergleichsweise guten) Deckungsbeitrag von 57,3 % verblieben davon 260 Mio., die nicht
durch Einnahmen gedeckt waren und die als notwendige öffentliche Finanzierung auch, oder
sogar besonders, in Zukunft benötigt werden.
1.3 Zuständigkeiten und aktuell laufende Planungen
In der Region gibt es mannigfaltige Projekte und laufende Planungsprozesse, die sich auch oder
ausschließlich mit dem Verkehr und der Mobilität auseinandersetzen. Dabei kann man fünf
unterschiedliche Prinzipien identifizieren:
Explizite Verkehrsentwicklungspläne, die sich mit Verkehrsentwicklung, Infrastruktur-
und Angebotsplanung im Sinne von Umsetzungsvorgaben mit regulativer Wirkung
beschäftigen
Stadtentwicklungskonzepte und Flächennutzungsplanungen, die sich auch mit Verkehr
und Mobilität (und in der Regel deren Verzahnung mit der Stadtentwicklung) befassen.
Agenden-Prozesse und lokale Diskussionen, die sich mit nachhaltiger Entwicklung
auseinandersetzen und daher den Verkehr mit einschließen (müssen)
Projekte, die sich mit spezifischen – innovativen - Ansätzen der Gestaltung und Lenkung
von Verkehr und Mobilität auseinander setzen und von, z.T. europäischen, z.T.
nationalen, Forschungsprogrammen gefördert werden
Nicht oder nur teilweise institutionell verankerte Diskussionsgruppen und Arbeitskreise
von „NGOs‚ (VCD, ADFC) und Interessensvertretungen von Handel und Industrie
(Handelskammer, LVI)
Neben diesen von Akteuren in der Region getragen Prozessen sind übergeordnete Planungen für
bauliche (Ausbauplan) und betriebliche (Telematikplan) von Bund und Land maßgebend für den
Verkehr in der Region. Die konkreten Verantwortungen und Zuständigkeiten sind dabei
gestaffelt und unterschiedlich bindend.
Auf der regionalen Ebene ist es in erster Linie die Region selbst als Körperschaft mit
Planungsbefugnissen, die die regionalen Planungsprozesse steuert. Sie ist die
Koordinationsebene und Träger für die Flächennutzungsplanung und der Aufgabenträger für
den Schienenpersonennahverkehr. Basierend auf dem Regionalplan 2009 hat die Region die
Fortschreibung des Regionalverkehrsplans (RVP) gestartet. Der RVP ist sicherlich die wichtigste
regionale Planungsgrundlage.
Daneben gibt es eine Reihe von städtischen Verkehrsentwicklungskonzepten wie das
Verkehrsentwicklungskonzept der Stadt Stuttgart (VEK 2030), oder lokale
Verkehrsentwicklungspläne (z.B. Winnenden 2020) oder Stadtentwicklungskonzepte wie z.B.
das SEK Ludwigsburg. Gemeinsam ist diesen Planungen die institutionelle Bindungswirkung,
indem sie in den politischen Gremien abgestimmte Planungsvorgaben machen und regionale
oder kommunale Ziele definieren.
Ein Beispiel für Forschungs- und Kooperationsprojekte ist unter anderem das Projekt
‚Democritos - Developing the Mobility Credits Integrated Platform Enabling Travellers To
Improve Urban Transport Sustainability‛, das von der Europäischen Union gefördert wird und an
dem die Stadt Stuttgart und der Verband Region Stuttgart als Projektpartner beteiligt sind.
Die folgende Tabelle versucht, die Akteure zu systematisieren und ihren Verantwortungs- und
Handlungsraum zu umschreiben:
9Tabelle 1: Akteure und Handlungsfelder (Quelle: PTV)
Planungs- Aufgabenträ
Mitwirkung Finanzier
Akteur Planungsebene rechte in der ger ÖPNV
in der Region ung
Region Region
Bund Bundesverkehrs- Nein Teilweise Ja Nein
wege
Land BVWP, LVP Ja Teilweise Teilweise Nein
Verband Region Ja Ja Teilweise Ja (SPNV)
Kreise, kreisfreie Kreis, Kommune Ja Ja Teilweise Ja
Kommunen
Nicht kreisfreie Kommune Ja Teilweise Teilweise Nein
Kommunen
Verbände, NGOs, Keine Ja Nein Nein Nein
Forschungseinricht
ungen
Europäische Union Keine Nein Nein Ja Nein
102 Aktionsfelder für nachhaltige Mobilität in der Region Stuttgart
Sieht man vom Flugverkehr ab, lassen sich fünf primäre Mobilitätsformen in der Region Stuttgart
unterscheiden:
Motorisierter Individualverkehr (MIV) Güterverkehr
ÖPNV Lieferverkehr
Rad- und Fußverkehr
Jede Mobilitätsform hat ihre charakteristischen Eigenschaften, die es für eine nachhaltige
Mobilität zu berücksichtigen gilt. Die folgende Tabelle zeigt mögliche Ansätze und
Handlungsrichtungen als Aktionsfelder auf, um die Nachhaltigkeitspotenziale der genannten
Mobilitätsformen auszuschöpfen, dabei orientiert sie sich an den drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit:
Tabelle 2: Aktionsfelder einer nachhaltigen Mobilität (Quelle: PTV)
Aktionsfelder
Mobilitäts-
Dimension Umwelt Dimension Wirtschaft Dimension Soziales
formen
Reduktion des Aufkommens Steigerung der Minimierung der
an Pkw-Fahrten Effizienz des Betriebskosten
Erhöhung des Anteils an Straßennetzes (durch Gerechter Zugang zur
2.1 MIV emissionsfreien Fahrzeugen (Verkehrsmanage- Straßenbenutzung
Reduktion der ment vs. Reduktion der
durchschnittlichen Emissionen Infrastrukturausbau) Lärmbelastung
pro Fahrzeug Nutzungsgerechte Reduktion der
Verkürzung der Wegelängen Nutzerfinanzierung Trennwirkungen
Steigerung des Anteils am Erhöhung (Mindest-)Standards für
Gesamtaufkommen Deckungsbeitrag den Zugang zur ÖPNV-
Reduktion der Emissionen pro Entlastung der Nutzung
Fahrzeug (Zug, Bus) Straßeninfrastruktur Sozial verträgliche Tarife
2.2 ÖPNV Erhöhung der Anzahl Stärkung des ÖPNV Sicherstellen der
Passagiere pro Fahrzeug als Wirtschaftseinheit Verbindungsqualität zu
Verknüpfung mit anderen Etc. den Zentren
Verkehrsträgern (E-Mobility, Sicherheit der Nutzer
Fahrrad, Pkw) Barrierefreiheit.
Aktionsfelder
Mobilitäts-
formen Dimension Umwelt Dimension Wirtschaft Dimension Soziales
Steigerung des Anteils im Schaffung von neuen Nutzbarmachung von
Modalsplit. Dienstleistungen im Flächen, die derzeit von
Berücksichtigung bei Stadt- Umfeld des Fahrrades motorisierter Mobilität
und Regionalplanung (Wartung, Abstellen, „beansprucht werden‚
(Radwege, Ladeinfrastruktur) Laden, Leihangebote) Z.B. Gezielte Förderung
Erhöhung der absoluten Zahl Attraktivierung von von Fahrradbesitz nach
an Fahrrädern und Pedelecs. Aktivitätsstandorten Einkommen.
2.3 Rad- /
Verknüpfung mit anderen (Einkaufen und „Belohnungssysteme‚
Fußverkehr Verkehrsträgern (E-Mobility, Freizeit) (z.B. Zuschuss bei
ÖPNV, PKW) Stärkung Tourismus Abschaffung eines Pkw
zugunsten eines Pedelecs)
Public Awareness für nicht
fahrradaffine
Nutzergruppen
11Integration von Steigerung der Reduktion der Belastung in
Standortplanung und Effizienz des intensiv genutzten und
Verkehrsplanung Straßennetzes durch dicht besiedelten Gebieten
Reduktion der Management, Kooperative Planung von
durchschnittlichen Emissionen insbesondere Lkw-Routen
pro Fahrzeug kooperatives Erhaltung der
Prüfung der Möglichkeiten zur Management wirtschaftlichen
zeitlichen und räumlichen Schaffung und Leistungskraft als
Entzerrung der GV-Nachfrage Aufrechterhaltung Voraussetzung einer
und Entkopplung vom leistungsfähiger prosperierenden Region
allgemeinen Verkehr Verbindungen für
2.4 Güter- Identifikation und Ausweisung den GV als
spezieller Lkw-Routen Standortfaktor
verkehr Nutzungsgerechte
Kooperatives Verkehrs- und
Flottenmanagement Nutzerfinanzierung
(insbesondere im Bereich der
Baustellenlogistik)
Belohnung/Restriktion zur
Erhöhung des Anteils
emissionsarmer Fahrzeuge
Verbesserung der Einbindung
intermodaler Knoten und
Stärkung von Hubs für einen
weitergehenden Einsatz von
Schiene und Binnenschiff.
Reduktion der Lärm und Aufrechterhaltung Entlastung von
Abgasemission des städtischen der Zugänglichkeit für Beeinträchtigungen durch
Güterverkehrs Lieferverkehre Lieferverkehr
Reduktion des Einbeziehung in die Zugänglichkeit für alle
Fahrzeugaufkommens durch regionale und Nutzergruppen/Kun-
2.5 Liefer- Steuerung der Logistik und städtische Planung dengruppen
Bündelung im KEP (Kurier- Steigerung der Wichtiger Faktor für
verkehr Express und Paketservices) Effizienz des wirtschaftliche Prosperität
Berücksichtigung bei Stadt- Lieferverkehrs. Etc.
und Regionalplanung Ausnutzen von
Reduktion der Synergieeffekten mit
durchschnittlichen Emissionen Elektromobilität
pro Fahrzeug Schaffung von neuen
Verkürzung der Wegelängen Dienstleistungen
123 Instrumente für nachhaltige Mobilität in der Region Stuttgart
In der Region Stuttgart steht eine große Bandbreite an Instrumenten zur Verfügung, um auf die
einzelnen Mobilitätsformen einzuwirken und eine Steigerung der Nachhaltigkeit zu erzielen.
Wichtig ist dabei, die Instrumente nicht als isolierte Werkzeuge zu betrachten, sondern
insbesondere ihr Potential im Zusammenspiel zu heben. Die von uns identifizierten
Hauptinstrumente sind:1
Informations- Elektrifizierung des Antriebsstrangs
/Kommunikations-
technologien
Intermodale Mobilitätsansätze Verkehrsplanung
Sozial integrative Ansätze Wirtschaftsförderung und
-koordination
Stadt- und Regionalplanung
Im Folgenden wird auf jedes dieser Instrumente kurz eingegangen. Dabei sind die Instrumente
nach ihrem Zeithorizont geordnet, beginnend mit eher kurzfristig orientierten Ansätzen.
3.1 Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
Die IKT ist ein Bereich, der das Gesicht der Mobilität in Zukunft stark beeinflussen wird. Der
positive Aspekt dabei ist, dass sich verschiedenste Formen der Mobilität via IKT beeinflussen und
vernetzen lassen für umfassende Intermodalität.
Im Bereich IKT spielen Anwendungen von der punktgenauen Stromabrechnung für
Elektromobilität über die Verwendung von intermodalen Mobilitätstickets über Smartphones bis
hin zum komplexen Mobilitäts- und Verkehrsmanagement in Ballungszentren eine wichtige
Rolle. In einer nicht allzu fernen Zukunft wird IKT dafür sorgen, dass Fahrzeuge miteinander
kommunizieren, wodurch sich ein vollkommen neues Feld für die Mobilität der Zukunft ergibt.
Hervorzuheben sind auch Ansätze, die auf existierende Geräte und Strukturen aufsetzen, wie
z.B. ein regionales Verkehrsmanagement unter Miteinbeziehung mobiler Smartphone-Besitzer.
Tabelle 3: Einsatz von IKT auf einen Blick
Zeithorizont Kurzfristig
Aktionsfeld MIV Wirtschaftsverkeh Umweltverbund
Sozial: r
Nachhaltigkeit Wirtschaftlich:
Ökologisch:
3.2 Intermodale Mobilitätsansätze
Es vollzieht sich langsam ein Wandel in der Einstellung der Bevölkerung zu Mobilität. Nicht mehr
jeder möchte heute ein Auto besitzen, sondern es geht verstärkt um die Nutzung. Damit rückt
Mobilität als Ganzes in den Fokus. Die Frage, wie Person X am schnellsten und einfachsten von
Punkt A nach Punkt B gelangt, wird immer häufiger über verschiedene Verkehrsträger hinweg
1
Die Liste der Instrumente basiert auf Auswertung und Clusterung von über 70 Einzelmaßnahmen im Bereich der nachhaltigen
Mobilität durch das Fraunhofer IAO.
13entschieden. Der Bereich der Intermodalität wird dadurch zu einer Spielwiese für neuartige
Mobilitätsansätze über alle Verkehrsträger hinweg.
Maßnahmen in diesem Bereich reichen vom traditionellen Car-Sharing über Park+Ride Angebote
bis hin zum Angebot von Null-Emissions-Mobilitätstickets, die eine flächendeckende individuelle
Mobilität unter Verwendung von Bahn, Rad und Elektro-Auto garantieren. Chancen tun sich hier
vor allem bei der Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren sowie im Zusammenspiel mit
den IKT auf.
Tabelle 4: Intermodale Mobilitätsansätze auf einen Blick
Zeithorizont Kurz- / mittelfristig
Aktionsfeld MIV Wirtschaftsverkeh Umweltverbund
Sozial: r
Nachhaltigkeit Wirtschaftlich:
Ökologisch:
3.3 Elektrifizierung des Antriebsstrangs
Ein vielversprechender Ansatz, um die lokalen Emissionen des Verkehrs (Luft, Lärm) zu
bekämpfen, steckt in der Elektromobilität. Dieser Bereich wird derzeit von der Bundesregierung
massiv gefördert und birgt ein hohes Momentum, was die Vergabe von Fördergeldern und
Projekten angeht.
Im Sinne der Nachhaltigkeit macht Elektromobilität vor allem dann Sinn, wenn Mobilität mit
ökologisch erzeugtem Strom ermöglicht wird. Hier stellen sich vor allem Fragen der
Energieerzeugung sowie der Kooperation zwischen Automobilherstellern und
Energielieferanten. Des Weiteren spielen Fragen der Infrastrukturentwicklung – im speziellen der
Ladeinfrastruktur – eine herausgehobene Rolle. Querverbindungen zum nachhaltigen Bauen
(Stichwort: „Plusenergiehaus + Elektromobilität‚) existieren.
Neben den positiven Auswirkungen auf den verkehrsbedingten Emissionsausstoß birgt die
Elektromobilität ein hohes Potential für die regionale Wirtschaft. Neben den hier angesiedelten
OEM können verstärkt auch KMU als Zulieferer oder als Bereitsteller innovativer E-Mobility
Services diesen Bereich für individuelle Geschäftsmodelle entdecken.
Tabelle 5: Elektrifizierung des Antriebsstrangs auf einen Blick
Zeithorizont Mittelfristig
Aktionsfeld MIV Wirtschaftsverkeh Umweltverbund
Sozial: r
Nachhaltigkeit Wirtschaftlich:
Ökologisch:
3.4 Sozial integrative Ansätze
Die bereits aufgeführten Instrumente können durch ein Bündel an Maßnahmen ergänzt werden,
das sich positiv auf die soziale Ausgewogenheit des Mobilitätssystems auswirkt. Hier finden sich
eher politisch motivierte Programme wieder, die speziell auf die Bedürfnisse benachteiligter
Gesellschaftsschichten eingehen. Viele der anderen Instrumente haben keinen direkten Bezug
zur Förderung von sozial benachteiligten Bevölkerungsteilen – der Zwang zur Wirtschaftlichkeit
kann verhindern, dass Instrumente für nachhaltige Mobilität eine sozial ausgleichende Wirkung
entfalten. Aus diesem Grund ist die geringere Zahlungsfähigkeit benachteiligter
Gesellschaftsschichten zu berücksichtigen und sind Maßnahmen auf Möglichkeiten der
preislichen Abstufung zu überprüfen.
14Ein wichtiger Hebel zur Integration unterschiedlicher Gesellschaftsschichten – und damit zur
Sicherung des sozialen Zusammenhalts in der Region Stuttgart – liegt im politischen Wille,
effiziente und umweltfreundliche Mobilität für jedermann zugänglich zu machen.
Tabelle 6:Sozial integrative Ansätze auf einen Blick
Zeithorizont Mittelfristig
Aktionsfeld MIV Umweltverbund
Sozial:
Nachhaltigkeit Wirtschaftlich:
Ökologisch:
3.5 Wirtschaftsförderung und -koordination
Im Mobilitätssektor der Region Stuttgart kommen viele Akteure zusammen, die gemeinsam
einen großen Einfluss auf die Mobilitätsstruktur haben. Zu nennen sind hier zum einen
Unternehmen und Akteure, die einen direkten Einfluss auf das Mobilitätssystem haben (VVS,
SSB, WRS, IHK, Verkehrsministerium und kommunale Initiativen), zum anderen aber auch
Akteure, deren substantieller Einfluss auf das Mobilitätssystem erst durch die Anzahl ihrer
einzelnen Einflussfaktoren sichtbar wird (Unternehmen mit Berufspendlern, Logistik-
unternehmen, Energielieferanten, Messen, etc.). In den meisten Fällen agieren diese Akteure
autonom und sprechen ihre Handlungen im Bereich der Mobilität nicht ab.
Eine Koordination von Aktionen durch die Förderung von Dialog sowie das Setzen von Anreizen
für ein bestimmtes Mobilitätsverhalten können deshalb eine große Hebelwirkung entfalten. Mit
der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) existiert zudem ein Partner, der für eine
Vernetzung der Akteure in Programmen sorgt und Koordinationsaufgaben übernehmen kann.
Maßnahmen in diesem Bereich könnten z.B. sein: Die Förderung von Dienst-Fahrrädern und
Dienst-Pedelecs, die Förderung der regionalen Vermarktung von Lebensmitteln, die Erhöhung
des Anteils der Erneuerbaren Energien im Umweltverbund, ein Zusammenschluss von Akteuren
für nachhaltigen Tourismus in der Region, etc.
Tabelle 7: Wirtschaftsförderung und –Koordination auf einen Blick
Zeithorizont Mittel- / langfristig
Aktionsfeld MIV Wirtschaftsverkeh Umweltverbund
Sozial: r
Nachhaltigkeit Wirtschaftlich:
Ökologisch:
3.6 Verkehrsplanung
Das klassische Verkehrsmanagement wird derzeit durch Verkehrsleitzentralen in Städten und
Land geleistet. Eine langfristige Verkehrsplanung findet sich im Regionalverkehrsplan wieder.
Beide Komponenten der Verkehrsplanung sind von herausragender Bedeutung was die
Reduktion von Emissionen, die Wirtschaftlichkeit der Mobilität, aber auch die
Sozialverträglichkeit des Verkehrs angeht. Eine Optimierung beider Systeme im Sinne der
Nachhaltigkeit ließe sich durch die Entwicklung eines strategischen Verkehrs- und
Mobilitätsmanagements erzielen, das mittel- und langfristig orientiert ist und sowohl auf
regionaler, wie auch auf betrieblicher und zielgruppenspezifischer Ebene ansetzt.
Konkrete Maßnahmen in diesem Bereich reichen von IT-gestützten flexiblen
Verkehrsleitstrategien, über Informations- und Steuerungssysteme für MIV und ÖPNV bis hin zu
15stadtplanerischen Tätigkeiten (Stichwort: City Maut). Denkbar wären auch Kooperationen mit
Unternehmen und öffentlichen Körperschaften für betriebliches Mobilitätsmanagement.
Tabelle 8: Verkehrsplanung auf einen Blick
Zeithorizont Mittel- / langfristig
Aktionsfeld MIV Wirtschaftsverkeh Umweltverbund
Sozial: r
Nachhaltigkeit Wirtschaftlich:
Ökologisch:
3.7 Stadt- und Regionalplanung
Unsere Mobilitätsstrukturen werden zu einem großen Teil durch die Strukturen unserer Städte
und Regionen bestimmt. Langfristig kann deshalb die Berücksichtigung von Mobilitätsfaktoren
bei einer nachhaltigen Stadt- und Regionalplanung den größten Hebel überhaupt für eine
nachhaltige Mobilität entwickeln. Wie bereits gesehen stellt der Verkehr für Freizeit und Einkauf
den größten Anteil am Verkehrsaufkommen dar. Schafft man es, durch Kleinraumplanung und
kluge Stadtentwicklung den kollektiven Bedarf an Einkaufs- und Freizeitverkehr zu senken, kann
langfristig Verkehr reduziert und damit Mobilität nachhaltiger gestaltet werden.
Herauszuheben ist hier, dass Stadt- und Regionalplanung sich nicht nur auf Siedlungsraum
bezieht, sondern dass auch eine entsprechende Planung des Gewerberaums eine signifikante
Wirkung hin zu einer nachhaltigen Mobilität haben kann.
Tabelle 9: Stadt- und Regionalplanung auf einen Blick
Zeithorizont Eher langfristig
Aktionsfeld MIV Wirtschaftsverkeh Umweltverbund
Sozial: r
Nachhaltigkeit Wirtschaftlich:
Ökologisch:
164 Aktuelle Programme für nachhaltige Mobilität
4.1 Übersicht über die heutigen Programme
In der Region Stuttgart existieren viele Projekte, die direkt oder indirekt auf eine nachhaltige
Mobilität hin arbeiten und dabei eine große Bandbreite an Instrumenten verwenden. Projekte
reichen von der Elektrifizierung kommunaler Fuhrparks (Ludwigsburg) bis hin zu städtebaulichen
Gesamtkonzepten (z.B. in Göppingen). Aus Platzgründen wird hier nur auf die wichtigsten
Programme und Projekte eingegangen:
4.1.1 Modellregion Elektromobilität Stuttgart
Die Region Stuttgart ist eine von 8 Modellregionen für Elektromobilität, die vom
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) mit insgesamt 130 Mio.
Euro gefördert werden. Die unter dem Dach der Modellregion Elektromobilität Stuttgart
zusammengefassten Projekte stellen einen der wichtigsten Pfeiler beim Aufbruch der Region
Stuttgart in ein Zeitalter nachhaltiger Mobilität dar. Um das zentrale Thema – den Umstieg vom
Verbrennungsmotor auf einen elektrifizierten Antriebsstrang – gruppieren sich verschiedene
Projekte, die unterschiedliche Aspekte der Elektromobilität untersuchen. Hier finden sich
prominente Ansätze wie die Elektronauten von EnBW oder die Erprobung von fünfzig E-Vitos
von Daimler im städtischen Lieferverkehr. Es tauchen hier aber auch weiterreichende Ansätze
auf, um die Elektromobilität in ihrer Einbettung in größere Strukturen zu erproben (z.B.
Elektrifizierung kommunaler Fuhrparkflotten der Stadt Ludwigsburg). Auch das Flugfeld
Böblingen / Sindelfingen lotet Potenziale der Elektromobilität im städtebaulichen
Zusammenhang aus und „Call-a-Bike Stuttgart‚ erprobt die Verwendung von Pedelecs im
öffentlichen Fahrrad-Verleihsystem.
4.1.2 CARS - Clusterinitiative Automotive der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart
CARS trägt dazu bei, die Region Stuttgart als weltweit bedeutenden Standort des Fahrzeugbaus
zu stärken sowie die Region als Standort von Anbietern neuer Technologien und
Dienstleistungen rund um das Thema Mobilität voran zu treiben. Neben dem Netzwerk-
management gehört die zielgruppenspezifische Bereitstellung von Informationen zu den
Aufgaben der Clusterinitiative. Mehr als 300 Unternehmen und Institutionen haben sich in den
letzten Jahren aktiv beteiligt. CARS kooperiert mit den führenden Clusterinitiativen der
europäischen Automobilregionen im Rahmen des European Automotive Strategy Network
(EASN).
4.1.3 Nachhaltig Mobile Region Stuttgart (NaMoReg Stuttgart)
Das Land Baden-Württemberg hat am 4. Februar 2011 in der Region Stuttgart die Modellregion
für eine Nachhaltige Mobilität initiiert. Als langfristiges Ziel wird gemeinsam mit den Beteiligten
aus den Kommunen, der Region, der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Verbände und den
Bürgerinnen und Bürgern ein Leitbild entwickelt, das als Grundlage für Projekte wie zum Beispiel
die Erprobung neuer Geschäftsmodelle, elektromobiler Stadtquartiere, einer „Eco-City‚ oder
einer „Smart City‚ und als Modell für andere Regionen dienen kann. Darüber hinaus werden in
einem „Marktplatz Umweltfreundliche Mobilitätssysteme‚ Projekte, die wichtige Fragen
zukünftiger Mobilität thematisieren, zusammengefasst.
174.1.4 Landesinitiative Elektromobilität in Baden-Württemberg
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat Ende 2009 zusätzlich zu den bereits bestehenden
zahlreichen Maßnahmen im Bereich der Elektromobilität eine Landesinitiative gestartet, um die
Entwicklungen alternativer Antriebskonzepte wie die Erforschung und Einführung von Hybrid-
und Elektrofahrzeugen in Baden-Württemberg weiter voranzutreiben. Ein zentraler Punkt der
Landesinitiative war der Aufbau einer Landesagentur Elektromobilität, die heute als e-Mobil BW
alle wichtigen Akteure und Förderaktivitäten verzahnt und insbesondere auch kleine und
mittelständische Zulieferbetriebe noch stärker in den Innovationsprozess Elektromobilität
einbindet.
Die Landesagentur nimmt die Funktion eines „Daches‚ für Elektromobilität und
Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnik in Baden-Württemberg wahr. Sie dient insbesondere
als landesweite Koordinierungsstelle zum Wissenstransfer, zum Aufzeigen von
Innovationspotenzialen, zur Initiierung von Kooperationen über Branchen und
Technologiegrenzen hinweg, zur noch besseren Positionierung Baden-Württembergs als
Forschungs- und Wirtschaftsstandort auf dem Gebiet der Elektromobilität einschließlich des
Standortmarketings, zur Öffentlichkeitsarbeit und zur Imagepflege.
Aktuell ist eine interministerielle „Task Force Elektromobilität‚ der Landesregierung beauftragt,
ein Konzept für eine Landesinitiative Elektromobilität II zu erarbeiten.
4.1.5 Nationale Programme
Neben den genannten, existieren weitere Programme, die in Zukunft Einfluss auf ein System der
nachhaltigen Mobilität haben werden. Hier sind vor allem zu nennen:
Schaufensterprogramm der Bundesregierung:
Drei bis fünf nationale Schaufenster mit einer Anzahl von Elektrofahrzeugen im
fünfstelligen Bereich, sollen die Modellregionen Elektromobilität ablösen. Die Region
Stuttgart hat sich als eine Schaufensterregion beworben und kann hiervon einen
massiven Impuls beim Verfolgen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie im Mobilitätsbereich
erwarten. Eine Entscheidung über die Teilnehmer am Schaufensterprogramm wird
allerdings nicht vor Mitte 2012 fallen.
Spitzencluster-Wettbewerb des BMBF
Ziel des Spitzencluster-Wettbewerbs ist es, die leistungsfähigsten Cluster auf dem Weg
in die internationale Spitzengruppe zu unterstützen. Durch die Unterstützung der
strategischen Weiterentwicklung exzellenter Cluster soll die Umsetzung regionaler
Innovationspotentiale in dauerhafte Wertschöpfung befördert werden. Dadurch sollen
Wachstum und Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen und der Innovationsstandort
Deutschland attraktiver gemacht werden. Für die dritte Runde des Spitzelcluster
Wettbewerbs hat das BMBF den Wettbewerbsbeitrag der e-mobil BW (Elektromobilität
Süd-West - "road to global market") unter die elf Finalisten gewählt. Eine Entscheidung
über die Förderung fällt im Januar 2012.
Leuchtturmprojekte der Bundesregierung
Ab Ende 2011 möchte die Bundesregierung mit der Einrichtung von Leuchtturm-
Vorhaben die Innovation im Bereich der für die Elektromobilität wichtigen Technologien
fördern und Innovationsprozesse branchenübergreifend öffnen. Auch hiervon kann die
Region Stuttgart profitieren und wichtige Zukunftsimpulse für die hier verankerte
Industrie im Automobilbereich erhalten.
18Abbildung 7: Übersicht über heutige Programme und Projekte
Eine detaillierte grafische Übersicht der existierenden Programme und Projekte befindet sich im
Anhang (6.2)
195 Fahrplan für nachhaltige Mobilität
5.1 Impulse für den regionalen Ausbau nachhaltiger Mobilität
Für die Förderung und den Ausbau nachhaltiger Mobilität in der Region Stuttgart werden auf
Basis der vorgestellten Aktionsfelder und Instrumente drei Projektschwerpunkte mit
unterschiedlicher Ausrichtung vorgeschlagen:
1. Aktionsfeld I: MIV
zielt darauf ab, den MIV zu kanalisieren, wo möglich zu reduzieren und gleichzeitig die
Luft- und Lärmbelastung durch den MIV zu minimieren.
2. Aktionsfeld II - III: Umweltverbund (ÖPNV und Rad-/Fußverkehr)
wirkt hierbei unterstützend, indem Verkehr auf den Umweltverbund verlagert wird. Ziel
ist es, den Modalsplit positiv zu Gunsten von ÖPNV, Rad- und Fußverkehr zu
beeinflussen und nahtlose Intermodalität zu fördern.
3. Aktionsfeld IV + V: Wirtschaftsverkehr (Güterverkehr und Lieferverkehr)
widmet sich der speziellen Form des Wirtschaftsverkehrs, um bei dieser stark
strukturierten, aber dennoch heterogenen Verkehrsform speziell geeignete Instrumente
zur Steigerung der Nachhaltigkeit anzuwenden.
Jedes Projektcluster zielt dabei darauf ab, die Nachhaltigkeit einer spezifischen Mobilitätsform zu
steigern und besteht aus aufeinander abgestimmten Maßnahmen in verschiedenen Handlungs-
feldern. Durch die Fokussierung auf drei Projektcluster wird nachhaltige Mobilität ganzheitlich
in der Region gefördert:
Projektbeispiele Projektbeispiele Projektbeispiele
Aktionsfeld I Aktionsfeld II + III Aktionsfeld IV + V
•E-Fahrzeuge in •Zero Emission Mobility •Elektrifizierung von
Flotten/Fuhrparks Ticket Kommunalfahrzeugen,
•E-Mobilitätsangebote durch Lieferfahrzeugen, etc.
•Ausbau von Radwegen
Stadtwerke •City Logistik mit E-Mobility
•E-Mobility Infrastruktur
•Kleinraumplanung: •Optimierte Quartierskonzepte
(Ladesäulen) Diversifikation und für kleinräumliche Versorgung
•"Null Emissions-Zone" in den Verdichtung urbaner von
kommunalen Zentren Räume - Stadt der kurzen Stadtquartieren/Kommunen
•City Maut Wege. •Mobilitätsmanagement: E-
•Verkehrsleitzentrale: •Shared Spaces Mobiler Lieferverkehr könnte
Verkehrsmanagement z.B. Busspuren nutzen
•Erhöhung des Anteils
•Umweltplaketten (Evtl. erneuerbarer Energien im •Elektroflotten als Dienstwagen
Blaue Plakette für E-Autos) ÖPNV •Förderung regionaler
Vermarktung (regionaler
•... •Jobtickets von Seiten der Produkte), dadurch
Arbeitgeber Vermeidung längerer
• Mobilitätsticket als App Transportwege
auf das Smartphone •...
•...
Abbildung 8: Projektcluster für Nachhaltige Mobilität (Quelle: Fraunhofer IAO)
20Die Projektschwerpunkte stehen dabei nicht einzeln für sich, sondern sind in ein umfassendes
Programm für Nachhaltige Mobilität eingebettet, das beteiligte Akteure vernetzt, ein Leitbild zur
nachhaltigen Mobilität entwickelt und einen langfristigen Wandel im Mobilitätssektor mit
flankierenden Maßnahmen wie Evaluationen, Workshops und breiter Beteiligung der
Öffentlichkeit voran treibt.
Deshalb ist es wichtig, den Ausbau nachhaltiger Mobilität mit folgenden strategischen
Maßnahmen zu flankieren:
Gemeinsames Leitbild der Region:
Die Entwicklung eines Leitbildes, einer gemeinsamen Vision für eine nachhaltige
Mobilität in der Region Stuttgart wird als imperativ für den Erfolg eines regionalen
Förderprogramms gesehen (Siehe Kap.1.4). Diese Vision sollte gemeinsam von den
wichtigsten Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung in der Region
Stuttgart erarbeitet werden, um durch ein tragfähiges Leitbild Kohärenz auf allen
Aktionsebenen herzustellen.
Beteiligung und Partizipation:
Ohne die Beteiligung der Bürger der Region Stuttgart sowie wichtiger Verbände und
NGO’s bleiben Projekte für eine Modellregion für nachhaltige Mobilität auf der
abstrakten Ebene. Eine erfolgreiche Übertragung nachhaltiger Mobilitäts-formen in den
Alltag ist jedoch die Voraussetzung für einen funktionierenden langfristigen Wandel im
Mobilitätssektor. Es ist deshalb anzustreben, dass mittels eines guten Informationsflusses
sowie direkter Beteiligung von interessierten Bürgern, Verbänden und NGO’s bei
Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen, das Thema „Nachhaltige Mobilität‚
in der Bevölkerung verankert wird.
Vernetzung und Kooperation:
Die projektübergreifende Vernetzung der Akteure ist ein wichtiges Instrument, um
einerseits Transparenz und Sichtbarkeit innerhalb der Modellregion herzustellen,
andererseits aber auch, um regionale Akteure – und damit die regionale Industrie – zu
stärken. Projekte und Einzelmaßnahmen in einer Modellregion nachhaltige Mobilität
sollten deshalb von gemeinsamen Treffen, Workshops und Konferenzen aller involvierten
Akteure begleitet werden.
Monitoring und Evaluation:
Ein regionales Förderprogramm für eine Modellregion nachhaltige Mobilität kann nicht
nur auf bewährte Projekte zurückgreifen, sondern wird auch Neues ausprobieren.
Hierbei sind Erfolge und Konsequenzen oftmals ungewiss. Umso wichtiger ist es,
Einzelmaßnahmen und Programme mittels einer gut koordinierten Forschung zu
begleiten und regelmäßig zu evaluieren. Der interne Wissenstransfer von „Best
Practices‚ ist dabei ebenso wichtig wie adaptive Lernstrategien, die Modifikation und
Selektion von Projekten und Maßnahmen zulassen.
5.2 Beispielmaßnahmen und zeitliche Einordnung
Maßnahmen in den drei Projektschwerpunkten lassen sich zeitlich aufeinander abstimmen.
Folgende Auflistung ist beispielhaft und zeigt lediglich einige Möglichkeiten für
Herangehensweisen auf einer Zeitschiene mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielsetzungen:
21Sie können auch lesen