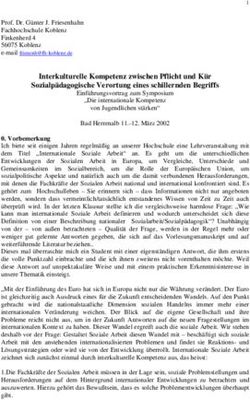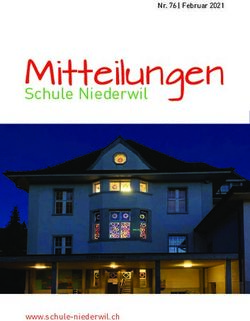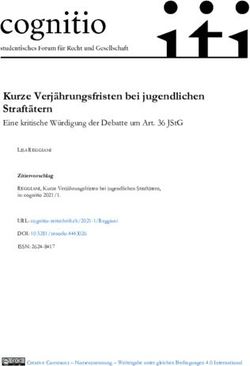Fragen & Antworten der Interdisziplinären Fachtagung "Partnerschaftsgewalt: Rechtssichere Verfahren und medizinische Unterstützung" vom 28.04.2021
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Fragen & Antworten der Interdisziplinären Fachtagung „Partnerschaftsgewalt: Rechtssichere Verfahren und medizinische Unterstützung“ vom 28.04.2021 Frage: Wäre es nicht möglich eine grundsätzliche Regelung festzulegen, dass im Falle eines Näherungsverbots gegen einen vormals gewalttätigen Partners, für die Kinder erst mal 2-4 Wochen Pause im Umgang mit diesem gewalttätigen Partner bzw. Vater festgelegt wird -damit Ruhe einkehren kann, und danach unbedingt nur begleiteter Umgang vereinbart wird. Ich habe Erfahrungen mit mehreren Jugendämter, die begleiteten Umgang ( nach Partnergewalt) aus Kostengründen abgelehnt haben, auch wenn ich als Fachfrau einer Psychologischen Familienberatungsstelle dies dringend empfohlen habe. Häufig werden die Mütter von Familiengerichten gezwungen, die Kinder kurz nach den traumatischen Gewalt-Erlebnissen an den Vater zu übergeben -trotz Näherungsverbots. Das ist absolut zynisch und damit werden sowohl die Kinder wie auch die Mütter in eine Opfer-Rolle gebracht. Und die Kinder erleben, dass sie keinen Schutz bekommen. Antwort: Leider finden sich immer wieder diese Berichte über den Umgang mit häuslicher Gewalt vor Gericht und auch seitens der Jugendämter. Das Problem liegt in der Überbetonung der Umgangsrechts und der Negierung der Gewalt-Folgen für das Familiensystem. Das Gewaltschutzgesetz gilt leider nicht im Verhältnis zwischen minderjährigen Kindern und ihren sorgeberechtigten Eltern, also nicht im Verhältnis zu Mutter und Vater. Das heißt, im Gewaltschutzverfahren kann keine Umgangsregelung getroffen werden, jedenfalls nicht vom Gericht. Es muss ein besonderes Verfahren durchgeführt werden zur Regelung des Umgangs. Das ist eine sog. Kindschaftssache, §§ 151ff. FamFG, zu beteiligten ist das Jugendamt, grundsätzlich bedarf es eines Antrages, hier: meist des Umgangsberechtigten. Theoretisch könnten die Gerichte auch von Amts wegen ein Umgangsverfahren einleiten und, wenn sie den Umgang für gefährlich halten, z.B. im Wege einstweiliger Anordnung den Umgang für ein paar Wochen, max. 6 Monate erst einmal ausschließen, § 1684 Abs. 4 BGB würde dies ermöglichen. Gemacht wird es allerdings nach meiner Kenntnis nicht. (Sabine Heinke) Frage: Was ist hilfreich in der Arbeit in den Arbeitsfeldern Ambulante Flexible Hilfen, SPFH, wenn der Verdacht „häusliche Gewalt“ aufkommt? Welche Fragestellungen darf und kann ich verwenden, ohne damit etwas zu implementieren was später vor Gericht keinen Bestand hat? Antwort: Ich vermute, dass hier „Unschuldsvermutung“ und „Suggestion“ im Hintergrund stehen. Dazu ist zu sagen: vor dem Familiengericht gilt die Unschuldsvermutung nicht. Das Gericht muss von Amtswegen die objektive Wahrheit ermitteln. Daher: alle Fragen stellen, die einem einfallen, und genau zuhören und möglichst dokumentieren. Sinnvoll sind natürlich offene Fragen, also wer, wie, wann, wo, wie. Insbesondere Kinder berichten häufig darüber, wie sie die Attacken erlebt haben. Sicher wichtig ist auch die Frage: und wie war das für Dich? Wie hast Du Dich gefühlt? O.ä. Wenn das Kind Täter, Tat und Opfer von sich aus schildert, spricht überhaupt nichts dagegen, hier nachzufragen, auch mit: und was hat Vati dann gemacht? Eigene Eindrücke von dem Befinden des Kindes sollte frau/man sich dazu im Nachhinein notieren. (Sabine Heinke)
Frage: Wie können Gefährdungsanalysen verbessert werden, damit Opfer vor Wiederholungstaten und vor allem vor Tötungsdelikten besser geschützt werden können? Antwort: Das ist in der Tat ein Problem, das immer wieder auftaucht. Das Gewaltschutzgesetz gibt, wie alle zivilrechtlichen Verfahren, einen sog. Titel, also eine Vollstreckungsgrundlage. So, wie auch sonst in allen zivilrechtlichen Verfahren, muss sich der Titelinhaber, hier: die Titelinhaberin, entscheiden, ob sie den Beschluss vollstrecken lassen will und dies – leider – auch selbst tun. Verstößt der Täter gegen die gerichtlichen Auflagen, muss frau bei Gericht einen Antrag auf Festsetzung von Ordnungsmitteln – Ordnungsgeld oder Ordnungshaft – stellen. Dann gibt es wieder ein Verfahren, wo geklärt wird, ob der Täter gegen die Auflage verstoßen hat. Da ist dann ein polizeiliches Protokoll (Täter war am 2.6. um 18.00 Uhr vor der Haustür) sehr hilfreich. Blöd ist, dass das Opfer sich auf diese Weise dauernd mit dem Täter beschäftigen muss, Listen schreiben über Verstöße gegen die Anordnungen und eben wieder Anträge stellen. Anders als im Ursprungsverfahren, wo für die einstweilige Anordnung als Glaubhaftmachung eine eidesstattliche Erklärung des Opfers ausreicht, muss im Vollstreckungsverfahren Beweis erbracht werden für den Verstoß, d.h., sie braucht Zeugen, Fotos, emails, chat-Protokolle usw. usf. Es ist leider ein mühsames Geschäft und durch nichts zu verschlanken oder zu beschleunigen. Andererseits ist es dann auch ein schöner Erfolg, wenn 3 oder 6 Monate Ordnungshaft verhängt werden und der Täter erstmal auf Abstand gehalten wird. (Sabine Heinke) Frage: Wann wird der Schutz der Frauen bei der Umsetzung des Umgangsrechtes berücksichtigt? Antwort: Unsere Erfahrung ist, dass häusliche Gewalt bei Umgangsrechtsverfahren und der Organisation des Umgangs der gemeinsamen Kinder komplett ausgeblendet wird, nach dem Motto „das muss eine Mutter aushalten“. Frauen werden jeden Tag gezwungen, die Kinder dem Gefährder ohne Schutz zu übergeben! Das passiert erst dann, wenn Gewalt und ihre Folgen als massive Gefahr für das Kindeswohl wahrgenommen werden. Und die hysterische Überbetonung des Umgangsrechts (Fegert) ein Ende findet, was allerdings nicht abzusehen ist. Sie kennen sicher auch die Fälle, in denen die Kinder nach der Trennung den Vater nie wieder sehen, weil dieser sich nicht interessiert. Es wird nichts getan, um diesen Zustand zu ändern. Wäre Umgang so zentral wichtig, müsste die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Plakate kleben lassen: „lass Dein Kind nicht im Stich“. Sehen Sie diese Plakate? Ist Umgang zentral wichtig? Alle übersehen § 1684 Abs. 4 BGB, gern leider auch die Jugendämter, die das Umgangsdogma genauso verinnerlicht zu haben scheinen. Wie immer braucht es eine Kindeswohlprüfung, bei der alle Faktoren gewichtet werden, nicht nur die Bindungen, sondern auch das, was die Bindungen belastet, wie etwa die Auswirkungen von h.G. Wir warten hier auch auf die Änderung von § 1626 BGB, die war schon angedacht, wird aber diese Legislaturperiode nichts mehr werden. (Sabine Heinke) Frage: Kann der Vortrag von Frau Prof. Dr. Baer runtergeladen werden, um ihm Mitarbeiter*innen oder Kooperationspartner*innen zu zeigen? Antwort: Nein, der Vortrag wird aber hier https://www.uniklinik-ulm.de/kinder-und- jugendpsychiatriepsychotherapie/publikationen-vortraege-downloads/vortraegeveranstaltungen.html gestreamt werden können.
Frage: Wie kann es gelingen, Ärzt*innen, insbesondere Gynäkolog*innen, in das Hilfe-System einzubeziehen und zur Kooperation im Netzwerk zu gewinnen? Antwort: Mir ist aufgefallen, dass gerade fast ausschließlich von „Frauen und Kindern“ als Opfer häuslicher Gewalt aufgrund alter Rollenstereotype gesprochen wurde. In einer meiner ersten Fortbildungen zu Kindschaftssachen sagte die Dozentin, das die Gewalt in Beziehungen fast pari pari verteilt wäre. Gibt es dazu auch Erkenntnisse? Carolin Claas, Richterin am Amtsgericht, Amtsgericht Marl Nach der Auswertung des BKA zum Berichtsjahr 2018 in der „Kriminalstatistischen Auswertung Partnerschaftsgewalt“, in der das Bundeskriminalamt (BKA) seit dem Jahr 2011 die Opfer- Tatverdächtigen-Beziehung erhebt, lag der Anteil der weiblichen Opfer bei 81,7 %, die der männlichen bei 18,3 % (BKA 2019, S. 6). Es ist zwar davon auszugehen, dass es im Dunkelfeld noch mehr männliche Opfer gibt und die Hemmschwelle, häusliche Gewalt zur Anzeige zu bringen, bei Männern nach wie vor noch höher ist als bei Frauen. Ein Hinweis auf „pari/pari“ findet sich allerdings auch in Dunkelfeld- Studien nicht. Frage: Kann man am Kurs, der im Juni/Juli startet, noch teilnehmen? Antwort: Ja, Anmeldung ist möglich unter https://haeuslichegewalt.elearning- gewaltschutz.de/registrierung Frage: Wird es einen zweiten Kurs im Herbst/Winter geben oder bleibt es nur bei dem Kus beginnend im Juli? Antwort: Aktuell können wir noch nichts zu einem erneuten Kursdurchlauf nach der Projektlaufzeit sagen. Informieren werden wir darüber aber zum Beispiel über den „Dazugehören“-Newsletter unter https://dazugehoeren.info/newsletter Frage: Ich habe den 1. Ausbildungsabschnitt absolviert und da waren die Expert*inneninterviews leider nur selten abrufbar. Wie hat sich das geändert? Wird in Zukunft auch die Möglichkeit eines Austauschs für die TN eingerichtet, da ich das für sehr sinnvoll gerade bei diesem Thema halte? Oder hatte ich etwas beim 1. Abschnitt übersehen? Bei der Vernetzung gab es kein Beispiel zum Thema HG sondern die Kompetenzzentren Frühe Hilfen. Da würde ich mir ein themenbezogeneres Beispiel wünschen, wird es das zukünftig geben? Antwort: Es gibt ein Tool zum Austausch von Kontaktdaten zwischen den Teilnehmenden im Kurs. Frage: Warum haben 46,4 % der Teilnehmer der 1. Kohorte den Kurs nicht abgeschlossen? Antwort: Der Hauptgrund für das nicht Abschließen des Kurses mit einem Zertifikat waren mangelnde zeitliche Ressourcen beruflicher oder privater Natur. (Anna Maier) Frage: Wie viel Stunden benötigt man effektiv für den Kurs? Antwort: Die Mehrzahl der Personen hat etwas mehr als 40 Stunden benötigt, um den Kurs erfolgreich abzuschließen. (Anna Maier) Frage: Wie sind die Kosten für den Onlinekurs? Antwort: Der Online-Kurs ist kostenlos. (Anna Maier) Frage: Wie hoch war der tägliche zeitliche Umfang des Kurses? Antwort: Das können wir leider nicht beantworten, da die Kursbearbeitungsdauer von circa 40 Stunden innerhalb von sechs Monaten frei eingeteilt werden kann. (Anna Maier) Frage: Wie sehen die Prüfungen des Kurses denn aus, bzw. wie laufen diese ab? Antwort: Die Prüfungen bestehen aus Multiple-Choice-Fragen, die anhand der Texte beantwortet werden können. Um eine Prüfung zu bestehen müssen 70% der Fragen richtig beantwortet werden. Pro Prüfung haben die Nutzer*innen drei Versuche. (Anna Maier) Frage: Es werden 40 Std. Zertifiziert. Aber wie sieht es mit der realen lern Zeit aus? Wieviel Zeit sollte eingeplant werden? Antwort: Einige Nutzer haben auch angegeben bis zu 80 Stunden benötigt zu haben. Andere waren schneller als die 40 Stunden. Für die meisten haben die 40 Stunden gut gepasst. (Anna Maier)
Frage: Sind die Inhalte des Online-Kurses hilfreich, wenn demnächst in einer Frauenberatungsstelle arbeiten soll? Antwort: Gerade in diesem Fall sind sie sehr hilfreich. Frage: Ist auch angedacht, dass der Online Kurs als Plattform für Vernetzung der Professionen genutzt werden kann (ZB Chat)? Antwort: Es gibt ein Tool zum Austausch von Kontaktdaten zwischen den Teilnehmenden im Kurs. (Anna Maier) Frage: Inwieweit bedenken Sie bei der Primärprävention die politische Grundentscheidung für ein lebensfeindliches Wirtschaftssystem, das per se Ungerechtigkeit und Ausbeutung schafft? Auf dieser Grundlage eines neoliberalen Systems können wir nur Symptome bekämpfen, während gleichzeitig das Leid fortgesetzt und zementiert wird. Antwort: Die Betrachtung und Bewertung des Wirtschaftssystems und die Analyse (bzw. der Vergleich mit anderen Ländern), ob es bei einem anderen politischen System andere Prävalenzen bei häuslicher Gewalt geben würde, würde den Rahmen des Kurses sprengen. Deshalb konzentriert sich der Kurs auf die Analyse, Beschreibung und Lösungsmöglichkeiten für den Ist-Zustand. Frage: Besteht die Möglichkeit einer professionellen Täterschulung im Rahmen der Prävention? Vorsorge besteht nicht nur im Opferschutz, sondern in Aufklärung des Täters über sein Handeln. Antwort: Eine solche Täterschulung findet im Rahmen der Täterarbeit statt. Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie im Modul „Beziehungsdynamiken in Schutz und Hilfe“ des Kurses oder auf der Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit https://bag- taeterarbeit.de/. Frage: Gibt es eine Übersicht der Gewaltschutzambulanzen bundesweit oder in den jeweiligen Bundesländern? Antwort: Unter dem Link https://www.dgrm.de/arbeitsgemeinschaften/klinische- rechtsmedizin/untersuchungsstellen findet sich eine Übersicht der rechtsmedizinischen Institute, die diese Untersuchungen anbieten. Frage: Wird „psychische Gewalt“ als Form der Gewaltausübung beim Thema „Häusliche Gewalt“ in Statistiken mit aufgenommen? Findet psychische Gewalt überhaupt Beachtung? Antwort: In früheren Untersuchungen, etwa der vielfach zitierten Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ von Prof. Dr. Ursula Müller und Dr. Monika Schröttle aus dem Jahr 2004 wurde psychische Gewalt noch nicht gesondert erfasst. Allerdings findet das Phänomen der psychischen Gewalt immer mehr Beachtung und findet deshalb auch vermehrt Eingang in Forschungsarbeiten. Ergebnisse hierzu werden auch im Rahmen des Projekts zur Erstellung dieses Kurses bald publiziert. Frage: Guten Tag, beinhaltet der vorgestellte Kurs auch Inhalte zu den Grenzen der Schweigepflicht? Hieran scheitert häufig effektive Zusammenarbeit im Netzwerk. Antwort: Ja, im Modul „Kooperation und Unterstützungssysteme“ findet sich ein Text zum Datenschutz, der detailliert auf die jeweiligen Anforderungen eingeht – auch innerhalb der Netzwerke. Frage: Was empfehlen Sie einer Kinder-Psychotherapeutin, wenn sie Kindeswohlgefährdung wiederholt dem Jugendamt meldet, und es vom Jugendamt nicht ernst genommen wird? Antwort: Zunächst einmal eine eher formale Antwort. Seit dem 17. Juni 2021 sieht das Gesetz eine Rückmeldepflicht von Jugendämtern vor, wenn Berufsgeheimnisträger:innen wie Sie als Kinder- Psychotherapeutin eine Mitteilung wegen festgestellter oder vermuteter Kindeswohlgefährdung machen. Das Jugendamt ist also verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Mitteilung angekommen ist. Nun aber zu Ihrem Konflikt. Unterschiedliche Einschätzungen zur Gefährdung von Kindern sind erst einmal normal. Wichtig ist, über diese ins Gespräch zu kommen und ich dafür zu interessieren, wie es zu den unterschiedlichen Einschätzungen kommen kann, also weshalb die jeweils andere Seite zu anderen Beurteilungen kommt. Wie Sie persönlich oder innerhalb Ihrer Strukturen vor Ort in einen solch neugierig-konstruktiven Austausch mit dem Jugendamt kommen können, lässt sich aus der Ferne natürlich nicht sagen. Wir drücken jedenfalls die Daumen. (Thomas Meysen) Frage: Gibt es einen juristischen Unterschied, ob die Frau mit dem Täter liiert oder verlobt ist?
Antwort: Wenn ein*e Betroffene*r mit dem*der Täter*in verlobt ist, hat sie*er vor Gericht (und der Staatsanwaltschaft und Polizei) nach § 52 StPO ein Zeugnisverweigerungsrecht, d.h. sie*er muss nicht aussagen. Das ist nicht der Fall, wenn das Paar lediglich liiert ist. Dann ist der*die Betroffene zur Aussage verpflichtet. Frage: Verstehe ich den Sachverständigenbeweis nach der Unwahrhypothese richtig, dass die geschädigte Person zunächst Beweisen muss, dass Sie nicht lügt? Antwort: Nein. Das (mutmaßliche) Opfer muss nicht beweisen, dass es nicht lügt, vielmehr muss dem oder der Angeklagten die Schuld bewiesen werden. Die „Unwahrhypothese“ ist eine gedankliche Konstruktion des*der Richter*in, um der Unschuldsvermutung gerecht zu werden. Gedanklich geht er*sie zunächst davon aus, dass ein*e Unschuldige*r vor ihm*ihr sitzt. Das bedeutet, dass er bei einer belastenden Zeugenaussage zunächst gedanklich zu unterstellen hat, dass die Aussage, soweit sie den*die Angeklagte*n belastet, unwahr ist. Nachdem die Zeugenaussagen für sich betrachtet anschließend daraufhin nach unterschiedlichen Kriterien geprüft worden ist, ob die Unterstellung der Unwahrheit aufrecht erhalten werden kann oder ob nach der Prüfung nichts dafür spricht, dass die Aussage unwahr ist, kann das Gericht davon ausgehen, dass die Aussage wahr ist. Neben der Prüfung der Aussage selbst sind aber auch noch andere Beweismittel, wenn sie denn vorliegen, bedeutsam und müssen in den Prozess eingeführt werden. Anhand dieser Beweismittel kann sich dann auch noch ergeben, dass eine Zeugenaussage, obwohl sie für sich betrachtet durchaus wahr schien, unwahr sein kann, ebenso aber auch, dass eine belastende Zeugenaussage, die für sich betrachtet einer Wahrheitsüberprüfung nicht standgehalten hat, dennoch wahr gewesen sein muss.(Stefan Caspari) Frage: Bei wieviel % der Fälle kommt es denn zur Verurteilung? Und wie viele werden aus Mangel an Beweisen fallen gelassen? Antwort: Zwar gibt es in den Lageberichten des BKA mittlerweile Angaben zur Häufigkeit von Gewalttaten in Paarbeziehungen. Eine bundesweite Auswertung über den Ausgang bzw. den Verlauf der Strafverfahren gibt es hingegen nicht. Man kann sich hier nur über einzelne Länderstatistiken nähern, Daten aus Berlin etwa legen nahe, dass der weit überwiegende Teil der angezeigten Taten eingestellt wird. Mit Strafbefehl bzw. Anklage enden hier nur ca. 10-15 % der angeklagten Delikte. (Die exakten Zahlen finden Sie im Kurs). Dass ein Verfahren eingestellt wird, bedeutet aber nicht immer, dass dies aus Mangel an Beweisen erfolgt ist. Einstellungsgründe können auch sein, insbesondere bei geringer Tatschwere: eine Verweisung auf den Privatklageweg, eine Einstellung wegen geringer Schuld oder eine Einstellung der weiteren Strafverfolgung im Hinblick darauf, dass gegen den Beschuldigten wegen anderer Tatvorwürfe eine ohnehin bereits höhere Bestrafung zu erwarten ist. (Stefan Caspari) Frage: Wie lange nach der Tat kann Anzeige erstattet werden? Könnte eine Tochter ihren gewalttätigen Vater als Erwachsene noch anzeigen? Antwort: Das hängt immer vom konkreten Tatvorwurf ab. Nach § 78 StGB verjähren Straftaten im Zeitraum zwischen drei und 30 Jahren, lediglich Mord verjährt nie. Eine einfache Körperverletzung etwa verjährt nach drei, eine gefährliche Körperverletzung nach zehn Jahren. Bei einigen Missbrauchs- und Sexualdelikten, gibt es die Besonderheit, dass die Verjährungsfrist nach § 78b Absatz 1 Nummer 1 StGB frühestens mit Vollendung des 30. Lebensjahres des Opfers beginnt. Eine gleichlautende Regelung gibt es hinsichtlich der Körperverletzungsdelikte nicht. Zudem ist zu beachten, dass die genannte Altersgrenze vom Gesetzgeber bereits mehrfach angehoben worden ist. Liegt eine Tat bereits sehr lang zurück und war die Verjährung zwischenzeitlich bereits einmal eingetreten, dann bleibt die Tat unverfolgbar, auch wenn später die Verjährungsfrist verlängert wird. Dies betrifft immer nur solche Taten, die bei der Heraufsetzung der Altersregelung noch nicht verjährt waren. (Stefan Caspari) Frage: Insbesondere im Bereich der psychischen Gewalt (Bedrohung, Nötigung) ist die Beweisführung bei häuslicher Gewalt schwierig. Inwiefern sind dabei rechtsmedizinische Gutachten oder therapeutische Stellungnahmen bei Gericht zulässig oder gängig? Antwort: Rechtsmedizinische Gutachten werden in diesen Fällen nicht zielführend sein, da sie sich regelmäßig nur auf körperlich erkennbare Tatfolgen beziehen. Im Einzelfall ist lediglich möglich, dass
bei der Untersuchung eines Opfers auch begleitend psychische Auffälligkeiten festgestellt werden, die sich dann auch in der Dokumentation bei der Beschreibung der zu untersuchenden Person wiederfinden. Therapeutische Stellungnahmen können, soweit die Schweigepflicht und das Zeugnisverweigerungsrecht der Therapeuten dem nicht entgegen stehen, in einem Strafverfahren berücksichtigt werden, wobei dann regelmäßig eine Befragung des*der Therapeuten*Therapeutin erfolgt. Darauf wird vom Gericht regelmäßig zurückgegriffen werden, sowohl weil es unmittelbar zur Tataufklärung dienen kann, aber auch weil es bei der Würdigung der Zeugenaussage als wahr oder unwahr eine Hilfestellung bietet. (Stefan Caspari) Frage: Dürfen die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung genutzt werden, wenn die Geschädigte von Ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht? Antwort: Handelt es sich bei der Geschädigten um eine Angehörige des Beschuldigten (§ 52 Absatz 1 StPO), dann kann sie die Teilnahme an der Untersuchung verweigern (§ 81c Absatz 3 Satz 1 StPO). Sie könnte allerdings nicht verweigern, dass sie - auch schon im Ermittlungsverfahren - von einem*einer Richter*Richterin ohne eine eigene Mitwirkung in Augenschein genommen wird, was allerdings in der Praxis kaum vorkommt. Ist die rechtsmedizinische Untersuchung richterlich angeordnet worden und die zu untersuchende Person vorab richterlich darüber belehrt worden, dass sie an der Untersuchung nicht teilnehmen muss, dann können die Untersuchungsergebnisse auch bei einer späteren Inanspruchnahme eines Zeugnisverweigerungsrechtes verwertet werden. Ist eine solche Belehrung jedoch nicht erfolgt, erstreckt sich eine spätere Zeugnisverweigerung auch auf die Ergebnisse einer rechtsmedizinischen Untersuchung.(Stefan Caspari) Frage: Wie bewerten Sie die Möglichkeit der ermittlungsrichterlichen Videovernehmung in Fällen von Partnerschaftsgewalt? Antwort: (Bei der Beantwortung dieser Frage gehe ich davon aus, dass damit die Aufzeichnung einer Videovernehmung angesprochen ist, nicht aber die Vernehmung mittels Videokonferenz.) Jedenfalls in Fällen mit gewichtigen Tatfolgen kann eine frühzeitige Videovernehmung im weiteren Verfahren von Bedeutung sein. Der Gesetzgeber hat dafür inzwischen in den §§ 58a, 255a StPO ein - im Einzelnen nicht ganz unkompliziertes - Regelwerk geschaffen, in welchen Fällen eine Aufzeichnung einer Videovernehmung erfolgen soll. (Stefan Caspari) Frage: Wie wirkt es sich aus, wenn Erinnerungslücken vorhanden sind (z.B. wegen durch die Tat oder in der Kindheit des Opfers erlittener Traumata)? Kann da eine Begutachtung zur Beweisführung helfen? Antwort: Erinnerungslücken stehen der Glaubhaftigkeit einer Aussage nicht generell entgegen. Vielmehr hängt es im Einzelfall davon ab, worauf sich die Erinnerungslücken und ob sie erklärbar sind. Es gibt dazu psychologische und auch psychiatrische Erfahrungen, wann solche Lücken sogar erwartbar, jedenfalls aber erklärlich sind und woran bei einem realen Geschehen in der Regel Erinnerungen vorliegen müssten. Im Einzelfall kann sogar die Schilderung von vielen Details eines Geschehens dafür sprechen, dass nicht ein reales Geschehen aus der Erinnerung erzählt wird, sondern ein Tatablauf dargestellt wird, der zumindest ausgeschmückt, möglicherweise sogar ausgedacht ist. Ob sich das Gericht für diese Würdigung eine eigene Sachkunde zutraut oder sich dazu der Beratung durch eine*n Psychologen*Psychologin / Psychiater*in bedient, hängt vom Einzelfall oder den möglichen Gründen für die Erinnerungslücken ab. (Stefan Caspari) Frage: Es klang gerade so, als würde eine ärztliche Untersuchung durch einen Rechtsmediziner GEGEN den Willen der Geschädigten(per richterlichem Beschluss) durchgeführt werden- das wäre dann doch ein Fall der sekundären Viktimisierung? Sollte eine Person so schwer verletzt sein, dass diese Person sich dazu nicht ausreichend äußern KANN müsste die Schwere der Verletzung dann doch schon für sich sprechen. Sollten Opfer tatsächlich gegen ihren Willen rechtsmedizinisch untersucht werden? Antwort: Die Frage geht von der Unterstellung aus, dass es sich bei der zu untersuchenden Person um ein Opfer handelt. Dies steht aber im Ermittlungsstadium noch nicht fest. Vielmehr dient die ärztliche Untersuchung - auch gegen den Willen der zu untersuchenden Person - gerade der Vorbereitung, dies später gerichtlich feststellen zu können. Zudem kann mit der rechtsmedizinischen Untersuchung möglicherweise auch der Nachweis einer Tat geführt werden, die später ohne diese Untersuchung nicht
mehr nachweisbar wäre. Dies dürfte die Viktimisierung eines tatsächlichen Opfers weit eingreifender verstärken. Die Fallkonstellation mit einem Opfer, dass sich nicht äußern kann, hängt mit der Frage einer richterlichen Anordnung der rechtsmedizinischen Untersuchung nicht zusammen. Davon abgesehen aber, besagt allein der Umstand, dass ein Opfer schwer verletzt ist, weder etwas darüber aus, wie die Verletzung entstanden ist, noch darüber, von wem sie zugefügt wurde. Abgesehen davon ist die Schwere einer Verletzung häufig gerade nicht augenfällig. Gerade blutende Verletzungen können deutlich schwerer erscheinen, als sie tatsächlich sind. Andererseits werden rechtsmedizinisch häufig schwere Verletzungen erst festgestellt, die - da im Körperinneren liegend - zunächst gar nicht erkennbar waren. (Stefan Caspari) Frage: Wenn es nach einer Strafanzeige wegen partnerschaftlicher Gewalt zu einer Gerichtsverhandlung kommt, wer übernimmt die Kosten? Ich könnte mir vorstellen, dass die Gerichts- und Anwaltskosten abschreckend wirken. Antwort: Um eben diesen Abschreckungseffekt zu vermeiden, werden die Gerichtskosten im Falle eines Freispruchs vom Staat getragen, im Falle einer Verurteilung trägt sie der*die Angeklagte. Eine*n Anwält*in zu beauftragen steht jedem Opfer frei, notwendig ist es jedoch nicht. Falls sich ein*e Betroffene den Prozess nicht alleine zutraut, gibt es neben der Hinzuziehung eines*einer Anwält*in verschiedene Möglichkeiten der psychosozialen Prozessbegleitung. Näheres dazu finden Sie im Kurs. Frage: Muss eine Befundsicherung unbedingt durch ein rechtsmed. Institut erfolgen oder hat auch ein Befundbericht durch niedergelassenen Arzt oder Notaufnahme rechtssichere Aussagekraft? Antwort: Eine Befundsicherung kann in jedem Fall auch bei einem*einer niedergelassenen Ärzt*in oder in der Notaufnahme erfolgen. Vorteil des rechtmedizinischen Instituts ist aber, dass die Fachkräfte hier genau wissen, worauf sie achten und wie sie Befunde gerichtsfest dokumentieren müssen. Frage: Gibt es Statistiken/Erfahrungswerte, wie oft die ärztlichen/rechtsmedizinischen Begutachtungen in Gerichtsverfahren zu häuslicher/sexualisierter Gewalt tatsächlich herangezogen werden und auch für die Verurteilung eine Rolle spielen? Wir werden oft danach gefragt, haben dazu aber keine statistischen Werte. Antwort: Statistiken dazu sind mir nicht bekannt. Ob sie für die Verurteilung eine Rolle gespielt haben, wird sich einer statistischen Auswertung wohl auch entziehen, da eine Verurteilung stets auf einer Gesamtwürdigung des Beweisergebnisses beruht und daher nicht unbedingt erkennbar ist, ob die Entscheidung mit oder ohne Gutachten anders ausgefallen wäre. (Stefan Caspari) Frage: Wie geht das Gericht mit dissoziierten Opfer um? Antwort: Je nach dem Grad der Beeinträchtigung und abhängig davon, ob die dissoziative Störung auf einem Tatgeschehen beruht oder beruhen kann, wird sich das Gericht im Einzelfall bei der Beantwortung dieser Frage der Unterstützung eines*einer Psycholgen*Psychologin / Psychiaters*Psychiaterin bedienen. (Stefan Caspari) Frage: Wie schätzen Sie den § 153 a StPO ein, der vorinstanzlich greift. Wir in der Beratung aber häufig mit diesem Phänomen zu tun haben? Antwort: Eine allgemeine Antwort lässt sich dazu nicht finden. Generell kann eine Einstellung nach § 153a StPO nur bei Vergehen (Delikte mit Strafandrohung von im Mindestmaß weniger als einem Jahr Freiheitsstrafe) erfolgen. Nach den Straferhöhungen in der Vergangenheit sind damit die meisten Sexualdelikte dem Anwendungsbereich enthoben. Ob § 153a StPO sinnvoll erscheint, bedarf der Betrachtung im Einzelfall. Es ist nicht auszuschließen, dass es auch zu Einstellungen dieser Art kommen kann, die dem Opfer als zu milde erscheinen. Andererseits kann eine Einstellung in einzelnen Fällen auch einer Befriedung der Beziehung dienen, wenn die Partner etwa unter sich wieder Frieden miteinander geschlossen haben, die Staatsanwaltschaft aber gleichwohl zeigen will, dass ein bestimmtes Verhalten auch dann nicht ohne jede staatliche Reaktion bleiben muss. Zudem kann eine Einstellung nach dieser Norm bedingen, dass etwa ein Täter-Opfer-Ausgleich stattzufinden oder der Beschuldigte an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen hat. Dies kann von Fall zu Fall sinnvoller
erscheinen als eine Reaktion etwa durch eine Geldstrafe, die an der Einsichts- und Veränderungsbereitschaft des Täters möglicherweise nicht viel ändert. (Stefan Caspari) Frage: Gibt es eine Statistik dazu, ob Richter andere Urteile fällen als Richterinnen? Antwort: Eine solche Statistik ist mir nicht bekannt. Sie würde auch ohnehin nur bei vergleichsweise geringfügigen Strafen möglich sein, da nur dort Strafrichter*innen allein urteilen. Bei gewichtigeren Delikten entscheidet beim Amtsgericht das Schöffengericht mit zusätzlich zwei Schöffen, beim Landgericht eine Große Strafkammer mit zwei oder drei Berufsrichtern*Berufsrichterinnnen und zwei Schöffen. Hierzu gibt es - außer bei Jugendschöffen - keine gesetzlichen Vorgaben zu dem Verhältnis von männlichen und weiblichen Richtern / Schöffen, so dass häufig einer Kammer sowohl männliche als auch weibliche Richter / Schöffen angehören. (Stefan Caspari) Frage: Aus rechtswissenschaftlicher Sicht mag die Arbeitshypothese sowie die damit einhergehenden Unterhypothesen vielleicht logisch nachvollziehbar sein. Auch ist eine grundlegende Unschuldsvermutung grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings beziehen sich die Hypothesen einseitig auf die In-Frage-Stellung der Aussagen der mutmaßlichen ‚Opfer‘ von Gewalt. Diese Einseitigkeit im Denken öffnet meiner Ansicht nach, gängigen Mythen (z.B. ‚Opferkonstruktionen‘ und ‚Täterkonstruktionen‘) Tür und Tor. 1. Frage: Wie sehen sie das? Antwort: Die „Unwahrhypothese“ ist lediglich ein Gedankenkonstrukt, das es dem*der Richter*in ermöglicht, eine strukturierte Wertung der Beweismittel vorzunehmen und im Urteil entsprechend zu argumentieren. Vielleicht ist nochmals wichtig zu erwähnen, dass diese Hypothese vor der Zeugenvernehmung ansetzt. Der*die Opferzeug*in ist auch ein „Beweismittel“. (Stefan Caspari) Frage: Auf welcher Basis wurden diese Arbeits- und Unterhypothesen gebildet? Aus meiner Sicht fehlt das Einbeziehen von Ergebnissen empirischer Studien, wie z.B. solchen, die belegen, dass z.B. lediglich 3- 5% von Beschuldigungen hinsichtlich sexualisierter Gewalt (konkreter: Vergewaltigung), auch finde ich in den Hypothesen die Ergebnisse von Studien nicht wider, wonach die statistischen Wahrscheinlichkeiten für eine Schuld sprechen (hauptsächlich männliche (Ex-)Partner als Täter). Auch sind aus sozialwissenschaftlicher und psychologischer Sicht, Aussagen nicht gleich unwahr, weil potenzielle Gewalt Betroffene z.B. Angst haben, Schamempfinden oder traumatisiert sind. Auch dies findet sich in den Hypothesen nicht wieder. Antwort: Die Hypothesen sind nicht in allen Fällen gleich, sondern werden für jeden Einzelfall als Unterhypothesen gebildet, nämlich danach, warum eine Aussage unwahr sein könnte. Empirische Studien haben weder etwas mit der Unwahrhypothese, noch mit den Unterhypothesen zu tun. Bei den Unterhypothesen wird gerade berücksichtigt, aus welchen Gründen Umstände, die bei erster Betrachtung für eine unwahre Aussage sprechen, aus anderen Gründen erklärlich sind und im Ergebnis sogar die Glaubhaftigkeit stützen können. Das kann insbesondere auf Auslassungen, Erinnerungslücken oder auch Widersprüchlichkeiten in Aussagen zu unterschiedlichen Zeiten zutreffen. Dies alles spricht nicht per se für eine unwahre Aussage. Statistische Wahrscheinlichkeiten allerdings können niemals zur Begründung einer Verurteilung herangezogen werden, da bei jeder Statistik, die als Ergebnis nicht wissenschaftlich belegte 100% ausweist, gerade der vorliegende Fall einer sein kann, der zu den wenigen abweichenden Prozenten gehört. (Stefan Caspari) Frage: Was raten sie Frauen mit Blick auf Beweissicherung? Sollten betroffene z.B. Tagebuch führen, die No Stalk App zur Beweissicherung des Weißen Ringes nutzen, o.ä.??? Welche Relevanz hat dies? Alles was dazu beitragen kann, die Erinnerung von Betroffenen aufrecht zu erhalten oder zu sichern, ist in einem späteren Verfahren nützlich. Derartige Unterlagen können auch bei der Beweiswürdigung Berücksichtigung finden, wenn auch nicht allein der Umstand, dass etwas aufgeschrieben wurde, beweist, dass das Geschriebene richtig ist. Bestimmte Geschehen lassen sich aber etwa leichter überprüfen, je mehr Details dazu bekannt sind (zum Beispiel für einen Abgleich einer Tatzeit mit den Arbeitszeiten des Beschuldigten mit dortigen Pausen, Urlauben, Abwesenheiten oder ähnlichem; Nachvollziehbarkeit anhand von Telekommunikationsdaten; Möglichkeit der Befragung weiterer Zeugen). (Stefan Caspari)
Frage: Kann ein Aussenstehender, z.B. der Arzt Anzeige erstatten, wenn die/der Betroffene nicht will, wenn der Arzt Sorge hat, dass der/die Betroffene irgendwann totgeschlagen wird? Antwort: Theoretisch ist dies möglich, diese Hürde - das Brechen der Schweigepflicht gegen den ausdrücklichen Willen der Patientin - liegt bei erwachsenen Opfern aber sehr hoch. Nähere Ausführungen hierzu finden Sie im Kurs. Frage: Sollten sich Frauen von einer Rechtsanwältinnen unterstützen lassen, wenn Sie einen Gewaltschutzantrag stellen? Antwort: Frau braucht keine Anwältin, den Antrag bei Gericht kann sie selbst stellen. Es ist oft sinnvoll, wenn die Frau in der Verhandlung, wenn eine solche stattfindet, mit Anwältin erscheint, um sich sicherer zu fühlen. Auch kann die Anwältin dafür sorgen, dass im Gericht bestimmte Sicherheitsstandards (getrennte Anhörung; getrennter Zu- und Abgang zum Verhandlungssaal) eingehalten werden. Selbstverständlich kann Verfahrenskostenhilfe beantragt werden. Ich höre allerdings, dass Frauen Schwierigkeiten haben, schnell Anwältinnen zu finden, weil diese überlastet sind und die Verfahren nicht besonders beliebt (viel Arbeit, wenig Geld) sind.(Sabine Heinke) Frage: kann die Familienrichterin nur eingeleitete Verfahren in den Unterlagen finden? Oder auch eingestellte Verfahren? Antwort: Wir können auch eingestellte Verfahren finden, allerdings nicht im Bundeszentralregister, aber in den Verfahrensübersichten von Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Polizei hat ja auch Überblick über die Einsätze in der Familie. (Sabine Heinke) Frage: Werden die Parteien beim Familiengericht gleichzeitig durch den Richter befragt, nicht getrennt? Antwort: Es ist beides möglich, die getrennte Befragung ist natürlich mühsamer und erfordert 2 Termine, das macht RichterIn natürlich nicht so gern. Außerdem müssen die jeweiligen Aussagen protokolliert werden, der anderen Seite zugänglich gemacht werden; diese muss dazu Stellung nehmen können, alles im sog. Eilverfahren etwas umständlich. In besonders bedrohlich wirkenden Fällen wird allerdings die getrennte Anhörung durchgeführt und sie kann natürlich jederzeit von den Beteiligten auch angeregt werden, § 33 Abs. 1 FamFG. Wer als Opfer auf keinen Fall mit dem Täter zusammentreffen will, sollte dies bei Antragstellung bereits mitteilen. Auch in Stalkingfällen sollte das Gericht dem Täter durch eine gemeinsame Anhörung nicht noch wieder ein Forum bieten, sich dem Opfer zu nähern oder es nach der Verhandlung zu verfolgen. Inwieweit hier ein Bewusstsein bei den RichterInnen besteht, vermag ich nicht zu beurteilen. (Sabine Heinke) Frage: Ist für die Beantragung / Durchführung eines Verfahrens nach dem Gewaltschutzgesetz eine Strafanzeige bei der Polizei notwendig? Im konkreten Fall teilte eine Antragstellerin bei der Anzeigenerstattung mit, vom Richter*in aufgefordert worden zu sein, zunächst eine Anzeige bei der Polizei zu stellen. Antwort: Nein, eine Anzeige ist nicht erforderlich. Hier ging es vielleicht um ein Beweisproblem?, das durch die Ermittlungen der Polizei geklärt werden sollte? Erscheint jedenfalls merkwürdig.(Sabine Heinke) Frage: Ist es für einen Antrag nach dem GewSchG beim Familiengericht relevant, wie lange die Tat zurückliegt? Gibt es dazu Fristen? Antwort: Ja, das ist relevant, denn meist leiten die Antragsteller*innen ein sog. Eilverfahren ein. D.h. sie stellen einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz, über den das Gericht im Wege einstweiliger Anordnung, also möglichst noch am Tage der Antragstellung, mindestens aber nur ein, zwei Tage später entscheiden soll. Wenn es so eilig sein soll, erscheint es wenig überzeugend, wenn „die Tat“ schon 6 Wochen zurück liegt. Dann war es nämlich 6 Wochen lang nicht eilig, die Rechte zu verfolgen. Technisch sprechen wir vom „Rechtsschutzbedürfnis“. Wer seine Rechte nicht alsbald wahrnimmt, erweckt den Eindruck, dass es ihr/ihm damit nicht ernst ist. Anders liegt der Fall, wenn es vor 6 Wochen schon eine Attacke gab und vorgestern wieder… Ich denke, für ein Eilverfahren sollte das Tatgeschehen nicht länger als 2 oder 3 Wochen zurückliegen, für ein sog. Hauptsacheverfahren kann es auch länger sein, sicher auch 2 Monate. Letztlich kommt es darauf an, was der Grund für das Zuwarten ist. Wenn frau/man große Angst vor dem Täter hat und sich
noch permanent bedroht fühlt oder durch die Tat stark belastet wurde, ist dies ein vom Gericht zu beachtender Grund für eine verhältnismäßig späte Antragstellung. (Sabine Heinke) Frage: Wie lange werden Vergehen, die zur Beweiserhebung wichtig sind, im Strafauszug gespeichert? Antwort: Die Speicherfristen im Bundeszentralregister sind im Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (BZRG) geregelt. Die Dauer bis zur Tilgung richtet sich insbesondere danach, zu welcher Strafe eine Verurteilung erfolgt ist und ob weitere Verurteilungen gefolgt sind (§§ 46, 47 BZRG). Die Mindestdauer einer Speicherung beträgt fünf Jahre.(Stefan Caspari) Frage: Wenn es durch den Täter zu Belästigungen in Form von Auflauern, Beobachten und Beleidigungen kommt, zielt ein Antrag nach Gewaltschutzgesetz darauf ab, dass der Täter das unterlässt. Eine entsprechende Anordnung scheint mir ein sehr geringer Eingriff in Rechte des Täters zu sein. Dennoch erlebe ich Richter_innen als zögerlich. Warum? Antwort: Diese Frage stelle ich mir auch. Der Täter kann sämtliche Beeinträchtigungen seiner Freiheit dadurch vermeiden, dass er sich „ordentlich“ verhält. Wer sich benimmt, hat nichts zu befürchten. Daher können wir die RichterInnen nur ermutigen, beherzt zu beschließen. (Sabine Heinke) Frage: Sind Richterinnen verpflichtet alte Akten aus dem Fam FG , Strafregisterauszüge, bei Staatsanwaltschaften nachzufragen und bei der Polizei nach weiteren Einsätzen nachzufragen und dies mit einzubeziehen? Antwort: Die Richter sollen von Amtswegen (§ 26 FamFG) ermitteln, was los war. Dazu haben sie alle Ermittlungen anzustellen, die zielführend sind und die nach dem geschilderten Sachverhalt nahe liegen. Ich weiß, dass das Beiziehen von Akten eher selten geschieht und selbst der Anruf bei der Polizei häufig unterbleibt. Wer als Antragstellerin ahnt, dass es da schon Einsätze/Verfahren gegeben hat, sollte daher von sich aus das Gericht bitten, bei Polizei/Staatsanwaltschaft nachzufragen, das kann helfen. (Sabine Heinke) Frage: Welche Möglichkeiten werden zum Austausch von Informationen zwischen Familiengericht und Staatsanwaltschaft gesehen? Sollte eine Mitteilung über mögliche Straftaten durch das Familiengericht an die Staatsanwaltschaft erfolgen, oder begründet dies eher die Sorge der Befangenheit? Antwort: Dafür gibt es keine wirkliche Leitlinie. Sinnvoll erscheint mir, mit der/dem Geschädigten zu besprechen, ob das gewünscht ist, denn schließlich wird sie/er die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen als Zeugin/Zeuge voranbringen müssen. Viele möchten sich dem nicht aussetzen. Im Übrigen würde ich vielleicht in die Kommentierung zu § 149 ZPO schauen und nachsehen, ob es in den MiZi irgendwelche Hinweise gibt, bevor ich tätig würde. Bei schweren Straftaten dürfte es ohnehin bereits Ermittlungen geben. (Sabine Heinke) Frage: In welcher Form soll das Opfer Anträge auf Ordnungsgeld oder Ordnungshaft stellen, wenn der Täter gegen den Gewaltschutzbeschluss verstößt? Antwort: Die Anträge müssen schriftlich beim Gericht gestellt werden, entweder direkt bei der Rechtsantragstelle oder eben durch einen Brief an das Gericht. Wichtig ist, dass das Opfer Beweise anführen muss für die behaupteten Verstöße (also: Täter war um 22.30 Uhr vor dem Haus, Beweis: Nachbarin A. hat das gesehen; Täter hat angerufen: Telefonanrufliste) (Sabine Heinke) Frage: Führt ein GewSchVerfahren auch zu strafrechtlichen Konsequenzen? Antwort: Nein, ein eventuelles Strafverfahren läuft völlig unabhängig vom zivilrechtlichen Gewaltschutzverfahren. Allerdings kann ein Gericht eine strafrechtliche Sanktion anordnen, wenn ein*e Antragsgegner*in beharrlich gegen gerichtliche Anordnungen aus dem Gewaltschutzverfahren verstößt (§ 4 GewSchG). Frage: Können im Familiengerichtsverfahren erhobene Beweise im Strafverfahren eingeführt werden (z.B. als Urkundenbeweise durch Einführung des Hauptverhandlungsprotokolls)? Können Familienrichter/Innen als Zeugen/Innen im Strafverfahren vernommen werden? Antwort: Letztere Frage würde ich mit „ja“ beantworten, ansonsten kenne ich mich mit den Regeln der Strafprozessordnung nicht so aus, dass ich zu Frage 1 ja oder nein sagen könnte. Vermutlich kommt es, wie immer, darauf an, wie die Beweise vor dem FamG erhoben wurden (Belehrung pp.) (Sabine Heinke)
Frage: Können die Familiengerichte auf die Videovernehmungen parallellaufender Strafverfahren zugreifen? Wird das in der Praxis gemacht? Antwort: Theoretisch ja, praktisch wohl eher nein. (Sabine Heinke) Frage: Erhält das Amtsgericht bei Verfahren der Strafverfolgung Einblick in Gewaltschutzakten des FamG? Antwort: Die Staatsanwaltschaft fordert die Akten an, z.B. wenn es um die Verfolgung von Verstößen gegen familiengerichtliche Gewaltschutzanordnungen geht. In aller Regel bekommt die Staatsanwaltschaft die Akten auch. (Sabine Heinke) Frage: Werden bei einer einstweiligen Anordnung auch immer A und B angehört? Antwort: Die Frage ist etwas unspezifisch. Wenn A den Antrag stellt und das Gericht auf den Antrag hin gleich den Beschluss erlässt, bekommt B. erstmal kein rechtliches Gehör. Dieses bekommt B. erst dadurch, dass sie/er die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt. In dem Antrag schildert sie/er seine Gründe dafür, dass aus ihrer/seiner Sicht der Beschluss zu Unrecht ergangen ist. In der Verhandlung werden beide dazu gehört und das Gericht wird erneut entscheiden. (Sabine Heinke) Frage: Das Vorgehen bei Verstößen ist den Betroffenen häufig nicht klar und ehrlich gesagt auch ziemlich unverständlich. Gibt es leicht verständliche Informationen dazu, die von den Gerichten ausgegeben werden? Antwort: Nein, leider nicht. Das wäre eine – einseitige – Rechtsberatung, so wird es wohl gesehen und das ist nicht die Aufgabe der Gerichte. Ich meine auch, noch keine Broschüre zu dem Thema gesehen zu haben … In den Vollstreckungsverfahren brauchen die Betroffenen noch eher als im ursprünglichen Verfahren anwaltlichen Beistand. (Sabine Heinke) Frage: Wie geht man am Besten vor, wenn der Gewalttäter ein Polizeibeamter ist? Welche Hilfe kann man Opfern von häuslicher Gewalt dann anbieten? Antwort: Ja, das ist ganz großer Mist und kommt leider doch immer mal wieder vor. Ich habe schon daran gedacht, als Richterin disziplinarische Maßnahmen anzuregen, aber das habe ich mich dann auch nicht getraut. Grundsätzlich kann der Gewaltschutzantrag gestellt werden und wenn Stalking pp. dann weiter geht, obwohl ein Beschluss erlassen wurde, sollte das Opfer darüber nachdenken, die nächsten Wochen möglichst immer in Begleitung zu sein, damit ZeugInnen vorhanden sind für die Verstöße gegen den Beschluss, denn das Vertrauen darein, dass die Polizei helfen wird, ist natürlich eingeschränkt. (Sabine Heinke) Frage: Leider erlebe ich in der Beratung immer wieder bei bestimmten Richtern, dass auch nach sehr eindeutige Gewalttaten und trotz Polizei Einschätzung keinerlei Maßnahmen erfolgen. Bei anderen Amtsgerichten sind Beschlüsse schneller und auch bei weniger harten Vorfällen umgesetzt. Warum gibt es so große Unterschiede? Und wie kann man in der BRD das etwas neutraler gestalten? Bei älteren Richtern auf dem Land ist kaum ein professioneller Dialog - auch in Gremien möglich. Und Betroffene sind auf das jeweilige AG angewiesen - Ich versuche Frauen trotzdem zu ermutigen diese Schritte zu gehen. Die Polizei ist da weiter, und da verzweifeln auch die Beamt*innen an „diesen“ Richtern. Besonders heikel ist, wenn ein Gewaltäter in eine Psychiatrische Einrichtung eingewiesen wird, weder die betroffene Frau noch die Polizei erfährt von der Entlassung. ZUmindest hier in Bayern. Antwort: Da helfen vielleicht nur Rechtsmittel – Beschwerden – gegen die ablehnenden Beschlüsse. Nach wie vor gibt es ja leider keine Fortbildungspflicht für FamilienrichterInnen, obwohl schon lange gefordert. (Sabine Heinke) Frage: Was ist die Internetwache? Antwort: Im Internet gibt es für jede Polizeidienststelle sogenannte „Onlinewachen“: Hier ist es möglich, in nicht dringenden Sachverhalten (also z.B. nicht bei akuter Gefährdung oder einem Verkehrsunfall) die Strafanzeige online einzugeben.
Frage: Bei der Tabelle zur Verteilung der Straftatgruppen handelt es sich um Daten aus 2019. Lässt sich durch den momentanen Lockdown und der damit verbundenen erhöhten Zeit im eigenen Wohnraum eine Erhöhung der Straftaten feststellen? Antwort: Nach bisherigen Erkenntnissen scheint die Häufigkeit häuslicher Gewalt – vor allem gegen Frauen– gestiegen. Dies hat sich allerdings nicht während der Lockdowns, sondern erst mit den Lockerungen gezeigt. Zudem wird aus den Gewaltschutzambulanzen berichtet, dass die Verletzungen teilweise schwerer sind. Frage: Was darf ich als Sozialarbeiter in Sachen Spurensicherung? Antwort: Sie können Fotos von Verletzungen machen – auch wenn ein Arzt die Befunde besser einschätzen kann oder weiß, wo er suchen oder was er fotografieren muss – Beweiswert können grundsätzlich auch die Fotos von Laien haben. Frage: Darf ein Hausarzt Spurensicherung vornehmen? Ich dachte das dies nicht gerichtsverwertbar ist. Antwort: Er darf es in jedem Fall. Zum Aufsuchen der Gewaltschutzambulanz wird nur deswegen häufig aufgerufen, weil die dortigen Mitarbeiter*innen sehr erfahren sind, genau wissen, wo sie suchen und wie sie einzelne Verletzungen dokumentieren kann, sowie welche körperlichen Handlungen man aus bestimmten Verletzungsmustern schließen kann. Frage: An wen sollte/kann ich mich direkt wenden, wenn ich als Hebamme bei Hausbesuchen den Eindruck bekomme, dass bei einer Familie häusliche Gewalt vorkommt? Und wird eine solche Befundsicherung auch von Hebammen „verlangt“ oder kann ich an Ärzt/Innen weiterleiten? Antwort: Zunächst einmal ist toll und leider nicht selbstverständlich, dass Sie Ihren Vermutungen weiter nachgehen wollen. Es bietet sich an, erst einmal vertrauliche Fachberatung durch entsprechend kompetente in Anspruch zu nehmen. Das kann die Fachberatungsstelle bei häuslicher Gewalt sein oder die Koordinationsstelle (KoKi) Frühe Hilfen, aber auch eine Schwangerschafts- oder Erziehungsberatungsstelle oder eine insoweit erfahrene Fachkraft, die speziell für Hebammen zur Verfügung steht, falls es so jemanden bei Ihnen gibt. Landen Sie nicht bei der richtigen Stelle, fragen Sie am besten, von wem Sie sich beraten lassen können. Bei der Fachberatung wird auch zu thematisieren sein, ob und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt Sie das Jugendamt hinzuziehen und wie Sie dies ggf. mit den Betroffenen in der Familie kommunizieren. (Thomas Meysen)
Sie können auch lesen