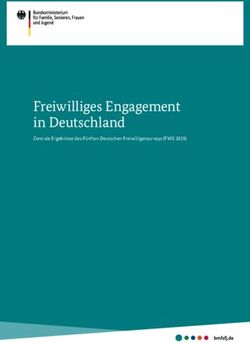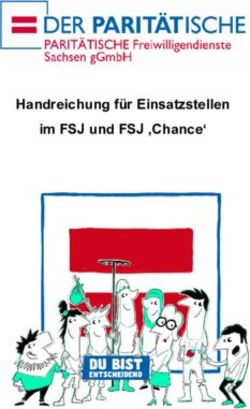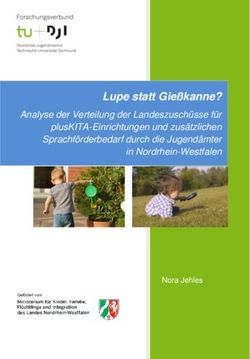Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen - Auswertung der Fragebogenerhebung Mai 2009 Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum Mag.a Nicole ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen Auswertung der Fragebogenerhebung Mai 2009 Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum Mag.a Nicole Sonnleitner Mag.a Christine Böhm
VSG – Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum Johann-Konrad-Vogel-Straße 2, 4020 Linz www.ulf-ooe.at Eine Initiative des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz & des Sozialressorts des Landes Oberösterreich
Inhaltsverzeichnis
1. Ausgangslage 1
2. Einsatzbereich(e) der Einrichtung 2
3. Notwendigkeit von freiwilligem Engagement 3
4. Freiwillige MitarbeiterInnen in der Einrichtung 4
4.1 Einrichtungen, in denen KEINE freiwilligen MitarbeiterInnen tätig sind 4
4.2 Einrichtungen, in denen derzeit freiwillige MitarbeiterInnen tätig sind 6
4.2.1 Anzahl der Freiwilligen 6
4.2.2 Verteilung der Freiwilligen nach Geschlecht 7
4.2.3 Verteilung der Freiwilligen nach Altersgruppen 8
4.2.4 Durchschnittliches Stundenausmaß pro Woche und Person 8
4.2.5 Tätigkeitsbereiche der Freiwilligen 9
4.2.6 Beginn der Freiwilligenarbeit in der Einrichtung 10
4.2.7 Gewinnung von Freiwilligen 10
4.2.8 Konflikte und Lösungsansätze 11
4.2.9 Stellenwert von Freiwilligenarbeit nach Einsatzbereichen 12
4.2.10 Mitgliedschaft für Freiwillige 13
4.2.11 Ansprechperson für Freiwillige 13
4.2.12 Leistungen für Freiwillige 14
5. Zusammenarbeit mit ULF 15
6. Informationsmaterial über ULF 17
7. Anregungen oder Wünsche in Bezug auf Freiwilligenarbeit 18
8. Resümee 19
Anhang: FragebogenFreiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
1. Ausgangslage
Im September 2008 startete das von Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und
Sozialressort des Landes OÖ initiierte Pilotprojekt „Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum“ – kurz ULF.
Das ULF will gemeinsam mit den oberösterreichischen Städten und Gemeinden, sowie gemeinnützigen
Organisationen und Vereinen
• Menschen aller Altersgruppen
• auf kommunaler und regionaler Ebene
• durch neue Formen und Ansätze
zum regelmäßigen freiwilligen Engagement im Sozialbereich motivieren.
Ziele des Pilotprojektes:
• Förderung der Kultur der Solidarität und gegenseitigen Unterstützung
• Förderung des Zusammenhalts zwischen Generationen, Kulturen und sozialen Schichten
• Nutzung des besonderen Potentials älterer Menschen in der Nachberufsphase
• Einbindung benachteiligter Gruppen im ausgewogenen Geschlechterverhältnis (z.B. Menschen mit
Beeinträchtigung, MigrantInnen, sozial Schwache)
• Gezielte Verbesserung der Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement
• Förderung des nonformellen Lernens und des Erwerbs von zusätzlichen sozialen und fachlichen
Kompetenzen durch freiwilliges Engagement
• Förderung der Teambildung zwischen Hauptamtlichen und Freiwilligen
• Förderung einer ausgeglichenen Repräsentanz von Frauen und Männern in der Projektdurchführung und in
der Zielgruppe
Ziele der Fragebogenerhebung:
• Kontaktaufnahme mit oberösterreichischen Sozialeinrichtungen
• Bestandsaufnahme der Freiwilligenarbeit in den Einrichtungen
• Abklärung der Bedürfnisse der Einrichtungen
• Ermittlung des Handlungsbedarfes im Bereich Freiwilligenarbeit
• Finden von KooperationspartnerInnen
Methode:
Für die Befragung wurde ein teilstandardisierter Fragebogen entwickelt, der offene und geschlossene Fragen
beinhaltet (siehe Anhang). Angemerkt soll an dieser Stelle werden, dass bei Frage 1 zwar die Daten der Einrichtung
abgefragt wurden, diese aber weder in vorliegender Auswertung aufscheinen, noch an Dritte weitergegeben wurden
oder werden.
Insgesamt wurden 421 Fragebögen im Jänner 2009 an oö. Sozialeinrichtungen, die in den verschiedensten
Einsatzbereichen tätig sind, gesendet. Davon wurden 316 Fragebögen (75 Prozent) per Email und 105 Fragebögen
(25 Prozent) per Post ausgesendet. Grundlage der vorliegenden Auswertung sind die Ergebnisse von 166
ausgefüllten Fragebögen – das entspricht einer Rücklaufquote von rund 40 Prozent und ist damit als sehr
hoch einzustufen.
Seite 1Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
2. Einsatzbereich(e) der Einrichtung
Einr
Die Einrichtungen wurden danach gefragt, in welchem Einsatzbereich bzw. in welchen Einsatzbereichen sie tätig sind.
12 Einsatzbereiche wurden vorgegeben, wobei die Möglichkeit bestand, weitere Bereiche unter „Sonstige“
anzuführen. (Mehrfachnennungen
n möglich)
Mehr als die Hälfte der
er Einrichtungen, die an der Befragung teilgenommen haben, sind im SeniorInnenbereich – das
Gros davon in oö. Alten- und Pflegeheimen – tätig. Rund 20 Prozent sind Einrichtungen für Menschen mit
Beeinträchtigungen und Kinder
nder und Jugendliche, aber auch Familie und Frauen.
Neben den vorgegebenen Einsatzbereichen haben zehn Prozent sonstige Einsatzbereiche angeführt. Die
häufigsten Nennungen hatten die Bereiche „Pflege und Betreuung“ und „schwer und chronisch kranke Menschen“.
Mensche
Ein bis zwei Nennungen gab es bei „Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht bzw. schon betroffen sind“,
„Menschen mit HIV/Aids, sowie deren Angehörige“, „Gesundheitsdienste“ und „Sozialdienste (Haus-
(Haus und
Heimservice)“. Zudem wurden noch „Wohnungssicherung“,
„Wohnungssich „Straffälligenhilfe“, „Aus- und Weiterbildung“, „Textil-
„Textil und
Möbelrecycling“ sowie „Umwelt, Berg-/Biobauern,
Berg Tiergarten“ erwähnt..
Seite 2Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
3. Notwendigkeit von freiwilligem Engagement
Die Einrichtungen wurden danach gefragt, ob freiwilliges Engagement in ihrem
ihrem Arbeitsumfeld notwendig,
manchmal notwendig, eher nicht notwendig oder nicht notwendig ist. Zudem wurden sie um eine kurze
Begründung gebeten, warum freiwilliges Engagement den ausgewählten Stellenwert in der Einrichtung hat.
Begründungen für den ausgewählten Stellenwert von freiwilligem Engagement:
Bei den 69 Prozent der Einrichtungen, für die freiwilliges Engagement notwendig bzw. manchmal notwendig ist,
wurde dies am häufigsten damit begründet, dass „die Personal-
Personal und Zeitressourcen zu knapp bemessen
bem sind und
deshalb verschiedenste Maßnahmen ohne freiwilliges Engagement nicht geleistet werden könnten“. In 19
Einrichtungen kann aufgrund von freiwilligem Engagement „durch Zusatzangebote eine Abwechslung und somit auch
eine Bereicherung im Alltag erzielt
zielt werden“. 14x wurde erwähnt, dass „soziale Kontakte hergestellt und aufrecht
erhalten werden können“ und 6x, dass „die Lebensqualität der zu betreuenden Personen erhöht wird“. Weiters wurde
noch genannt, dass „die Vorstandsfunktionen finanziell nicht abgegolten werden können“ und dass „es sich um eine
rein ehrenamtliche Einrichtung handelt“.
Bei den 8 Prozent der Einrichtungen, die freiwilliges Engagement als eher nicht notwendig bzw. nicht notwendig
erachten, wurde dies am häufigsten damit begründet, dass „es keine passenden Tätigkeitsbereiche für freiwillige
MitarbeiterInnen gibt“. Von zwei Einrichtungen wurde festgestellt, dass „die Arbeiten eigentlich ganz gut durch
hauptamtliche MitarbeiterInnen abgedeckt werden“ und eine Einrichtung meint, dass „es
„es nur in ganz speziellen
Bereichen/Situationen vorstellbar wäre, mit freiwilligen MitarbeiterInnen zu arbeiten“.
Seite 3Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
4. Freiwillige MitarbeiterInnen in der Einrichtung
Die Einrichtungen wurden danach gefragt, ob in ihrer Einrichtung freiwillige MitarbeiterInnen
MitarbeiterInne tätig sind. Bei
mehr als der Hälfte der Einrichtungen, die an der Befragung teilgenommen haben, ist dies der Fall.
4.1 Einrichtungen, in denen KEINE freiwilligen MitarbeiterInnen tätig sind
Die Einrichtungen, in denen derzeit keine freiwilligen MitarbeiterInnen
MitarbeiterInnen tätig sind, sollten einerseits begründen warum
dies der Fall ist und andererseits mitteilen, ob in Zukunft freiwillige MitarbeiterInnen in die Einrichtung eingebunden
werden sollen.
Von den 62 Einrichtungen ohne freiwillige MitarbeiterInnen haben
haben rund 80 Prozent Gründe dafür angegeben. Es
bestand die Möglichkeit, neben den vorgegebenen Gründen weitere Punkte unter „sonstige
„sonstige Gründe“ anzuführen.
(Mehrfachnennungen möglich)
Seite 4Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
Ein Großteil der Einrichtungen, in denen noch keine Freiwilligen tätig sind, meint, dass es in ihrer Einrichtung keine
passenden Tätigkeitsbereiche gibt. Nur wenige Einrichtungen geben an, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht
haben oder dafür zu wenige Ressourcen zur Verfügung stehen. Fast ein Viertel hat diese Frage nicht beantwortet.
Neben den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wurden
wurde noch weitere Gründe angeführt. In 9 Einrichtungen
werden „MitarbeiterInnen mit einschlägiger Ausbildung benötigt“, in 6 Einrichtungen „sind keine Strukturen
vorhanden, d.h. es muss zuerst ein
in Konzept erarbeitet werden“ und für 5 Einrichtungen „gibt es keine geeigneten
InteressentInnen“. Außerdem wurde angegeben, dass „mit Zivildienern und PflichtpraktikantInnen gearbeitet wird“,
„diverse Vereine bei Veranstaltungen unterstützen“ und „die Hauptamtlichen
Hauptamtlichen nebenbei ehrenamtlich mitarbeiten“. Ein
weiterer Grund ist, dass „die rechtliche Frage noch nicht geklärt ist“.
Auf die Frage, ob sie zukünftig gerne freiwillige MitarbeiterInnen in ihre Arbeitsabläufe einbinden
würden, haben 60 von 62 geantwortet.
rtet.
20 der Einrichtungen möchten gerne in Zukunft mit freiwilligen MitarbeiterInnen zusammen arbeiten; für 40 spielt
das Thema auch zukünftig keine Rolle. Bei letzerer Antwort wurde um eine Begründung gebeten:
Begründungen, warum auch zukünftig keine
keine freiwilligen MitarbeiterInnen eingebunden werden sollen:
Die Gründe, warum auch zukünftig keine freiwilligen MitarbeiterInnen eingebunden werden sollen, decken sich
großteils mit den genannten Gründen, warum es keine freiwilligen MitarbeiterInnen gibt; es gibt aber auch ein paar
neue Aspekte. In 17 Einrichtungen „werden ausschließlich MitarbeiterInnen mit einschlägiger Ausbildung benötigt“
und bei 12 Einrichtungen „ist der Einsatz von freiwilligen MitarbeiterInnen derzeit nicht geplant“. Einige Einrichtungen
Einricht
haben keinen Bedarf an Freiwilligen, da sie anderweitig unterstützt werden, nämlich durch den Sozialausschuss bzw.
Frauen aus der Pfarre, die örtlichen Vereine, die SPÖ-Frauen
SPÖ Frauen und Zivildiener und PflichtpraktikantInnen. Andere
Gründe sind, dass „derzeit
eit Umbauarbeiten stattfinden, aber eventuell nachher Interesse besteht“ und dass „die
Heimbewohner sehr schwer zu motivieren sind“.
Seite 5Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
4.2 Einrichtungen, in denen derzeit freiwillige MitarbeiterInnen tätig sind
Die Einrichtungen, in denen derzeit freiwillige
freiwillige MitarbeiterInnen tätig sind, sollten einerseits einige Fragen über die
interne Struktur der Freiwilligenarbeit beantworten, sowie andererseits Erfahrungswerte bei der Einbindung bzw.
Zusammenarbeit mit freiwilligen MitarbeiterInnen bekannt geben.
4.2.1 Anzahl der Freiwilligen
Von den 103 Einrichtungen, in denen derzeit freiwillige MitarbeiterInnen tätig sind,, haben 81 eine Antwort
bezüglich der Anzahl der Freiwilligen gegeben. In diesen 81 Einrichtungen gibt es insgesamt mehr als 9.600
Freiwillige.
In rund 20 Prozent der Fälle liegt die Anzahl der Freiwilligen zwischen 1 – 5. Rund 40 Prozent der Einrichtungen
arbeitet mit bis zu 20 Freiwilligen. Mehr als 20 Freiwillige gibt es nur mehr in wenigen Einrichtungen. In 4
Einrichtungen sind es mehr als 100
0 freiwillige MitarbeiterInnen.
Seite 6Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
4.2.2 Verteilung der Freiwilligen nach Geschlecht
Von den oben erwähnten 81 Einrichtungen, die die Anzahl der Freiwilligen angegeben haben, kann bei 78
Einrichtungen bzw. über 9.200 Freiwilligen das Geschlecht eindeutig zugeordnet werden: ca. 5.100 Frauen und ca.
4.100 Männer.
In 64 der Einrichtungen, die die Anzahl der Freiwilligen angegeben und das Geschlecht eindeutig zugeordnet haben,
arbeiten mehr Frauen als Männer freiwillig mit; bei 45 Prozent sind zu
u 100 Prozent Frauen tätig. Das sind vor
allem jene Einrichtungen, in denen eher eine geringere Anzahl an Freiwilligen tätig ist (1-20);
(1 20); insgesamt gesehen
ändert sich das Verhältnis allerdings nicht bei steigender bzw. sinkender Anzahl an Freiwilligen.
In 6 der Einrichtungen, die die Anzahl der Freiwilligen angegeben und das Geschlecht eindeutig zugeordnet haben,
arbeiten mehr Männer als Frauen freiwillig mit.
Hierbei handelt es sich mit einer einzigen Ausnahme um Einrichtungen, bei denen eher eine geringere
geringe Anzahl an
Freiwilligen tätig ist (1-20);
20); es gilt dasselbe wie oben, nämlich dass sich das Verhältnis nicht bei steigender bzw.
sinkender Anzahl an Freiwilligen verändert.
In 3 der Einrichtungen, die die Anzahl der Freiwilligen angegeben und das Geschlecht
Geschlecht eindeutig zugeordnet haben,
arbeiten ungefähr gleich vielen Frauen und Männer.
Männer. Hierbei handelt es sich um Einrichtungen, bei denen die
Anzahl der Freiwilligen unterschiedlich hoch ist.
Bei 5 Einrichtungen konnte zwar das Geschlecht eindeutig zugeordnet
zugeordnet werden, jedoch nicht das Verhältnis zwischen
Frauen und Männern.
Seite 7Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
4.2.3 Verteilung der Freiwilligen nach Altersgruppen
Von den Einrichtungen, die die Anzahl der Freiwilligen angegeben haben, haben 76 Einrichtungen – das entspricht 94
Prozent – ihre freiwilligen MitarbeiterInnen vorgegebenen Altersgruppen zugeordnet:
Da es zwei Einrichtungen gibt, deren Anzahl an freiwilligen MitarbeiterInnen überdurchschnittlich hoch ist und sich
diese überwiegend zwei Altersgruppen zurechnen lassen (bis 29 bzw. über 60), werden beide Situationen dargestellt.
Betrachtet man die Altersgruppen ohne diese beiden Einrichtungen, so sind rund ein Viertel der Freiwilligen über 60
Jahre alt. Unterrepräsentiert ist die die Gruppe der 30 – 49Jährigen. Sechs Prozent der Freiwilligen
reiwilligen sind unter 30
Jahre alt.
4.2.4 Durchschnittliches Stundenausmaß pro Woche und Person
Auf die Frage nach dem durchschnittlichen Stundenausmaß pro Woche und Person haben 68 Einrichtungen –
das entspricht 66 Prozent – geantwortet:
Seite 8Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
Es zeigt sich, dass sich die Mehrheit der Freiwilligen bis zu 2 bzw. 3 Stunden wöchentlich engagiert.
Keine eindeutige Angabe bedeutet, dass 11 Prozent der Einrichtungen zwar die Frage beantwortet haben, jedoch
nicht so, dass die Antworten in die Auswertung mit einfließen können. Die Angaben sind zu ungenau und die
Zeiträume variieren in einem zu großen Ausmaß (10-20h/Monat, 1h/Monat bis 10h/Woche, 1h/Woche bis 4/Tag, 2-8
Wochen, unregelmäßig/unterschiedlich, nach Vereinbarung).
4.2.5 Tätigkeitsbereiche der Freiwilligen
Die Einrichtungen wurden danach gefragt, in welchem Tätigkeitsbereich bzw. in welchen
Tätigkeitsbereichen die freiwilligen MitarbeiterInnen tätig sind. 90 Einrichtungen haben diese Frage
beantwortet, wobei insgesamt 69 verschiedene Tätigkeitsbereiche genannt wurden. Das zeigt, wie vielfältig der
Einsatz von freiwilligen MitarbeiterInnen sein kann und welchen Stellenwert das Engagement im Alltag einnimmt.
Am häufigsten – nämlich 38x – wurde der „Besuchsdienst“ als Tätigkeitsbereich genannt. Bei 19 Einrichtungen helfen
die Freiwilligen bei der „Organisation von Veranstaltungen“ mit oder sind dafür sogar selbst verantwortlich. 15
Einrichtungen haben angegeben, dass die Freiwilligen in der „Freizeitgestaltung“ tätig sind.
Auch „diverse Vorstandstätigkeiten“ wurden mehrmals erwähnt. Zudem gehört die „Planung und Durchführung von
diversen Festen und Feiern“ zu den Aufgabenbereichen von Freiwilligen und zwar bei 12 Einrichtungen. Jeweils 8x
wurden „Rollstuhlausfahrten“ und die „seelsorgerische Begleitung“ genannt und jeweils 7x „Ausflüge“ sowie „Singen
und Musizieren“. „Spazieren gehen“ und „Plaudern“ wurden jeweils 5x aufgezählt.
Weitere Tätigkeitsbereiche wurden vier bis einmal genannt:
Kirchenbesuch/Messbesuche, Raumdekoration (Weihnachten, Ostern, …), Vorlesen, Alltagsbegleitung, Verwaltung,
Teilnahme an Aktionen/Projekten, Basteln, Gymnastik, Turnen, Kaffeehausbetrieb, Einkaufsfahrten,
Urlaubsbegleitung/betreutes Reisen, Kunst, Gesellschaftsspiele (Karten spielen, …), Schwimmen, betreutes Wohnen,
Erledigungen im Haushalt, Essen auf Rädern, Fahrdienste, Hospizarbeit, Buchführung, PC-Schulungen,
Programmgestaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Lernbegleitung, Beratung, psychosoziale
Unterstützung, Flohmärkte, Küchenhilfe, Gartenarbeit, Tageszentrum/Tagesstruktur, Konzertbesuche, Kulturobjekte
besichtigen, Film- und Dia-Vorträge, Fotografie, Briefe schreiben, Stricken, Werkstätte, Gedächtnistraining, Heimhilfe,
hauswirtschaftliche Begleitung, Lebens- und Sterbensbegleitung, Rettungsdienst, Krankentransport,
Sanitätsüberwachung, Systemadministration, Spielgruppenleitung, Aufgabenbetreuung, Deutschunterricht,
Psychotherapie, Resozialisierung, Spenden sammeln, Kleiderausgabe, Radiosendung, Mesnerdienst, Bibliothek.
Seite 9Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
4.2.6 Beginn der Freiwilligenarbeit in der Einrichtung
Auf die Frage, seit wann in der Einrichtung freiwillige MitarbeiterInnen tätig sind, haben 62 der
Einrichtungen (60 Prozent) geantwortet:
Auffallend ist bei dieser Frage, dass viele der Einrichtungen ab zirka 1990 begonnen haben, Freiwillige einzubinden.
Sehr wenige haben bereits früher damit begonnen. Das liegt mitunter auch daran, dass die meisten Einrichtungen in
den vergangenen 20 Jahren gegründet wurden.
4.2.7 Gewinnung von Freiwilligen
Die Einrichtungen wurden
n danach gefragt, mit welchen Mitteln freiwillige MitarbeiterInnen gewonnen
werden können bzw. bisher gewonnen werden konnten.
konnten Es wurden 5 Antwortmöglichkeiten zur Auswahl
vorgegeben, wobei die Möglichkeit bestand, weitere Punkte unter „Sonstige“ anzuführen.
n. (Mehrfachnennungen
möglich)
Seite 10Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
Mehr als 50 Prozent sehen das „direkte
direkte Ansprechen“
Ansprechen und „durch andere Freiwillige“ als das wirksamste Mittel zur
Gewinnung von neuen freiwilligen MitarbeiterInnen. Mehr als ein Viertel bewerten Veranstaltungen und Medien als
a
wirkungsvolle Instrumente.
Neben den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wurden noch weitere Mittel genannt, wobei der Kontakt über die
„Pfarrgemeinde“ und „persönliche Kontakte“ mehrfach genannt wurden. Andere Möglichkeiten, die noch genannt
wurden, sind
d „ehemalige Zivildiener“, „Auflegen/Verteilen von Faltern in öffentlichen Räumen (Einkaufszentren, Ärzte,
Schulen, Gasthäuser, …)“, „Fortbildungsveranstaltungen für Interessierte“, „das Internet“, „Mundpropaganda“,
„PensionistInnenvereine“, „Berufsinfomessen“,
„Berufsinfomessen“, „die Vernetzung mit anderen Einrichtungen“ sowie „Angehörige von
ehemaligen BewohnerInnen“.
4.2.8 Konflikte und Lösungsansätze
Die Einrichtungen wurden danach gefragt, ob es bei der Einbindung von freiwilligen MitarbeiterInnen Konflikte gibt
bzw. gab.
b. Falls ja, sollten sie noch beurteilen, wie häufig es zu Konfliktsituationen kommt, in welchen Bereichen
diese auftreten und welche Lösungsansätze angewendet werden.
In 14 der Einrichtungen, die diese Frage beantwortet haben, gibt bzw. gab es schon einmal Konfliktsituationen. 12
davon haben Angaben zur Häufigkeit der Konfliktsituationen gemacht, wobei die Antwortmöglichkeiten
„selten“, „manchmal“ und „oft“ vorgegeben wurden. 9 haben angegeben, dass es „selten“ zu Konflikten kommt
bzw. kam und in 3 tritt
itt diese Situation „manchmal“ auf. „Oft“ wurde nicht genannt.
Konfliktbereiche:
In Bezug auf die Ursachen, die die Konflikte ausgelöst haben, wurden auch einige Bereiche angeführt. 4
Einrichtungen haben angegeben, dass „es ein übertriebenem Einsatzwille der freiwilligen MitarbeiterInnen
vorherrscht und es zu Kompetenzüberschreitungen kommt“. Jeweils 3x wurde erwähnt, dass „die freiwilligen
MitarbeiterInnen die Vereinbarungen nicht einhalten“ und dass „die hauptamtlichen MitarbeiterInnen Angst haben,
dass die Freiwilligen ihnen die Arbeit wegnehmen“. Weitere Konfliktpotentiale sind „unterschiedliche Erwartungen auf
beiden Seiten, sowohl bei den Freiwilligen, als auch bei den Hauptamtlichen“, „ein unzureichender Informationsfluss“,
Seite 11Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
„die Überforderung der freiwilligen
eiwilligen MitarbeiterInnen“ sowie „die mangelnde Unterstützung durch die hauptamtlichen
MitarbeiterInnen“.
Lösungsansätze:
Als häufigste Methode den Konflikten entgegenzuwirken, wurden „gemeinsame Gespräche, Reflexionen und
Supervisionen“ genannt. 4 Einrichtungen
richtungen bieten Schulungen zu den verschiedensten Themen an. Diese sind sowohl
für Freiwillige, als auch für Hauptamtliche zugänglich. Jeweils 2 Einrichtungen halten „ein gesteuertes
Zusammenführen beider Gruppen durch Workshops“ sowie die „Bereitstellung
„Bereitstellung einer Ansprechperson“ für sinnvoll. Als
Lösungsansätze wurde aber auch „eine klare Trennung zwischen den Tätigkeiten der hauptamtlichen und der
freiwilligen MitarbeiterInnen“ und dass man „die unterschiedlichen Blickwinkel zugänglich macht“ genannt.
4.2.9 Stellenwert von Freiwilligenarbeit nach Einsatzbereichen
Die Einrichtungen wurden danach gefragt, in welchem ihrer Tätigkeitsfelder Freiwilligenarbeit einerseits
unverzichtbar, andererseits wünschenswert ist.
ist Die 12 Einsatzbereiche (siehe Punkt 2) wurden
wurde wieder
vorgegeben, wobei es auch hier die Möglichkeit gab, weitere Bereiche unter „Sonstige“ anzuführen.
(Mehrfachnennungen möglich)
Vor allem im SeniorInnenbereich
bereich wird das Engagement von Freiwilligen als unverzichtbar bzw. wünschenswert
betrachtet.
Neben den vorgegebenen Einsatzbereichen wurden noch einige weitere Bereiche genannt und zwar Menschen mit
HIV/Aids, Straffälligenhilfe, Selbstorganisation, Seelsorge, Essen auf Rädern, Verwaltung, Programmgestaltung,
Raumgestaltung und Vorstandstätigkeiten.
Vorstandstätigkei
Seite 12Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
4.2.10 Mitgliedschaft für Freiwillige
Die Einrichtungen wurden danach gefragt, ob eine Mitgliedschaft erforderlich ist, um sich in der Einrichtung
freiwillig engagieren zu können.
4.2.11 Ansprechperson für Freiwillige
Die Einrichtungen wurden danach
anach gefragt, ob es eine Ansprechperson für freiwillige MitarbeiterInnen gibt.
Falls nicht, sollten sie noch begründen, warum dies der Fall ist.
Als Begründung,, warum es in 9 der Einrichtungen, die diese Frage beantwortet haben, keine Ansprechperson
gibt, wurde von 2 Einrichtungen genannt, dass „das gesamte Team angesprochen werden kann“. 2x wurde erwähnt,
dass „die freiwilligen MitarbeiterInnen je nach Einsatzbereich eine/n verantwortliche/n Vorgesetzte/n als
Ansprechperson haben“ und dass „die Kontakte
Kontakte in den Zweigvereinen der Bezirksstellen hergestellt werden und es
keine zentrale Übersicht/Verwaltung gibt“. Darüber hinaus wurde noch „Zeitmangel“ und dass „es mehrere
Pflegedienstleitungen gibt“ genannt.
Seite 13Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
4.2.12 Leistungen für Freiwillige
Die Einrichtungen
tungen wurden danach gefragt, welche Leistungen sie freiwilligen MitarbeiterInnen anbieten können. 12
Punkte wurden vorgegeben, wobei die Möglichkeit bestand, weitere Angebote unter „Sonstige“ anzuführen.
(Mehrfachnennungen möglich)
Mehr als die Hälfte der Einrichtungen, die diese Frage beantwortet haben, bieten den freiwilligen MitarbeiterInnen die
Teilnahme an Veranstaltungen und Begleitung und Betreuung an. Rund 30 Prozent stellen ihren Freiwilligen eine
Einarbeitung durch Fachkräfte, die Teilnahme an
an Teambesprechungen und einen Tätigkeitsnachweis zur Verfügung.
Rund ein Viertel bietet einen Versicherungsschutz und Fahrtkostenersatz. 20 Prozent arbeiten mit
Einsatzvereinbarung, Aufwandsentschädigung, Tätigkeits-
Tätigkeits und Anforderungsprofilen.
Neben den vorgegebenen
rgegebenen Leistungen wurden noch einige weitere Punkte aufgezählt. Am häufigsten, nämlich 6x,
wurden „gratis Mahlzeiten“ genannt. In 5 Einrichtungen werden regelmäßig „Feedbacktreffen“ veranstaltet und bei 3
Einrichtungen werden die Freiwilligen zu den „Betriebsfeiern“
„Betriebsfeiern“ eingeladen. Jeweils 2 Einrichtungen bieten
„Supervision“, „Infonachmittage“, „Freiwilligentreffs“ und „gemeinsame Ausflüge“ an. Zudem wurden noch „interne
Weiterbildungsmöglichkeiten“, diverse „Vergünstigungen“, „kleine Aufmerksamkeiten“, die
die „Anerkennung der
Leistungen in den Medien“, eine „Dankesfeier“ sowie „Auslandseinsätze“ angeführt.
Seite 14Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
5. Zusammenarbeit mit ULF
Die Einrichtungen wurden danach gefragt, ob sie in Zukunft mit ULF zusammen arbeiten möchten, um (neue)
freiwillige MitarbeiterInnen
nen zu gewinnen. Falls nicht, sollten sie begründen, warum dies der Fall ist.
Teilt man die Einrichtungen in jene, in denen derzeit freiwilligen MitarbeiterInnen tätig sind und jene, in denen das
nicht der Fall ist, sieht das Ergebnis folgendermaßen aus:
a
Seite 15Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
Gründe, warum keine Zusammenarbeit gewünscht wird:
Die Gründe, warum keine Zusammenarbeit mit ULF gewünscht wird, sind sehr vielseitig. In 13 Einrichtungen „gibt es
derzeit genügend freiwillige MitarbeiterInnen“, sodass diesen keine zusätzlichen Freiwilligen vermittelt werden
müssen. Bei 12 Einrichtungen „ist der Einsatz von freiwilligen MitarbeiterInnen derzeit überhaupt nicht geplant“ und
somit spielt das Thema keine Rolle für sie.
Ein anderer Grund, warum eine Zusammenarbeit ausgeschlossen wird,
wird, ist, dass „nur MitarbeiterInnen mit
einschlägiger Ausbildung benötigt werden“. Das ist bei 9 Einrichtungen der Fall. 5 Einrichtungen haben angegeben,
dass sie „ihre Freiwilligen aus der Pfarrgemeinde“ bekommen. 4x wurde genannt, dass „generell nur Hauptamtliche
Haup
beschäftigt werden“. Bei jeweils 3 Einrichtungen „kommen die Freiwilligen über das Rote Kreuz und die Caritas“ oder
sie werden „durch persönliches Ansprechen gesucht und gefunden“. Von 3 Einrichtungen wurde angegeben, dass
„der Einsatz der Freiwilligen
lligen gut koordiniert ist und keine Vorteile in einer Zusammenarbeit gesehen werden“. Bei drei
anderen Einrichtungen „wird innerhalb des Trägers an der Implementierung von Freiwilligen gearbeitet“ und bei
weiteren 3 „gibt es derzeit keine freien Personalressourcen“.
Personalr
Eine Zusammenarbeit wird zudem auch abgelehnt, weil „es keine passenden Tätigkeitsbereiche gibt“, „es schwierig
ist, eine Trennung zwischen Hauptamtlichen und Freiwilligen zu finden“, „es vertraute Leute für dieses Engagement
braucht“, mit „Zivildienern
vildienern und PflichtpraktikantInnen gearbeitet wird“ oder „das Thema erst wieder nach den
Umbauarbeiten relevant wird“.
Seite 16Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
6. Informationsmaterial über ULF
Die Einrichtungen wurden danach gefragt, ob die Zusendung von Informationsmaterial weiterhin erwünscht
erwünsch
ist.
Teilt man die Einrichtungen in jene, die zukünftig mit ULF zusammen arbeiten möchten und jene, die das nicht tun
wollen, sieht das Ergebnis folgendermaßen aus:
Seite 17Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
7. Anregungen oder Wünsche in Bezug auf Freiwilligenarbeit
7 Einrichtungen wollen
en „Informationen über Schulungsangebote und zwar sowohl für freiwillige MitarbeiterInnen, als
auch für BetreuerInnen/KoordinatorInnen“. Vorgeschlagen wurde hierbei auch „das Erkennen der eigenen Grenzen
und mein Umgang damit“. Für 3 Einrichtungen ist die „Durchsetzung der gesellschaftlichen Anerkennung von
Freiwilligenarbeit und eine Bewusstseinsschaffung“ wichtig.
Es wird angemerkt, dass „der Status der Freiwilligen in Österreich unklar ist“. Es wird aber auch nach klaren
rechtlichen und organisatorischen
n Rahmenbedingungen verlangt. 3 Einrichtungen wünschen sich diesbezüglich „eine
einheitliche Regelung für Oberösterreich und zwar in den Bereichen Schulungen und Versicherungen sowie bei
arbeitsrechtlichen und medizinischen Vorgaben“.
Darüber hinaus wird nach „Informationen über den Versicherungsschutz sowie nach einer günstigen Unfall-
Unfall und
Haftpflichtversicherung“ gefragt, wobei angemerkt wurde, dass „eine übergeordnete Regelung der Versicherung über
das Land Oberösterreich sinnvoll wäre, vor allem dann, wenn Freiwillige die Einrichtung wechseln“. Eine Nachfrage
besteht aber auch bei „der Erstellung eines Konzeptes für Freiwilligenarbeit“, nach „einer gemeinsamen Definition
von Anforderungsprofilen“ sowie nach „Informationen über andere Einrichtungen und deren
deren Einsatz von
Freiwilligenarbeit“. Auch „steuerliche Anreize“ wurden erwähnt.
Seite 18Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
8. Resümee
Mit rund 40 Prozent war die die Beteiligung an der Befragung sehr hoch. Wie bereits im Vorfeld der Erhebung
angenommen, bildet den größten Teil der teilnehmenden Einrichtungen – nämlich mit rund 51 Prozent – der
Bereich SeniorInnen und hier hauptsächlich der Bereich der Alten- und Pflegeheime. Rund 20 Prozent der
Teilnehmenden sind Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Kinder und Jugendliche.
Bemerkenswert ist, dass rund 62 Prozent der teilnehmenden Einrichtungen bereits freiwillige
MitarbeiterInnen einbinden. Auffallend ist dabei, dass anscheinend viele Einrichtungen vor allem in den
vergangenen zehn bis 15 Jahren auf das Engagement von Freiwilligen zurückgreifen. Zurückführen könnte man das
unter anderem auf eine Öffnung der Sozialeinrichtungen, vor allem auch der Alten- und Pflegeheime, aber auch auf
die steigenden Anforderungen in diesem Berufsfeld.
Bei der Begründung, warum keine Freiwilligen tätig sind, haben 48 Einrichtungen Auskünfte gegeben. 24 meinen,
dass es keine passenden Tätigkeitsbereiche gibt, 30 geben sonstige Gründe an. Neun Einrichtungen geben an, dass
Personen mit einschlägiger Ausbildung nötig sind, weitere sechs geben als Grund nicht vorhandene Strukturen für
Freiwillige und das Fehlen eines Konzeptes an. Bei der Frage, ob sie zukünftig gerne Freiwillige einbinden würden,
haben 60 Einrichtungen geantwortet, davon 20 mit „ja“.
Festgehalten werden muss an dieser Stelle auch die Einstufung der Notwendigkeit von freiwilligem
Engagement. Dazu haben 128 Einrichtungen Angaben gemacht. Davon stufen 80 Einrichtungen dieses Engagement
als „notwendig“, 34 als „manchmal notwendig“ ein. Davon geben 35 Einrichtungen als Begründung an, dass
aufgrund der knappen Zeit- und Personalressourcen verschiedene Maßnahmen ohne freiwilliges Engagement nicht
geleistet werden könnten. Vor allem geht es dabei um Zusatzangebote, die den Alltag bereichern würden. Vor allem
im Bereich SeniorInnen wird der Einsatz als unverzichtbar eingestuft. Lediglich acht Einrichtungen stufen diesen
Einsatz als „eher nicht bzw. nicht notwendig“ ein. Diese Bewertungen spiegeln die Bedeutung von freiwilligem
Engagement im Sozialbereich wider.
Betrachtet man die Verteilung der Freiwilligen nach Geschlecht und Alter, so zeigt sich, dass mehr als die
Hälfte (53 Prozent) Frauen sind. In Bezug auf das Alter der Freiwilligen haben 76 Einrichtungen geantwortet. Knapp
ein Viertel der Freiwilligen sind über 60 Jahre alt, ca. ein Sechstel zwischen 50 und 59 Jahre. Die Gruppe der bis
49Jährigen ist eher unterrepräsentiert. Angenommen wird, dass Menschen, die im Berufsleben stehen, eher weniger
Zeit für freiwilliges Engagement aufbringen können oder auch keine passenden Angebote vorfinden.
Gefragt nach den Tätigkeitsbereichen der Freiwilligen, antworteten 90 Einrichtungen. Ein Gros der Freiwilligen
engagiert sich im Besuchsdienst (38 Nennungen), gefolgt von Freizeitgestaltung, Veranstaltungen und Feste feiern
(31 Nennungen) und Vorstandstätigkeiten mit 13 Nennungen.
Hinsichtlich der Gewinnung von Freiwilligen werden als wirkungsvollste Mittel die direkte Ansprache von
Freiwilligen, sowie die Gewinnung durch andere Freiwillige genannt. Dieser Meinung sind mehr als die Hälfte der 74
Einrichtungen, die dazu Angaben gemacht haben.
Auf die Frage, ob durch die Einbindung von Freiwilligen Konflikte auftauchen, gaben 75 Einrichtungen eine Antwort.
Nur 14 dieser Einrichtungen geben an, dass es Konflikte gab bzw. gibt. Davon stufen zwei Drittel die Häufigkeit des
Auftretens als „selten“ ein. Keine Einrichtung gibt hier die Antwortmöglichkeit „oft“ an.
Seite 19Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen
In Bezug auf die Leistungen der Einrichtungen an die Freiwilligen haben 72 Einrichtungen geantwortet. 66
geben an, dass es eine Ansprechperson für Freiwillige gibt. Hinsichtlich weiterer Leistungen können vor allem die
Teilnahme an Veranstaltungen und Begleitung und Betreuung genannt werden. Eine Versicherung gegen
Haftungsrisiken wird von 28 und gegen Unfallrisiken von 24 dieser Einrichtungen angeboten. Lediglich ein Viertel
bietet ein Tätigkeits- oder Anforderungsprofil, Aufwandsentschädigung oder Einsatzvereinbarung an.
Gefragt, ob die Einrichtungen eine Zusammenarbeit mit ULF wünschen, antworteten 81 von 157 Einrichtungen
also mehr als 50 Prozent mit „ja“. Zudem möchten 110 Einrichtungen regelmäßig über die Aktivitäten des ULF
Informationen erhalten.
Abschließend kann festgehalten werden, dass die vorliegende Auswertung die Wichtigkeit und Notwendigkeit von
freiwilligem Engagement widerspiegelt. Die fortwährend steigenden Anforderungen und Bedürfnisse im Sozialbereich
macht dieses Engagement unverzichtbar. Eine Förderung und Entwicklung in diesem Bereich ist wesentlich, damit
Menschen, die sich freiwillig engagieren und damit ihre Zeit und ihre Kompetenzen zur Verfügung stellen, gute
Strukturen und Rahmenbedingungen vorfinden. Auch wenn dieses Engagement unentgeltlich also kostenlos ist, muss
es in entsprechender Form anerkannt und angemessen wertgeschätzt und vor allem in das öffentliche Bewusstsein
gerückt werden. ULF möchte dazu einen Beitrag leisten.
Seite 20VSG – Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum
Johann-Konrad-Vogel-Straße 2, 4020 Linz
0650.470 00 71, ulf@vsg.or.at
0650.470 00 72, ulf.office@vsg.or.at
www.ulf-ooe.at
Situationsanalyse „Freiwilligenarbeit in oö. Sozialeinrichtungen“
1. Informationen zur Einrichtung:
Name der Einrichtung:
Ansprechperson:
Strasse: PLZ: Ort:
Telefon: Fax: Mobil:
E-Mail: Internet:
2. Einsatzbereich(e) der Einrichtung:
□ SeniorInnen □ Kinder und Jugendliche
□ Familie □ MigrantInnen
□ Hilfs- und Rettungswesen □ Menschen mit Beeinträchtigungen
□ Obdachlosigkeit □ Sachwalterschaft
□ Frauen □ Männer
□ Hospiz □ Selbsthilfe
□ Sonstige:
3. Ist freiwilliges Engagement in Ihrer Einrichtung
□ notwendig □ manchmal notwendig □ eher nicht notwendig □ nicht notwendig
Erläutern Sie bitte kurz warum:
4. Sind in Ihrer Einrichtung freiwillige MitarbeiterInnen tätig?
□ ja □ nein
Wenn nein – weiter bei Frage 19!
5. Anzahl der Freiwilligen:
davon Frauen: davon Männer:
6. Alter:
bis 29: 30-39: 40-49: 50-59: über 60:
7. Seit wann arbeiten Freiwillige in der Einrichtung?VSG – Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum
Johann-Konrad-Vogel-Straße 2, 4020 Linz
0650.470 00 71, ulf@vsg.or.at
0650.470 00 72, ulf.office@vsg.or.at
www.ulf-ooe.at
8. In welchen Tätigkeitsbereichen?
9. Durchschnittliches Stundenausmaß pro Woche und Person:
10. Mit welchen Mitteln konnten (können) Freiwillige gewonnen werden?
□ Medien (Inserat, Artikel) □ Veranstaltungen □ direktes Ansprechen
□ Aushang □ durch andere Freiwillige
□ Sonstige:
11. Gab (gibt) es Konflikte in Ihrer Einrichtung durch die Einbindung von freiwilligen MitarbeiterInnen?
□ ja □ nein
Wenn nein – weiter bei Frage 15!
12. Wie häufig kommt es zu Konfliktsituationen?
□ oft □ manchmal □ selten
13. In welchen Bereichen treten Konflikte auf?
14. Welche Lösungsansätze gibt es in Ihrer Einrichtung?
15. In welchem Tätigkeitsfeld der Einrichtung ist Freiwilligenarbeit unverzichtbar, in welchem
wünschenswert?
Bereich: unverzichtbar: wünschenswert:
SeniorInnen □ □
Kinder- und Jugendliche □ □
Familie □ □
MigrantInnen □ □
Hilfs- und Rettungswesen □ □
Menschen mit Beeinträchtigungen □ □
Obdachlosigkeit □ □
Sachwalterschaft □ □
Frauen □ □
Männer □ □
Hospiz □ □
Selbsthilfe □ □
Sonstige: □ □
□ □VSG – Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum
Johann-Konrad-Vogel-Straße 2, 4020 Linz
0650.470 00 71, ulf@vsg.or.at
0650.470 00 72, ulf.office@vsg.or.at
www.ulf-ooe.at
16. Ist eine Mitgliedschaft erforderlich, um sich in Ihrer Einrichtung freiwillig zu engagieren?
□ ja □ nein
17. Gibt es in Ihrer Einrichtung eine feste Ansprechperson für Freiwillige?
□ ja □ nein
Wenn nein, warum nicht?
18. Welche Leistungen können Sie freiwilligen MitarbeiterInnen anbieten?
□ Einsatzvereinbarung □ Fahrtkostenersatz
□ Tätigkeits- und Anforderungsprofil □ Aufwandsentschädigung
□ Einarbeitung durch Fachkräfte □ Versicherung gegen Unfallrisiken
□ Aus- und Weiterbildungsangebote □ Versicherung gegen Haftungsrisiken
□ Begleitung/Betreuung □ Tätigkeitsnachweis/Zeugnis
□ Teilnahme an Teambesprechungen □ Teilnahme an Veranstaltungen
□ Sonstige:
Bitte weiter bei Frage 21!
19. Warum sind in Ihrer Einrichtung keine freiwilligen MitarbeiterInnen tätig?
□ Es gibt keine passenden Tätigkeitsbereiche in der Einrichtung.
□ Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht.
□ Die dafür nötigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen sind nicht vorhanden.
□ Freiwillige MitarbeiterInnen werden von den KlientInnen nicht angenommen.
□ Wir möchten Freiwillige nicht in unser Team einbinden.
□ Wir haben noch nie daran gedacht.
□ Sonstige Gründe:
20. Würden Sie gerne freiwillige MitarbeiterInnen in Ihre Einrichtung einbinden?
□ ja □ nein
Wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, möchten Sie vom ULF eine Hilfestellung bei der Einbindung von Freiwilligen (z.B. Zusendung einer Arbeitshilfe
für die Planung, Beratung in Bezug auf Freiwilligenarbeit)?
□ ja □ nein
21. Gibt es Anregungen oder Wünsche in Bezug auf Freiwilligenarbeit an das ULF?VSG – Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum
Johann-Konrad-Vogel-Straße 2, 4020 Linz
0650.470 00 71, ulf@vsg.or.at
0650.470 00 72, ulf.office@vsg.or.at
www.ulf-ooe.at
22. Möchten Sie in Zukunft mit dem ULF zusammen arbeiten, um neue freiwillige MitarbeiterInnen zu
gewinnen?
□ ja □ nein
Wenn nein, warum nicht?
Falls ja, werden wir Ihnen in nächster Zeit ein Anforderungsprofil zukommen lassen!
23. Möchten Sie weiterhin Informationen des ULF erhalten?
□ ja □ nein
Kontaktperson:
Postadresse: E-Mail:
WIR BEDANKEN UNS FÜR IHRE MITARBEIT UND FREUEN UNS AUF EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT !
Der Fragebogen dient nur zur internen Auswertung und Adaptierung unseres Angebotes. Ihre Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben.Sie können auch lesen