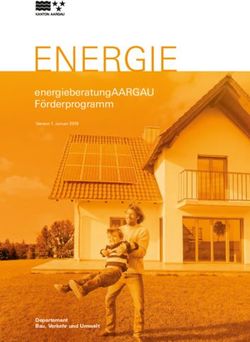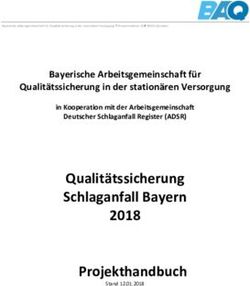Gebäude +energie - planen bauen fördern - Bayerisches Staatsministerium für ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium
des Innern
gebäude
+energie
3
planen
bauen
fördern
Bericht des Arbeitskreises
Energieeffizientes Bauen
Stand September 2012Inhalt
Vorwort4
Organigramm und Teilnehmer 6
Fachbeiträge:8
Aufbruch in ein neues Energiezeitalter 9
Energieeinsparverordnung 2007 bis 2012 10
Energieeffiziente Siedlungsentwicklung 11
Neuer Energiestandard im staatlichen Hochbau 12
Investitionspakt 2008, 2009 13
und Konjunkturpaket II
Energieeffizienz im Wohnungsbau 14
Das aktuelle Modellvorhaben e% des Experimentellen
Wohnungsbaus
Klimaschutz und Energieeffizienz in der 15
Städtebauförderung
Beispielhafte Bauten: Energieeffizientes Bauen in Bayern 16
Energetische Sanierung – Ertüchtigung von Wohn- und 17
Nichtwohngebäuden
Wie regionale Energieagenturen zur Energiewende 18
beitragen
Aktionsprogramm:19
01 – 18 Öffentlichkeitsarbeit und Information 21
19 – 32 Forschung und Umsetzung 30
33 – 38 Rechtliche Grundlagen 37
39 – 49 Weitere Aktivitäten 40
Tagesordnungen der Sitzungen des Arbeitskreises 46
ab Sept. 2008
Aktivitäten in den Regierungsbezirken seit April 2008 48
Weiterführende Links und Impressum 51
3Die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende ist ein ter des Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltmi-
zentrales Ziel bayerischer Politik. Am 24. Mai 2011 hat nisteriums, der sieben Bezirksregierungen, der Architek-
der Ministerrat das bayerische Energiekonzept „Energie tenkammer, der Ingenieurekammer-Bau, der kommuna-
innovativ“, eine Energieversorgung, die überwiegend len Spitzenverbände, des Verbandes der bayerischen
auf erneuerbaren Energien basiert, beschlossen. Damit Wohnungsunternehmen sowie der bayerischen Energie-
dieser Umstieg gelingen kann, müssen wir unsere größ- agenturen an. Der nun vorliegende dritte Bericht stellt
ten Potenziale nutzen – die Energieeinsparung und die die Aktivitäten des Arbeitskreises „Energieeffizientes
Steigerung der Energieeffizienz. Der Gebäudebereich Bauen“ der letzten vier Jahre dar. In Fachbeiträgen wer-
spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn rund 38% den darüber hinaus verschiedene Aspekte des energie-
der in Deutschland verbrauchten Energie werden hierfür effizienten Bauens genauer beleuchtet.
eingesetzt. Die Oberste Baubehörde im Bayerischen
Staatsministerium des Innern hat sich dieser Aufgabe Die enge Zusammenarbeit der Beteiligten bei der Um-
angenommen. Sie setzt nicht nur Maßnahmen bei staat- setzung der Energiewende in Bayern hat sich bewährt.
lichen Liegenschaften um, sondern unterstützt mit Bera- Das engagierte Miteinander wollen wir – Bauherren,
tungs- und Förderangeboten auch Projekte der Kommu- Bauwirtschaft, Planer, Kommunen und Freistaat – konst-
nen und energieeffiziente Modernisierungs- und Neu- ruktiv für die gute Sache fortsetzen.
baumaßnahmen von Wohngebäuden.
Den Aufbruch in ein neues Energiezeitalter kann der
Staat aber nicht allein bewältigen. Wir brauchen dazu
ein Zusammenwirken aller Kräfte. Nur im konstruktiven
Miteinander aller am Planen und Bauen beteiligten Ak-
teure lassen sich die Herausforderungen unserer Zeit
meistern. Bereits 2004 wurde der interdisziplinäre Ar-
beitskreis „Energieeffizientes Bauen“ an der Obersten
Baubehörde eingerichtet mit der Aufgabe, ein übergrei-
fendes Netzwerk zu bilden, eine Informations- und Wis-
sensplattform aufzubauen und konkrete Maßnahmen
anzustoßen bzw. umzusetzen. Neben Vertretern der
Obersten Baubehörde gehören dem Arbeitskreis Vertre-
Joachim Herrmann
Bayerischer Staatsminister des Innern
Mitglied des Bayerischen Landtags
Gerhard Eck
Staatssekretär im Bayerischen
Staatsministerium des Innern
Mitglied des Bayerischen Landtags
5Teilnehmer
ByAK ByIK -Bau VdW
Bayern
StMI/OBB
planen
StMWIVT bauen
fördern
Verband der
gebäude
+energie
Bayer. Bezirke
StMUGV
Bayer.
Landkreistag
StMELF
Bayer.
Städtetag
Energie
Innovativ Bayer.
Gemeindetag
Regierungen
LHSt
München
Stadt
Nürnberg
Bayerisches ARGE Energie-
Energie- Energie- Region
forum Agenturen Nürnberg
in Bayern
Arbeitskreis
Energieeffizientes Bauen
Die Arbeitsgruppenmitglieder haben gemeinsam
beschlossen, dass alle erarbeiteten Unterlagen generell
öffentlich, für jedermann zugänglich sind. Die Kern
aufgabe des Arbeitskreises besteht in der Bündelung
der Aktivitäten zu den Themen „Bauen und Energie“.
6Gisela Baumann Bayern Innovativ Daniel Kaus OBB Christian Schiebel
baumann@bayern-innovativ.de daniel.kaus@stmi.bayern.de Reg. von Oberbayern
0911 20671-154 089 2192-3656 christian.schiebel@reg-ob.bayern.de
089 2176-2216
Gerhard Binner Reg. von Mittelfranken Johann Lechner Reg. von Unterfranken
gerhard.binner@reg-mfr.bayern.de johann.lechner@reg-ufr.bayern.de Ingo Schötz OBB
0981 53-1254 0931 380-1443 ingo.schoetz@stmi.bayern.de
089 2192-3480
Wolfgang Böhm Thomas Lenzen ByAk
Energieagentur Oberfranken lenzen@byak.de Dr. Jürgen Seeberger
boehm@energieagentur-oberfranken.de 089 139880-0 EnergieRegion Nürnberg
09221 8239-0/-11 juergen.seeberger@energieregion.de
Michael Loch StMUG 0911 2529-624
Robert Burkhard LHSt München michael.loch@stmug.bayern.de
robert.burkhard@muenchen.de 089 9214-2220 Ingrid Simet OBB
089 233-60979 ingrid.simet@stmi.bayern.de
Wolfgang Müller Stadt Nürnberg 089 2192-3280
Peter Dombrowe Reg. der Oberpfalz wolfg.mueller@stadt.nuernberg.de
peter.dombrowe@reg-opf.bayern.de 0911 231-4223 Franziska Spreen OBB
0941 5680-414 franziska.spreen@stmi.bayern.de
Werner Ortinger StMELF 089 2192-3381
Klaus-Jürgen Edelhäuser BylK-Bau werner.ortinger@stmelf.bayern.de
mail@kje.de 089 2182-2704 Gottfried Weiß OBB
09861 94940 gottfried.weiss@stmi.bayern.de
Joachim Paas OBB 089 2192-3337
Monika Geiß Bayer. Städtetag joachim.paas@stmi.bayern.de
monika.geiss@bay-staedtetag.de 089 2192-3330 Dr. Maria Wellan Bayer. Landkreistag
089 290087-12/-0 maria.wellan@bay-landkreistag.de
Wolfgang Pazdior Reg. von Schwaben 089 286615-21
Irmgard Gihl Verband Bayer. Bezirke wolfgang.pazdior@reg-schw.bayern.de
i.gihl@bay-bezirke.de 0821 327-2494 Bernhard Wiesner StMWIVT
089 212389-23 bernhard.wiesner@stmwivt.bayern.de
Josef Poxleitner OBB 089 2162-2414/-01
Stefan Graf Bayer. Gemeindetag josef.poxleitner@stmi.bayern.de
stefan.graf@bay-gemeindetag.de 089 2192-3212 Christian Wunderlich
089 360009-23/-0 Reg. von Oberfranken
Karin Reich OBB christian.wunderlich@reg-ofr.bayern.de
Ulrich Hach Energie Innovativ karin.reich@stmi.bayern.de 0921 604-1506
ulrich.hach@stmwivt.bayern.de 089 2192-3442
089 2162-7066 Reinhard Zingler VdW Bayern
Doris Reuschl Reg. von Niederbayern reinhard.zingler@vdwbayern.de
Martin van Hazebrouck OBB doris.reuschl@reg-nb.bayern.de 0951 9144-12/-0
martin.vanhazebrouck@stmi.bayern.de 0871 808-1423
089 2192-3484
Peter Richter EnergieRegion Nürnberg
Herbert Hoch Bayer. Landkreistag peter.richter@energieregion.de
herbert.hoch@lra-mue.de 0911 2529-624
08631 699702
Martin Sambale eza-gGmbH
Julia Jelen OBB sambale@eza-allgaeu.de
julia.jelen@stmi.bayern.de 0831 960286-10
089 2192-3656
7Fachbeiträge
Aufbruch in ein neues Energiezeitalter Beispielhafte Bauten: Energieeffizientes Bauen in
MR Ulrich Daubenmerkl Bayern
Oberste Baubehörde/Sachgebiet Koordinierung Dipl.-Ing. Architekt Thomas Maria Lenzen
Umweltrecht, Baulandumlegung, Enteignungsrecht Geschäftsführer Architektur und Technik der
Bayerischen Architektenkammer
Energieeinsparverordnung 2007 bis 2012
MR Martin van Hazebrouck Energetische Sanierung – Ertüchtigung von Wohn-
Oberste Baubehörde/Sachgebiet Fachliche und Nichtwohngebäuden
Angelegenheiten der Bauordnung Dipl.-Ing. (FH) Alexander Lyssoudis, Vorstandsmitglied
der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
Energieeffiziente Siedlungsentwicklung
MR Stephan Lintner, BRin Johanna Löhlein Wie regionale Energieagenturen zur Energiewende
Oberste Baubehörde/Sachgebiet Städtebau beitragen
Martin Sambale, Geschäftsführer energie- & umwelt
zentrum allgäu
Neuer Energiestandard im staatlichen Hochbau
Ltd BD Andreas Kronthaler, BORin Karin Reich,
Oberste Baubehörde/Abteilung Staatlicher Hochbau
Umsetzung des Investitionspakts 2008, 2009 und des
Konjunkturpakets II
MR Gottfried Weiß, BRin Julia Jelen
Oberste Baubehörde/Sachgebiet Wohnraumförderung
Energieeffizienz im Wohnungsbau
Das aktuelle Modellvorhaben e% des Experimentellen
Wohnungsbaus
MRin Karin Sandeck, Oberste Baubehörde/Sachgebiet
Technische Angelegenheiten des Wohnungsbaus, Expe-
rimenteller Wohnungsbau
Klimaschutz und Energieeffizienz in der
Städtebauförderung
MR Armin Keller, BOR Ingo Schötz
Oberste Baubehörde/Sachgebiet Städtebauförderung
8Aufbruch in ein neues Energiezeitalter noch vor der ersten Wärmeschutzverordnung 1979
MR Ulrich Daubenmerkl errichtet. Diese Gebäude entsprechen vielfach nicht den
Oberste Baubehörde/Sachgebiet Koordinierung heutigen energetischen Anforderungen – im staatlichen
Umweltrecht, Baulandumlegung, Enteignungsrecht Bereich ebenso wie im kommunalen oder privaten
Bereich.
Durch die Einrichtung des Sonderprogramms zur ener-
Wenn zwischen 2015 und 2022 die bayerischen Atom- getischen Sanierung staatlicher Gebäude hat die Bayeri-
kraftwerke vom Netz gehen, müssen wir eine grundle- sche Staatsregierung die energetische Ertüchtigung
gende Energiewende geschaffen haben. Wir brauchen staatlicher Liegenschaften bereits vor Jahren verstärkt
eine zuverlässige, leistungsfähige und umweltverträgli- voran gebracht. Im Rahmen dieses Programms, das
che Energieversorgung, die auch bezahlbar ist. Dazu gilt einen wesentlichen Bestandteil des Klimaprogramms
es, Einsparpotenziale zu nutzen und die Energieeffizienz Bayern 2020 bildet, wurden in den Jahren 2008 bis 2011
zu steigern, denn nicht benötigte Energie muss auch ergänzend zu den regulären Haushaltsansätzen 150 Mio.
nicht erzeugt werden. Auch weil die Energiewende nicht Euro für die energetische Verbesserung des staatlichen
zu Lasten des Klimaschutzes gehen soll, müssen Wär- Gebäudebestands bereit gestellt. Oberstes Ziel dabei
me und Strom effizienter verwendet werden. war, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eine mög-
lichst große Reduzierung der CO2-Emmissionen zu errei-
Das Bayerische Energiekonzept „Energie innovativ“, das chen. Angegangen wurden dazu insbesondere die
am 24. Mai 2011 verabschiedet wurde, legt deshalb Gebäude, die mittelfristig für entsprechende Maßnah-
einen Schwerpunkt auf die Steigerung der Energieeffizi- men durch das zuständige Ressort nicht vorgesehen
enz und auf Verbesserungen bei der Energieeinsparung. waren.
Konkret bedeutet dies, dass das energieeffiziente Pla-
nen und Bauen sowie die energetische Gebäudesanie- Der staatliche Hochbau will auch künftig seiner Vorbild-
rung wesentliche Bestandteile der Energiewende sind, funktion gerecht werden. So hat die Staatsregierung im
da über ein Drittel der verbrauchten Energie in die Wär- Juli 2011 festgelegt, dass bei staatlichen Gebäuden
meversorgung von Gebäuden fließt. künftig ein deutlich höherer Energiestandard zugrunde
gelegt wird. Neue Verwaltungsgebäude des Freistaats
Energieeffizientes Planen und Bauen beginnt mit der Bayern werden auf der Grundlage des Passivhausstan-
städtebaulichen Planung. Wesentlicher Bestandteil dards ausgeführt. Für alle anderen staatlichen Baumaß-
dabei sind kommunale Energiekonzepte, die in der Kom- nahmen, sowohl im Neubau als auch im Bestand, ist
mune Verbrauch und Entwicklungspotenziale aufzeigen grundsätzlich die Anforderung der Energieeinsparver-
und als Grundlage für eine weitere städtebauliche Ent- ordnung 2009 bezüglich der durchschnittlichen Anforde-
wicklung dienen, vor allem aber die energetische Ent- rungen an die Gebäudehülle um 30% zu unterschreiten.
wicklung in der Gemeinde steuern: Ein erster Schritt
dazu ist eine Bestandsanalyse, die den konkreten Ener- Welch immenser Bedarf bei den Gemeinden besteht,
gieverbrauch im Ort ermittelt. Als zweites sind dann die ihre Einrichtungen energetisch zu sanieren, wurde durch
Potenziale für regenerative Energien vor Ort darzustel- den 2008 aufgelegten Investitionspakt Bund-Länder-
len. Schließlich sind als dritter Schritt die erneuerbaren Kommunen deutlich. Darauf folgte mit dem Konjunktur-
Energiequellen mit dem Energiebedarf zu koordinieren. paket II die „Energetische Modernisierung der sozialen
Für die anschließende zügige Umsetzung des Energie- Infrastruktur“ in Bayern.
konzepts in die kommunale Bauleitplanung sind Pla-
nungssicherheit und Akzeptanz bei Bürgern und Unter- Der ausschlaggebende Beitrag für den Erfolg der Ener-
nehmern entscheidend. Das Innenministerium unter- giewende liegt allerdings in der Sanierung der bestehen-
stützt die Gemeinden bei der Entwicklung von Energie- den Wohngebäude, deren Bestand in Bayern bei 5,7
konzepten und deren Umsetzung in der Bauleitplanung. Mio. Wohneinheiten liegt. Hier müssen die Mittel der
KfW für ihre bisher sehr erfolgreiche Förderung aufge-
Im Bauplanungsrecht ist es besonders wichtig, dass stockt werden. Daneben sind weitere Anreize für die
Städte und Gemeinden die Bedeutung der aktiven Wahr- energetische Modernisierung von Wohnungen zwin-
nehmung bauplanungsrechtlicher Steuerungsmöglich- gend erforderlich, bis hin zur steuerlichen Förderung
keiten speziell bei Windkraftanlagen erkennen. Nur von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohnge-
dann, wenn sich die Gemeinde zur Festlegung von Kon- bäuden.
zentrationszonen im Flächennutzungsplan entschließt
und damit im Sinne der Energiewende aktiv wird, kann
die Gemeinde die Standorte von Windkraftanlagen posi-
tiv festlegen. Der Windkrafterlass vom 20. Dezember
2011 der Bayer. Staatsministerien bietet hier eine
wesentliche Hilfestellung.
Das zentrale Ziel ist es, eine Reduzierung des Wärmebe-
darfs um 20% und bis 2050 eine Minderung der CO2-
Emissionen im Gebäudesektor in der Größenordnung
von 80% zu erreichen. Dafür ist der Gebäudebestand
entscheidend. Dreiviertel des Gebäudebestands wurden
9Energieeinsparverordnungen 2007 bis 2012 einzelne „unbedingte“ Nachrüstanforderungen: Außer-
MR Martin van Hazebrouck betriebnahme alter Heizkessel (vor dem 01.10.1978 auf-
Oberste Baubehörde/Sachgebiet Fachliche Angelegen- gestellt), Dämmung oberster Geschossdecken, Däm-
heiten der Bauordnung mung von Warmwasser- und Wärmeverteilungsleitun-
gen. Die EnEV stellt außerdem Mindestanforderungen
an einzelne Bauteile, falls diese erneuert werden, zwingt
aber nicht zur Modernisierung. An diesem Grundsatz
wird auch künftig festzuhalten sein.
Die Änderungen der zum 01.10.2007 novellierten EnEV
(EnEV 2007) waren zur Umsetzung der von der EU 2002
erlassenen „Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden“ (kurz „Gebäuderichtlinie“) in nationales
Recht erforderlich. Um bei Nichtwohngebäuden u. a.
auch den Energiebedarf für Klimatisierung und Beleuch-
tung – wie in der Richtlinie gefordert – erfassen zu kön-
nen, wurde ein neues Rechenverfahren, die DIN V
18599, eingeführt. Nach dieser Norm wird ein Referenz-
gebäude berechnet, das in Nutzung und Geometrie mit
Symposium zur EU-Gebäuderichtlinie mit Herrn Staatsminister
Herrmann am 15.09.2008 in der Bayer. Vertretung Brüsel
dem geplanten Gebäude identisch ist, hinsichtlich der
technischen Ausführung jedoch festgelegten Anforde-
Die bundesrechtlichen Regelungen zur Gebäudeener- rungen der EnEV entspricht. Der errechnete Primärener-
gieeffizienz waren wiederholt Gegenstand der Berichter- giebedarf ist vom Bauvorhaben einzuhalten („Referenz-
stattung und – durchaus auch kontroversen – Diskussio- gebäudeverfahren“).
nen im Arbeitskreis. Im Blickpunkt standen immer wie-
der die Fragen, ob die mit der Energieeinsparverord- Nicht zuletzt aus der Förderpraxis gewonnene Erfahrun-
nung (EnEV) gestellten Anforderungen noch dem Wirt- gen hatten gezeigt, dass bei dem seit 2002 unverändert
schaftlichkeitsgebot des Energieeinsparungsgesetzes gültigen Anforderungsniveau der EnEV noch Spielräume
(EnEG) entsprechen, ob der Bogen im Hinblick auf den für anspruchsvollere Vorgaben bestanden. Die am
vermieteten Wohnungsbestand nicht schon überspannt 01.10.2009 in kraft getretene EnEV 2009 erhöht die pri-
ist oder ob im Hinblick auf den Klimawandel und auf märenergetischen Anforderungen für Neubauten um
eine wirksame Gefahrenabwehr vom Wirtschaftlichkeits- rund 30% und die Anforderungen an die Gebäudehülle
gebot sogar abgewichen werden sollte. um rund 15%; bei größeren Änderungen im Gebäude-
bestand werden ebenfalls um 30% höhere Anforderun-
Nach § 5 EnEG müssen die in den Rechtsverordnungen gen gestellt. Die EnEV 2009 enthält außerdem eine Rei-
des Bundes aufgestellten Anforderungen nach dem he von zusätzlichen Nachrüstverpflichtungen, darunter
Stand der Technik erfüllbar und für Gebäude gleicher Art eine Dämmpflicht oberster begehbarer Geschossde-
und Nutzung wirtschaftlich vertretbar sein. Anforderun- cken. Nicht zuletzt aufgrund der Initiative Bayerns blei-
gen gelten als wirtschaftlich vertretbar, wenn generell ben selbst genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser von
die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der üblichen diesen Nachrüstpflichten auch weiterhin ausgenom-
Nutzungsdauer durch die eintretenden Einsparungen men, solange sie nicht veräußert werden.
erwirtschaftet werden können. Die Bayerische Staatsre-
gierung ist weiterhin der festen Überzeugung, dass dem Aus der neu gefassten und am 18.06.2010 bekannt
Bürger keine Anforderungen an die Gebäudeenergieeffi- gemachten EU-Gebäuderichtlinie ergibt sich für den
zienz zugemutet werden können, die dem Wirtschaft- Bund die Notwendigkeit, die Energieeinsparverordnung
lichkeitsgebot nicht genügen. Die Oberste Baubehörde 2009 erneut zu novellieren. Die Richtlinie fordert von
ist bei den Fortschreibungen des Energieeinsparungs- den Mitgliedstaaten, einen „Niedrigstenergie-Standard“
rechts des Bundes über die Bundesratsbehandlung, vorzugeben, dem alle Neubauten ab dem 31.12.2020
aber auch über die Gremienarbeit der Länder und des (Gebäude der öffentlichen Hand bereits ab 31.12.2018)
Bundes (so etwa durch ihre Mitarbeit in der Projektgrup- genügen müssen, stellt aber auch diese Anforderung
pe EnEV der Bauministerkonferenz) intensiv eingebun- unter einen Wirtschaftlichkeitsvorbehalt. Nachdem heu-
den – bei den beiden letzten Novellierungen der EnEV te nicht abschätzbar ist, welcher Standard 2021 bzw.
2007 und 2009 ebenso wie bei der aktuellen Fortschrei- 2019 wirtschaftlich sein wird, will der Bund den Nied-
bung („EnEV 2012“). rigstenergie-Standard zunächst nur als Verpflichtung im
EnEG verankern, ohne ihn weiter zu definieren. Unab-
Die EnEV geht zurück auf die Wärmeschutzverordnung hängig vom Anpassungsbedarf der EnEV an die EU-
von 1977, die – als Reaktion auf die erste Ölkrise Gebäuderichtlinie prüft der Bund, welcher Spielraum
1973/74 – erstmals den Wärmebedarf von Gebäuden in sich aus dem Wirtschaftlichkeitsgebot des EnEG aktuell
Deutschland begrenzte. 2002 wurden Wärmeschutzver- überhaupt noch für weitere Erhöhungen der Gebäude-
ordnung und Heizungsanlagenverordnung in der EnEV energieeffizienz-Anforderungen ergibt. Bayern wird sich
zusammengefasst. Die EnEV begrenzt den Primärener- – wie auch bei früheren Novellierungen der EnEV – für
giebedarf von Neubauten und stellt Mindestanforderun- eine strikte Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebotes,
gen an die Gebäudehülle und an die Effizienz der für technische Machbarkeit und für einen Vollzug ohne
Anlagentechnik. Bei Bestandsgebäuden stellt die EnEV unnötige Bürokratie einsetzen.
10Energieeffiziente Siedlungsentwicklung plans in der räumlichen Planung zeigt der Energienut-
MR Stephan Lintner, BRin Johanna Löhlein zungsplan ganzheitliche energetische Konzepte und Pla-
Oberste Baubehörde/Sachgebiet Städtebau nungsziele auf.
Die ersten Phasen bei der Erstellung eines Energienut-
zungsplans bilden die Bestands- und Potenzialanalyse.
Ermittelt werden der bestehende Energiebedarf, die
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit
Energieinfrastruktur und die vor Ort vorhandenen Ener-
giepotenziale unter Beachtung zu erwartender Entwick-
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern
lungen wie Baulandausweisungen und Bevölkerungs-
wachstum. Auf Basis der Ergebnisse wird ein Konzept
erarbeitet, das den bestehenden Bedarf und die Potenzi-
Leitfaden ale räumlich verknüpft. Ziel ist es beispielsweise, Wär-
Energienutzungsplan me aus erneuerbaren Energien möglichst verbraucher-
nah zu erzeugen, um Leitungslängen zu verringern und
Transportverluste zu vermeiden. Im Bereich des Stroms
ist die räumliche Nähe weniger relevant.
Zudem werden Möglichkeiten der Energieeinsparung
und -effizienzsteigerung im Bereich der Gebäude, aber
auch bei Gewerbe und Industrie untersucht.
Es ist die Aufgabe der Städte und Gemeinden, abzuwä-
gen und zu entscheiden, welches konkrete Konzept ver-
folgt werden soll.
Die Umsetzung der Ziele eines Energienutzungsplans
erfolgt unter anderem im Rahmen der kommunalen
NIS
MI T
S
E
N
RI
LEBE
UM
A
E
B
Y E .D
R N
Bauleitplanung.
Eine zukunftsorientierte nachhaltige Siedlungsentwick- Eine weitreichende Akzeptanz und Eigeninitiative bei
lung erfordert es, Energieeffizienz und Klimaschutz Bürgern, Unternehmen, Groß- und Sonderabnehmern
neben Flächensparen und demografischem Wandel bei sowie den Energieversorgern vor Ort fördert eine erfolg-
der städtebaulichen Planung intensiv zu berücksichti- reiche Umsetzung. Es ist deshalb wichtig, relevante
gen. Zwischen den Themen ergeben sich dabei vielfach Akteure vor Ort bereits frühzeitig bei der Erstellung des
Berührungspunkte und Synergieeffekte. Energienutzungsplans einzubinden und Möglichkeiten
Den Städten und Gemeinden kommt bei der Umsetzung für bürgerliches und unternehmerisches Engagement
der Energiewende eine wichtige Rolle zu. Bereits auf aufzuzeigen und zu nutzen.
der Ebene der Ortsplanung können die Weichen für den
späteren Energieverbrauch und eine nachhaltige Ener- In vielen Fällen sind die benachbarten Kommunen von
gieversorgung von Siedlungen und Gebäuden gestellt der Umsetzung betroffen. Vielfach können sich auch
werden. Entscheidende Aspekte sind der Vorrang der Synergien ergeben. Deshalb ist vielerorts über eine blo-
Innenentwicklung und die Schaffung kompakter Sied- ße Abstimmung hinaus auch eine gemeinsame Planung
lungseinheiten. Mit einer konsequenten Innenentwick- über Gemeindegrenzen hinweg sinnvoll.
lung können innerörtliche Brachflächen wiederbelebt
und Baulücken aufgefüllt werden. Die vorhandene Infra- Die Städte und Gemeinden werden mit einem Energie-
struktur kann effizienter genutzt werden, dies hat auch nutzungsplan in die Lage versetzt, die Umsetzung von
wirtschaftliche Vorteile. Teilkonzepten und Maßnahmen gezielt zu koordinieren
Lebendige Ortszentren mit allen Einrichtungen des tägli- sowie zu überprüfen, ob Einzelvorhaben sich sinnvoll in
chen Bedarfs ersparen den Bürgern lange Wege und das angestrebte energetische Konzept einfügen.
reduzieren zusätzlich das Verkehrsaufkommen. Das Ziel
einer „Stadt der kurzen Wege“ erhält deshalb vor dem Die Oberste Baubehörde unterstützt die Kommunen bei
Hintergrund des Aufbruchs in ein neues Energiezeitalter einer energieeffizienten Stadtplanung durch Beratung
neues Gewicht. und Information. In 2010 wurde hierzu das Arbeitsblatt
Das Bayerische Energiekonzept setzt verstärkt auf „Energie und Ortsplanung“ veröffentlicht (s. Nr. 08). Der
dezentrale Versorgungsstrukturen. Viele Aspekte der im Juli 2011 erschienene „Leitfaden Energienutzungs-
Energieversorgung müssen bereits auf der Ebene der plan“, der im Rahmen eines Modellprojekts entstanden
Ortsplanung entschieden werden. Im Hinblick auf eine ist (s. Nr. 27), soll anderen Städten und Gemeinden als
energieeffiziente und regenerative Energieversorgung Impulsgeber und Arbeitsanleitung zur Erstellung eines
sind vielfach strukturelle Anpassungsprozesse und spe- energetischen Gesamtkonzeptes dienen. Modellhafte
zifische Einzelmaßnahmen notwendig. Vorgehensweisen bei städtebaulichen Planungen und
Untersuchungen können mit Zuschüssen des Freistaats
Für eine sinnvolle und effiziente Umsetzung ist ein ganz- Bayern gefördert werden. Beispielsweise wird aktuell
heitliches kommunales Energiekonzept sinnvoll. Ein eine Feinuntersuchung zur Erstellung eines interkommu-
Energienutzungsplan kann den Städten und Gemeinden nalen sachlichen Teilflächennutzungsplans für Wind-
als informelles Planungsinstrument zum Thema Energie kraftanlagen für 22 Gemeinden im Landkreis Fürsten-
dienen, um die energetische Entwicklung zu steuern. feldbruck unterstützt.
Vergleichbar dem Grundgedanken des Flächennutzungs-
11Neuer Energiestandard im staatlichen Hochbau
Ltd BD Andreas Kronthaler, BORin Karin Reich,
Oberste Baubehörde/Abteilung Staatlicher Hochbau
Mit der Neufassung der „Richtlinie über die Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden“, die im Juli 2010 in Kraft
getreten ist, hat die EU eine Vorschrift von maßgebli-
cher Bedeutung für den Gebäudebereich formuliert.
Neben grundsätzlichen Anforderungen an die Energieef-
fizienz bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen fordert
die EU ab Ende 2020 die Errichtung sogenannter „Near-
ly-Zero-Energy-Buildings“ bzw. „Niedrigstenergiegebäu-
de“. Öffentlichen Bauherren soll eine Vorreiterrolle
zukommen. Für sie gilt die Verpflichtung bereits ab Ende
2018.
Angesichts dieser anstehenden Vorgabe hat der Minis-
terrat im Juli 2011 beschlossen, bereits jetzt Verwal-
tungsneubauten des Freistaats auf der Grundlage des
Passivhausstandards zu errichten. Für einzelne Sonder-
baumaßnahmen mit komplexeren Nutzungsanforderun-
gen soll der Passivhausstandard in Pilotprojekten ange-
wandt werden. Bei allen anderen Gebäuden werden Funktionsprinzipien eines Passivhauses
künftig die geltenden Anforderungen der EnEV 2009 an
den durchschnittlichen Wärmedurchgang der Außen- – hochwärmegedämmte opake Bauteile,
bauteile um 30% unterschritten. U-Wert ≤ 0,15 W/m²K
– hochisolierende dreifachverglaste Fenster,
Der Passivhausstandard wurde durch das Passivhausin- U-Wert ≤ 0,8 W/m²K
stitut in Darmstadt entwickelt und bereits vor zwanzig – zuverlässig luftdichte Konstruktion und
Jahren erstmals realisiert. Anfangs vor allem im Woh- – Minimierung von Wärmebrücken.
nungsbau angewandt, etabliert sich der Passivhausstan-
dard mittlerweile auch im Bereich von Nichtwohngebäu- Gleichzeitig minimiert eine Lüftungsanlage über eine
den. Er wird inzwischen europaweit – und auch über hocheffiziente Wärmerückgewinnung die Lüftungswär-
Europa hinaus – umgesetzt. Ein „Passivhaus“ weist auf- meverluste. Eine kontrollierte Lüftung stellt im Passiv-
grund seiner optimierten Gebäudehülle einen minimier- haus – neben der Rückgewinnung von Wärme – den
ten Energiebedarf auf und benötigt weder eine her- hygienisch erforderlichen Luftwechsel und eine hohe
kömmliche Heizung noch eine konventionelle Kühlung. Raumluftqualität sicher. Die hoch gedämmte warme
Der Wärmebedarf wird dabei zum überwiegenden Teil Außenwand verhindert zuverlässig Schimmelbildung an
aus „passiven“ Quellen gedeckt wie solaren Gewinnen den Innenoberflächen und führt zu einem konstant aus-
über Fenster und internen Wärmegewinnen durch Per- geglichenen und behaglichen Temperaturniveau. Gleich-
sonen oder technische Geräte. Der verbleibende gerin- zeitig trägt die hohe Wärmedämmung von Dach und
ge Energiebedarf kann effizient durch eine Versorgung Wänden zu angenehmen Innentemperaturen auch im
auf niedrigem Temperaturniveau abgedeckt werden – im Sommer bei.
Hinblick auf künftige Anforderungen an „Niedrigstener- Unbedingt erforderlich ist im Passivhaus ein gut funktio-
giegebäude“ vorzugsweise auf der Basis regenerativer nierender Sonnenschutz, um die Sonneneinträge durch
Energien. die Fenster gezielt steuern und begrenzen zu können.
Die mechanische Lüftung kann im Sommer die nächtli-
Ein Passivhaus muss definierte energetische Kennwerte che Luftspülung unterstützen. Nach heutigen Erkennt-
einhalten: nissen erzielen Passivhäuser eine hohe Gesamtwirt-
– Heizwärmebedarf ≤ 15 kWh/(m²a) schaftlichkeit. Die hochwertige Gebäudehülle und Bau-
– Nutzkältebedarf ≤ 15 kWh/(m²a) ausführung führen in der Regel zu erhöhten Investitions-
– Primärenergiebedarf ≤ 120 kWh/(m²a) kosten, die in einer Größenordnung von rund 4 bis 12%
– Gebäudeluftdichtheit ≤ 0,6/h liegen können. Gleichzeitig reduzieren sie den Energie-
– Gebäudeheizlast ≤ 10 W/m² bedarf und die Energiekosten, so dass in der Regel über
eine bestimmte Laufzeit die Einsparungen im Betrieb
Die Begrenzung des Primärenergiebedarfs auf 120 kWh/ die investiven Mehrkosten kompensieren.
(m²a) umfasst dabei alle im Haus vorhandenen Verbrau- In einer Pilotphase wurden bereits mehrere Maßnah-
cher wie Beleuchtung, technische Geräte etc. men initiiert und entsprechende Erfahrungen gesam-
Ziel des Passivhausstandards ist die Minimierung des melt, so dass auf Vorschlag der Obersten Baubehörde
Energieverbrauches; die Wärmeverluste durch Trans- der Ministerrat mit Beschluss vom 19. Juli 2011 die
mission im Bereich der Gebäudehülle werden reduziert grundsätzliche Anwendung des Passivhausstandards
durch bei Neubauten von Verwaltungsgebäuden einführte.
12Investitionspakt 2008, 2009 und Konjunkturpaket II Die vorgefundene Architektursprache zahlreicher
MR Gottfried Weiß, BRin Julia Jelen, Bestandsgebäude war sehr anspruchsvoll und hochwer-
Oberste Baubehörde/Sachgebiet Wohnraumförderung tig, so dass eine verantwortungsvolle Auseinanderset-
zung mit dem individuellen architektonischen Konzept
sowie eine differenzierte und abgestimmte Planung uner-
lässlich waren. So unterschiedlich die Gebäude, so vari-
Das energetische Einsparpotenzial im Gebäudebereich antenreich waren dabei folglich die Planungsergebnisse.
ist beträchtlich. So werden in Deutschland etwa 38%
der verbrauchten Energie für die Erzeugung von Raum- Um die Erfahrungen aus dem KPII und IP 08 und 09 zu
wärme (ca. 30%), von Warmwasser (ca. 5%) und die dokumentieren, gleichzeitig aber den Blick in die
Beleuchtung (ca. 3%) eingesetzt. Mit der Entscheidung Zukunft zu richten, hat die Oberste Baubehörde unter
des Deutschen Bundestags vom 30. Juni 2011 zum dem Titel „Energiesparen macht Schule“ gemeinsam
Atomausstieg haben die Themen Energieeinsparung, mit Umweltministerium, Kultusministerium und Bayeri-
Effizienzsteigerung und der Umstieg auf erneuerbare scher Architektenkammer eine Auswahl von Schulpro-
Energien zusätzliche Bedeutung gewonnen. Dass dabei jekten begleitet, bei denen es besonders gut gelungen
insbesondere im Bereich des Gebäudebestands der ist, die alten Gebäude funktional wie gestalterisch wei-
sozialen Infrastruktur ein enormer energetischer Moder- terzuentwickeln.
nisierungsbedarf besteht, zeigt sich u.a. an den über
5.500 kurzfristig von kommunalen und privaten Maßnah- Im Sonderheft Bau Intern zum KP II wurde zudem eine
menträgern erstellten Bewerbungen zur Aufnahme in Auswahl aus den zahlreichen sehenswerten Maßnah-
das Förderprogramm Konjunkturpaket II (KPII) im Früh- men veröffentlicht. Diese, aber auch die weiteren im
jahr 2009. Rahmen des KPII und IP 08 und 09 geförderten Maß-
nahmen in ganz Bayern, können vorbildliche Lösungen
Anlass für das KPII waren die Folgen der Finanz- und für die technischen, wirtschaftlichen und gestalteri-
Wirtschaftskrise im Jahr 2008. Das Teilprogramm „Ener- schen Herausforderung energetischer Modernisierun-
getische Modernisierung sozialer Infrastruktur in Bay- gen aufzeigen.
ern“ (insbesondere Schulen, Kindergärten, Verwaltungs-
gebäude) wurde als Maßnahme zur Belebung der Bau- Trotz der immensen Zahl von über 1.600 im Rahmen des
wirtschaft initiiert. Der fachliche Fokus lag dabei auf Ein- KPII und IP 08 und 09 umgesetzten Projekten, darf hier-
sparungen im energetischen Bereich. Bereits mit dem bei nicht vergessen werden, dass es sich dabei nur um
Investitionspakt 2008 (IP), fortgesetzt mit dem IP 2009, einen geringen Bruchteil des modernisierungsbedürfti-
hat man in Bayern in vergleichbarer Weise insgesamt gen Gebäudebestands der sozialen Infrastruktur in Bay-
146 Maßnahmen gefördert. ern handelt und weiterhin enorme Einsparpotenziale in
diesem Bereich bestehen. Aus diesem Grund setzt sich
An erster Stelle der energetischen Modernisierungskon- das Bayerische Staatsministerium des Innern für eine
zepte im KPII und IP 08 und 09 stand zumeist eine Redu- Neuauflage des Investitionspakts ein.
zierung des Wärmeverlusts durch die Außenhülle (Trans-
missionswärmeverlust). Dies wurde durch umfangreiche
Wärmedämmmaßnahmen an Außenwänden, Keller- und
Geschossdecken und im Dachraum, die Erneuerung
alter Fenster sowie vereinzelt durch die Nachrüstung von
Windfängen erreicht. Zur Steigerung der Energieeffizienz
wurden zudem veraltete Heizungen durch moderne, häu-
fig mit regenerativer Energie betriebene Anlagen ersetzt.
Maßnahmen wie der Einbau von Lüftungsanlagen mit
integrierter Wärmerückgewinnung und die Umrüstung
der Beleuchtung ergänzten die energetischen Konzepte.
Durch Energiebedarfsausweise wurde der Erfolg der
energetischen Sanierung nachgewiesen.
Neben den energetischen Einsparungen konnten im
Rahmen der Modernisierungen zumeist weitere Gebäu-
deaufwertungen mit vergleichsweise geringem Auf-
wand realisiert werden, um den vielfältigen Ansprüchen,
die heute von Eigentümern und Nutzern an Gebäude
gestellt werden, gerecht zu werden. Diese umfassen
z.B.:
– wirtschaftliche Gesichtspunkte (z.B. geringer Energie-
verbrauch),
– gestalterische (z.B. modernes Erscheinungsbild) und
– funktionale Aspekte (z.B. Brandschutz, Barrierefrei-
heit, Schallschutz, Funktionalität der Räume),
– Anforderungen an die Behaglichkeit (z.B. frische Luft,
keine Zugluft, angenehme Temperatur). Gesundheitsamt Fürstenzell vor und nach der Sanierung
(Walter Schwetz Architekt BDA, Passau)
13Energieeffizienz im Wohnungsbau Projekten sind kleinere Maßnahmen im ländlichen Raum
Das aktuelle Modellvorhaben e% des Experimentel- wie größere Wohnsiedlungen, konventionellere Konzep-
len Wohnungsbaus te wie innovative Formen der Energiegewinnung für Ein-
Dipl.-Ing. Architektin Karin Sandeck, Oberste Baubehör- zelgebäude und für Quartiersversorgungen. Die Einbe-
de/Sachgebiet Technische Angelegenheiten des Woh- ziehung der Nutzer in die Planung der Modernisierungs-
nungsbaus, Experimenteller Wohnungsbau maßnahmen, Mieterinformationen und leicht handhab-
bare technische Lösungen tragen zur Akzeptanz der
noch ungewohnten Standards durch die Bewohner bei.
Die Oberste Baubehörde arbeitet im Rahmen des sog. Inzwischen sind die ersten beiden Pilotprojekte bezo-
Experimentellen Wohnungsbaus an der Zukunft des gen; zwei weitere Maßnahmen werden in diesem Jahr
Wohnens. In Zusammenarbeit mit innovationsfreudigen fertig gestellt. Mit einem errechneten Primärenergiebe-
Wohnungsunternehmen entstehen Schrittmacherprojek- darf zwischen 21 und 37 kWh/m²a und Werten von bis
te, die zeigen, wie sich ändernde Anforderungen im zu nur 0,16 W/m²k bei der energetischen Qualität der
Wohnungsbau mit neuen Konzepten gut und kosten- Gebäudehülle wird die Zielsetzung des Modellvorha-
günstig umgesetzt werden können. bens bei Neubauten sogar teilweise unterschritten. Bei
Die Endlichkeit der fossilen Brennstoffe, der steigende den Modernisierungen kann der Primärenergiebedarf
Energieverbrauch und die Notwendigkeit zur Reduzie- bis fast um den Faktor 10 auf 38 kWh/m²a gesenkt wer-
rung der CO2-Emissionen haben den bayerischen Expe- den. Die ersten Ergebnisse zeigen aber auch, dass die
rimentellen Wohnungsbau im Jahr 2007 veranlasst, mit Gesamtwirtschaftlichkeit der Gebäude unter den derzei-
dem Modellvorhaben „e% – Energieeffizienter Woh- tigen Rahmenbedingungen und insbesondere in Regio-
nungsbau“ Anschauungsprojekte zur Reduzierung von nen mit niedrigem Mietniveau und hohen Baukosten
Energieverbrauch und zum verstärkten Einsatz erneuer- nicht leicht zu erreichen ist. Detaillierte Ergebnisse wird
barer Energien im Geschosswohnungsbau anzuschie- die Nachuntersuchung nach Abschluss des zweijährigen
ben. Energetische Zielsetzung des Modellvorhabens ist Monitorings zeigen.
es, um 40% bessere energetische Werte zu erreichen, Mit der Modellreihe stehen zu einem Zeitpunkt, an dem
als es die aktuelle Energieeinsparverordnung bei Moder- die Energiewende in der Planungspraxis ankommt, reale
nisierungen wie beim Neubau fordert. Damit soll in der Anschauungs- und Diskussionsprojekte zur Verfügung,
Praxis überprüft werden, inwieweit gesetzliche Zukunfts- aus denen die Wohnungspolitik weiterentwickelt wer-
standards Auswirkungen auf die städtebauliche Anord- den kann, Wohnungsbaugesellschaften Nachfolgepro-
nung, die Baukörperform, die Fassadengestaltung, die jekte konzipieren und Architekten Bauträger und Baufa-
Haustechnik und auf die Gesamtwirtschaftlichkeit eines milien beraten können, um nachhaltigen Wohnungsbau
Mehrfamilienhauses haben, um darauf im Rahmen der in Bayern in der Breite zu forcieren.
bayerischen Wohnungspolitik reagieren zu können.
Über das Energiesparziel hinaus sollen die Maßnahmen
eine breite Palette an weiteren Nachhaltigkeitsaspekten
beinhalten und sich dennoch an den Wirtschaftlichkeits-
kriterien des geförderten Wohnungsbaus orientieren.
Allerdings darf der dort vorgegebene Kostenrahmen
wegen des ambitionierten energetischen Standards
leicht überschritten werden. Um die Projekte nicht wie
üblich nur aus der Gebäudeperspektive zu betrachten,
wurden die Konzepte der insgesamt 10 Projekte in Pla-
nungswettbewerben mit interdisziplinär besetzten
Teams aus Architekten und Energiefachplanern ermit-
telt. Um den kontinuierlichen Queraustausch zwischen
den Projekten zu gewährleisten und eine fundierte
Nachuntersuchung erarbeiten zu können, wird die
Umsetzung der Maßnahmen und das sich anschließen-
de zweijährige Monitoring durch ein von der Obersten
Baubehörde beauftragtes wissenschaftliches Gremium
begleitet.
Das Modellvorhaben umfasst sieben Neubau- und zwei
Modernisierungsmaßnahmen. Die Neubauten sind
Nachverdichtungs- oder Ersatzprojekte in integrierter
Stadtlage, so dass kein neues Bauland in Anspruch
genommen wird und keine neuen Infrastrukturen
geschaffen werden müssen. Die Größe der Projekte, die
Grundstücke und die städtebauliche Form sind sehr
unterschiedlich und keineswegs immer optimal für die
Umsetzung einer kostengünstigen energieoptimierten
Bebauung. Dies war gewollt, um weniger unter „Labor-
konditionen“, sondern vielmehr unter alltäglichen Praxis-
bedingungen dennoch modellhaft als Vorbild für eine Modellprojekt in Ingolstadt: Unterschreitung der Anforderungen
der EnEV um mehr als 50%, sehr hoher solarer Deckungsgrad und
spätere breite Anwendung zu bauen. Unter den neun CO2-neutraler Baustoff Holz (bogevischs buero, München)
14Klimaschutz und Energieeffizienz in der Städtebau rung sowie Fort- und Weiterbildung bietet. Durch die
förderung Vereinigung verschiedener Kultur- und Bildungseinrich-
MR Armin Keller, BOR Ingo Schötz tungen unter einem Dach werden Synergien erzeugt
Oberste Baubehörde/Sachgebiet Städtebauförderung und die Effizienz gesteigert. Die Sanierung des integrier-
ten, denkmalgeschützten Altbaus erfüllt die Anforderun-
gen an Neubauten nach der Energieeinsparverordnung.
Klimaschutz geht uns alle an. Unsere Städte und Ge- Der Neubau erreicht sogar Passivhausstandard – zum
meinden sowie die dort lebenden und arbeitenden Men- ersten Mal bei einem öffentlichen Gebäude in Nürnberg.
schen sind Betroffene und Akteure zugleich. Energieeffi- Die Stadt hat für das Projekt Finanzhilfen der Städte-
zienz und Klimaschutz wurden daher in den vergange- bauförderung von der EU und dem Freistaat Bayern in
nen Jahren zu zentralen Elementen der Stadterneue- Höhe von rund 4,7 Mio. Euro erhalten.
rung. Im Rahmen der Energiewende ist es zunächst
eine kommunale Aufgabe, die notwendigen Rahmenbe-
dingungen für klimagerechte Stadt- und Ortsteile zu
schaffen. Als wesentlicher Bestandteil dieser quartiers-
bezogenen Erneuerungsmaßnahmen ist die Anpassung
des Baubestands eine der großen Zukunftsaufgaben der
Bau- und Wohnungswirtschaft. Gerade für Städte und
Gemeinden, die stark durch den demografischen und
wirtschaftstrukturellen Wandel geprägt sind, ist die
energetische Stadterneuerung eine zusätzliche Heraus-
forderung. Die energieeffiziente Erneuerung in den
Stadt- und Ortsquartieren ist eine Querschnittsaufgabe
in allen Städtebauförderungsprogrammen. Die Belange
der Ökologie, darunter auch Energieeffizienz und Klima-
schutz, sind als übergreifende Handlungsfelder in den
Städtebauförderungsrichtlinien dargestellt. Die Städte-
bauförderung kann bereits im Rahmen der Vorbereitung Der Südpunkt trägt mit Angeboten zur Fort- und Weiterbildung und
kulturellen Aktivitäten zur Bewältigung des Strukturwandels in der
der Sanierung die Weichenstellung zu mehr Energieeffi- Nürnberger Südstadt bei. (Kuntz + Manz Architekten, Würzburg)
zienz und Klimaschutz stellen. Neben der klassischen
Modernisierung und Instandsetzung wird daher die
energetische Erneuerung bei der Durchführung der
Sanierung und somit auch bei der Städtebauförderung
verstärkt im Vordergrund stehen. Durch eine Bündelung
und Verzahnung bestehender Förderangebote und eine
passgenaue Lücken- bzw. Spitzenfinanzierung können
dabei hohe Anstoßwirkungen erzielt werden.
Im Rahmen der Städtebauförderung können demzufolge
die Städte und Gemeinden Finanzhilfen insbesondere
für folgende Maßnahmen erhalten:
– Kommunale quartiersbezogene Energieleitpläne als
Teil der kommunalen städtebaulichen Entwicklungs-
konzepte
– Interkommunale Energiekonzepte als Teil überörtlich
abgestimmter städtebaulicher Entwicklungsstrategien
– Vorbereitungs- und Freilegungsmaßnahmen zur Nutz-
barmachung von Konversions- und alten Industrieflä-
chen, z.B. für energetische Nachfolgenutzungen
– Energetische Gebäudesanierung im Rahmen kommu-
naler und privater Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen
– Ausbau der kommunalen Förderprogramme als
Anreizförderung, z.B. bei Fassadeninstandsetzungen,
Nahwärmenetzen in Ortszentren, Quartieren etc.
Ein erfolgreiches Beispiel für energieeffiziente Erneue-
rungsmaßnahmen ist das „Südstadtforum Qualifizierung
und Kultur“, genannt „Südpunkt“. Mit dem Südpunkt
wurde in der Nürnberger Südstadt ein multifunktionales
Zentrum für Bildung, Qualifizierung und Kultur geschaf-
fen, das neben seiner Funktion als Bürgerzentrum als
überbetriebliche Schulungsstätte für die Wirtschaft eine
Vielzahl von Lehrgängen und Maßnahmen zur Qualifizie-
15Beispielhafte Bauten: Energieeffizientes Bauen in terlagen einreichen. Ein unabhängiger Beirat prüft und
Bayern bewertet die Unterlagen und wählt besonders vorbildli-
Dipl.-Ing. Architekt Thomas Maria Lenzen che Architekturbeispiele aus, die den Typologien Woh-
Geschäftsführer Architektur und Technik der Bayeri- nen, Bauten für die Öffentlichkeit, Bildungsbauten,
schen Architektenkammer Gewerbe- und Verwaltungsbauten, Denkmäler sowie
Energieversorgung zugeordnet und anschließend auf
den jeweiligen Homepages veröffentlicht werden.
Dass nachhaltige Architektur energieeffizient sein muss,
zugleich ökologische, ökonomische und soziokulturelle Natürlich lässt sich trefflich über die Aussagekraft von
Aspekte in sich vereint und vor allem auch gute Gestal- energetischen Standards, Kennzahlen und deren Prüf-
tung verkörpert, präsentieren die Bayerische Architek- barkeit diskutieren, bis hin zur grundsätzlichen Frage, ob
tenkammer und die Oberste Baubehörde anhand von es überhaupt zulässig sein kann, baukulturelle Beiträge
„Beispielhaften Bauten“ auf ihren Homepages in einer u.a. an bauphysikalischen Kennzahlen zu messen.
gemeinsamen Projektauswahl. Die gezeigten Projekte Alle Projekte weisen jedoch objektiv nach, dass durch
liefern eindrucksvoll Antworten auf aktuelle Fragen der kluge Entwurfs- und Planungsentscheidungen sowie
Energieeffizienz und der Energieversorgung von Gebäu- besondere Material- und Energieeffizienz beim Bau und
den und bieten Perspektiven für eine zukunftsfähige bei der Nutzung Ressourcen sparsamer eingesetzt, die
Entwicklung von Baukultur und Gesellschaft. Für die Dauerhaftigkeit verbessert und mögliche Umweltschä-
fortlaufende Aktualisierung der Projektauswahl wurden den reduziert werden können.
2011 im Rahmen des Arbeitskreises ‚Energieeffizientes
Bauen’ der Obersten Baubehörde vorbildliche Architek- Viele technische Lösungen hierfür sind nicht neu, denn
turbeispiele aus den Jahren 2004 bis 2011 gesichtet in der traditionellen Architektur der vergangenen Jahr-
und in einheitlichem Layout zusammengestellt. hunderte lassen sich eindrucksvolle Beispiele finden,
die die heutigen Prinzipien des energieeffizienten und
Mit wachsender Kenntnis über globale Zusammenhän- nachhaltigen Bauens vorwegnehmen. Die stetige Wei-
ge gewinnen Themen wie die Minimierung des Primär- terentwicklung dieser Systeme unter Einbeziehung der
energie- und des Betriebsenergieverbrauchs, die fachlichen Kompetenz aller Beteiligten ist allerdings
Berücksichtigung der Materialkreisläufe bis hin zum unabdingbar, um den Anforderungen der Globalisierung,
Baustoffrecycling und nicht zuletzt die ökonomische der Ressourcenverknappung und des Klimawandels
Dauerhaftigkeit der Investitionen bei Neuplanungen und erfolgreich zu begegnen.
Sanierungen von Gebäuden an Dynamik. Der Arbeitskreis Energieeffizientes Bauen der Obersten
Wie erfolgreich zeitgenössische Architektur sich diesem Baubehörde und die Bayerische Architektenkammer
Wandel der Anforderungen stellt, zeigen die ausgewähl- gehen an dieser Stelle bewusst einen konstruktiven,
ten Projekte auf nachvollziehbare Weise. Die Bayerische motivierenden Weg. Alle Projekte der Auswahl fassen
Architektenkammer hat in Abstimmung mit der Obers- Energieeffizienz und Nachhaltigkeit als physikalisches,
ten Baubehörde eine Datenabfrage etabliert, die konkre- ökonomisches und gestalterisches Potenzial auf.
te Informationen über relevante Kenngrößen zur Ener- Dies soll als Anspruch an und Ansporn für nachhaltige
gie, Ökologie und Ökonomie der Gebäude liefert. Die Architektur verstanden werden, mit dem Ziel, gemein-
Teilnehmer der jährlich stattfindenden „Architektouren“ sam eine lebenswerte Zukunft zu sichern und bestmög-
können die Kenndaten freiwillig mit weiteren Projektun- lich zu gestalten.
16Energetische Sanierung – Ertüchtigung von Wohn- Die hohen Anforderungen, die die EnEV an die energeti-
und Nichtwohngebäuden schen Kennwerte „normaler“ Wohngebäude stellt, kön-
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Lyssoudis, Vorstandsmitglied nen in der Regel von Baudenkmalen nicht erfüllt werden.
der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau Denn es besteht die Gefahr, dass durch falsche Baumaß-
nahmen der Denkmalcharakter verloren geht oder bau-
physikalische Schäden an den Gebäuden verursacht
werden. Zum 01.04.2012 hat das Bundesministerium für
Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung von Wohn- Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) gemeinsam
und Nichtwohngebäuden sind zu einem motivierenden mit der KfW im Rahmen der KfW-Förderprogramme zum
Faktor in der Bauwirtschaft geworden. energieeffizienten Bauen und Sanieren den Förderbau-
stein „Effizienzhaus Denkmal“ neu eingeführt. Die Baye-
Zu unterscheiden aber gilt es Maßnahmen, die verpflich- rische Ingenieurekammer-Bau hat ihr Fachwissen in eine
tend sind, und solche, die sich als sinnvoll erweisen, Arbeitsgruppe eingebracht, die den Leitfaden für die ent-
aber keinen verpflichtenden Charakter haben. Die Ver- sprechende Fortbildung entwickelt hat. Die Ingenieuraka-
pflichtungen ergeben sich vorwiegend aus der Energie- demie Bayern wird voraussichtlich im Herbst 2012 die
einsparverordnung (EnEV) 2009: geeigneten Ausbildungsmodule anbieten.
– Diese regelt u.a., dass Heizkessel, die älteren Bau-
jahrs sind als Oktober 1978, ausgetauscht werden Im Nichtwohngebäude sind die Einhaltung der gesetzli-
müssen. chen Verpflichtungen gleichermaßen zu erfüllen, wie
– Sie verlangt, dass ungedämmte und warmgehende auch sinnvoll. Der Nachweis über die energetische Qua-
Leitungen außerhalb von beheizten Räumen lität und die Beurteilung des Ist-Zustandes sind im
gedämmt werden müssen. öffentlich-rechtlichen Teil der Nachweisführung an die
– Die obersten Geschossdecken müssen auf einen Anwendung der DIN18599 gekoppelt. Die Anwendung
maximalen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Norm und die richtige Interpretation der daraus ent-
gedämmt werden. standenen Berechnung erfordern jedoch ein höchstes
– Zudem sind Eigentümer verpflichtet, witterungsge- Maß an technischem Verständnis in Sachen baulicher
führte Regelungen nachzurüsten, also beispielsweise Wärmeschutz und technischer Gebäudeausrüstung.
Heizsysteme zu installieren, die die Außentemperatur Auch hier kann sich der Markt dem hohen Qualifikati-
erkennen und die entsprechende Leistungsabgabe onsniveau der an der Bayerischen Ingenieurekammer-
danach ausrichten. Bau geführten Energieberater für Nichtwohngebäude
bedienen.
Zusätzlich verpflichtet die EnEV auch zur Außerbetrieb-
nahme von elektrischen Speicherheizsystemen auf Neben den angestrebten Energieeinsparungen durch
Grundlage des Baujahres bzw. der letzten Generalüber- die Maßnahmen selbst können als wirtschaftlicher
holung. In den meisten Fällen muss dies erst nach Anreiz auch entsprechende Fördermaßnahmen zur ener-
einem Zeitraum von 30 Jahren erfolgen. getischen Sanierung angeführt werden. Neben den
Auch sind Eigentümer dazu angehalten, bei Klimaanla- bewährten Förderprogrammen der KfW im Wohnungs-
gen ab einer Größe von 12kW Leistungsbedarf für bau zum energieeffizienten Bauen sind mittlerweile
Gebäudekühlung eine energetische Inspektion durch auch energetische Sanierungsmaßnahmen wie z.B. die
einen Experten durchführen zu lassen. Fenstererneuerung, Dämmung, Erneuerung der Hei-
Unberührt von der EnEV bleiben die Anforderungen des zungs- oder Beleuchtungsanlage sowie Einbau oder
Bundesimmissionsschutzgesetzes, die die Feuerschau Ersatz von Lüftungsanlagen im Nichtwohngebäude inte-
durch den Schornsteinfeger regeln. ressant. Auch einzelne Maßnahmen aus dem baulichen
Wärmeschutz oder auch technischen Ausbau, die im
Weitergehende sinnvolle Maßnahmen zur energeti- engen zeitlichen Zusammenhang als Paket durchgeführt
schen Sanierung lassen sich aber in der Regel erst ablei- werden, sind förderfähig.
ten, wenn der Eigentümer vorhat, an seinem Gebäude
wesentliche bauliche Maßnahmen vorzunehmen. Im Bereich der Gebäudesanierung müssen die klimapoli-
Zur Beurteilung eventuell zusätzlich ratsamer Maßnah- tischen Anstrengungen zur Umsetzung der Energiewen-
men ist in jedem Fall ein Fachmann hinzuzuziehen: Im de intensiviert werden. Die Energiewende ist nicht allei-
Rahmen einer energetischen Begutachtung des Gebäu- ne auf den Stromsektor beschränkt, sondern betrifft sys-
des bewertet dieser die erforderlichen Ertüchtigungen temisch auch den Wärme- und Kältebereich sowie die
bautechnisch und wirtschaftlich. Solche energetischen Mobilität. Die Energieproduktivität müsste bis 2020 mehr
Begutachtungen können Ingenieure mit entsprechender als verdoppelt werden, von bisher pro Jahr ca. 1,6 Pro-
Zusatzausbildung zum Energieberater durchführen. Die zent auf knapp unter vier Prozent. Es gibt viel zu tun!
Bayerische Ingenieurekammer-Bau bietet auf ihrer Web-
site eine „Planer- und Ingenieursuche“ an, die dem Ver-
braucher hilft, einen kompetenten und unabhängigen
Energieberater in seiner Nähe zu finden. Die dort gelis-
teten Ingenieure haben die nötigen Fachkenntnisse in
technischer Gebäudeausrüstung und Gebäudebauphy-
sik und entwickeln exakt auf den Einzelfall zugeschnitte-
ne Sanierungsstrategien.
17Sie können auch lesen