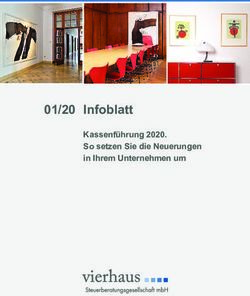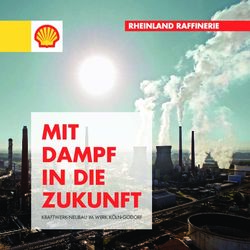Gefahrenhinweiskarten nationaler Stufe (BAFU) - sCHoolmaps.ch
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gefahrenhinweiskarten auf nationaler Stufe (BAFU) Hangmuren: Die Gefährdungskarte Oberflächenabfluss des BAFU gennzeichnet Überschwemmungsgebiete, die bei seltenen bis sehr seltenen Ereignissen potenziell betroffen sind: weitere Naturgefahrenkartenlayer auf map.schoolmaps.ch unter Link siehe dazu Aktuell: Sorge um Reussdamm +++ Berner S-Bahn-Linien wegen Erdrutsch-Gefahr unterbrochen (bluewin.ch)
Aber sicher gibt es die offiziellen Hinweise auf Naturgefahren auch hier: https://www.naturgefahren.ch siehe den aktuellen Beitrag zu Hochwasser vom 14.07 hier: https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/hier-droht-hochwasser-796466.html
Wie naturnah sind unsere Bäche
und Flüsse? Ökomorphologie Stufe
F (BAFU)
Wie naturnah sind unsere Bäche
und Flüsse? Ökomorphologie Stufe
F (BAFU)
Die Schweizer Fliessgewässer sind stark verbaut und in ihren natürlichen
Funktionen eingeschränkt. Rund ein Viertel aller Gewässer befindet sich in einem
schlechten morphologischen Zustand. Zusätzlich beeinträchtigen zahlreiche
Durchgangshindernisse den Lebensraum.
27.05.2021 | www.geo.admin.ch
Copyright: /shutterstock.comLink auf die Karte: map.geo.admin.ch Um die Gewässer umfassend schützen zu können, muss ihr Zustand bekannt sein. Das Modul-Stufen-Konzept bildet den Rahmen für eine standardisierte Gewässeruntersuchung und -bewertung. Das Konzept ist modular aufgebaut und umfasst Untersuchungen der Hydrologie, Struktur der Gewässer (Ökomorphologie), Wasserchemie und Ökotoxikologie sowie der Lebensgemeinschaften von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen (Biologie). Im Modul Ökomorphologie werden die strukturellen Eigenschaften der Bäche und Flüsse ganzer Regionen (z.B. Kantone, Regionen, Gemeinden) flächendeckend (Stufe F) untersucht. Der Layer «Abschnitte» zeigt die Klassifizierung der einzelnen Fliessgewässerabschnitte von natürlich bis künstlich und eingedolt (Referenzgeometrie VECTOR25 GWN). Diese Einteilung erfolgt anhand der summarischen Beurteilung ökologisch bedeutsamer Merkmale wie beispielsweise der Beschaffenheit des Uferbereiches. Weitere Informationen zum Thema Ökomorphologie: Website BAFU Verringerung der biologischen Vielfalt der Fliessgewässer durch anthropogenen Einfluss? (BAFU) Verringerung der biologischen Vielfalt der Fliessgewässer durch
anthropogenen Einfluss? (BAFU)
Im Rahmen der Nationalen Beobachtung Oberflächengewässerqualität (NAWA)
wird an rund 100 Messstellen die Gewässerqualität durch Bund und Kantone
gemeinsam erfasst. Eine anthropogene Beeinträchtigung der Fliessgewässer
könnte in der Regel zu einer Verringerung der biologischen Vielfalt führen, von
der insbesondere bestimmte Insekten betroffen sind.
10.06.2021 | www.geo.admin.ch
Copyright: /shutterstock.com
Link auf die Karte: map.geo.admin.ch
Die Karte zeigt, wie gut die Oberflächengewässerqualität der Schweizer
Fliessgewässer ist. Die Bewertung des biologischen Gewässerzustandes aufgrund
von Makrozoobenthos-Untersuchungen erfolgt mittels des Moduls
Makrozoobenthos des Modul-Stufen-Konzepts. Diese Untersuchungen dienen
dazu, Beeinträchtigungen mit deutlichen biologischen Auswirkungen zu erkennen
und die Notwendigkeit vertiefter Untersuchungen abzuschätzen.
Als Makrozoobenthos werden die wirbellosen Kleinlebewesen am Gewässergrund
bezeichnet. Die wirbellosen Kleinlebewesen, deren Lebenszyklus sich zu einem
wesentlichen Teil im Gewässer abspielt, sind als Bioindikatoren geeignet, da sieden Zustand des Gewässers über ihre gesamte Lebensdauer im Wasser integrieren und ihre Ansprüche an Wasserqualität und Lebensraum vielfach gut bekannt sind. Weitere Informationen zum Thema Makrozoobenthos : Website BAFU Wie stark sind die Gewässer durch diffuse Stickstoffeinträge belastet? Modellierte Werte (BAFU) Wie stark sind die Gewässer durch diffuse Stickstoffeinträge belastet? Modellierte Werte (BAFU) Stickstoffeinträge in Gewässer stellen eine unerwünschte Belastung dar. Im Rahmen des Übereinkommens über den Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (OSPAR) hat sich die Schweiz verpflichtet, die über den Rhein aus der Schweiz gelangende Stickstofffracht gegenüber 1985 um 50% zu reduzieren. Dieses Ziel ist noch nicht erreicht. 03.06.2021 | www.geo.admin.ch
Blogbeitragsbild: /shutterstock.com Link auf die Karte: map.geo.admin.ch Die Schweizer Gewässer werden nach wie vor mit Stickstoffeinträgen belastet. Insgesamt gelangen pro Jahr rund 51‘000 t Stickstoff aus diffusen Quellen in die Gewässer der Schweiz. Hohe Einträge erfolgen von intensiv genutzten Ackerflächen, insbesondere von drainierten Flächen.Die Stickstoffeinträge in die Gewässer wurden mit dem Stoffflussmodell MODIFFUS über alle diffusen Eintragsquellen (Ackerland, Dauergrünland, Wald, Gletscher, Siedlungsgrünflächen etc.) und Eintragspfade (Bodenerosion, Auswaschung, Abschwemmung, Drainage, atmosphärische Deposition etc.) berechnet. Die Karte zeigt die aufsummierten Verluste pro Landnutzungskategorie im Hektarraster, basierend auf der Arealstatistik 2004/09. Es wurden mittlere klimatische Bedingungen zugrunde gelegt, das Bezugsjahr ist 2010. Diese modellierten Werte sind nicht gleichzusetzen mit gemessenen Werten in Gewässern, da sie die Umwandlungs- und Ablagerungsprozesse sowohl in der Landschaft als auch im Gewässer selbst nicht berücksichtigen. Die Resultate sind für hydrologische oder administrative Einheiten ab 50 km2 Grösse interpretierbar, nicht aber für einzelne Pixel. Weitere Informationen zum Thema diffuse Stickstoffeinträge: Website BAFU
Die Schweiz – das Wasserschloss Europas – Thema “Wasser” auf map.geo.admin.ch Wie der Tagesaktuelle Artikel im Bund, “Als könnte man durch die Flüsse waten”, ausführt, ist Wasser auch dieses Jahr ein zentrales Thema in der Schweiz. Auf den Rekordsommer folgt der Rekordherbst. Besonders Bäume und Fische leiden unter dem Regenmangel (Zitat der Bund vom 19.10.2018). Wie kann ich als Lehrperson das Thema Wasser anschaulich, mit den digitalen Karten des Bundes, und Hintergrundinformationen verstehen und visualisieren? Die Schweiz gilt als das Wasserschloss Europas. Rund 6% der Trinkwasserreserven des Kontinents befinden sich in der Schweiz, und 4% der Gesamtfläche des Landes entfallen auf Seen und Flüsse. Mit dem Rheinfall verfügt die Schweiz über den grössten Wasserfall Europas, und die Mauer des Grande-Dixence-Stauses im Wallis zählt mit 285 Metern zu den höchsten Staumauern der Welt. Die vier Flüsse Rhone, Rhein, Inn und Tessin haben ihre Quelle alle in den Schweizer Alpen und fliessen in unterschiedliche Meere. Es gibt in der Schweiz über 1500 Seen. Viele davon gehen auf Vertiefungen der Gletscher zurück, welche sich während der letzten Eiszeit gebildet haben. Der Genfersee im französisch-schweizerischen Grenzgebiet ist der grösste See Mitteleuropas. Der grösste See innerhalb der Schweiz ist der Neuenburgersee.
Wegen der Klimaerwährmung schmelzen die Gletscher und das Klima im
Alpenland verändert sich stark. Die Wasserreserven sind dadurch in Zukunft
gefährdet (Blaser A.; Kernen U.; Moser-Léchot, V. D., Die Schweiz Verstehen,
2018). Zu Allen, oben im Text hervorgehobenen Begriffen, finden Sie auf
map.geo.admin.ch digitale Karten unterschiedlicher Bundesämter, mit welchen
Sie Ihren Unterricht anschaulich gestalten können.
Beispiel: Hochwasser Gefahrenstufen Bundesamt für Umwelt:
Thema “Wasser” auf map.bafu.admin.ch
Thema Wasser in der Schweiz (Bundesamt für Umwelt)
Das Wasserschloss der Schweiz steht unter Beschuss (2017)
Folge der Trockenheit auf map.geo.admin.ch
Staunanlagen des Bundesamts für Energie:Gletscherschmelze auf den digitalen Karten von swisstopo: Morteratschgletscher – Ein Eisriese verschwindet Der lange Morteratschgletscher hat sich seit Beginn der Messungen im Jahre 1878 ununterbrochen zurückgezogen. Im Durchschnitt beträgt der Rückgang 16 Meter/ Jahr. In wärmeren Phasen (1935 bis 1965) wurde ein Rückgang bis zu 48 Meter pro Jahr gemessen. Seit den 1990-er Jahren ist eine Verstärkung des Schwundes zu verzeichnen. Die erste Publikation der Siegfriedkarte und das Orthofoto von 2009 zeigen uns seinen Rückzug: Bild Wasserschloss: http://naturschutz.ch/news/das-wasserschloss-europas-steht-unter -beschuss/114154 unter https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de Besser leben mit weniger Lärm Besser leben mit weniger Lärm Das Bundesamt für Umwelt BAFU ermittelt mit Hilfe der Daten und Modelle von swisstopo die Lärmbelastung in der Schweiz. Es berechnet auch künftige Immissionen und erarbeitet gezielte Strategien zur Lärmreduktion. An manchen Orten in der Schweiz ist es (zu) laut: Tagsüber ist jede siebte und nachts jede achte Person in unserem Land schädlichem oder lästigem Strassenlärm ausgesetzt – trotz grosser Anstrengungen bei der Bekämpfung des Lärms. Das Bundesamt für Umwelt BAFU veröffentlicht auf map.geo.admin.ch
verschiedene Karten zum Thema «Lärm» – zum Beispiel die Lärmbelastung durch Strassenverkehr zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten oder durch Eisenbahn, Helikopter und Flugzeuge. Betrachtet man die Karten, fällt einem die Konzentration des Lärms in der Agglomeration auf. Hier wohnen mehr als 90 Prozent der Menschen, die von Lärm betroffen sind. Wie und was wird gemessen? Für die Ermittlung der Lärmbelastung wurde die Lärmdatenbank sonBASE entwickelt. Auf der Basis eines geografischen Informationssystems (GIS) kann damit die Lärmbelastung in der ganzen Schweiz modelliert, abgeschätzt und visualisiert werden. Andreas Catillaz, stellvertretender Sektionschef beim BAFU, erklärt, was man dafür braucht: «Wir haben eine Vielzahl von georeferenzierten Daten verschiedener Bundesämter, Bahnbetreiber und Ingenieurbüros. Diese Daten fügten wir zusammen und speisten sie ein. Die Qualität und Quantität verfügbarer Daten wird in Zukunft weiter zunehmen.» Die Resultate sind einerseits eine so genannte Rasterkarte mit einer Pixelauflösung von zehn Mal zehn Metern und anderseits eine Beurteilung der Lärmbelastung an definierten Fassadenpunkten jeweils aller Häuser getrennt für den Tag (6 bis 22 Uhr) und die Nacht (22 bis 6 Uhr). Eine schweizweite Lärmberechnung für den Eisenbahn-, Strassen- und eventuell auch Flugverkehr wird alle vier bis fünf Jahre durchgeführt. Lärmdaten für die ganze Schweiz Für seine Berechnungen nutzt das BAFU verschiedene Datensätze und Modelle von swisstopo, nämlich das Höhenmodell swissALTI3D, das Topografische Landschaftsmodell swissTLM3D sowie die Gebäudedaten swissBUILDINGS3D. «Weil der Bund diese Daten erhebt und pflegt, sind sie homogen für die ganze Schweiz vorhanden. Das ist für uns ein grosser Vorteil und erleichtert uns die Arbeit enorm. Wir hätten sonst erheblich mehr Aufwand und Kosten», ist Andreas Catillaz überzeugt. Tempo 30 wirkt Was tun, wenn es zu laut ist? Bauliche Vorkehrungen in Form von Lärmschutzwänden sind aufwändig, teuer und unter Umständen wenig effektiv.
Eine wirksame Massnahme ist hingegen die Drosselung des Lärms an der Quelle:
Strassengestaltung, lärmarme Strassenbeläge, leise Reifen und die Reduktion der
Geschwindigkeit. Gilt Tempo 30 anstatt Tempo 50, reduzieren sich die
Lärmemissionen um rund drei Dezibel. Das entspricht einer Halbierung des
Verkehrs.
Städte akustisch gestalten
Dank den Lärmdaten des BAFU kann nicht nur der Lärm reduziert werden: Sie
leisten auch wertvolle Dienste bei der akustischen Gestaltung von Städten. Diese
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Rede ist vom «Stadtklang»,
hervorgerufen durch die akustischen Materialeigenschaften von Böden, Fassaden,
Gebäuden und Gestaltungselementen. Denn die Stadt der Zukunft soll nicht nur
gut aussehen, sondern auch gut klingen.
20 Jahre KOGIS, Koordination,
Geoinformation und Services
Am 1. Januar 2000 nahm die Stabsstelle KOGIS, kurz für Koordination,
Geoinformation und Services, ihren Betrieb auf. Ihre Aufgabe: Eine Koordination
im Geoinformationsbereich zu schaffen, damit nicht jedes Amt und jeder Kanton
eine eigene Infrastruktur aufbauen mussten. Unter dem Einfluss von KOGIS
entwickelte sich swisstopo von einem Geodatenproduzenten zu einem
Dienstleistungszentrum, von dessen Produkten und Leistungen jede Schweizerin
und jeder Schweizer profitieren kann. Insbesondere mit dem Geoportal
map.geo.admin.ch hat KOGIS etwas geschaffen, das grossen und vielfältigen
Nutzen für alle stiftet.
Mehr über KOGIS
Weitere Informationen
map.geo.admin.ch, Stichwort “Lärm”
Die Lärmkarten des BAFU
Strassenverkehr: Besser schlafen dank Tempo 30, Artikel im des BAFUvom 29.5.2019
Wie klingt die Stadt von morgen? Artikel auf nextroom.at vom 8.4.2017
Ökomorphologie –
Gewässerschutz/Gewässeruntersuc
hung und -bewertung – Bundesamt
für Umwelt
Um die Gewässer umfassend schützen zu können, muss ihr Zustand bekannt sein.
Das Modul-Stufen-Konzept bildet den Rahmen für eine standardisierte
Gewässeruntersuchung und -bewertung. Das Konzept ist modular aufgebaut und
umfasst Untersuchungen der Hydrologie, Struktur der Gewässer
(Ökomorphologie), Wasserchemie und Ökotoxikologie sowie der
Lebensgemeinschaften von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen (Biologie).Im
Modul Ökomorphologie werden die strukturellen Eigenschaften der Bäche und
Flüsse ganzer Regionen (z.B. Kantone, Regionen, Gemeinden) flächendeckend
(Stufe F) untersucht. Der Layer «Abschnitte» zeigt die Klassifizierung der
einzelnen Fliessgewässerabschnitte von natürlich bis künstlich und eingedolt
(Referenzgeometrie VECTOR25 GWN). Diese Einteilung erfolgt anhand der
summarischen Beurteilung ökologisch bedeutsamer Merkmale wie beispielsweise
der Beschaffenheit des Uferbereiches:
siehe auch: LinkUnterschiedliche Pflanzen auf map.geo.admin.ch Invasive gebietsfremde Pflanzen – Potentialkarte Felsen-Greiskraut (BAFU): Invasive gebietsfremde Pflanzen – Potentialkarte Syrische Seidenpflanze (BAFU): Es gibt jede Menge weitere Pflanzenarten zu entdecken im Themenkatalog “INSPIRE” (rotes Kästchen unter Themenwahl) und dann “Umwelt, Biologie und Geologie” und dann “Verteilung der Arten”! Den SuS kann die Karte gezeigt werden und der Arbeitsauftrag mehr zur Pflanzensorte herauszufinden im Internet. / Evtl. Vorbereitung zu einer Exkursion? Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (BAFU)
Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (BAFU) In der Schweiz leben heute 19 Amphibienarten – fast alle befinden sich auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten. Die Fläche der Feuchtgebiete als Lebensraum der Amphibien schrumpfte in den letzten 100 Jahren auf weniger als einen Zehntel zusammen. Die noch erhaltenen Lebensräume sollten deshalb gesichert werden. 24.03.2020 | www.geo.admin.ch Copyright: /shutterstock.com Link auf die Karte: map.geo.admin.ch Als Laichgewässer bevorzugen die meisten Arten stehende Kleingewässer wie Tümpel und Weiher. Neben kleineren Tümpeln bis zu grossen Feuchtgebietskomplexen bilden Kies- und Lehmgruben einen wichtigen Anteil
(rund ein Fünftel der Gesamtobjekte) des Inventars. Im Laufe der Nutzung haben sie sich zu schützenswerten naturnahen Standorten entwickelt. Die ortsfesten Objekte sind in zwei verschiedene Bereiche eingeteilt: Der Bereich A ist dem Naturschutz unterstellt. Der Bereich B umfasst den engeren Bereich der Landlebensräume und die Pufferzonen. Es sind meist land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Wanderobjekte beinhalten genutzte Gruben, innerhalb deren die dynamische Voraussetzung für eine Erhaltung der vorkommenden Amphibienbestände erhalten werden soll. Als viertes Bundesinventar gemäss Art. 18a NHG setzte der Bundesrat 2001 das Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete mit 701 Objekten in Kraft, welches in den Jahren 2003, 2007 und 2017 revidiert wurde. Aktuell sind 929 Objekte (835 Ortsfeste und 94 Wanderobjekte) in Kraft. Wo ist die Lärmbelastung durch Strassenverkehr nachts am höchsten (BAFU)? Wo ist die Lärmbelastung durch Strassenverkehr nachts am höchsten ist (BAFU)? Die Karte zeigt, welcher Lärmbelastung die Bevölkerung durch den Strassenverkehr in der Nacht ausgesetzt ist. Die Angaben basieren auf flächendeckenden Modellberechnungen (sonBASE).
Copyright: /shutterstock.com Link auf die Karte: map.geo.admin.ch Die Verkehrsdaten für den Strassenverkehr wurden mit einem Mobilitätsmodell für das Jahr 2015 ermittelt. Die so ermittelten Verkehrsdaten wurden auf der Grundlage von ca. 1900 nationalen und kantonalen Zählstellen mit stundenfeinen Zählwerten kalibriert. Daten sind gesetzlich nicht verbindlich. Verbindliche Angaben zur Belastung wie auch zur Lärmsanierung geben die jeweiligen Vollzugsbehörden. Bei Nationalstrassen: Bundesamt für Strassen (ASTRA). Bei Haupt- und übrige Strassen: Die Kantonalen Vollzugsbehörden
Sie können auch lesen