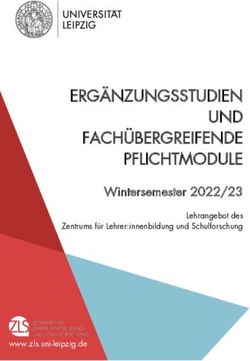GEO I FR Zwischen Bern und Lausanne
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
GEO I FR
DIDAKTISCHER KOMMENTAR
ZUSÄTZLICHE DOKUMENTE AUF : http//geo.friportal.ch
Bern
Zwischen
nne
und Lausa
KANTONALE LEHRMITTELVERWALTUNG, FREIBURGLIEBE LEHRPERSONEN Geografie befasst sich mit Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt. Sie untersucht, welchen Ein- fluss der Mensch auf seine Umwelt nimmt, aber auch welchen Einfluss ein bebautes Territorium auf seine Be- wohner ausübt. So beeinflussen einerseits Siedlungen wie auch die Topografie den Verlauf einer Verkehrsver- bindung. Andererseits wirkt sich zum Beispiel der Bau eines neuen Autobahnabschnittes auf die Einzonierung neuer Bauzonen aus, er erhöht die Erreichbarkeit auseinander liegender Orte und fördert die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe. Angesichts dieses bedeutenden Einflusses der Mobilität auf die Lebensweise jedes Einzelnen (Unterwegs sein ist ein lebenswichtiges Bedürfnis) und eine verkehrsbedingte tief greifende Veränderung des Territoriums (in der Schweiz sind 30% der überbauten Zonen Verkehrsflächen) sind diese Personenbewegungen und die dazu benötigten Einrichtungen wesentliche Themen des Geografen. 92% der aktiven Bevölkerung der Schweiz sind Pendler. Dies ist der zweitwichtigste Grund für Verschiebungen, nach dem Freizeit- und Reiseverkehr (die weiten Distanzen der Ferienreisen sind für diese Platzierung verant- wortlich). Die Problematik des Pendlerverkehrs liegt in seiner zeitlichen und räumlichen Konzentration sowie sei- ner Regelmässigkeit (an jedem Arbeitstag). Die dabei zurückgelegten Distanzen eignen sich gut, die Problematik im kantonalen Massstab zu untersuchen. Auch die Kinder sind von der Pendlerproblematik betroffen, sind sie doch als Schülerinnen und Schüler ebenfalls Pendler. Zudem ist ein grosser Teil der Menschen ihrer Umgebung verpflichtet, regelmässig kürzere oder weitere Strecken zum Arbeitsort zurückzulegen. Schliesslich erfahren Kinder wie Erwachsene die Vor- und Nachteile dieser täglichen Verkehrsbewegungen am eigenen Leib. (Verkehrsinfrastrukturen, öffentlicher Verkehr, Zersied- lung, Lärm, Emissionen, Unfallgefahr…) Der Titel "Zwischen Bern und Lausanne" mag für ein Freiburger Geografielehrmittel auf den ersten Blick etwas befremden. Doch die bedeutendsten Verkehrslinien, Eisenbahnen und Autobahnen, die unseren Kanton von SW nach NO durchqueren, verbinden eben diese zwei Zentren. Auf ihnen wickelt sich auch der grössere Teil des inner- und ausserkantonalen Pendlerverkehrs ab. Eine von fünf aktiven Personen hat ihren Arbeitsort in einer dieser beiden Agglomerationen und trägt damit zum Bild von Freiburg als "Schlafkanton" bei. Um den Kindern die Pendlerproblematik näher zu bringen, schlägt dieses Lehrmittel nebst den zehn Unterrichtsein- heiten eine an die Eltern gerichtete Umfrage und ein Pendlerspiel vor, in dem Situationen simuliert werden, mit 1 denen Arbeitspendler täglich konfrontiert sind. Die Fragen, was eigentlich Mobilität ist (UE 1) und warum wir unterwegs sind (UE 2), bilden ausgehend von den eigenen Verschiebungen der Schülerinnen und Schüler den Einstieg in dieses Lehrmittel. Mit den UE 3 und 4 wird die örtliche und zeitliche Situation des Pendelns in unserem Kanton beleuchtet. Die UE 5 vergleicht Kriterien, welche die Art der Fortbewegung beeinflussen. Ein historischer Überblick (UE 6) zeigt, wie sich Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung gegenseitig beeinflussen. UE 7 zeigt am Beispiel von Umfahrungen (H 189 Bulle, Poyabrücke Freiburg) auf, wie der Kanton den wachsenden Strassenverkehr mit dem Bau neuer Infrastrukturen zu bewältigen versucht und welche Auswirkungen dies für Strassenbenutzer und Anwohner hat. Parallel dazu wurden im öffentlichen Verkehr Nahverkehrslinien geschaffen (RER, Mobul). Über die UE 8 und 9 erfahren die Schülerinnen und Schüler, was notwendig ist, damit das Netz des öffentlichen Verkehrs in der Stadt wie auch auf dem Land benutzerfreundlich und effektiv ist. Die UE 10 regt die Schülerinnen und Schüler dazu an, das Gelernte zusammenfassend einzusetzen, um auf die Fragen der UE 1 Antworten zu finden. Gewisse Inhalte und vorgeschlagene Vorgehensweisen verlangen von der Lehrperson Fingerspitzengefühl. Die Aufgabe der Lehrperson besteht darin, gegenseitiges Verständnis zu fördern, Fakten und Informationen objektiv aufzuarbeiten und unterschiedliche Meinungen unabhängig vom sozialen, kulturellen oder familiären Hintergrund zu respektieren. Doch bietet gerade dieser "sensible" Bereich den Kindern eine gute Gelegenheit, sich zu einem aktuellen gesellschaftlichen Thema zu äussern, sich objektiv zu informieren, diese Informationen auszuwerten, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Wir wünschen Ihnen, Ihren Schülerinnen und Schülern viel Freude und Erfolg bei der Arbeit mit GEO|FR. die Autoren Charles Folly Alexandre Mauron
Inhalt
Einführung S. 1
UE 1: Was ist Mobilität? S. 5
Sich bewusst werden, indem man Transportmittel nach ihrer Funktion ordnet, dass es vielerlei
Möglichkeiten der Fortbewegung gibt und dass Bedarf und Anspruch an die Mobilität viele Fra-
gen und Probleme aufwerfen, welche man auf unterschiedliche Weise zu befriedigen versucht.
UE 2: Warum bin ich unterwegs? S. 9
Sich bewusst werden, indem unterschiedliche Wege dargestellt und miteinander verglichen
werden, dass gewisse Strecken regelmässig und mit der Absicht zurückgelegt werden, sich zur
Arbeit oder zur Schule zu begeben (Pendlerverkehr).
UE 3: Hin und her? S. 13
Sich durch Vergleichen und Analysieren von Statistiken und der Resultate des Fragebogens be-
wusst werden, dass viele Menschen unterschiedliche Wohn- und Arbeitsorte haben, dass sich
die meisten Arbeitsplätze in bestimmten Zonen konzentrieren.
UE 4: Eine Frage der Zeit? S. 17
Sich mit Hilfe der Umfrageergebnisse und von Statistiken bewusst werden, dass die Anzahl der
Pendler zunimmt, die Arbeitswege und Wegzeiten länger werden und dadurch Verkehrsüberlas-
tungen entstehen, welche zeitlich beschränkt sind.
2 UE 5: Wie komme ich von A nach B? S. 21
Sich mit Hilfe der Umfrageergebnisse und von Statistiken bewusst werden, dass das Privat-
fahrzeug am häufigsten für den Arbeitsweg benutzt wird und die Summe der Auswahlkriterien
Auswirkungen ökonomischer, gesellschaftlicher und ökologischer Art haben.
UE 6: Entwicklung dank Verkehr? S. 25
Sich durch Vergleichen von Karten unterschiedlicher Perioden bewusst werden, dass sich Sied-
lungs- und Verkehrsentwicklung gegenseitig in Zeit und Raum beeinflussen.
UE 7: Warum neue Strassen bauen? S. 29
Sich bewusst werden, indem man Verkehrsflüsse aufzeichnet, dass eine Verkehrszunahme neue
Infrastrukturen verlangt und diese ihrerseits wiederum Auswirkungen auf den Verkehr haben.
UE 8: Platz für den ÖV? S. 33
Sich bewusst werden, dass der Streckenplan eine Grundlage für die Wirksamkeit des öffentli-
chen Verkehrs (Kapazität, Reisedauer, Anschluss an andere Verkehrsträger…) darstellt, indem
man reale Streckenpläne konsultiert.
UE 9: Wie ist ein Bahnhof gestaltet? S. 37
Sich bewusst werden, welche zentrale Rolle ein Bahnhof als Verkehrsknoten spielt, indem man
Karten unterschiedlicher Massstäbe vergleicht.
UE 10: Zusammenfassung? S. 41
Sich bewusst werden – indem die Kenntnisse und Einsichten der vorangegangenen Unter-
richtseinheiten abgerufen werden –, dass für die Planung einer Reise mehreren Umständen
Rechnung zu tragen ist und dass unter mehreren Möglichkeiten eine Auswahl getroffen werden
muss, welche mehr oder weniger Einfluss haben.Abfolge der Unterrichtseinheiten
Die Unterrichtseinheiten dieses Lehrmittels sind in einer logischen Abfolge geordnet ( ).
Da gewisse Unterrichtseinheiten voneinander unabhängig sind, ist ein Unterrichten in der vorgeschlagenen
Reihenfolge jedoch nicht zwingend. Zudem ist je nach Situation (Interesse der Kinder, angestrebte Lernziele,
verfügbare Zeit…) auch eine Auswahl der Module möglich. Das unten stehende Schema schlägt verschiedene
Wege vor ( ) und versteht sich als Hilfe bei einer Auswahl, die besondere Schwerpunkte setzt.
RAUM UE 1
Was ist Mobilität?
? Unterrichtseinheiten
?
Einführung und
Zusammenfassung
UE 2 ?
Warum bin ich unterwegs?
Umfrage
Pendlerspiel
UE 3 Akzent
ng
Entfernu
Hin und her?
- Ze it
UE 4
Eine Frage der Zeit?
3
UE 5
Wie komme ich von A
Akzent: nach B?
Verkehrs
mittel
UE 6
Entwicklung dank Verkehr?
UE 7
Warum neue Strassen
bauen?
nt:
Akze turen
k
stru UE 8
Infra
Platz für den ÖV?
UE 9
Wie ist ein Bahnhof
gestaltet?
UE 10 ?
Zusammenfassung?LP21 - NMG - 1./2. ZYKLUS
UE 1: Was ist Mobilität?
UE 2 : Warum bin ich unterwegs?
UE 3 : Hin und her?
UE 4 : Eine Frage der Zeit?
UE 5 : Wie komme ich von A nach B?
UE 6 : Entwicklung dank Verkehr?
UE 7: Warum neue Strassen bauen?
UE 8 : Platz für den ÖV?
UE 9 : Wie ist ein Bahnhof gestaltet?
UE 10 : Zusammenfassung?
Kompetenzbereich und Kompetenz
NMG.7 - NMG.8
Schwerpunkt
ergänzend
NMG.7 Lebensweisen und Lebensräume von Menschen erschliessen und vergleichen
1 Die Schülerinnen und Schüler können unterschiedliche Lebensweisen beschreiben und erkennen,
was Menschen ihre Herkunft und Zugehörigkeiten bedeuten.
2 Die Schülerinnen und Schüler können Vorstellungen zu Lebensweisen von Menschen in fernen
Gebieten der Erde beschreiben, vergleichen und entwickeln.
3 Die Schülerinnen und Schüler können Formen des Unterwegs-Seins von Menschen, Gütern und
Nachrichten erkunden sowie Nutzen und Folgen des Unterwegs-Seins für Mensch und Umwelt
abschätzen.
4 Die Schülerinnen und Schüler können Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Lebens-
weisen und Lebensräumen von Menschen wahrnehmen, einschätzen und sich als Teil der einen
Welt einordnen.
NMG.8 Menschen nutzen Räume - sich orientieren und mitgestalten
1 Die Schülerinnen und Schüler können räumliche Merkmale, Strukturen und Situationen der natürli-
chen und gebauten Umwelt wahrnehmen, beschreiben und einordnen.
4 2 Die Schülerinnen und Schüler können die unterschiedliche Nutzung von Räumen durch Menschen
erschliessen, vergleichen und einschätzen und über Beziehungen von Menschen zu Räumen nach
denken.
3 Die Schülerinnen und Schüler können Veränderungen in Räumen erkennen, über Folgen von Verän-
derungen und die künftige Gestaltung und Entwicklung nachdenken.
4 Die Schülerinnen und Schüler können Elemente und Merkmale von Räumen in Darstellungsmitteln
auffinden sowie raumbezogene Orientierungsraster aufbauen und anwenden.
5 Die Schülerinnen und Schüler können sich in ihrer näheren und weiteren Umgebung orientieren,
sicher bewegen und dabei Orientierungsmittel nutzen und anwenden.
Andere Kompetenzbereiche NMG
NMG
NMG.1 Identität, Körper, Gesundheit - sich kennen und zu sich Sorge tragen 1.2e
NMG
NMG.2 Tiere, Pflanzen und Lebensräume erkunden und erhalten 2.6g
NMG NMG
NMG.3 Stoffe, Energie und Bewegungen beschreiben, untersuchen und nutzen 3.1g 3.1g
NMG.4 Phänomene der belebten und unbelebten Natur erforschen und erklären
Nmg
NMG.5 Technische Entwicklungen und Umsetzungen erschliessen, einschätzen und anwenden 5.1e
NMG.6 Arbeit, Produktion und Konsum - Situationen erschliessen
NMG NMG
NMG.9 Zeit, Dauer und Wandel verstehen - Geschichte und Geschichten unterscheiden 9.1d 9.1d
NMG
10.3
NMG.10 Gemeinschaft und Gesellschaft - Zusammenleben gestalten und sich engagieren f/g
NMG
NMG.11 Grunderfahrungen, Werte und Normen erkunden und reflektieren 11.3e
NMG.12 Religionen und Weltsichten begegnenNMG.7 1 … können unterschiedliche Le- 2 … können die unterschiedliche Nut- 3 … können Formen des Unterwegs- 4 … können Zusammenhänge und
Lebensweisen und bensweisen beschreiben und erken- zung von Räumen durch Menschen Seins von Menschen, Gütern und Abhängigkeiten zwischen Lebens-
Lebensräume von nen, was Menschen ihre Herkunft und erschliessen, vergleichen und ein- Nachrichten erkunden sowie Nutzen weisen und Lebensräumen von Men-
Menschen erschlies- Zugehörigkeiten bedeuten. schätzen und über Beziehungen von und Folgen des Unterwegs-Sein für schen wahrnehmen, einschätzen und
sen und vergleichen Menschen zu Räumen nachdenken. Mensch und Umwelt abschätzen. sich als Teil der einen Welt einordnen.
Unterrichtseinheit 1
Was ist Mobilität?
SCHWERPUNKT
Sich bewusst werden, indem man Transportmittel nach ihrer Funktion ordnet, dass es vielerlei Möglichkeiten
der Fortbewegung gibt und dass Bedarf und Anspruch an die Mobilität viele Fragen und Probleme aufwerfen,
die man auf unterschiedliche Weise zu befriedigen versucht.
LERNZIELE:
FÄHIGKEITEN (WISSEN)
—— Fahrzeuge aufgrund verschiedener Kriterien ordnen.
—— Fahrzeuge und Verkehrsmittel unterscheiden.
—— Drei Arten der Mobilität unterscheiden (MIV - ÖV - LV).
FERTIGKEITEN (KÖNNEN)
—— Durch Fragen einen Themenbereich eingrenzen. 5
—— Eine graphische Darstellung (Baumdiagramm) zur Klassifizierung nutzen.
WOLLEN
—— Den Fokus auf ein Hauptziel des Lehrmittels (Mobilität und die damit verbundene Problematik) richten
(NMG.7.3).
Der Begriff "Verkehrsmittel" beinhaltet auch die Möglichkeit, sich von einem
s
Info
zum andern Ort zu bewegen. So ist ein Trotinett (wie auch ein Segelschiff,
Skateboard, Ski…) kein Verkehrsmittel, wenn es für Freizeitaktivitäten oder
als Spiel genutzt wird; es wird zu einem Verkehrsmittel, wenn ich damit z. B.
meinen Schulweg zurücklege. So ist auch die Strassenwalze kein Verkehrs-
mittel, denn ihr Zweck ist nicht der Transport von Waren oder Personen.
Nicht jedes Fahrzeug ist also ein Transportmittel.
Die Fortbewegung zu Fuss wie auch mit einem Elektrovelo
zählt zum Langsamverkehr.
1
NMG.8 1 … können räumliche Merk- 2 … können die unter- 3 … können Veränderungen 4 … können Elemente und 5 … können sich in ihrer
Menschen nutzen male, Strukturen und Situati- schiedliche Nutzung von in Räumen erkennen, über Merkmale von Räumen in näheren und weiteren Um-
Räume - onen der natürlichen und ge- Räumen durch Menschen Folgen von Veränderungen Darstellungsmitteln auffinden gebung orientieren, sicher
sich orientieren und bauten Umwelt wahrnehmen, erschliessen, vergleichen und die künftige Gestaltung sowie raumbezogene Orien- bewegen und dabei Orien-
mitgestalten beschreiben und einordnen. und einschätzen und über und Entwicklung nachdenken. tierungsraster aufbauen und tierungsmittel nutzen und
Beziehungen von Menschen anwenden. anwenden.
zu Räumen nachdenken.LEKTIONSVORSCHLAG (2-3 LEKTIONEN)
LEHRPERSON:
SCHÜLERINNEN und SCHÜLER… MATERIAL
(FRAGESTELLUNG, AUFTRÄGE)
-- Wo liegt das Problem beim Thema Verkehr?
…… sehen sich den Film an.
-- Welche Fragen stellt ihr euch zum Thema Verkehr
…… formulieren und notieren Fragen zum Thema Verkehr. friportal Film
wenn ihr diesen Film gesehen habt? 1
…… wählen mit Hilfe der Lehrperson bedeutsame Fragen
-- Welche Fragen scheinen euch besonders interessant? aus, die bei der Arbeit mit diesem Lehrmittel vertieft
angegangen werden. 2 DOK 4
-- Worüber möchtet ihr mehr wissen?
…… stellen Vermutungen an.
-- Welche Antworten auf diese Fragen scheinen euch
möglich? …… erarbeiten Möglichkeiten, diese Vermutungen zu
verifizieren.
-- Welche Art von Verkehrsmitteln werden benutzt?
friportal 1
-- Wie kann man die Spielkarten mit den Fahrzeugen …… entdecken die verschiedenen Arten von Fahrzeugen, 1 Karten-
ordnen? indem sie das Quartett spielen. spiel für 4
Schüler
…… ordnen (Grösse, Geschwindigkeit, Anzahl Personen,
Preis…)
-- Könnte man die Fahrzeuge auch anders ordnen?1 3 1 …… und kategorisieren (Antrieb / Boden - Wasser - Luft /
Kinder - Erwachsene / individuell - kollektiv / Personen
- Waren / Beruf - Freizeit / gratis - kostenpflichtig…)
6 -- Nach welchen Kriterien haben die andern Gruppen die …… finden anhand der ausgelegten Karten die Ord-
AH 1 a
Karten geordnet? nungskriterien der andern Gruppen.
-- Welche Fahrzeuge kann man als Verkehrsmittel be- …… erkennen die Fahrzeuge, die dem Transport von DOK 5
zeichnen? Waren und Personen dienen. AH 1.1 b
…… klassieren die Karten nach Antriebsart (Treibstoff,
Elektrizität, Muskelkraft, Schwerkraft, Windkraft).
Kartenspiel
-- Wie sind die verschiedenen Fahrzeuge angetrieben? …… zeichnen und benennen nach Beschreibung ein friportal
Fahrzeug. AH 1.2 c
…… erkennen, dass der Begriff "Mobilität" ausschliesslich
Personen betrifft und drei Kategorien umfasst. (ver-
einfachte Definitionen entsprechend den Kategorien DOK 5
-- Was versteht man unter Mobilität? des Bundesamts für Statistik - BfS) AH 1.2 d
…… benennen mehrere Fahrzeuge und ordnen sie einer
Kategorie der Mobilität zu.
BEMERKUNGEN
1 Bevor die Kinder konkrete Fragen formulieren, soll untereinander ein Austausch ihrer Beobachtungen
und Bemerkungen stattfinden.
2 Die ausgewählten Fragen erlauben es, die Kinder besser ins Thema einzubinden und ihre Interessen
aufzunehmen. Auf der Basis dieser gemeinsamen Fragensammlung kann die Lehrperson eine Auswahl
der zu behandelnden Unterrichtseinheiten treffen. (Handlungsaspekte s. Did. Kom. S. 3)
3 Zur Auswahl stehen zwei Versionen des Spiels: eine mit und eine ohne vorgegebene Bezeichnungen
und Klassifizierungen.
Verschiedene Spielmöglichkeiten, z. B. "Wer bin ich?" (Karte auf der Stirne, durch geschlossene Fragen
– ja nein – Kinder erraten das Fahrzeug.)ZUSAMMENFASSUNG
—— Man kann Fahrzeuge nach unterschiedlichen Kriterien ordnen: nach Antriebsart (Motor, Muskel-
kraft, Wind…) nach "Elementen" (Erde, Wasser, Luft), nach Zweck (Waren, Personen…), nach
Geschwindigkeit…
—— Man unterscheidet drei Arten der Mobilität: Motorisierter Individualverkehr (MIV), Öffentlicher Verkehr
(ÖV), Langsamverkehr (LV).
—— Phänomene werden in der Geografie mit Hilfe spezifischer Fragen angegangen.
VORSCHLÄGE ZUR EVALUATION
—— Auf unterschiedlichen grafischen Darstellungen (Tabellen, Diagramme…) unterschiedliche Verkehrs-
mittel unterscheiden.
—— Verbinden von Begriffen (ÖV, MIV, LV) mit ihrer Definition oder mit Illustrationen.
—— Bedeutsame Fragen zu einer konkreten Situation stellen.
WEITERFÜHRENDE AKTIVITÄTEN
—— Verbindungen zwischen Verkehrsmittel und benötigter Energie (s. GEO|FR "Natur - Energie").
—— Von einem bestimmten Ort aus alle (Verkehrsmittel/Verkehrsteilnehmer) zählen, die während einer
bestimmten Zeit sichtbar sind (Strichliste: Fussgänger, Velofahrer, Autos, Lastwagen, Busse, Trakto-
ren, Flugzeuge…).
—— Ausserschulischen Lernort zum Thema Verkehr besuchen (Verkehrshaus Luzern, öffentliche oder
private Sammlungen von Fahrrädern, Autos, Eisenbahnen, Flugzeugen…), Modellanlagen (Kaeser-
bergbahn, imp. des Ecureuils 9b, Granges-Paccot). 7
—— Interview/Diskussion über die Faszination, die von Fahrzeugen ausgeht (Sammler, Modellbau, Sta-
tussymbol, Gefühl von Freiheit…).U
E
Was?
c) Zeichne und benenne die unterschiedlichen Fortbewegungsmittel der Mobilität.
1
Ich bin ein städti- Ich bin ein Motorfahr-
sches, öffentliches zeug auf der Strasse.
Trolleybus Elektrofahrzeug. Motorrad Mich benutzt eine
Tram Auto Einzelperson.
a) Wie lassen sich die Fahrzeuge ordnen?
...................................... ......................................
entsprechend der Wahl jedes Einzelnen
Mein Ordnungskriterium: ....................................................................................................... Mit Muskelkraft ange- Als Elektrofahrzeug auf
trieben, transportiere der Strasse befördere
z. B. Anzahl Personen/Grösse/Ge-
Andere Kriterien: ..................................................................................................................... ich eine Person. Elektro- ich höchstens fünf
schwindigkeit/Kinder - Erwachsene/Preis/ Velo
................................................................................................................................................ auto Personen.
Freizeit - Beruf/Kosten…
................................................................................................................................................
...................................... ......................................
b) Notiere auf jede Zeile den Namen eines Fahrzeugs. Ich habe zwei Räder Elektrisch angetrieben
und einen Benzinmotor. verbinde ich auf Schie-
zum Beispiel: Fahrzeug
Eisen- nen zwei Städte.
Motorrad
bahn
für Personentransport für Warentransport ...................................... ......................................
1.2
1.1 Auf der Strasse beför- Auch ich bin mobil,
dere ich dank meines aber ohne Fahrzeug.
* * Dieselmotors viele Fussgän-
Passagier-
1.1 Passagier-
auf der Erde
Fracht- auf der Erde
Fracht- Autobus Personen.
auf dem Wasser
ger
schiff
in der Luft auf dem Wasser in der Luft
.........................
flugzeug
......................... schiff
......................... flugzeug
..........................
...................................... ......................................
d) Markiere auf dem Baumdiagramm (Beispiel b):
auf Schienen auf der Strasse
- gelb: Fahrzeuge die Teil der Mobilität sind
Personenzug
.................................................. auf Schienen auf der Strasse
- grün: Mittel des Langsamverkehrs (LV)
Tram
.................................................. Güterzug Lastwagen
.......................
.........................
- orange: Transportmittel des motorisierten Individualverkehrs (MIV)
- blau: öffentliche Verkehrsmittel (ÖV) Was ist
öffentlich privat
Autobus
..................................................
Das weiss ich nun, das kann ich nun: Mobilität?
Trolleybus
..................................................
mit Motor ohne Motor
Auto
.................................................. Velo
..................................................
Motorrad
.................................................. Rollbrett…
..................................................
*je nach Beispiel
Privatflugzeug/Linienflugzeug
8NMG.7 1 … können unterschiedliche Le- 2 … können die unterschiedliche Nut- 3 … können Formen des Unterwegs- 4 … können Zusammenhänge und
Lebensweisen und bensweisen beschreiben und erken- zung von Räumen durch Menschen Seins von Menschen, Gütern und Abhängigkeiten zwischen Lebens-
Lebensräume von nen, was Menschen ihre Herkunft und erschliessen, vergleichen und ein- Nachrichten erkunden sowie Nutzen weisen und Lebensräumen von Men-
Menschen erschlies- Zugehörigkeiten bedeuten. schätzen und über Beziehungen von und Folgen des Unterwegs-Seins für schen wahrnehmen, einschätzen und
sen und vergleichen Menschen zu Räumen nachdenken. Mensch und Umwelt abschätzen. sich als Teil der einen Welt einordnen.
Unterrichtseinheit 2
Warum bin ich unterwegs?
SCHWERPUNKT
Sich bewusst werden, indem unterschiedliche Wege dargestellt und miteinander verglichen werden, dass
gewisse Strecken regelmässig und mit der Absicht zurückgelegt werden, sich zur Arbeit oder zur Schule zu
begeben (Pendlerverkehr).
LERNZIELE:
FÄHIGKEITEN (WISSEN)
—— Gründe, Absichten von Verkehrsteilnehmern identifizieren und kategorisieren.
—— Verschiedene Massstäbe zurückgelegter Distanzen unterscheiden (lokal - regional - international).
—— Den Begriff "Pendlerverkehr" erfassen, Pendler identifizieren und die eigene Stellung als Pendler
erkennen.
FERTIGKEITEN (KÖNNEN)
—— Bezugspunkte im Gelände, auf einer Skizze und auf einer Karte erkennen und benennen. 9
—— Einen vertrauten Raum schematisieren, um den eigenen Schulweg darzustellen.
—— Eine Legende zur eigenen Skizze erstellen und diese mit der topografischen Karte vergleichen.
—— Distanzen auf einem Balkendiagramm darstellen.
WOLLEN
—— Den Raum, in dem wir uns täglich bewegen, bewusst wahrnehmen.
Geografisch gesehen ist ein Bezugspunkt ein signifikantes (im Sinn von
s unverkennbar), permanentes (abhängig vom Zeitbegriff) Merkmal im Raum.
Info Es kann sich dabei um ein natürliches (Berggipfel, Bach, Hecke…) oder ein
künstliches Element (Brücke, Kirchturm, Schulhaus, Strasse…) handeln.
Bezugspunkte dienen der Lokalisierung und Wegbeschreibung.
Ein Bezugspunkt kann je nach Person subjektiver Natur sein
(bedingt durch Beziehung und Erfahrung) und daher von
einer anderen Person nicht als solcher erkannt werden.
NMG.8 1 … können räumliche Merk- 2 … können die unter- 3 … können Veränderungen 4 … können Elemente und 5 … können sich in ihrer
Menschen nutzen male, Strukturen und Situati- schiedliche Nutzung von in Räumen erkennen, über Merkmale von Räumen in näheren und weiteren Um-
Räume - onen der natürlichen und ge- Räumen durch Menschen Folgen von Veränderungen Darstellungsmitteln auffinden gebung orientieren, sicher
sich orientieren und bauten Umwelt wahrnehmen, erschliessen, vergleichen und die künftige Gestaltung sowie raumbezogene Orien- bewegen und dabei Orien-
mitgestalten beschreiben und einordnen. und einschätzen und über und Entwicklung nachdenken. tierungsraster aufbauen und tierungsmittel nutzen und
Beziehungen von Menschen anwenden. anwenden.
zu Räumen nachdenken.LEKTIONSVORSCHLAG (2-3 LEKTIONEN)
LEHRPERSON:
SCHÜLERINNEN und SCHÜLER… MATERIAL
(FRAGESTELLUNG, AUFTRÄGE)
-- Warum sind wir unterwegs?
…… erstellen ein Inventar ihrer Wege während einer
Woche. AH 2.1 a
-- Wenn ihr unterwegs seid, wohin geht ihr?
…… wenden die drei Kategorien der Mobilität an.
…… zählen (anhand der aufgestreckten Finger) die
-- Warum (zu welchem Zweck) seid ihr unterwegs? wichtigsten Gründe, warum die Kinder der Klasse
unterwegs sind.
…… stellen fest, dass es regelmässige und gelegentliche
Verschiebungen gibt.
-- Wie häufig seid ihr unterwegs? AH 2.1 b
…… verknüpfen Zweck und Häufigkeit der Verschiebun-
gen.
-- "Jemand ist ein Pendler." Was bedeutet dies? 1 …… erklären mit eigenen Worten den Begriff "Pendler".
DOK 5
-- Und wir, sind wir auch Pendler? …… vergleichen ihre Definition mit der vorgeschlagenen. 1
-- Warum (zu welchem Zweck) ist man in der Schweiz …… beobachten das Kreisdiagramm
unterwegs? DOK 6
…… stellen fest, dass man die grössten Distanzen im
-- Was fällt euch auf? Bereich Freizeit zurücklegt.
…… übertragen die Distanzen der unterschiedlichen
-- Wie kann man die unterschiedlichen Arten des Unter- Personen auf das Balkendiagramm DOK 6
wegsseins darstellen? …… ordnen den Personen die drei Arten der Mobilität zu AH 2.1 c
und identifizieren die Pendler.
10 …… erkennen, dass man fast zehn Seiten benötigen
würde, um Josés Spanienreise darzustellen.
-- Wie kann man erklären, dass der Freizeitverkehr den
grössten Anteil hat? …… erkennen, dass die Distanzen zum grossen Anteil
des Freizeitverkehrs führen, man fährt oder fliegt
nicht oft, aber sehr weit. 2
-- Wo führt unser Weg durch?
…… zeichnen ihr Haus und das Schulhaus ein (so weit als
-- Welches ist euer Schulweg? möglich auseinander, um den Schulweg so genau AH 2.2 d
als möglich zeichnen zu können).
-- Welche Orientierungspunkte könnt ihr auf eurem …… nennen Orientierungspunkte ihres Schulweges.
AH 2.2 e/f
Schulweg erkennen? …… tragen diese auf ihrem Plan ein (evt. als Symbole).
…… folgen auf der Karte den beiden Schulwegen, stellen
-- Wie sind die Schulwege von Lucas und Joëlles Cousin Unterschiede in der Art der Fortbewegung fest (zu
Fuss, Bus). DOK 7
und Cousine dargestellt?
…… ergänzen ihre Orientierungspunkte auf dem Plan.
…… lokalisieren ihren Wohnort, das Schulhaus und einige
-- Und wenn wir nun unseren Schulweg auf einer Karte Bezugspunkte. AH 2.2 g
eintragen würden? 3
…… tragen ihren Schulweg auf dem Plan/der Karte des friportal
Schulorts ein.
…… vergleichen eigene Zeichnung mit Plan und Karte:
-- Welche Unterschiede stellt ihr zwischen eurer eigenen
subjektive - objektive Distanzen, Ausrichtung frei -
Zeichnung und dem Plan und der Karte fest?
genordet, erfundene Symbole - Legende…BEMERKUNGEN
1 Wortbedeutung anhand eines Pendels und seiner Bewegung erläutern (evt. Video auf youtube). Die
Schülerinnen und Schüler aufmerksam machen, dass die nachfolgenden UE diese Art der Mobilität als
Schwerpunkt haben wird.
2 Die Destination "Spanien" ist für diese Art des Verkehrs noch relativ nahe.
3 Um eine Karte des Schulortes auszudrucken s. Link auf friportal.1
ZUSAMMENFASSUNG
—— Pendler verschieben sich regelmässig von ihrem Wohnort zu ihrem Arbeits- oder Studienort.
—— Im schweizerischen Durchschnitt werden die längsten Distanzen im Bereich Freizeitverkehr
zurückgelegt.
—— Um einen Weg zu beschreiben, benötigt man Bezugspunkte.
—— Unsere subjektive Wahrnehmung lässt uns Strecken, Orte, Reisedauer unterschiedlich erfahren.
VORSCHLÄGE ZUR EVALUATION
—— Konkrete Situationen einer Verkehrsart zuordnen.
—— Eigene Beispiele von Pendlerverkehr nennen und die Gründe dafür anführen (Regelmässigkeit,
Arbeits- oder Schulweg).
—— Auf einem Plan oder einer Karte signifikante örtliche Bezugspunkte verorten.
11
—— Einen Weg für eine ortsfremde Person beschreiben und/oder skizzieren.
WEITERFÜHRENDE AKTIVITÄTEN
—— Skizzen der Schulwege innerhalb der Klasse austauschen und erkennen, wer diesen Weg geht.
—— In Partnerarbeit: Ein Kind beschreibt seinen Schulweg (links-rechts-geradeaus, Himmelsrichtungen…),
sein Partner zeichnet den Weg nach dieser Beschreibung auf ein leeres Blatt oder eine Karte.
—— Den eigenen Schulweg fotografisch oder filmisch dokumentieren.
—— Gefahren auf dem Schulweg identifizieren und Verhaltensregeln umsetzen.
—— Schulwege von Kindern anderswo auf der Erde kennen lernen (z. B. Film: " Auf dem Weg zur Schule"
von Pascal Plisson).Warum ? Wo?
U
E
2
a) Ergänze
a) Ergänze die Tabelle
die Tabelle mitAngaben
mit den den Angaben all deiner
all deiner Verschiebungen
Verschiebungen (Wege)
(Wege) während
während einer einer
Woche.Woche.
Wohin?
Wohin? Wie? Wie? Warum?
Warum? d) Mit einem roten Punkt nahe beim Rahmen stellst du dein Wohnhaus dar und, so weit als
Beispiel:
LV LV SchuleSchule FreizeitFreizeit möglich entfernt, mit einem violetten Rechteck das Schulhaus.
MIV MIV
ÖV ÖV EinkäufeAndereAndere
Einkäufe e) Zeichne deinen üblichen Schulweg zwischen beiden Orten.
zum Schulhaus X LVMIV LV
MIV X Schule Schule FreizeitFreizeit
EinkäufeAndereAndere
Einkäufe
ÖV ÖV
zur Bäckerei X LV LV SchuleSchule FreizeitFreizeit
MIV
ÖV
MIV
ÖV X EinkäufeEinkäufeAndereAndere
zum Volleyballtraining X
LV
MIV
ÖV
LV
MIV
ÖV
X
SchuleSchule FreizeitFreizeit
EinkäufeAndereAndere
Einkäufe
zu den Grosseltern
LV LV
X MIV
ÖV
MIV
ÖV
SchuleSchule FreizeitFreizeit
X
EinkäufeAndereAndere
Einkäufe
zum Musikunter-
LV
MIV
LV
MIV X Schule Schule FreizeitFreizeit
X LV ÖV ÖV EinkäufeAndereAndere
Einkäufe
richt… entsprechend dem Wohnort jedes
LV SchuleSchule FreizeitFreizeit
MIV MIV
ÖV ÖV EinkäufeAndereAndere
Einkäufe
Schülers/jeder Schülerin
LV LV SchuleSchule FreizeitFreizeit
MIV MIV
ÖV ÖV EinkäufeAndereAndere
Einkäufe
2.1 2.2
b) Notiere
b) Notiere eine Verschiebung,
eine Verschiebung, die dudie
... du ... machst.
machst.
... fast...jeden
fast jeden zur Schule
Tag: ...................................................................................................................
Tag: ...................................................................................................................
... fast...jede
fast Woche:
jede Woche:zum Fussballtraining
.................................................................................................................
.................................................................................................................
... von...Zeit
vonzu
Zeit
ins Schwimmbad
zu .................................................................................................................
Zeit: Zeit: .................................................................................................................
c) Gib für die verschiedenen Personen die Art ihrer Mobilität an. Trage die 6
zurückgelegte Distanz im Diagramm ein und bemale die Balken entspre-
chend dem Grund ihrer Verschiebung. (Beachte das Beispiel von Ania.)
Markiere die Wege der Pendler. Pendler?
orange
f) Füge einige markante Bezugspunkte ein, zeichne die Sonne, wo sie am Morgen steht.
Ania LV x
Bernard ÖV gelb g) Führe nun die gleiche Übung d) und e) auf einem Plan deines
Warum bin
ich
Carine MIV dunkelblau Wohnortes durch. (Plan / Karte als Beilage).
Daniel MIV grün x
Emilie LV blaugrün Das weiss ich nun, das kann ich nun: unterwegs
?
Fatim MIV blaugrün
Gerd ÖV grün x
Hélène - gelb
Isabelle ÖV grün x
José ÖV orange *
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 km
*Wir würden 10 Seiten benötigen, um Josés
12 Reise massstabgetreu darzustellen.NMG.7 1 … können unterschiedliche Le- 2 … können die unterschiedliche Nut- 3 … können Formen des Unterwegs- 4 … können Zusammenhänge und
Lebensweisen und bensweisen beschreiben und erken- zung von Räumen durch Menschen Seins von Menschen, Gütern und Abhängigkeiten zwischen Lebens-
Lebensräume von nen, was Menschen ihre Herkunft und erschliessen, vergleichen und ein- Nachrichten erkunden sowie Nutzen weisen und Lebensräumen von Men-
Menschen erschlies- Zugehörigkeiten bedeuten. schätzen und über Beziehungen von und Folgen des Unterwegs-Seins für schen wahrnehmen, einschätzen und
sen und vergleichen Menschen zu Räumen nachdenken. Mensch und Umwelt abschätzen. sich als Teil der einen Welt einordnen.
Unterrichtseinheit 3
Hin und her?
SCHWERPUNKT
Sich durch Vergleichen und Analysieren von Statistiken und der Resultate des Fragebogens bewusst werden,
dass viele Menschen unterschiedliche Wohn - und Arbeitsorte haben, dass sich die meisten Arbeitsplätze in
bestimmten Zonen konzentrieren.
LERNZIELE:
FÄHIGKEITEN (WISSEN)
—— Folgen politischer Entscheidungen (Grundrechte, Raumplanung) auf die Gestaltung des Raumes
erkennen.
—— Räumliche und zeitliche Konsequenzen (bedingt durch die Wahl des Wohn- und Arbeitsortes) erkennen.
—— Den Weg eines Pendlers einer Aussage zuordnen.
—— Orte lokalisieren, die Pendler anziehen.
—— Gründe (natürliche und menschliche) aufzählen, welche die räumliche Konzentration der Arbeitsplätze
erklären. 13
FERTIGKEITEN (KÖNNEN)
—— Himmelsrichtungen verwenden.
—— Auf einer Luftaufnahme oder einer Karte Wohn- und Arbeitszonen und Verkehrswege verorten.
—— Arbeitswege schematisieren und diese Grafik mit einer entsprechenden thematischen Karte
vergleichen.
WOLLEN
—— Den Fokus auf eine geografische Frage richten und ein passendes Werkzeug (Umfrage) schaffen,
welches zur Beantwortung dieser Frage führt.
Laut BfS versteht man unter dem Begriff Pendler Erwerbstätige ab 15 Jahren
s sowie Personen in Ausbildung, welche ihren Wohnort verlassen, um ihren Arbeits-/
Info Ausbildungsort zu erreichen. Unterschieden werden des Weiteren Pendler, die
innerhalb ihrer Wohngemeinde arbeiten (Binnenpendler), von denjenigen, die ihre
Wohngemeinde verlassen und ihrer Beschäftigung in einer anderen Gemeinde
(Wegpendler) oder im Ausland (Grenzgänger) nachgehen.
Zusätzliche Informationen unter friportal
NMG.8 1 … können räumliche Merk- 2 … können die unter- 3 … können Veränderungen 4 … können Elemente und 5 … können sich in ihrer
Menschen nutzen male, Strukturen und Situati- schiedliche Nutzung von in Räumen erkennen, über Merkmale von Räumen in näheren und weiteren Um-
Räume - onen der natürlichen und ge- Räumen durch Menschen Folgen von Veränderungen Darstellungsmitteln auffinden gebung orientieren, sicher
sich orientieren und bauten Umwelt wahrnehmen, erschliessen, vergleichen und die künftige Gestaltung sowie raumbezogene Orien- bewegen und dabei Orien-
mitgestalten beschreiben und einordnen. und einschätzen und über und Entwicklung nachdenken. tierungsraster aufbauen und tierungsmittel nutzen und
Beziehungen von Menschen anwenden. anwenden.
zu Räumen nachdenken.LEKTIONSVORSCHLAG (4-6 LEKTIONEN)
LEHRPERSON:
SCHÜLERINNEN und SCHÜLER… MATERIAL
(FRAGESTELLUNG, AUFTRÄGE)
-- Welche Wahl? Welche Folgen?
…… stellen Vermutungen an.
-- Warum arbeiten die meisten Leute nicht dort, wo sie …… stellen u.a. fest, dass die Verfassung Niederlas- DOK 8
auch wohnen? sungsfreiheit (man ist nicht verpflichtet, an seinem (oben)
Arbeitsort zu wohnen) garantiert und dass Wohn-
und Arbeitszonen räumlich getrennt sind.
…… stellen fest, dass man zum Wohnen eher eine ruhige
-- Warum verlangt die Raumplanungsordnung, Zonen Lage wählt, was mit gewerblichen und industriellen Ak-
AH 3.2 d
unterschiedlicher Nutzung zu trennen? tivitäten (Emissionen, Lärm, Verkehrsbewegungen für
Personen und Waren…) nicht unbedingt vereinbar ist.
…… wählen aus den Vorgaben einen Wohn- und einen DOK 8
-- Wo würdet ihr wohnen und wo arbeiten?
Arbeitsort und begründen dies. AH 3.1 a
…… heben die Konsequenzen ihrer Wahl (räumliche und
AH 3.1 b/c
-- Welche Folgen hat deine Wahl? zeitliche) und die Auswirkungen auf ihre frei verfügba-
DOK 8
re Zeit hervor.
-- Welche Gründe haben Personen, die in Düdingen …… ordnen Beweggründe diverser Personen und ihre
AH 3.2 e/f
wohnen oder arbeiten, zu ihrer Wahl bewogen? Arbeitswege (zum Teil) den Aussagen zu.
-- Wie ist es für Leute aus unserem Schulort?
…… schlagen Vorgehensweisen vor, die es erlauben, Daten
-- Wie kann man dies herausfinden?
zu sammeln (Umfrage, Interview, Datensammlungen…)
…… wägen Vor- und Nachteile ab, wählen entsprechend
-- Welche ist wohl für uns die beste Art? ihren Möglichkeiten eine Art, die örtliche Situation zu Friportal
erfassen. (Umfrage bei Eltern und Bekannten 1 )
14 …… tragen alle genannten Arbeitsorte F 1 zusammen
(s. Umfrage Rubrik A), übertragen diese in die Tabelle AH 3.3 g
-- Wo arbeiten die Personen, die wir befragt haben? 2
(gleiche Orte zusammengefasst, mit Angabe der
Nennungen).
…… suchen die genannten Arbeitsorte, die entspre-
-- Welche Distanzen werden zurückgelegt und in welche chenden Himmelsrichtungen und Distanzen F 4 ,
AH 3.3 h
Richtungen führen sie? übertragen Distanzen und Himmelsrichtungen in die
Tabelle.
…… übertragen Distanzen und Himmelsrichtungen auf
das Diagramm 3 .
-- Wie können wir dies nun auf einem Diagramm (gra-
…… finden eine Möglichkeit, die Anzahl gleicher Wege AH 3.3 i
fische Darstellung von Daten, Sachverhalten oder
grafisch darzustellen (unterschiedliche Farben, Friportal
Informationen) darstellen?
mehrere Pfeile, Mächtigkeit der Pfeile, Legende mit
Angabe der Anzahl…).
…… stellen anhand ihres Diagramms gewisse Fakten fest
-- Was können wir nun aus unserem Diagramm heraus- AH 3.3 i
(z.B. fast die Hälfte der Befragten arbeitet in…, die
lesen?
meisten legen mehr als… km zurück…).
…… vergleichen ihre Ergebnisse mit der Karte der Pend-
lerströme.
…… stellen Vermutungen an, um Unterschiede zu DOK 10
-- Wie sieht es für unseren Bezirk aus? erklären (z. B. die befragten Personen sind nicht AH 3.4 j
repräsentativ für den Bezirk: man kann auf der Karte
die Pendlerströme innerhalb des Bezirks nicht sehen;
unsere Gemeinde ist am Rand des Bezirks,…).-- Warum finden sich die meisten Arbeitsplätze an bestimmten Orten, in bestimmten Zonen?
…… erkennen und benennen Orte, wo sich Arbeitsplätze
-- Wo befinden sich die meisten Arbeitsplätze? konzentrieren.
DOK 11
-- Warum liegen sie oft dort? …… vergleichen unterschiedliche Aussagen mit der Karte. AH 3.4 k
…… zählen einige Gründe für diese Situation auf.
…… stellen fest, dass gewisse Strassen sehr belastet sind.
-- Welche Auswirkungen haben diese
…… beschreiben einige Folgen für Anwohner dieser Mappe
Pendlerbewegungen?
Strassen (Belastungen: Lärm, Luft, Unfallgefahren…).
BEMERKUNGEN
1 Im Idealfall erarbeiten die Kinder den Fragebogen selber. Um Zeit zu gewinnen, finden Sie einen Vorschlag
auf Friportal.
2 Der Fragebogen dient dazu, Fragen der Mobilität für den eigenen Schulort nachzugehen. In keinem Fall
darf er die Aussagen werten. Möglicherweise empfinden gewisse Eltern diese Angaben als zu persönlich.
Es empfiehlt sich, den Eltern mittels der Dokumente und des Arbeitshefts den Zweck dieser Umfrage
offenzulegen. Zudem ist der Umfragebogen anonym.
3 Je nach Möglichkeit und Ausrüstung können die Schülerinnen/Schüler mit der Schulkarte FR (1 cm
1 km) und für entferntere Orte mit der Schweizer Karte (1cm 5 km) oder mit einem Kartografieportal
arbeiten.
ZUSAMMENFASSUNG
—— Pendeln gehört zum Berufsalltag der meisten Menschen, weil Wohnort und Arbeitsort selten identisch
sind, und unterschiedliche Beweggründe bestimmen, wo wir wohnen und wo wir arbeiten.
—— Die Umfrage zeigt, dass für unseren Schulort die befragten Personen vor allem in… arbeiten.
15
—— Das Angebot von Arbeitsstellen konzentriert sich an bestimmten Orten. Unternehmen lassen sich dort
nieder, wo es für sie interessant ist, vor allem in oder um Städte (Verkehrsanbindung, Verfügbarkeit von
Arbeitskräften, Arbeitszonen, Produktions-, Geschäts- und Verwaltungszentren…).
—— Eine Umfrage erlaubt, Informationen auf lokaler Ebene zu erhalten.
VORSCHLÄGE ZUR EVALUATION
—— Auf einem Foto/einer Schrägaufnahme/einer Luftaufnahme/einer Karte, wichtige Verkehrsverbindun-
gen, Wohn- und Arbeitszonen erkennen und einzeichnen.
—— Eigenschaften einer Wohnzone/Arbeitszone erkennen und zuordnen.
—— Wahl eines Wohnortes/Arbeitsortes begründen.
—— Auf einer Karte Distanzen und Himmelsrichtung zwischen unterschiedlichen Orten erkennen.
WEITERFÜHRENDE AKTIVITÄTEN
—— Mit Hilfe von Bezugspunkten den Weg eines Pendlers beschreiben.
—— Andere Personen zum Pendeln befragen.
—— Mit Hilfe einer Umfrage Beweggründe der Wahl von Arbeits- und Wohnort erheben.
—— Auf einer Luftaufnahme/Karte Wohn- und Arbeitszonen des eigenen Schulorts lokalisieren.
—— Sich über die Anzahl der Arbeitsplätze/Einwohner (www.fr.ch/stata/Gemeindeverwaltung) der eige-
nen Gemeinde informieren.
—— Pendlerwege (Strassen, Eisenbahnlinien) auf einer Karte des Kantons (und Umgebung) einzeichnen.
—— Verantwortliche eines Betriebes über die Gründe der Niederlassung an diesem bestimmten Ort befragen.
—— Ausgehend von einem Rollenspiel (Situation: z. B. mein Vater hat ein Angebot, in Zürich zu arbei-
ten…) Diskussion über Vor- und Nachteile des Pendelns führen.Warum hier? Wohin
U
E
3
und woher?
9
a) Ergänze, entsprechend 8 Agenda d) Umkreise: - gelb: einige Wohnzonen
deiner Auswahl: 06:00 - rot: einige Arbeitszonen
Ich wähle als Wohnort: 07:00 Übermale: - violett: die wichtigsten Verkehrswege
Siviriez Freiburg
08:00 Luftbild Düdingen
weil ..............................................................
(2015) Swisstopo
......................................................................
......................................................................
09:00
G
en
......................................................................
10:00 Arbeitszeit
ts
pr
11:00
Ich wähle als Arbeitsort:
ec 12:00
Düdingen heBulle E
nd
weil .............................................................. 13:00
d
......................................................................
er
......................................................................
14:00
W
......................................................................
15:00
ah Arbeitszeit
lj
16:00
3.1 3.2
b) Verbinde auf der Karte die Orte, die du aus- d
e 17:00
e18:00 F
gewählt hast. rS
c
19:00 hü 0 50 100 150 m
le e) Ordne jede Sprechblase einem Arbeitsweg auf der farbigen
20:00
rin Aufnahme zu (Buchstabe).
9
21:00 /je
D
de
Ich habe vor Ort keine
Praktisch, ich verliere geeignete Wohnung
22:00
s keine Zeit für meinen
Ich habe nur anderswo gefunden; also komme ich Glücklicherweise habe
Sc
Arbeit gefunden. Also jeden Tag mit dem Auto
F Arbeitsweg. Ich wohne
im Bauernhaus, wo ich
nehme ich täglich zuerst über die Autobahn zur
ich eine Wohnung in der
Nähe meines Arbeitsor-
hü
23:00 beim Bahnhof den Zug.
auch arbeite. Arbeit. tes gefunden.
le
rs B
.......................
D C
.......................
A
c) Markiere in der Agenda je nach Wahl des ....................... .......................
Wohn- und Arbeitsortes, die du getroffen hast.
S f) Zeichne auf der oben stehenden Luftaufnahme einen möglichen Weg ein, der den Aussa-
- violett: die Zeit des Unterwegssein gen entspricht.
B Ich arbeite beim Bahnhof Ich wollte nicht in der Stadt woh-
- die Uhrzeit des Aufstehens Ich will in der Nähe meiner Familie und Düdingen. Zum Glück kann ich nen. Also bin ich hierhin gezogen. So
(man benötigt 1h für Frühstück und Vorbereitungen) meiner Freunde wohnen; also fahre ich nur 300 Meter entfernt bei nehme ich halt jeden Tag den Zug
täglich 50 km, um hierhin an meinen meinen Eltern wohnen. um arbeiten zu gehen.
- gelb: Freizeit zuhause Arbeitsplatz zu kommen.
- braun: die Zeit, die man nicht zuhause ist. E F G
zum Beispiel…
16
Wo? Warum hier?
U
E
3
dem S
g) Ergänze die Tabelle der Arbeitsorte mit h) Suche Richtung und Distanz für jeden
chu
OK 10 lort/Wohnbez
j) Mit Hilfe der Karte zu den Pendlerbewegungen kannst du folgende Fragen
den Angaben der ganzen Klasse. dieser Orte. Dbeantworten: 10
entspWohnbezirk
rechendie drei wichtigsten irk undPendlerziele?
Arbeitsort/Schule Anzahl
Distanz Himmels-
Welches sind für deinen
d der Ka
rte
(km) richtung
.................................. ................................. ...................................
Welches sind für deinen Wohnbezirk die drei wichtigsten Herkunftsorte von Pendlern?
.................................. ................................. ...................................
entsprechend den Umfrageergebnissen der Klasse Saanebezirk
Welcher Bezirk des Kantons empfängt die meisten Pendler? ...............................................
k) Bewerte folgende Aussagen: 11
N
NW NO Die Arbeitsplätze befinden sich...
entspricht überhaupt nicht entspricht dem, was
meinen Beobachtungen ich beobachten kann
W O ... entlang der Autobahnen 0 1 2 3 4 5
SW SO
... an Seeufern
S 0 1 2 3 4 5
g
... entlang der Eisenbahnlinien
c hla
ors
5
0 1 2 3 4
3.3 3.4
rV
he
i) Übertrage mit Hilfe N ... in den grossen Städten
lic
0 1 2 3 4 5
von Richtungspfeilen
zum Beispiel g
mö
die Entfernungen zum ... in grosser Höhenlage
Arbeitsort auf das NW NO 0 1 2 3 4 5
Diagramm. Versuche ... in den Kantonshauptorten
0 1 2 3 4 5
auch die Anzahl
sichtbar zu machen. ... entlang eines Flusses
0 1 2 3 4 5
... im Kanton Freiburg
W O 0 1 2 3 4 5
5k
m
10
Hin und
km
20
km
her?
Das weiss ich nun, das kann ich nun:
30
km
SW SO
SNMG.7 1 … können unterschiedliche Le- 2 … können die unterschiedliche Nut- 3 … können Formen des Unterwegs- 4 … können Zusammenhänge und
Lebensweisen und bensweisen beschreiben und erken- zung von Räumen durch Menschen Seins von Menschen, Gütern und Abhängigkeiten zwischen Lebens-
Lebensräume von nen, was Menschen ihre Herkunft und erschliessen, vergleichen und ein- Nachrichten erkunden sowie Nutzen weisen und Lebensräumen von Men-
Menschen erschlies- Zugehörigkeiten bedeuten. schätzen und über Beziehungen von und Folgen des Unterwegs-Seins für schen wahrnehmen, einschätzen und
sen und vergleichen Menschen zu Räumen nachdenken. Mensch und Umwelt abschätzen. sich als Teil der einen Welt einordnen.
Unterrichtseinheit 4
Eine Frage der Zeit?
SCHWERPUNKT
Sich mit Hilfe der Umfrageergebnisse und von Statistiken bewusst werden, dass die Anzahl der Pendler zu-
nimmt, die Arbeitswege und Wegzeiten länger werden und dadurch Verkehrsüberlastungen entstehen, welche
zeitlich beschränkt sind.
LERNZIELE:
FÄHIGKEITEN (WISSEN)
—— Stosszeiten, hervorgerufen durch menschliche Aktivitäten und zeitliche Organisation, identifizieren.
—— Dokumente vergleichen, die eine zeitliche Entwicklung aufzeigen.
—— Einige Folgen des Pendlerverkehrs und seiner Entwicklung erkennen.
FERTIGKEITEN (KÖNNEN)
—— Gesammelte Daten in einem Säulendiagramm darstellen und in eine Verlaufskurve umwandeln. 17
—— Fotos nach einem bestimmten Kriterium einordnen können.
—— Spezifischen Fragen mit Hilfe entsprechender Dokumente nachgehen.
WOLLEN
—— Sich bewusst werden, dass eine Vervielfältigung gleichen individuellen Verhaltens Auswirkungen auf
alle hat.
Seit 1970 nimmt die Zahl der Pendler zu, seit 2000 hat sich diese Entwicklung
beschleunigt (2014 waren 9 von 10 Erwerbstätigen in der Schweiz Pendlerin-
s
Info nen bzw. Pendler), die zurückgelegten Distanzen werden länger. Die Gründe
dafür sind die Konzentration der Arbeitsstellen an strategisch günstigen Orten
(Stadtzentren für den tertiären Sektor, Industriezonen mit guter Anbindung an
den Verkehr). Gleichzeitig entstehen zunehmend Wohnzonen in immer grösserer
Entfernung der Zentren und damit der Arbeitsorte. Zusammen mit einer markanten
Bevölkerungszunahme führt diese Entwicklung zu einer massiven Zersiedelung
und einer Zunahme der Verkehrsbelastung. Zudem erfolgt dieser Mehrverkehr
zu gewissen Tageszeiten (Morgen, Mittag, Abend) und an gewissen Orten, was
unausweichlich zu einer Verkehrsüberlastung (Stau) führt.
NMG.8 1 … können räumliche Merk- 2 … können die unter- 3 … können Veränderungen 4 … können Elemente und 5 … können sich in ihrer
Menschen nutzen male, Strukturen und Situati- schiedliche Nutzung von in Räumen erkennen, über Merkmale von Räumen in näheren und weiteren Um-
Räume - onen der natürlichen und ge- Räumen durch Menschen Folgen von Veränderungen Darstellungsmitteln auffinden gebung orientieren, sicher
sich orientieren und bauten Umwelt wahrnehmen, erschliessen, vergleichen und die künftige Gestaltung sowie raumbezogene Orien- bewegen und dabei Orien-
mitgestalten beschreiben und einordnen. und einschätzen und über und Entwicklung nachdenken. tierungsraster aufbauen und tierungsmittel nutzen und
Beziehungen von Menschen anwenden. anwenden.
zu Räumen nachdenken.LEKTIONSVORSCHLAG (2-3 LEKTIONEN)
LEHRPERSON:
SCHÜLERINNEN und SCHÜLER… MATERIAL
(FRAGESTELLUNG, AUFTRÄGE)
-- Wann ist man unterwegs?
…… strecken auf, wenn die Abfahrtszeit auf ihrer Umfrage
-- Wenn wir die Resultate der Umfrage anschauen, um genannt wird. Friportal
wie viel Uhr begeben sich die Leute zur Arbeit F 5 …… übertragen für jeden Zeitabschnitt die Anzahl Umfrage
und wann nach Hause F 6 ? gestreckter Hände in die Tabelle (Arbeitsweg und AH 4.1 a
Heimweg).
…… stellen fest, dass diese Zeiten ungleichmässig über
den Tag verteilt sind.
…… vergleichen das Ergebnis der ganzen Klasse mit der
-- Zu welchen Tageszeiten sind die meisten/die wenigs- Grafik der Verkehrsbelastung Freiburgs. DOK 12
ten der befragten Personen unterwegs? AH 4.1 b/c
…… erklären mögliche Abweichungen (z. B. Entfernung
zu einem regionalen Zentrum).
…… stellen fest, dass zu gewissen Tageszeiten Strassen
verstopft und Züge überfüllt sind.
-- Welche Auswirkungen hat diese unregelmässige DOK 12
Verteilung? …… leiten daraus ab, dass zu Stosszeiten der Strassen- AH 4.1 d/e
verkehr durch Staus verlangsamt wird und in öffentli-
chen Verkehrsmitteln der Komfort leidet (Sitzplatz…).
-- Wie haben sich Pendlerbewegungen entwickelt?
…… beobachten die unterschiedlichen Dokumente und
-- Welche Zeitabschnitte werden verglichen? ordnen diese zeitlich in die Geschichte ihrer Familie DOK 13
18 ein.
-- Auf welchem Dokument ist unsere Gemeinde zu …… lokalisieren ihre Wohngemeinde und erkennen den DOK 13
sehen? nächstgelegenen aufgeführten Bahnhof. Karte FR
-- Welche Informationen benötigt man, um die Entwick- …… beschreiben die massgeblichen Unterschiede DOK 13
lung des Pendlerverkehrs zu verstehen? zwischen der Situation 1970 und 2015. AH 4.2 f/g/h
…… stellen Vermutungen zu möglichen Erklärungen an
(technischer Fortschritt, der eine schnellere Fortbe-
wegung ermöglicht, Konzentration der Arbeitsplätze,
-- Wie kann man diese Unterschiede erklären?
die längere Arbeitswege bedingt, Auto wird zum
Allgemeingut, ermöglicht grössere Distanzen zu
Arbietsort,
-- PENDLERSPIEL …… 1. SzenarioSie können auch lesen