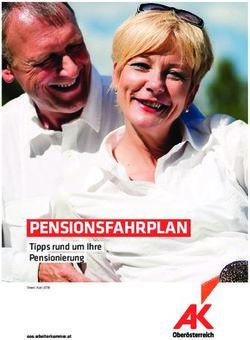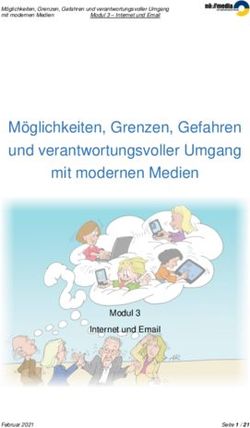Geschlechterdarstellungen in den Medien: eine unendliche (Klischee-)Geschichte
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Schwerpunkt
Geschlechterdarstellungen
in den Medien: eine unendliche
(Klischee-)Geschichte
Heike vom Orde
Geschlechterbilder in den Medien sind seit fast in den Medien von ungebrochener Aktualität.
fünf Jahrzehnten Gegenstand der Forschung Die vorliegende kommunikationswissenschaft-
in der deutschsprachigen Medien- und Kom- liche Genderforschung weist gerade in populären
munikationswissenschaft. Bereits 1975 stellte medialen Inhalten auf eine andauernde Stereoty-
Küchenhoff lakonisch als Fazit seiner Studie zur pisierung in der Darstellung von „Männlichkeit“
Darstellung der Frau im deutschen Fernsehen und „Weiblichkeit“ hin. Und dieser Tatbestand ist
fest: „Männer handeln, Frauen kommen vor“. Die nicht nur im Fernsehen, sondern über viele medi-
Autorinnen einer neueren repräsentativen Un- ale Formen und Genres hinweg zu beobachten.
tersuchung (Prommer & Linke, 2019) konstatieren Im Folgenden wird anhand ausgewählter
nach wie vor eine „Schieflage in den Geschlechter- Forschungsergebnisse aufgezeigt, welche Ge-
darstellungen im deutschen TV und Kino“. Nicht schlechterbilder und Stereotypisierungen in
nur wegen der empirisch hinreichend belegten Medien vorliegen und inwieweit diese medialen
Marginalisierung von Frauen ist die Frage nach Konstrukte Einfluss auf die Geschlechtsidentität
den Bildern und der Konstruktion von Geschlecht ihrer Rezipient*innen haben können.1
9
BPJMAKTUELL 2/2020__Mediale Geschlechterbilder: beträgt das Verhältnis sogar 3:1. Damit zeigt sich
eine Auswahl an Befunden keine Veränderung hinsichtlich der Sichtbarkeit
im Vergleich zu den Forschungsergebnissen von
Mit einer deutlichen Verzögerung zu den anglo- Weiderer (1993).
amerikanischen Feminist Media Studies bildete Auch jenseits der Geschlechterkategorien
sich in Deutschland die kommunikationswissen- zeigt sich das deutsche Fernsehen wenig divers:
schaftliche Geschlechterforschung ab Mitte der Menschen mit Migrationshintergrund kommen
70er Jahre heraus. Die Kategorie „Gender“, also das signifikant weniger vor als es der Verbreitung in
von sozialen und kulturellen Umständen abhän- der Bevölkerung entspricht. Sexuelle Diversität
gige Geschlecht, wurde in ihrer Bedeutung ab jenseits der Heterosexualität ist ebenfalls kaum
Mitte der 1990er Jahre auch in der deutschspra- sichtbar. Und neben dem vorherrschenden Bild
chigen Forschung berücksichtigt und der Prozess der jüngeren, schlanken Frau steht der Mann, der
des „Doing Gender“ trat in den Mittelpunkt der die Welt als Experte oder Moderator erklärt. Er
Studien (Dorer & Klaus, 2008). Dieser Forschungs- ist alt oder jung und in vielen Berufen und Funk-
perspektive liegt die Hypothese zugrunde, dass tionen präsent (Prommer & Linke, 2019). Bereits
Medien das symbolische System der Zweige- Lukesch (2004) sah die größten Unterschiede in
schlechtlichkeit reproduzieren und stützen, weil den Geschlechterbildern des Fernsehens im äuße-
„Realität“ von den Medien nicht nur abgebildet, ren Erscheinungsbild der gezeigten Frauen und in
sondern auch interpretiert und konstruiert wird. der Einbettung von Männern und Frauen in die
Zentrales Ziel ist es, soziale Konstruktionsprozesse Berufswelt begründet.
in und durch die Medien aufzuzeigen. Eine Studie zu „Familienbildern im Fernsehen“
Vorliegende nationale und internationale stellte in fiktionalen Formaten des deutschen
Studien, die eine Analyse von audiovisuellen Fernsehens zwar eine häufige Präsenz von starken,
Medieninhalten hinsichtlich der Quantität und berufstätigen und wohlsituierten Frauen (Han-
des thematischen Kontexts von Geschlechter- nover & Birkenstock, 2005) fest, in der Kinderer-
darstellungen vornehmen, stellen folgende ge- ziehung und bei der Haushaltsarbeit dominiert
nerelle Tendenzen fest (Appel, 2008): Mädchen jedoch das traditionelle Rollenmodell. Döveling
und Frauen sind unterrepräsentiert. Die gezeigten & Kick (2015) konnten neue Formen dieser alten
Frauen sind im Durchschnitt jünger als die Män- Festschreibungen finden. Zwar existiert mittler-
ner und haben oft eine sehr schlanke Statur. weile eine Vielfalt an Frauentypen in deutschen
Zudem werden Frauen und Männer überwiegend Fernsehserien, die aber oft als unerreichbarer
in eng definierten Geschlechterrollen gezeigt. For- Idealtypus der perfekt funktionierenden berufs-
schungsergebnisse zu einzelnen medialen Formen tätigen Frau, Mutter und (attraktiven) Partnerin
und Genres bestätigen diese Tendenzen. des Mannes gezeigt wird. Die sehr reale Doppel-
belastung vieler Frauen mit Kindern wird nicht
thematisiert.
Fernsehen Nationale wie internationale Untersuchungen
Seit Jahren belegen Analysen zur Geschlechterre- zu Genres des Reality-TV, insbesondere zu Ca-
präsentation im deutschen Fernsehen die generel- stingshows, stellen fest, dass in diesen gerade
le Unterrepräsentanz von Menschen weiblichen bei Heranwachsenden sehr beliebten Formaten
Geschlechts (u.a.: Küchenhoff, 1975; Weiderer, Geschlechterstereotype (oft in Form einer „post-
1993; Lukesch, 2004; Prommer & Linke, 2019), was feministischen Maskerade“ hinsichtlich eines
der faktischen Realität der Geschlechterverteilung „karrierefördernden“ Einsatzes weiblicher Attrak-
in der deutschen Bevölkerung widerspricht. tivität) dominieren und eine „natürliche“ Hetero-
Doch Frauen kommen nicht nur seltener im normativität vermittelt wird. Castingshows stellen
TV vor, auch ihre Marginalisierung im zuneh- für jugendliche Fans vielfältiges Material bereit,
menden Lebensalter ist gut dokumentiert. Schon die diese nutzen, um Alltagsprobleme zu bearbei-
bei Küchenhoff (1975) waren ältere Frauen we- ten und Geschlechtsidentitäten zu konstruieren.
sentlich weniger sichtbar als ältere Männer. In Hinsichtlich des dargestellten Ideals weiblicher
der Analyse von Prommer & Linke (2019) werden Attraktivität konnten Studien nachweisen, dass
Frauen bereits ab Mitte 30 zunehmend ausge- diese Formate zwar keine neuen Schönheitsi-
blendet: In dieser Altersgruppe kommen zwei deale erschaffen, vorhandene Einstellungen aber
Männer auf eine gezeigte Frau und ab 50 Jahren verstärken und vor allem bei Mädchen zu einer
10__BPJMAKTUELL 2/2020kritischen bis ablehnenden Haltung dem eigenen Figuren, die dem Konzept der „Girl Power“ fol-
Körper gegenüber führen können (Luca & Lenzen, gen), dennoch sind diese neuen Bilder häufig als
2011). ambivalent anzusehen, da sie sich wiederum ste-
reotyper Eigenschaftszuschreibungen bedienen.
So nehmen traditionelle Geschlechterstereotype
Kinderfernsehen im Kinderfernsehen zwar ab, aber meist nur, um
Das Fernsehen ist nach wie vor das Leitmedium durch neue ersetzt zu werden.
der Kinder. Umso besorgniserregender ist es,
dass sich auch hier seit Jahren konstante deut-
liche Ungleichheiten und Stereotypisierungen Kinderbilderbücher
finden lassen. 2007 wurde im Rahmen der Studie Bilderbücher sind ein wichtiger Indikator für
„Children’s Television Worldwide: Gender Re- soziale Normen und liefern den Rezipient*innen
presentation“ in 24 Ländern eine Stichprobe des Anhaltspunkte für akzeptiertes soziales Verhal-
jeweiligen Kinderfernsehens erhoben und ana- ten. Doch auch in diesen Inhalten finden sich
lysiert (Götz, 2013). Die Auswertung der Haupt- verzerrte Geschlechterbilder, die hinsichtlich der
figuren der fiktionalen Sendungen ergab, dass bereits früh einsetzenden Stereotypenbildung
im internationalen Kinderfernsehen auf eine bei Kindern wenig hilfreich sind. So konnten
weibliche Hauptfigur mindestens zwei männliche Studien zu Bilderbüchern (Anderson et al., 2006)
kommen. Die Analyse der Figuren förderte be- eine besonders starke Stereotypisierung der dort
kannte Geschlechterstereotype zutage: Weibliche dargestellten Elternfiguren belegen: Väter sind
Figuren sind signifikant häufiger blond und rot- signifikant unterrepräsentiert, entweder völlig
haarig, was dem Stereotyp des hilflosen und sexy „unsichtbar“ oder kaum in die Betreuung ihrer
gezeichneten Charakters entspricht. Bösewichte Kinder involviert, während vorrangig die Mütter
sind zumeist männliche erwachsene Dunkel- für das körperliche und emotionale Wohlbefinden
haarige, während bei den Frauen und Mädchen des Nachwuchses zuständig sind (Anderson &
der Typus der blonden oder rothaarigen „Zicke“ Hamilton, 2005).
vorherrscht. Eine Folgestudie (Götz et al., 2018) Eine Analyse der Repräsentation von Eltern-
bestätigte im wesentlichen diese Ergebnisse und rollen in 300 US-amerikanischen Kinderbilder-
konnte nur eine geringe Zunahme an diversen büchern, die zwischen 1902 und 2000 erschienen
Geschlechterbildern feststellen. sind, konnte unter Berücksichtigung des Erschei-
Besonders alarmierend sind die Befunde zum nungsjahres als Variable keine Entwicklung zu
unrealistischen Aussehen von Mädchenfiguren in egalitärem Rollenverhalten der dargestellten Vä-
animierten Formaten des Kinderfernsehens: Drei ter und Mütter feststellen (DeWitt et al., 2013). So
von vier Charakteren besitzen Körper, „die auf na- sind in den Bilderbüchern aus den 1970er Jahren
türliche Weise nicht erreichbar sind und keinesfalls die Väter zwar als „Kumpel“ und Betreuer ihrer
als wünschenswerte Vorbilder“ präsentiert werden Kinder anwesend, diese emanzipatorische Dar-
sollten (Götz & Herche, 2013). Es sind sexualisierte stellung nimmt jedoch in den danach folgenden
Körper kleiner Frauen, die unnatürlich schlank Jahren wieder ab und die Kinderbetreuung wird
sind und die sich durch extrem weibliche Kurven wiederum überwiegend von den Frauenfiguren
und unverhältnismäßig lange Beine auszeichnen. übernommen. Trotz tendenzieller Verbesserungen
Auch bei den Jungen und Männer herrschen in ist die Darstellung der Geschlechter weiterhin
der Zeichentrickwelt unnatürliche Körperbilder unausgeglichen zugunsten männlicher Figuren.
vor, wobei diese nicht so stark von natürlichen Sogar in Schweden, einem der gendergerech-
Körperproportionen abweichen wie bei den Mäd- testen Länder weltweit, dominieren männliche
chen. Figuren in den Bilderbüchern und Geschichten,
Die Hypersexualisierung von Mädchen im über die Lebenswelten von Mädchen wird kaum
Kinderfernsehen wird auch in der internationa- erzählt (Lynch, 2016).
len Forschungsliteratur breit diskutiert (Lemish,
2010). Lemish kommt nach Sichtung der vor-
handenen Literatur zu dem Ergebnis, dass zwar Bildschirm- und Computerspiele,
einige Stereotype aufgebrochen wurden (z.B. Social Media
durch das Aufkommen „aktiver“ und „schlauer“ So wie die traditionellen Medien Geschlechter-
Mädchencharaktere wie „Dora the Explorer“ oder klischees (re)produzieren können, bieten auch
11
BPJMAKTUELL 2/2020__digitale Spiele und Social Media solches Materi- se Ergebnisse sind umso erstaunlicher, als der
al an. Studien zeigen, dass in Computerspielen Journalismus zunehmend weiblicher wird, was
weibliche Figuren zwar zunehmend öfter, aber sich in Deutschland an der annähernd gleichen
im Vergleich zur sozio-demographischen Reali- Verteilung von Männern und Frauen in den
tät immer noch seltener als Männer und zudem Redaktionen (besonders im Fernsehjournalismus)
überwiegend in Nebenrollen oder als „Trophäe“ festmachen lässt.
der männlichen Figur auftreten (Klug, 2012). Seit vielen Jahren untersucht die kommuni-
Zudem unterliegen weibliche Körper oft einer kationswissenschaftliche Geschlechterforschung
Übersexualisierung: Ein prominentes Beispiel für die Berichterstattung über Politikerinnen in
die Überformung weiblicher Geschlechtsmerk- Nachrichtenmedien. Die Begriffe „Marginalisie-
male ist die Figur Lara Croft aus „Tomb Raider“. rung“ und „Trivialisierung“ sind kennzeichnend
Sie repräsentiert das Dilemma des binären Ge- für die Forschungsergebnisse aus den 1970er und
schlechterschemas (Kennedy, 2002) zwischen 1980er Jahren. Trivialisierung meint in diesem
sexistischer Zurschaustellung des Körpers und Kontext, dass die politische Rolle und Leistun-
einem tatkräftigen, unabhängigen weiblichen gen von Frauen tendenziell heruntergespielt
Rollenvorbild. Neben der Zementierung der und abgewertet werden. Trotz einer zunehmend
binären Geschlechterordnung wird insbesondere sachlicheren und differenzierten Darstellung von
bei männlichen Figuren Heterosexualität als ein Politikerinnen ab der Jahrtausendwende weisen
integraler Bestandteil ihrer Identität festgestellt Studien darauf hin, dass Rollenstereotype weiter-
(Klug, 2012). Digitale Spiele sind offensichtlich hin Bestand haben und subtil verwendet werden
männlich konnotiert und auch vorwiegend für (Holtz-Bacha, 2007; Pantti, 2007). Weise (2018)
diese Zielgruppe konzipiert. Zudem verhindern zeigt in ihrer Bildtypenanalyse junger Politike-
die wenigen Protagonistinnen, dass sich Mädchen rinnen auf, dass einige - aber nicht alle - gefun-
mit diesen Spielen beschäftigen, weil ihnen die denen Typen geschlechtlich konstruiert sind, was
angebotenen männlichen Rollen wenig Identifi- sie als einen Bedeutungsverlust des Faktors Ge-
kationsspielraum bieten. schlecht interpretiert.
Neuere Studien zur Selbstinszenierung in den
neuen Medien (MaLisa Stiftung, 2019; Döring Werbung
et al., 2016) zeigen zum einen, wie stark sich die Die internationalen Befunde zu Geschlechterdar-
Nichtsichtbarkeit von Mädchen und Frauen in stellungen in der Werbung gleichen überwiegend
digitalen Angeboten, wie etwa YouTube, fortsetzt. den Ergebnissen vorliegender deutscher Studien
Zum anderen machen sie auch deutlich, wie (Holtz-Bacha, 2011; Eisend, 2009; Furnham &
vor allem weibliche Heranwachsende fragwür- Paltzer, 2010). Die dargestellten Frauen verfügen
dige Geschlechterbilder aus der Populärkultur mittlerweile zwar über ein größeres Rollenreper-
(etwa aus Musikvideos, der Werbung oder von toire, aber „allein die Identifikation einer größeren
Influencer*innen) aufgreifen, um sie in ihrer per- Bandbreite von Frauenrollen bedeutet nicht, dass
sönlichen Selbstdarstellung, wie z.B. in Instagram, es die lange beklagten Geschlechterstereotypen und
distanzlos zu übernehmen. auch die subtilen Signale der Ordnung der Ge-
schlechter in der Fernsehwerbung nicht mehr gibt
Nachrichten und sich die Klagen nun erledigt haben“ (Venne-
Das Global Media Monitoring Project (GMMP), mann & Holtz-Bacha, 2011). Eine umfangreiche
das in Deutschland vom Journalistinnenbund international vergleichende Studie stellt ebenfalls
unterstützt wird, untersucht seit 1995 die Prä- eine abnehmende Geschlechterungleichheit fest,
senz von Frauen in den Nachrichten in über 100 bescheinigt der deutschen Werbung aber eine
Ländern der Welt. Die internationalen Ergebnisse Fortschreibung traditioneller Geschlechterrollen
der letzten Erhebung aus dem Jahr 2015 zeigen, (Matthes et al., 2016).
dass die Anzahl von Berichten mit namentlicher Zunehmend werden auch Männerdarstel-
Nennung von Frauen in Presse, Hörfunk und lungen in der Werbung dem Schönheitsdiktat
Fernsehen kontinuierlich angestiegen sind. Den- unterworfen, gekennzeichnet durch einen trai-
noch sind 3 von 4 genannten Personen in den nierten und muskulösen Körper. Ein Vergleich
Nachrichten männlichen Geschlechts; in den von Geschlechterinszenierungen zwischen der
Online- und Twitternachrichten wurde 2015 ein Jugend- und Elterngeneration (Derra et al., 2008)
ebenso niedriger Frauenanteil festgestellt. Die- konnte zeigen, dass die Anzeigenwerbung zwar
12__BPJMAKTUELL 2/2020einerseits auf veränderte gesellschaftliche Rah- und wirken sich auf bildliche und sprachliche
menbedingungen reagiert und mit traditionellen Muster aus, die diese Vorgaben weiter tradieren.
Geschlechterstereotypen weitgehend gebrochen Die Realitätsvorstellungen und Identitätsange-
hat. Es lassen sich aber signifikante Differenzen bote vom Geschlecht in den Medien liefern nicht
in den Darstellungsschemata der Generationen nur ein verzerrtes Spiegelbild der Gesellschaft,
feststellen: Besonders bei den dargestellten sondern verfestigen im ungünstigsten Fall proble-
Heranwachsenden (14- bis 19-Jährige) ist eine matische Geschlechterbilder (Prommer & Linke,
starke werbliche Zentrierung auf Körperlichkeit, 2019). Wissenschaftler*innen sehen deshalb die
Schlankheit und Schönheit festzustellen. So ist es Medien im Hinblick auf die Entwicklung einer
fraglich, ob die Auflösung der Geschlechterstereo- Geschlechtsidentität in einer besonderen Verant-
type in der Werbung ausschließlich positiv bewer- wortung, denn sie „fungieren als zentrale Vermitt-
tet werden kann. lungsinstanzen für Geschlechterrollenbilder in
der ganzen Bandbreite der Möglichkeiten, diese
auszugestalten“ (Stauber, 2006). Kinder sollten
Geschlechterstereotype, Identität nicht beiläufig aus den Medien lernen, was beim
jeweiligen Geschlecht als „normal“ oder als „ab-
und die Medien weichend“ zu bewerten ist. Stereotype sollten
Geschlechterstereotype sind kognitive Struk- nicht ihren Gedanken-, Gefühls- und Handlungs-
turen, die sozial geteiltes Wissen über die cha- spielraum einschränken, auch, weil sie entwick-
rakteristischen Merkmale von Männern und lungsbedingt solche Verallgemeinerungen und
Frauen enthalten. Sie sagen uns, wie Männer und Verzerrungen noch nicht selbst erkennen und
Frauen „zu sein haben“. Vor allem das soziale (und einordnen können.
kulturelle) Geschlecht ist dabei für die Identi- Aus diesen Gründen haben die schon seit
tätsfindung ausschlaggebend. Stereotype bilden Jahren geäußerten Forderungen nach einem
eine zentrale Komponente impliziter Geschlech- „geschlechtergerechten“, „geschlechtersen-
tertheorien („gender belief system“) und sind in siblen“ und „geschlechterreflektierten“ Handeln
hohem Maße änderungsresistent (Eckes, 2010). der Medien nichts an ihrer Aktualität verloren.
Dieses Wissen wird bereits im frühen Kindesalter Mediennutzer*innen, insbesondere Kinder und
erworben, setzt sich als Lernprozess bis in das Jugendliche, brauchen mediale Angebote, die
Erwachsenenalter fort und wird in Interaktionen ihnen eine eigenständige Interpretation ihres
ein Leben lang immer wieder hergestellt (Mühlen Geschlechts und der Geschlechterrolle ermög-
Achs, 2004). Renate Luca (2003) spricht von einer lichen: „Es geht nicht von einem „spezifischen“
„symbolischen Ordnung“, die für jedes Geschlecht Mädchen- oder Junge-Sein aus, sondern davon,
Regeln in Bezug auf Mode, Verhaltensweisen, dass Mädchen und Jungen in ihren vielfältigen
Verbote und Gebote bereitstellt. Interaktionen untereinander, mit Geschwistern,
Es gibt keine linearen und simplen Erklä- mit Eltern und pädagogischen Bezugspersonen,
rungen für die Wirkungen von Medien auf in ihren homo- und heterosozialen Bezügen, nicht
Rezipient*innen, das legen Erkenntnisse der zuletzt auch in ihrem Medienhandeln ihr Mädchen-
Medienwirkungsforschung nahe. Medien „produ- und Junge-Sein immer wieder (neu) herstellen“
zieren“ auch keine Geschlechtsidentitäten ihrer (Stauber, 2006). Medien können einen positiven
Rezipient*innen, sie stellen aber das Material Beitrag zur Geschlechterkonstruktion ihrer
dafür bereit und dienen als Ressource für das Nutzer*innen leisten, indem sie auf Sichtbarkeit
eigene Selbstbild und -verständnis (Mikos, 2007). achten und dazu beitragen, Klischees aufzubre-
Die Sozialisationsforschung zeigt, dass gerade für chen, stereotype Geschlechterrollen zu vermei-
Heranwachsende Medien ein integraler Bestand- den und ihren Nutzer*innen neue Perspektiven
teil beim Ausbilden von Geschlechter- und Gesell- auf Geschlecht in seiner Vielfalt zu eröffnen.
schaftsbildern sind, denn durch sie werden diese Medienmacher*innen bleiben also weiterhin mit
Bilder ausgewählt, geprägt und ausgehandelt. So der Herausforderung konfrontiert, der unend-
geben die Medien - neben anderen Sozialisations- lichen (Klischee-)Geschichte der Geschlechter ein
instanzen - den Interpretationsrahmen vor, was Ende zu bereiten und diversere Bilder anzubieten.
„echte“ Mädchen oder Frauen und „echte“ Jungen
oder Männer sind. Diese Geschlechterbilder ha-
ben Einfluss auf das Selbstbild ihrer Nutzer*innen
13
BPJMAKTUELL 2/2020__Lynch, Lisa (2016). Where are all the Pippis?: The under-repre-
Zur Person:
sentation of female main and title characters in children’s
Heike vom Orde (M.A.) ist seit 2001 für die Leitung literature in the Swedish preschool. Sex Roles 75, 422-433.
der wissenschaftlichen Literaturdokumentati- MaLisa Stiftung (Hrsg.) (2019). Weibliche Selbstinszenierung in
on des Internationalen Zentralinstituts für das den neuen Medien. Berlin.
Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) beim Baye- Matthes, Jörg et al. (2016). Gender-role portrayals in television
advertising across the globe. Sex Roles 75, 314-327.
rischen Rundfunk in München verantwortlich.
Prommer, Elizabeth & Linke, Christine (2019). Ausgeblendet.
Sie arbeitet u.a. den internationalen Forschungs-
Frauen im deutschen Fernsehen. Köln: Herbert von Halem
stand in Vorträgen und Publikationen auf. Verlag.
Weise Ramona (2018). Modern, mutig, muttihaft: Eine qualitative
Bildtypenanalyse junger Politikerinnen. In: Margreth Lünen-
Weiterführende Literatur: borg & Saskia Sell (Hrsg.) Politischer Journalismus im Fokus der
Journalistik (S. 113-138), Wiesbaden: Springer VS.
Döring, Nicola et al. (2016). How gender-stereotypical are selfies?
A content analysis and comparison with magazine ad-
1) Dieser Text ist eine überarbeitete und aktualisierte Fassung des
verts. Computers in Human Behavior, 55, 955-962.
Artikels „Geschlechterbilder in den Medien“ der Autorin, der
Döveling, Katrin & Kick, Isabel (2015): „Die Frau in der Serie. 2013 in der TelevIZIon 26(2) erschienen ist: http://www.izi.de/
Küche und Karriere: Alles easy oder ein Drahtseilakt?“. In: deutsch/publikation/televizion/26-2013-2/vomOrde_
Elizabeth Prommer, Martina Schuegraf und Claudia Wegener Geschlechterbilder_Medien.pdf
(Hrsg.). Medien – Gender – Screens (S. 39-64), Konstanz: UVK.
Dort finden sich auch die Nachweise der verwendeten
Götz, Maya et al. (2018). Whose story is being told? Results of an Literatur.
analysis of children‘s TV in 8 countries. Televizion, 31(E), 61-65.
14__BPJMAKTUELL 2/2020Sie können auch lesen