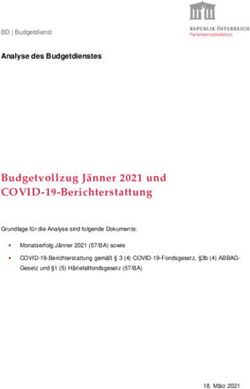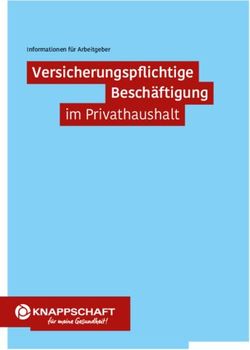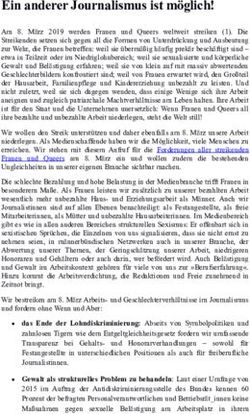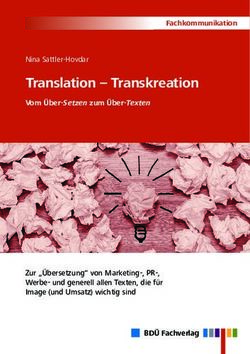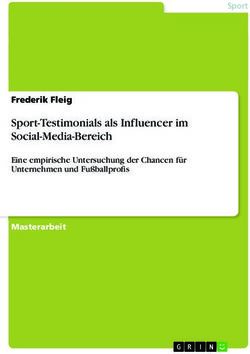Gesundheitsmanagement und Gesundheits okonomik
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomik Reihe herausgegeben von Steffen Fleßa, Lehrstuhl für ABWL, Universität Greifswald, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Die Gesundheitsökonomik ist die Lehre von der Beschreibung, Erklärung, Bewer- tung und Überwindung der Knappheit an Gesundheit durch Effizienz. Während sie sich traditionell eher den Strukturen und Prozessen des gesamten Gesund- heitssystems widmet, intendiert das Gesundheitsmanagement eine Übertragung der Erkenntnisse der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre auf die Betriebe des Gesundheitswesens, wobei bislang noch von keiner vollständig etablierten Bran- chenbetriebslehre des Gesundheitswesens gesprochen werden kann. Ziel muss es sein, das Gesundheitsmanagement als „Spezielle Betriebswirtschaftslehre“ zu eta- blieren, die dem Anspruch einer wissenschaftlichen Betriebsführung entspricht und sich konsistent aus den Erkenntnissen der stärker gesamtwirtschaftlich orien- tierten Gesundheitsökonomik ableitet. Die Schriftenreihe möchte einen Beitrag dazu leisten, Gesundheitsökonomik und Gesundheitsmanagement als interde- pendente Forschungsgebiete weiter zu entwickeln, die wissenschaftlich fundiert Handlungsanweisen für die Praxis entwickeln und von hoher Relevanz für Individuen und die Gesellschaft sind. Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/15970
Caroline Große Patientenorientierung im Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen Theoretische Grundlagen, gesetzliche Regelungen und eine sektorenübergreifende qualitative Studie
Caroline Große Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC) HHL Leipzig Graduate School of Management Leipzig, Deutschland Dissertation Universität Leipzig, 2021 ISSN 2523-7667 ISSN 2523-7675 (electronic) Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomik ISBN 978-3-658-34924-0 ISBN 978-3-658-34925-7 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-658-34925-7 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio- grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2021 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustim- mung der Verlage. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografi- sche Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral. Planung/Lektorat: Marija Kojic Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature. Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Geleitwort
Das Thema der Qualität in der Gesundheitsversorgung ist dermaßen wichtig,
dass sowohl der Gesetzgeber als auch Mediziner selbst sich diesem seit jeher
angenommen haben. Jedoch kommen zwei wesentliche Elemente immer wie-
der zu kurz: zum einen eine strikte Patientenorientierung und zum zweiten eine
sektorenübergreifende Qualitätsbetrachtung. Zu beiden Punkten kann die betriebs-
wirtschaftliche und hier im speziellen die Dienstleistungsforschung einen Beitrag
leisten mit ihrem etablierten Konzept der Kundenorientierung und der Betrachtung
von sogenannten Customer Journeys. Auch zur Generierung empirischer Evidenz
nutzt die betriebswirtschaftliche Forschung erprobte qualitative Forschungsme-
thoden, etwa die Inhaltsanalyse. Frau Großes Dissertation gewährt somit einen
empirischen ganzheitlichen Blick auf den horizontalen Weg des Patienten durch
die Sektoren des Gesundheitswesens. Der Vergleich der so abgeleiteten holis-
tischen Qualitätsdimensionen mit gegenwärtig eingesetzten Instrumenten liefert
unmittelbare Implikationen für eine verbesserte Qualitätsmessung, die sowohl
patientenorientiert als auch sektorenunabhängig ist.
Die vorliegende Arbeit ist für verschiedene Gruppen von Interesse. Der Prak-
tiker erhält einen fundierten und systematischen Überblick über Qualitätsmanage-
mentsysteme und die rechtlichen Grundlagen der Qualitätssicherung im deutschen
Gesundheitswesen. Er erhält jedoch auch wertvolle und unmittelbar umsetzbare
Vorschläge für eine verbesserte Qualitätsmessung von Gesundheitsdienstleistun-
gen. Der Wissenschaftler erfährt Schritt für Schritt an einem konkreten Beispiel,
wie eine qualitative Inhaltsanalyse systematisch durchgeführt wird und die Ergeb-
nisse gewinnbringend in Handlungsempfehlungen umgesetzt werden. Er bekommt
zudem Qualitätsdimensionen bei Gesundheitsdienstleistungen samt dazugehöri-
gen Items serviert, die in derzeit eingesetzten Messkonzepten zu kurz kommen.
Der interessierte Leser schließlich verschafft sich einen spannenden Einblick in
VVI Geleitwort
den klinischen Alltag, einen Blick hinter die Kulissen gleichsam, und erfährt, wie
gut es um die Gesundheitsversorgung in Deutschland bestellt ist und wie einfach
diese oftmals noch weiter verbessert werden könnte für den Patienten.
Univ.-Prof. Dr. habil. Dubravko RadićVorwort
Die vorliegende Dissertation wurde im Oktober 2020 bei der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig eingereicht und im April 2021
angenommen. Sie berücksichtigt den Stand der gesetzlichen Regelungen zu Qua-
litätsmanagement und Qualitätssicherung im deutschen Gesundheitswesen bis zur
Einreichung der Arbeit Anfang Oktober 2020.
Die Arbeit entstand in den letzten Jahren während meiner Tätigkeit an der Pro-
fessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Dienstleistungsmanagement der
Universität Leipzig. Während dieser Zeit trugen einige Menschen zum Entstehen
meiner Dissertation und darüber hinaus zu meiner persönlichen Entwicklung bei,
denen ich an dieser Stelle danken möchte.
Zunächst bedanke ich mich bei meinem Doktorvater und Erstgutachter Herrn
Professor Dr. Dubravko Radić, der immer an meine Arbeit glaubte, auch wenn
ich es zwischendurch mal nicht tat. Nach jeder Besprechung zu meinem Pro-
jekt ging ich mit einem guten Gefühl und neuer Motivation auf den nächsten
Streckenabschnitt des Marathonlaufs auf dem Weg zur fertigen Dissertation.
Frau Professorin Dr. Silvia Föhr danke ich für die Übernahme des Zweitgut-
achtens und ihre Wertschätzung meiner Arbeit. Bei Herrn Professor Dr. Matthias
Schmidt bedanke ich mich für die unkomplizierte Übernahme des Vorsitzes der
Promotionskommission und die kurzweilige Moderation der Verteidigung.
Außerdem danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen am Institut für Service
und Relationship Management der Universität Leipzig sowie am Fraunhofer IMW
(in chronologischer Reihenfolge ihres Auftretens):
Dr. Sandra Dijk, Dr. Sebastian Haugk, Robert Liebtrau, Dr. Marija Radić, Dr.
Romy Hilbig, Sergiy Makhotin, Dr. Michelle Wloka, Marco Hahn, Dr. Hareem
VIIVIII Vorwort
Arshad, Sebastian Hupfer, Juliane Theiß und Walli Hoffmann sowie den Sekre-
tärinnen Kirsten Lindner-Rösner und Janine Mörstedt und allen studentischen
Hilfskräften.
Euch allen danke ich dafür, dass ihr ein Stück des Weges mit mir gegangen
seid und dabei einen kleineren oder größeren Beitrag geleistet habt, damit ich
mich dahin entwickeln konnte, wo ich jetzt stehe. Hervorheben möchte ich meine
Kollegin Juliane Theiß, die mir auf den letzten Metern vor der Abgabe wertvolle
Hinweise zur Arbeit und später bei der Vorbereitung der Disputation gab, sowie
meine studentische Assistentin Cora Kleinsteuber (heute Cora Steininger), die
mich u. a. bei der Auswertung der Interviews unterstützte. Darüber hinaus danke
ich meiner Freundin Anja Köhler für Kommentare zur sprachlichen Form der
Arbeit.
Ein weiterer großer Dank gebührt den von mir befragten Patientinnen und
Patienten, ohne deren Mitwirkung diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Ich
danke ihnen für die Offenheit, ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse im
Verlauf ihrer Patient Journey mit mir zu teilen und mir einen Einblick in z. T.
sehr intime Gedanken zu geben. In diesem Zusammenhang danke ich auch dem
Krankenhaus, in dem ich die Interviews durchführen durfte, für den Zugang zu
seinen Patientinnen und Patienten sowie meinen Ansprechpartnerinnen für die
Unterstützung in den verschiedenen Phasen der qualitativen Studie. Herrn Dr.
Stefan Rädiker danke ich für wertvolle Hinweise zur Auswertung der Daten.
Nicht zuletzt danke ich meiner Familie, d. h. meinen Eltern, meinen Großeltern
und meiner verstorbenen Oma, die stets mit Rat und Tat zur Seite stehen, egal
welche Herausforderung mir das Leben auch stellt. Alex und Clara danke ich
einfach nur dafür, dass es sie gibt.
Leipzig Dr. Caroline Große
im Juni 2021Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Hintergrund, Problemstellung und Relevanz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Zielsetzung, Forschungsfragen und Aufbau der Arbeit . . . . . . . . 3
2 Qualitätsmanagement und Qualitätsmanagementsysteme . . . . . . . . . 7
2.1 Grundlagen, Begriff und Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Prinzipien des Qualitätsmanagements für Dienstleistungen
nach Bruhn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Kaizen und KVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4 Prozessorientiertes Qualitätsmanagement mit der
Normenreihe ISO 9000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.5 Six Sigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.6 Lean Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.7 Lean Six Sigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.8 Total Quality Management und Total Quality Service . . . . . . . . . 26
2.9 Excellence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.10 Gemeinsamkeiten der vorgestellten theoretischen Konzepte . . . . 34
3 Relevante Entwicklungen und Herausforderungen im
Gesundheitswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.1 Qualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2 Wettbewerb und Ökonomisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.3 Schnittstellenprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4 Status Quo der gesetzlichen Regelungen für externe
Qualitätssicherung und internes Qualitätsmanagement im
deutschen Gesundheitswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.1 Sektorenübergreifende Regelungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
IXX Inhaltsverzeichnis
4.2 Stationärer Sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.3 Ambulanter Sektor: vertragsärztliche und
vertragszahnärztliche Versorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.4 Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.5 Rehabilitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.6 Zusammenfassung, Synthese und Zwischenfazit:
Theoretische Grundlagen des Qualitätsmanagements
und Status Quo der gesetzlichen Regelungen für
Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement im
deutschen Gesundheitswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5 Qualitätssicherung im Gesundheitswesen auf dem Weg zu
einer erhöhten Patientenorientierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.1 Begriff der Patientenorientierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.2 Aktuelle Entwicklung der Patientenorientierung in der
Qualitätssicherung im deutschen Gesundheitswesen . . . . . . . . . . 91
6 Empirische Untersuchung: Erfahrungen, Erlebnisse und
Verbesserungsvorschläge von Patientinnen und Patienten nach
Operation im Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie – eine
sektorenübergreifende qualitative Studie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.1 Vorgehensweise und Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.1.1 Qualitative Interviews als Datengrundlage . . . . . . . . . . . 98
6.1.2 Auswahl des Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.1.3 Datenschutz und ethische Fragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.1.4 Vorüberlegungen und Vorannahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.1.5 Sampling und Ansprechen möglicher
Interviewpersonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.1.6 Durchführung der Interviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.1.7 Fragestellungen in den Interviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.1.8 Transkription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.1.9 Phasen der inhaltsanalytischen Auswertung . . . . . . . . . . 118
6.1.10 Studiengüte, Hinweise zum Umgang mit
Quantifizierungen und zur Verallgemeinerbarkeit
der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6.2 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.2.1 Erleben der Patient Journey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.2.2 Grundlegendes zur Struktur der Interviews –
relevante Themen im Vergleich persönlicher
Interviews mit den telefonischen Interviews . . . . . . . . . . 143Inhaltsverzeichnis XI
6.2.3 Eine fiktive orthopädisch-unfallchirurgische
Patient Journey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
6.2.3.1 Rund um die Aufnahme in das
Krankenhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
6.2.3.2 Rund um die Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
6.2.3.3 Während des Aufenthalts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
6.2.3.4 Rund um die Entlassung: Vorbereitung
der Entlassung, Entlassung und
Übergang in die anschließende
Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6.2.3.5 Nach der Entlassung: Rehabilitation und
ambulante Nachsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
6.2.4 Essenz der geführten Interviews: Eine
unbefriedigende Patient Journey bei einer
geplanten Operation am Beispiel des Einsatzes
eines künstlichen Hüftgelenks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
6.2.5 Essenz der geführten Interviews: Eine optimale
Patient Journey bei einer geplanten Operation
am Beispiel des Einsatzes eines künstlichen
Hüftgelenks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
6.2.6 Besonderheiten der Patient Journey eines Notfalls
im Vergleich zu geplanten Aufenthalten . . . . . . . . . . . . . 194
6.2.7 Management Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
6.2.8 Befinden der Befragten im Verlauf der Patient
Journey: Emotionen, körperliche Empfindungen
und wahrgenommener Gesundheitszustand . . . . . . . . . . . 199
6.2.9 Auswahl der Einrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
6.2.10 Beurteilung des Ergebnisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
6.2.11 Zufriedenheit, Patientenbindung und
Weiterempfehlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
6.2.12 Mitmenschen im Zimmer und in der Einrichtung
allgemein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
6.3 Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
6.3.1 Bezug zu vorhandenen Forschungsergebnissen . . . . . . . 217
6.3.2 Patientenzufriedenheitsbefragung des
Krankenhauses in Relation zur vorliegenden
qualitativen Studie und darauf basierender
Entwurf eines Fragebogens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
6.3.3 Limitationen und kritische Würdigung . . . . . . . . . . . . . . 230XII Inhaltsverzeichnis
6.3.4 Weiterführender Forschungsbedarf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
7 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Abkürzungsverzeichnis
AOK Allgemeine Ortskrankenkasse
AQUA Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im
Gesundheitswesen
ASQ American Society for Quality
BAR Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
CEO Chief Executive Officer
CTQ Critical to Quality Characteristics
DEGEMED Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation
deQus Deutsche Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Suchtthe-
rapie
DIN Deutsches Institut für Normung
DMADV Define – Measure – Analyze – Design – Verify
DMAIC Define – Measure – Analyze – Improve – Control
DPMO Defects per Million Opportunities
DRG Diagnosis Related Group (Fallpauschale)
DRV Deutsche Rentenversicherung
EFQM European Foundation for Quality Management
EN Europäische Norm(en)
EPA Europäisches Praxisassessment
FEISA Forschungs- und Entwicklungsinstituts für das Sozial- und
Gesundheitswesen Sachsen-Anhalt
G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss
GKV Gesetzliche Krankenversicherung
HCAHPS Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and
Systems
XIIIXIV Abkürzungsverzeichnis
HoQ House of Quality
IQM Initiative Qualitätsmedizin
IQTIG Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen
IQWiG Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
ISO International Organization for Standardization
KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung
KTL Klassifikation therapeutischer Leistungen
KTQ Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
KV Kassenärztliche Vereinigung
KVM Kontinuierliches Verbesserungsmanagement
KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
KZV Kassenzahnärztliche Vereinigung
MDK Medizinischer Dienst der Krankenkassen
MIT Massachusetts Institute of Technology
PCI Percutaneous coronary intervention (Perkutane Koronarinterven-
tion)
PDCA Plan – Do – Check – Act
PDPC Process Decision Program Chart
PEQ Patients’ Experience Questionnaire
PKV Private Krankenversicherung
PPM Parts per Million
PREM Patient Reported Experience Measures
PROM Patient Reported Outcome Measures
PTV Pflege-Transparenzvereinbarung
QDVS Qualitätsdarstellungsvereinbarung
QEP Qualität und Entwicklung in Praxen
QFD Quality Function Deployment
QM Qualitätsmanagement
QMS Qualitätsmanagementsystem
QS Qualitätssicherung
QSR Qualitätssicherung mit Routinedaten
RADAR required Results – plan and develop Approaches – Deploy
approaches – Assess and Refine approaches and deployment
RL Richtlinie
SERVQUAL Service Quality (Dienstleistungsqualität)
SGB Sozialgesetzbuch
SIPOC Supplier – Input – Prozess – Output – Customer
SPC Statistical Process Control (Statistische Prozesskontrolle)
TPS Toyota-ProduktionssystemAbkürzungsverzeichnis XV TQM Total Quality Management TQS Total Quality Service TRIZ Theorie des erfinderischen Problemlösens VOC Voice of Customer WIdO Wissenschaftliches Institut der AOK z-pms Zahnärztliches Praxis-Management-System
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 2.1 Prinzipien des Qualitätsmanagements für
Dienstleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Abbildung 2.2 Kaizen-Schirm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Abbildung 2.3 PDCA-Zyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Abbildung 2.4 Six Sigma Kurve mit 1,5 σ Shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Abbildung 2.5 Toyota-Produktions-System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Abbildung 2.6 EFQM-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abbildung 2.7 RADAR-Bewertungslogik des EFQM-Modells . . . . . . . 33
Abbildung 6.1 Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden
Inhaltsanalyse nach Kuckartz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Abbildung 6.2 Auszug aus einem mit MAXQDA bearbeiteten
Interview mit Visualisierung der Codierungen . . . . . . . . 125
Abbildung 6.3 Kategoriensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Abbildung 6.4 Aussagen nach Phasen und Dokumentgruppen,
Berechnung der Symbolgröße bezieht sich auf die
Spalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Abbildung 6.5 Aussagen nach Themen (Hauptkategorien) und
Dokumentgruppen, Berechnung der Symbolgröße
bezieht sich auf die Spalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Abbildung 6.6 Aussagen der Hauptkategorie Personal nach
Dokumentgruppen, Berechnung der Symbolgröße
bezieht sich auf die Spalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Abbildung 6.7 Aussagen der Hauptkategorie Kernleistung nach
Dokumentgruppen, Berechnung der Symbolgröße
bezieht sich auf die Spalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
XVIIXVIII Abbildungsverzeichnis
Abbildung 6.8 Aussagen der Hauptkategorie Organisation und
Abläufe nach Dokumentgruppen, Berechnung der
Symbolgröße bezieht sich auf die Spalte . . . . . . . . . . . . 147
Abbildung 6.9 Aussagen der Hauptkategorie Informationen und
Aufklärung nach Dokumentgruppen, Berechnung
der Symbolgröße bezieht sich auf die Spalte . . . . . . . . . 147
Abbildung 6.10 Aussagen der Hauptkategorie Tangibles nach
Dokumentgruppen, Berechnung der Symbolgröße
bezieht sich auf die Spalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Abbildung 6.11 Gegenüberstellung der Verteilung der Kategorie
Informationen und Aufklärung bei geplanten
Fällen (12 Befragte) und Notfällen (13 Befragte),
Berechnung der Symbolgröße bezieht sich auf die
Spalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Abbildung 6.12 Aussagen zum Befinden der Befragten nach Phasen . . . 200Tabellenverzeichnis
Tabelle 1.1 Ziel der Arbeit und Forschungsfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tabelle 2.1 Anzahl der Fehler für ausgewählte Sigma-Niveaus . . . . . . . 17
Tabelle 2.2 Haupt- und Teilkriterien der Bereiche Ausrichtung
und Realisierung des EFQM-Modells 2020 . . . . . . . . . . . . . 32
Tabelle 2.3 Überblick über die theoretischen Grundlagen der
vorgestellten Qualitätsmanagement-Konzepte . . . . . . . . . . . 35
Tabelle 2.4 Übersicht über die sich wiederholenden Grundsätze . . . . . 53
Tabelle 4.1 Zusammenfassung des Status Quo der gesetzlichen
Regelungen für externe Qualitätssicherung und
internes Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen . . . . . 81
Tabelle 4.2 Synthese: Wiederkehrende Grundsätze des
Qualitätsmanagements und externe Qualitätssicherung . . . 85
Tabelle 6.1 Übersicht über die Verteilung der Teilnehmenden
nach Kriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Tabelle 6.2 Gesamtheit aller im Jahr 2016 von den beiden
Stationen entlassenen Personen nach Geschlecht und
Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Tabelle 6.3 Im Jahr 2016 auf den beiden Stationen elektiv
behandelte Personen nach Geschlecht und Alter . . . . . . . . . 112
Tabelle 6.4 Im Jahr 2016 auf den beiden Stationen aufgrund
eines Notfalls behandelte Personen nach Geschlecht
und Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Tabelle 6.5 Kategoriendefinition am Beispiel der Subkategorie
Tagesablauf aus der Hauptkategorie Organisation
und Abläufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
XIXXX Tabellenverzeichnis
Tabelle 6.6 Subkategorien der Hauptkategorie Personal und
Anzahl der Codierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Tabelle 6.7 Subkategorien der Hauptkategorie Kernleistung und
Anzahl der Codierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tabelle 6.8 Subkategorien der Hauptkategorie Organisation und
Abläufe und Anzahl der Codierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Tabelle 6.9 Subkategorien der Hauptkategorie Informationen und
Aufklärung und Anzahl der Codierungen . . . . . . . . . . . . . . . 140
Tabelle 6.10 Subkategorien der Hauptkategorie Tangibles und
Anzahl der Codierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Tabelle 6.11 Subkategorien der Querschnittskategorie Befinden der
Befragten und Anzahl der Codierungen . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Tabelle 6.12 Subkategorien der Querschnittskategorie Ergebnis
und Anzahl der Codierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Tabelle 6.13 Subkategorien der Querschnittskategorie besprochene
Einrichtungen des Gesundheitswesens und Anzahl der
Codierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Tabelle 6.14 Entwurf des Fragebogens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Sie können auch lesen