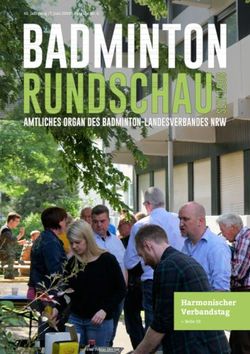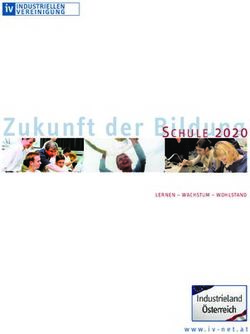"If I die, you can eat me" - Kannibalismus als Motiv im Spielfilm Dominik Schrey
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
„If I die, you can eat me“
Kannibalismus als Motiv im Spielfilm
Dominik Schrey
1. Kannibalismus in der Forschungsgeschichte
Angehörige der eigenen Spezies zu verspeisen gilt gemeinhin als das größte
Tabu der menschlichen Zivilisation. Dennoch scheint Kannibalismus in frü-
heren Zeiten und fernen Ländern eine weit verbreitete und nahezu alltägliche
Praxis gewesen zu sein – zumindest sofern man gewillt ist, den verschiede-
nen Erwähnungen und Beschreibungen des Phänomens in historischen Quel-
len von Herodot über die Reiseliteratur der Neuzeit bis hin zur Ethnologie des
frühen 20. Jahrhunderts Glauben zu schenken.
Nicht nur in der Antike wurde den so genannten Barbaren, die außerhalb
der Grenzen der „zivilisierten“ Welt siedelten, kannibalisches Verhalten un-
terstellt. Dass solche Zuschreibungen in vielen Fällen mehr mit Legitimati-
onsstrategien für die rücksichtslose Unterwerfung und Unterdrückung jener
Völker zu tun hatten als mit historischen Fakten, ist nahe liegend, denn tat-
sächlich scheint kein anderer Vorwurf geeigneter zu sein, um eine bestimmte
Gruppe oder eine gesamte Nation pauschal als Unmenschen zu disqualifizie-
ren, als der der Anthropophagie.
Deshalb wurden die Menschenfresser auch keineswegs nur in fernen Län-
dern, sondern immer wieder auch innerhalb der eigenen Gesellschaft gesucht
und gefunden, meist in ohnehin unter Generalverdacht stehenden Minder-
heiten: so herrschte zur Zeit des römischen Geschichtsschreibers Tacitus die
Meinung, dass die Christen Inzest und Kannibalismus begingen – später be-
haupteten die Christen selbst ähnliches nicht nur über die Heiden, sondern
zunehmend auch über die Anhänger der diversen Splittergruppen, die sich
vom Dogma der Hauptkirche abzuspalten begannen.
In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen zeichnet
sich aufgrund dieser Tatsachen und dem Fehlen glaubwürdiger Augenzeugen-
berichte1 immer mehr eine „Rückwendung vom Bild des Kannibalen zu dem,
der es zeichnet“2, ab. Nachdem bereits in den 1960er Jahren die Authentizität
1
Zur Problematik dieser Glaubwürdigkeit vgl. Christian Moser: Kannibalische Katharsis.
Literarische und filmische Inszenierungen der Anthropophagie von James Cook bis Bret
Easton Ellis, Bielefeld 2005, S. 27f.
2
Daniel Fulda: Unbehagen in der Kultur, Behagen an der Unkultur. Ästhetische und wissen-
schaftliche Faszination der Anthropophagie. In: Das andere Essen. Kannibalismus als Motiv
und Metapher in der Literatur, hg. von Daniel Fulda/Walter Pape, Freiburg im Breisgau
551bestimmter Ausgrabungsfunde, die zunächst als Beweis für prähistorische
Anthropophagie angesehen wurden, von verschiedenen Forschern in Frage
gestellt wurde, veröffentlichte 1979 der amerikanische Ethnologe William
Arens eine Studie mit dem Titel „The Man-Eating Myth: Anthropology and
Anthropophagy“3, in der er zu beweisen versuchte, dass sämtliche Berichte
über kannibalische Rituale und Praktiken – prähistorisch wie historisch – ein-
zig der Phantasie ihrer Autoren entsprungen seien.
Arens’ These spaltet bis heute die Ethnologen in zwei Lager, wobei zuletzt
wieder jene Gruppe, die glaubt, mit Hilfe archäologischer Funde zumindest
für prähistorische Zeit Kannibalismus nachweisen zu können, die Oberhand
gewinnt.4 Unabhängig davon zeigt die Diskussion jedoch eines sehr deutlich:
Selbst wenn es Kannibalismus bei bestimmten Völkern oder zu bestimm-
ten Zeiten tatsächlich gab – alltäglich waren solche Praktiken an keinem Ort
und zu keiner Zeit. Umso erstaunlicher erscheint es, was für eine Rolle die
Anthropophagie in Mythen, Literatur und Kunst spielt: neben der bereits
erwähnten Reiseliteratur und den frühen historischen Berichten finden sich
Beschreibungen von Anthropophagie sowohl in den Mythen und Märchen
verschiedenster Kulturkreise als auch in zentralen Werken der Weltliteratur.5
Doch während es über all diese kulturellen Manifestationen des Motivs vor
allem in den letzten Jahren reichhaltige Forschungsliteratur aus den verschie-
denen geisteswissenschaftlichen Disziplinen gibt6, wird der Film, der sich –
was wenig verwunderlich ist – ebenfalls bereits früh des Themas annahm, im
wissenschaftlichen Diskurs weitgehend außer Acht gelassen bzw. lediglich
pflichtbewusst erwähnt.
Ziel dieses Beitrags ist deshalb die Analyse der vorherrschenden Motivtra-
ditionen, die sich grob in drei Gruppen unterteilen lassen: Fast alle in Filmen
dargestellten kannibalischen Praktiken haben entweder eine primär alimentä-
re („Hungeranthropophagie“), rituelle oder pathologische Dimension. Mehr
oder weniger deutlich ist dabei immer auch eine allegorische Dimension vor-
handen, wobei die „wahren Kannibalen“ letztlich interessanterweise meist
2001, S. 7-50, hier S. 10.
3
William Arens: The Man-Eating Myth. Anthropology & Anthropophagy. Oxford/New York
1979.
4
Vgl. Fulda: Unbehagen in der Kultur, S. 10. (Anm. 8)
5
Vgl. Christian W. Thomsen: Menschenfresser in Mythen, Kunst und fernen Ländern. Erfts-
tadt 2006, S. 39.
6
Besonders seit Mitte der 1990er Jahre erscheint eine Vielzahl von Arbeiten zum Thema.
Ausführliche Untersuchungen zu Kannibalismus in Literatur und Kunst finden sich unter
anderem bei Thomsen: Menschenfresser in Mythen, Kunst und fernen Ländern; Moser:
Kannibalische Katharsis sowie bei Fulda/Pape: Das andere Essen.
552nicht diejenigen sind, die tatsächlich menschliches Fleisch verspeisen.
Zentral ist den für diesen Beitrag ausgewählten Filmen zudem die Fra-
ge nach dem Grad der Transgression, die hier eine Grenzüberschreitung im
doppelten Sinn ist: Gleichzeitig mit den Grenzen des individuellen Körpers,
die der Kannibale durch die Einverleibung eines anderen, fremden Körpers
ultimativ übertritt, wird auch eine gesellschaftliche Demarkationslinie über-
schritten. Der Kannibale – besonders der pathologische – ist ein Fremdkör-
per, den die Gesellschaft isolieren und ausstoßen muss, um ihr Fortbestehen
sicherzustellen. Implizit wird mit dem Kannibalismusdiskurs also immer
auch die Frage verhandelt, wie mit dem Fremden und Andersartigen umzu-
gehen ist.
2. Hungeranthropophagie
Das Essen von Menschenfleisch zur Sicherung des eigenen Überlebens in
einer existentiellen Notsituation stellt die einzige Form von Kannibalismus
dar, die unter bestimmten Bedingungen gesellschaftlich nicht sanktioniert
wird und als entschuldbar gilt. Entscheidend ist dabei vor allem die Frage, ob
aus Hunger gemordet wird oder ob bereits verstorbene Menschen verspeist
werden. Beide Fälle finden sich in einigen Filmen höchst unterschiedlicher
Qualität. Betrachtet man diese Filme, erscheint eine weitere Differenzierung
in zwei eigene Motivtraditionen sinnvoll, die sich vor allem durch das Aus-
maß der jeweiligen Notsituation unterscheiden.
2.1 Eingeschränkte Hungeranthropophagie
Die klassischen Geschichten von Hungeranthropophagie und ihre Verar-
beitungen im Medium Film bilden die erste dieser beiden Unterkategorien:
die (durch Raum, Zeit und beteiligte Personen) eingeschränkte Hungeranth-
ropophagie.
Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel für diese Kategorie ist die bereits
zweimal verfilmte Geschichte des Flugzeugabsturzes über den Anden im Jahr
1972.7 An Bord der Maschine befinden sich die Rugby-Nationalmannschaft
Uruguays und einige ihrer Angehörigen. Etwa die Hälfte der 45 Passagiere
stirbt bei dem Absturz, der Rest findet sich gestrandet in einer lebensfeind-
lichen Eiswüste nahezu komplett ohne natürliche Nahrungsquellen wieder.
7
Supervivientes de los Andes (Mexiko 1976, Regie : René Cardona, dt. Titel: Überleben) und
Alive (USA 1993, Regie: Frank Marshall, dt. Titel: Überleben!).
553Nach langem Zögern ringen sich die Überlebenden dazu durch, ihren Ekel zu
überwinden und das Fleisch der Verstorbenen zu essen, um selbst überleben
zu können (Abb. 1).
Abb. 1: Hungeranthropophagie in Frank Marshalls Alive
Der unbedingte Überlebenswille der durch die Extremsituation eng zusam-
mengewachsenen Gemeinschaft steht im Mittelpunkt beider Filme, vor allem
der amerikanischen Neuverfilmung des Stoffes von 1993 gelingt es dabei,
den Akt des Kannibalismus nicht nur als notwendige Konsequenz einer an-
sonsten auswegslosen Situation darzustellen, sondern sogar zum „triumph of
the human spirit“ zu stilisieren.8
Am Ende des Films gelingt es den Gestrandeten schließlich, sich aus eige-
ner Kraft aus ihrer Situation zu befreien und Hilfe zu organisieren, ausschlag-
gebend für den Erfolg ist das bedingungslose Vertrauen der Protagonisten in
Gott und vor allem Teamwork bis hin zur Selbstaufopferung für das Wohl
der Gruppe. Dies gipfelt in einer Schlüsselszene des Films, in der einer der
Passagiere zu den anderen sagt: „if I die, you can eat me.“ Auf diese Weise
wird der Kannibalismus, der generell mit Wildheit und asozialem Verhalten
verbunden wird, komplett umgedeutet und bekommt eine kathartische, sogar
messianische Dimension. Gezielt werden hier Assoziationen an die christli-
che Transsubstantiationslehre geweckt: „Und das Brot, das ich geben werde,
das ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt.“ (Joh.
6,51) Und: „Wer mein Fleisch issset und trinket mein Blut, der bleibt in mir
8
So lautet eine der offiziellen Werbezeilen des Films, auf deren Übersetzung ins Deutsche
wohl aufgrund der Ähnlichkeit zum Titel von Leni Riefenstahls NSDAP-Parteitagsfilm
verzichtet wurde.
554und ich in ihm.“ (Joh. 6,56) Dass sich an Bord des Flugzeugwracks keine
Getränke außer Rotwein befinden, verstärkt diesen Eindruck noch zusätzlich.
Die beim Absturz und im Laufe des anschließenden Überlebenskampfes Ge-
storbenen – und Verspeisten – werden durch ihr Opfer wieder dem Gruppen-
körper einverleibt, in dem sie qua Erinnerung präsent bleiben. Der Kanniba-
lismus wird so zu einem überdeterminierten Akt der Gruppenkonstitution.
Christine W. Brinckmann schreibt in einer der wenigen Arbeiten über Kan-
nibalismus im Film: „Wer in unserer Gesellschaft dazu schreitet, Menschen
zu verzehren, ist aus der Gemeinschaft ausgestoßen, ganz gleich, ob ihn die
Not dazu getrieben hat oder eine perverse Lust.“9 Dass sich diese Aussage
nicht in solch grundsätzlicher Form halten lässt, wird in der Hollywoodpro-
duktion überdeutlich. Hier werden nicht in üblicher Katastrophenfilmmanier
tragische Einzelschicksale dargestellt, sondern charakterstarke Vorbilder, die
zum Teil überlebensgroß gezeichnet werden: eine Gruppe junger Sportler, die
in einer Extremsituation lernt, was wahrer Teamgeist bedeutet, und dass man
seine eigenen Grenzen genauso wie die der Natur überwinden kann, wenn
man es nur energisch genug versucht und dabei den Glauben an Gott und sich
selbst nicht verliert. Menschlich zu bleiben beim eigentlich unmenschlichen
Akt des Verspeisens der Leichen verstorbener Freunde und Familienangehö-
riger wird zum Prüfstein in einer als Rite de Passage inszenierten Geschichte.
Um nicht Gefahr zu laufen, die als Kollektiv auftretenden Protagonisten trotz
all ihrer Reflexionen über die Richtigkeit ihres Handelns ikonografisch in die
Nähe der Darstellungen menschenfressender Wilder oder Monster zu stel-
len, wird der kannibalische Akt selbst sehr zurückhaltend inszeniert – ganz
im Gegensatz zur früheren mexikanischen Verfilmung desselben Stoffs, die
gerade diesen Aspekt besonders betont und deshalb als eine nur „auf Sen-
sationslust und Schauder zielende Studiobilligproduktion mit schamlosen
Ekeleffekten“10 gilt.
In der amerikanischen Version spielt sich vor dem Absturz des Flugzeugs
an Bord desselben eine interessante Szene ab, die programmatisch für den
Umgang des Films mit dem Kannibalismusmotiv ist: der Zuschauer sieht ein
Mädchen, das aus dem Fenster der Maschine die schneebedeckten Berggip-
fel betrachtet und ihre Mutter auffordert, dasselbe zu tun, da die Aussicht so
schön sei, doch die Mutter antwortet nur: „don’t make me look at the moun-
tains, Susanna, the mountains look like big teeth.“ Dies ist nicht nur ein Sus-
9
Christine N. Brinckmann: Unsägliche Genüsse. In: Montage/AV. Zeitschrift für Theorie und
Geschichte audiovisueller Kommunikation 10 (2001), H. 2, S. 77-94, hier S. 79.
10
O. V.: Überleben! In: Lexikon des internationalen Films. Das komplette Angebot in Kino
und Fernsehen seit 1945. 21000 Kurzkritiken und Filmographien, hg. von Klaus Brüne,
Hamburg 1991, S. 3922.
555pense erzeugender Vorausgriff auf das spätere Geschehen, das dem Zuschau- er zumindest in Grundzügen ohnehin bekannt ist, sondern ein Verfahren, mit dem schon im Voraus der spätere Kannibalismus gerechtfertigt wird, denn ei- gentlich kannibalisch verhält sich der dem Film inhärenten Logik nach nicht der überlebenswillige Mensch, sondern die Natur, deren grausamem Gesetz des Fressen-und-Gefressen-Werdens er sich in dieser Situation unterwerfen muss. 2.2 Uneingeschränkte oder globale Hungeranthropophagie Diese Motivvariation findet sich vor allem in Filmen, die dem Genre der Science Fiction zugeordnet werden. Das Ausgangsszenario ist dabei in den meisten Fällen sehr ähnlich: Aufgrund postnuklearer Verseuchung oder an- derer vergleichbar verheerender Umwelteinflüsse fallen die meisten der na- türlichen Nahrungsquellen aus und die Überlebenden haben mit einer Ernäh- rungskrise von globalen Ausmaßen fertig zu werden. Um das Fortbestehen der Menschheit zu sichern, wird das Kannibalismustabu schließlich aufge- hoben. Zwei Beispiele aus dem Bereich der Science Fiction sollen die unter- schiedlichen Möglichkeiten dieser Motivtradition verdeutlichen. In Richard Fleischers Soylent Green (USA 1973, dt. Titel: Jahr 2022... die überleben wollen) findet der von Charlton Heston gespielte Polizist Thorn am Ende der Filmhandlung heraus, dass das angebliche Planktonkonzentrat Soylent Green, mit dem die Welternährung gewährleistet werden soll und das in Form von grünen quadratischen Chips verkauft wird, in Wahrheit in den riesigen Krematorien New Yorks, dessen Stadtgrenzen sich bis nach Phila- delphia verschoben haben, direkt aus den Leichen Verstorbener hergestellt wird. Alle im 20. Jahrhundert üblichen Speisen sind im Jahr 2022 ein Luxus, den sich nur noch eine kleine Elite leisten kann. Die letzten gesprochenen Sätze des Films lauten „The Ocean’s dying, Plankton’s dying. […] It’s people. Soylent Green is made out of people. They‘re making our food out of people. Next thing they‘ll be breeding us like cattle for food. […] We’ve gotta stop them somehow!“ Schlagartig rückt damit das Thema Kannibalismus in den Mittelpunkt der Handlung, das bis zu diesem Zeitpunkt – oder zumindest bis zu Thorns Entdeckung im letzten Viertel des Films – vollkommen gefehlt hat. Durch Thorns Aufdeckung des Skandals bekommt der ganze Film eine neue Dimen- sion. Allerdings ist hervorzuheben, dass diejenigen, die das Soylent Green konsumieren, nicht wissen, dass sie dadurch zu Kannibalen werden – eine Spielart des Kannibalismusmotivs, die auch in vielen anderen Filmen vari- iert wird und sich bereits in der griechischen Mythologie findet, z. B. wenn 556
Atreus seinem verhassten Bruder Thyestes dessen eigene Kinder als Mahlzeit
vorsetzt.
Fraglich ist nun, ob von Kannibalismus im eigentlichen Sinne überhaupt
die Rede sein kann, wenn der Verzehrende sich der Herkunft der Speise über-
haupt nicht bewusst ist. In Soylent Green ist zudem der Abstraktionsgrad so
hoch bzw. keinerlei Ähnlichkeit zwischen Teilen des menschlichen Körpers
und den titelgebenden grünen Quadraten mehr zu erkennen, sodass das affek-
tive Potential der Darstellung äußerst gering ausfällt, d. h. auch hier sind die
tatsächlichen Menschenfresser selbst nicht negativ konnotiert. Die eigentliche
Grenzüberschreitung, das wesentliche Merkmal des Kannibalismusmotivs,
findet dann auch an anderer Stelle statt: Hier sind die „wahren Kannibalen“
nicht die unwissenden Konsumenten, sondern die wissenden Produzenten,
diejenigen, die für die Aufrechterhaltung der eigenen privilegierten Lebens-
weise einen ebenso subtilen wie perfiden Kreislauf der Ausbeutung instal-
liert haben. Die ohne Hoffnung auf Zukunft vor sich hin vegetierende Masse
der Underdogs wird an sich selbst verfüttert und – hierin liegt die größte
Perversion dieses Systems – gerade dadurch davon abgehalten, sich gegen
die ungerechten Zustände zu wehren. Solange die Versorgung mit Soylent
Green gewährleistet ist, besteht keine Notwendigkeit, revolutionäres Poten-
tial zu entwickeln und gegen den Status Quo aufzubegehren. Unter diesem
Aspekt scheint der Film auch modernes Konsumverhalten zu kritisieren, das
sich nicht mehr für die Ursprünge und Implikationen von Waren interessiert,
sondern nur noch auf Triebbefriedigung ausgelegt ist. Wie in vielen anderen
dystopischen Zukunftsentwürfen der Science Fiction funktioniert auch diese
„neue Welt […] nur durch Nichtwissen.“11
Eine ganz andere, wenn auch ähnlich düstere Vision der Zukunft entwer-
fen Jean-Pierre Jeunet und Marc Caro in ihrem Spielfilmdebüt Delicatessen,
dessen Handlung „in einer nicht näher definierten Endzeit mit anachronisti-
schem Ambiente“12 spielt, genauer im Mikrokosmos eines Mietshauses mit-
ten im Nirgendwo einer surreal trostlosen Ruinenwelt.
In der untersten Etage des Hauses befindet sich eine Metzgerei, die dem
Film seinen Namen gibt, doch Fleisch ist in dieser bizarren postkatastropha-
len Welt genauso wie andere Lebensmittel zur Mangelware geworden. Der
Metzger, zugleich Besitzer des gesamten Hauses, schlachtet und verkauft
daher Menschen, die als Bewerber für einen Hausmeisterjob in das Haus ge-
lockt werden. Der wesentliche Unterschied zu dem Szenario, das in Soylent
Green entworfen wird, besteht darin, dass hier „alle wissen, dass ihnen Stü-
11
Jörg C. Kachel: …Jahr 2022… die überleben wollen. In: Filmgenres. Science Fiction, hg.
von Thomas Koebner, Stuttgart 2003, S. 258-262, hier S. 263.
12
Andreas Rauscher: Delicatessen. In: Filmgenres. Science Fiction, S. 472-476, hier S. 472.
557cke des ehemaligen Hausmeisters verkauft werden, aber alle sind’s zufrieden,
befürchten nur, sie könnten als nächste dran sein.“13
Im Vergleich der beiden Filme lässt sich also das Kannibalismusmotiv als
Gradmesser von individueller und kollektiver Schuld deuten. Die Bewoh-
ner des Mietshauses werden zwar aus Hunger zu Kannibalen, haben jedoch
eindeutig Gefallen an Menschenfleisch gefunden und wollen nicht mehr da-
rauf verzichten, wie in einigen Szenen deutlich wird. Dadurch jedoch, dass
(fast) keiner von ihnen bereit ist, selbst zum Mörder zu werden, sind sie auf
den Metzger angewiesen, der zugleich verhasster Tyrann und notwendiger
Vollstrecker ist. Während des dramatischen Höhepunkts des Films wirft der
Metzger einen messerscharf geschliffenen Bumerang nach dem wehrlosen
Protagonisten und wird schließlich selbst von der zurückkehrenden Waffe ge-
tötet. Die Gewalt fällt auf ihren Urheber zurück, der Protagonist selbst kann
unschuldig bleiben. Plötzlich scheint eine heile Märchenwelt wiederherge-
stellt zu sein: die Metzgerei ist geschlossen, die Sonne scheint wieder. Es
handelt sich hierbei um ein Muster, das sich ähnlich in vielen Märchen und
Mythen findet und das der Verwendung in Alive diametral entgegengesetzt
ist: „das kannibalistische Prinzip wird als das Urböse dargestellt; sobald es
aus der Welt ist, ziehen Glück und Frieden ein.“14
3. Ritueller Kannibalismus
Die kannibalischen Wilden sind, wie einleitend bereits deutlich wurde, ein
Topos, der sich durch die gesamte menschliche Kulturgeschichte zieht, seine
(vorfilmische) Blütezeit jedoch erlebt das Motiv zweifellos in der europäi-
schen Reiseliteratur. Immer wieder begegnen die Entdecker und Forschungs-
reisenden von Columbus bis Bougainville Spuren kannibalischer Praktiken,
deren Augenzeuge sie selbst jedoch nie oder nur selten werden. Der Begriff
Kannibalismus selbst geht angeblich auf Columbus zurück und bezeichne-
te ursprünglich den Stamm der angeblich menschenfressenden Kariben. Die
weißen Flecken früherer Landkarten waren überschrieben mit „Anthropo-
phagi sunt“ – „Hier leben Menschenfresser“, „womit gleichzeitig Furcht und
Abscheu erweckt und zur Kolonisation ermuntert wird.“15 Solche Zeugnisse
von Kannibalismus dienen aus heutiger Sicht offensichtlich dem „fundamen-
talen Bedürfnis abendländischer Gesellschaften, eine (fast) absolute Grenze
13
Thomsen: Menschenfresser in Mythen, Kunst und fernen Ländern, S. 23.
14
Ebd., S. 82.
15
Ebd., S. 46.
558um sich zu ziehen, um sich der eigenen Identität zu versichern.“16 Mehr noch,
die Angst vor dem Fremden und Andersartigen in Phantasien von Menschen-
fressern zu verarbeiten, scheint eine anthropologische Konstante zu sein, die
sich keineswegs auf die westliche Welt beschränkt; so berichtet 1865 etwa
der Forschungsreisende David Livingstone: „Nearly all blacks believe the
whites to be cannibals.“17
Auch der Film nutzt ausgiebig das xenophobe Potential des Kannibalis-
musmotivs: bereits 1899, nur knapp vier Jahre nach der Geburt des Mediums,
erscheint ein Film mit dem zweideutigen Titel Bringing a Friend home for
Dinner (USA), in dem ein Stamm von Kannibalen einen Missionar verspei-
sen will, in King of the Cannibal Island (USA 1908), spielt der Stumm-
filmpionier D.W. Griffith „einen Kannibalen mit Zylinder“18 und 16 Jahre
später strandet auch Buster Keaton in The Navigator (USA 1924, dt. Titel:
Kreuzfahrt der Navigator) am Strand einer solchen von wilden Kannibalen
bewohnten Insel.19 Seine Angebetete wird von den Wilden entführt und soll
gerade geopfert werden, als Buster in einem überdimensionierten Taucher-
anzug aus dem Meer steigt. Die Eingeborenen halten ihn für eine Gottheit
und so kann er seine große Liebe retten und mit ihr gemeinsam fliehen. Auch
diese Wendung des Geschehens ist typisch für die Motivtradition des exo-
tischen Kannibalismus im Film, die primitiven Eingeborenen sind so naiv,
dass sie sich in den meisten Fällen sehr leicht überlisten lassen. Verantwort-
lich für diesen Stereotyp ist wohl nicht zuletzt die verbreitete Annahme eines
deterministischen Zivilisationsprozesses, innerhalb dessen die Ureinwohner
unerschlossener Gebiete eine Stellung einnehmen, die derjenigen der west-
lichen Kultur in frühgeschichtlichen Phasen entspricht. Allerdings lässt sich
ein verwandtes Motiv bereits in Homers Odyssee nachweisen, in der der
menschenfressende Zyklop Polyphem aufgrund seiner extrem begrenzten
geistigen Auffassungsgabe zum leichten Spiel für Odysseus wird.
Berühmt geworden ist das Motiv der wilden Kannibalenstämme im Film
vor allem durch eine Reihe italienischer Horrorfilme, die etwa ab Mitte der
1970er Jahre entstanden sind und den Begriff „Kannibalenfilme“ nachhaltig
geprägt haben.20 Die meisten dieser Filme nehmen deutliche Anleihen beim
16
Fulda: Unbehagen in der Kultur, S. 10.
17
Zit. nach Thomsen: Menschenfresser in Mythen, Kunst und fernen Ländern, S. 51.
18
Michaela Krützen: „I’m having an old friend for dinner“. Ein
������������������������������
Menschenfresser im Klassi-
schen Hollywoodkino. In: Das andere Essen, S. 483-531, hier S. 484.
19
Für einen ausführlicheren historischen Überblick vgl. ebd., S. 483f. Einige Titel aus der
Stummfilmzeit, die bei Krützen nicht erwähnt sind, nennt Jay Slater: Eaten Alive. Italian
Cannibal and Zombie Movies. London 2006, S. 13f.
20
Ein ausführlicher Überblick über die Geschichte dieser Filme mit vielen Hintergrundin-
559so genannten „Mondo-Film“. Kennzeichnend für dieses Genre ist, dass „vor
einer pseudo-dokumentarischen Fassade die voyeuristischen Neigungen des
Betrachters im Hinblick auf Sex, Gewalt und Bizarres“21 bedient werden. Ein
typisches Element dieser Filme ist daher der medial vermittelte Blick durch
Ferngläser, Fotoapparate, Filmkameras etc.
Am Ende von Joe D’Amatos Emanuelle e gli ultimi cannibali (Italien
1977, dt. Titel: Emanuelle und die letzten Kannibalen) betrachten die Pro-
tagonistin und ihr Begleiter in aller Ruhe die Folterung und rituelle Verspei-
sung einiger Mitglieder ihres Expeditionsteams aus sicherer Entfernung und
unterhalten sich über die Riten und Bräuche der Kannibalen, die Emanuelle
besonders interessieren. Ausgestattet mit diesem Fachwissen ist sie dann in
der Lage, sich als Göttin des Wassers zu „verkleiden“ – d. h. ihren nackten
Körper mit einem den Kannibalen heiligen Symbol zu bemalen – und auf
diese Weise ihre Freundin zu retten und gemeinsam mit dieser zu fliehen. Der
Moment, in dem Emanuelle aus dem Wasser steigt und die Eingeborenen, die
gerade ihre Freundin opfern wollen, ehrfürchtig erstarren, erinnert stark an
die entsprechende Rettungsszene in Keatons Stummfilm, der über 50 Jahre
früher entstand. Praktisch unverändert überlebt der Topos des dummen Wil-
den also bis in die späten 1970er Jahre. Allgemein fehlt das gesellschaftskriti-
sche Potential des Kannibalismusmotivs in diesem Film noch fast völlig, die
Kannibalen werden die meiste Zeit als triebgesteuerte Monster dargestellt.
Drei Jahre später entsteht mit Ruggero Deodatos Cannibal Holocaust
(Italien 1980, dt. Titel: Nackt und Zerfleischt) der einflussreichste und
mit Abstand komplexeste Film in der Reihe italienischer Kannibalenfilme.
Er arbeitet geschickt mit verschiedenen Zeitebenen und mehreren medialen
Brechungen, fast die komplette zweite Hälfte der Handlung besteht aus ei-
ner Film-im-Film-Situation. Zudem wird die „Beziehung zwischen der anth-
ropophagischen Ingestion und der Schaulust des westlichen Betrachters im
Film selbst thematisiert“22, was ihn jedoch nicht vor heftiger Kritik und dem
Verbot der Originalfassung in den meisten Ländern bewahrte. Die Populari-
tät von Cannibal Holocaust liegt nicht zuletzt darin begründet, dass lange
Zeit das Gerücht umging, einige der dargestellten Folter- und Todesszenen
seien echt.23 Christian Moser deutet die Probleme von Deodatos Film mit der
formationen und Inhaltsanalysen findet sich bei Mikita Brottman: Eating Italian. In: The
Bad Mirror. A Creation Cinema Collection Reader, hg. von Jack Hunter, London 2002, S.
109-124 und Slater: Eaten Alive.
21
Christian von Aster: Horror-Lexikon. Von Addams Family bis Zombieworld: Die Motive
des Schreckens in Film und Literatur. Berlin 1999, S. 231.
22
Moser: Kannibalische Katharsis, S. 91.
23
Dies ist zwar nicht der Fall, allerdings beinhaltet der Film in seiner ursprünglichen unge-
560Zensur folgendermaßen: „Der Film figuriert […] als Beispiel für einen ‚kan-
nibalischen’ Konsumgegenstand, nach dem in der westlichen Kultur ein gro-
ßes Verlangen besteht, den sie aber nicht zu ‚verdauen’ vermag, weshalb sie
gewisse repressive Mechanismen in Gang setzt“.24 Dazu passt folgendes Zitat
eines Rezensenten der Cahiers du Cinema: „the sole, but not negligible effort
of the spectator consists partly in overcoming his repulsion at this defiling of
phobic objects and traumatizing scenes, partly in not abandoning himself to
the only desire that this film excites: that for censorship.“25
Mosers sehr ausführlicher und aufschlussreicher Analyse des Kanniba-
lismusmotivs in diesem Film26 ist nur wenig hinzuzufügen, weshalb ich in
diesem Zusammenhang lediglich einige seiner Thesen wiedergeben und auf
die Eingangssequenz des Films eingehen werde, die bei ihm nur sehr knapp
besprochen ist.
Gleich zu Beginn des Films wird deutlich, dass der Unterschied zwischen
den Kannibalen und den Vertretern der westlichen Zivilisation nur gering
ist und letztere im direkten Vergleich die grausameren Menschen sind. Ein
Reporter berichtet vom Verschwinden eines amerikanischen Fernsehteams,
das von Dreharbeiten für eine Dokumentation über Kannibalen im Amazo-
nasgebiet nie zurückkehrte. Weit ausholend spricht er von der lebensfeind-
lichen Umgebung des Dschungels, die der Zuschauer nur kurz zuvor in den
ruhigen und friedlich wirkenden Vogelperspektivaufnahmen des Vorspanns
gesehen hat. Jetzt allerdings kontrastiert die Kamera den Kommentar mit den
Bildern hektischen Treibens auf den überfüllten Straßen New Yorks mit ihren
Myriaden von blinkenden Leuchtreklamen, der Text über das im Dschungel
geltende Gesetz des „Survival of the fittest“ wird kombiniert mit Aufnah-
men der Wallstreet, dem symbolischen Zentrum des Kapitalismus. Mitten
in New York hängt zudem ein gigantisches Werbeplakat für eine Dracula-
Verfilmung, in dessen Vordergrund eine halbnackte Frau liegt, die dem Vam-
pir im Hintergrund ihren Hals zum Biss darbietet – „Kannibalismus überall“
scheint die Botschaft zu sein. Ein zweites Team bricht auf, um die vermissten
Dokumentarfilmer zu suchen. Es stellt sich heraus, dass sie von Angehörigen
eines Kannibalenstamms getötet und gegessen wurden, nachdem die Vertre-
ter westlicher Zivilisation mordend, brandschatzend und vergewaltigend in
ihr Gebiet eingedrungen waren, um spektakuläre Bilder filmen zu können.
schnittenen Version eine Szene, in der Archivmaterial eines Nachrichtensenders von einer
tatsächlichen Hinrichtung in einem afrikanischen Bürgerkrieg gezeigt wird. Vgl. Brottman:
Eating Italian, S. 121.
24
Moser: Kannibalische Katharsis, S. 91.
25
Zit. nach Brottman: Eating Italian, S. 119f.
26
Moser: Kannibalische Katharsis, S. 89-109.
561Die Videoausrüstung haben die Kannibalen als Schrein aufbewahrt und über-
geben sie schließlich dem Leiter der zweiten Expedition, einem Anthropolo-
gieprofessor, der beim Betrachten der ungeschnittenen Aufnahmen Zeuge der
unglaublichen Grausamkeiten des Fernsehteams wird und sich angewidert
die Frage stellt: „I wonder who the real cannibals are.“ Die Antwort, die der
Film nahe zu legen scheint, fällt eindeutig aus:
Die Expeditionsteilnehmer sind Kannibalen, weil sie sich in den Dienst
des schrankenlosen westlichen Hungers nach Sensationen und schockie-
renden Bildern stellen, weil sie selbst von diesem Hunger angetrieben
werden und keine Scheu davor haben, ihm unschuldige Menschen zum
Opfer zu bringen. Sie sind Kannibalen, da es ihnen nicht darum geht, die
fremde Kultur der Indianer zu verstehen, sondern allein darum, diese für
ihre eigenen Bedürfnisse auszubeuten. […] Nicht der Mund, sondern die
Kamera dient ihnen als Organ der kannibalischen Ingestion.27
Diese Kritik an der Sensationslust und deren Befriedigung durch die Mas-
senmedien um jeden Preis ist natürlich insofern ambivalent, als der Film trotz
aller Gesellschaftskritik selbst offensichtlich diesem Zweck dient. In einer
Rezension war zu lesen:
the anthropologist declares that it would be odious to show such films
to the public, […] but what do you think the spectator is shown fort he
next hour and a half? The famous ignominious footage, with occasional
breaks to tell us how disgusting it all is. And yes, it certainly is.28
Während die figurative Anthropophagie der westlichen Zivilisation ein-
deutig verdammt wird, erfährt der rituelle Kannibalismus der „Wilden“ eine
Aufwertung29, da er nach Moser einem konkreten Zweck dient – „einen
Zustand natürlicher Reinheit zu konservieren und gegen äußere Einflüsse
abzudichten.“30 Dieser kathartische Effekt des Kannibalismus steht im Zent-
rum der weiteren Überlegungen Mosers, der auch die Tatsache, dass die letz-
ten Aufnahmen des am längsten überlebenden Kameramanns seinen eigenen
Tod dokumentieren, in diesem Sinne deutet: „Die Kamera frisst ihren eige-
27
Ebd., S. 102.
28
Zit. nach Brottman: Eating Italian, S. 120.
29
Dass durchaus andere Lesarten möglich sind, belegt der Vorwurf der rassistischen Darstel-
lung der „Wilden“, wie er in verschiedenen europäischen Rezensionen geäußert wurde. Vgl.
ebd., S. 120.
30
Moser: Kannibalische Katharsis, S. 105.
562nen Kameramann auf; sie betreibt eine Art von Autophagie. Der Hunger nach
drastischen Bildern, die das Leid der abgebildeten Menschen ausbeuten und
somit ‚verschlingen’, wendet sich schließlich gegen die Ausbeuter selbst.“31
Bei genauerer Betrachtung handelt es sich bei Cannibal Holocaust um
eine interessante Variation der Struktur des klassischen Horrorfilms, wie sie
etwa Robin Wood mit der simplen Formel „normality is threatened by the
monster“32 beschreibt. Normalität definiert er dabei als Übereinstimmung mit
den dominanten sozialen Normvorstellungen.33 Das Fernsehteam in Canni-
bal Holocaust bricht gewaltsam in eine fremde Ordnung ein, erschüttert die-
se in ihren Grundfesten, kann aber schließlich besiegt und vernichtet werden,
wodurch die Ordnung bzw. Normalität, hier allerdings die der Kannibalen,
wiederhergestellt wird.
4. Pathologische Anthropophagie
Die Figur des exotischen „wilden“ Kannibalen findet sich immer seltener
in Filmen, was nicht verwundert, denn ganz allgemein lässt sich feststellen,
dass Ureinwohner unerschlossener bzw. von westlicher Zivilisation abge-
schnittener Regionen seit knapp zwei Jahrzehnten „nicht länger als Bedro-
hung, sondern als positive Figuren“ 34 dargestellt werden.
Zeitgleich mit dem Verschwinden dieser Motivtradition taucht immer häu-
figer eine andere Art von Schrecken auf: kannibalische Psychopathen und
Serienkiller, deren Opfer nicht nur Angehörige derselben Spezies, sondern
sogar derselben Gesellschaft sind.35
Der Kannibale ist nicht mehr notwendigerweise der Angehörige einer
primitiven Gesellschaft, die in einem exotischen Land beheimatet ist. Er
31
Ebd., S. 106.
32
Robin Wood: An Introduction to the American Horror Film. In: Planks of Reason. Essays
on the Horror Film, hg. von Barry Keith Grant, Metuchen, N.J./London 1984, S. 164-200,
hier S. 175.
33
Ebd., S. 175.
34
Krützen: Ein Menschenfresser im Klassischen Hollywoodkino, S. 495. Prototypisch für
diese Entwicklung sind ihr zufolge Filme wie Kevin Costners Dances with Wolves (USA
1990, dt. Titel: Der mit dem Wolf tanzt), deren strukturelle Analogie zum Motiv der west-
lichen Zivilisation als Heimat der „wahren“ Kannibalen nicht zu übersehen ist.
35
Zwar gibt es in Doctor X (USA 1932, Regie: Michael Curtiz, dt. Titel: Der Geheimnisvol-
leDr. X) einen Vorläufer des kannibalischen Serienmörders, dieser bildet aber, soweit mir
bekannt, die einzige Ausnahme für die Zeit vor den 1960er Jahren.
563entstammt eher dem Dschungel der modernen Großstadt als den schwin-
denden Urwaldgebieten.36
Wie sehr das Phänomen der neuen Kannibalen westlicher Provenienz sich
von den wilden Menschenfressern der italienischen Horrorfilme unterschei-
det, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sie das Fleisch – zumindest wenn sie
die Gelegenheit dazu haben – zubereiten, ihm teilweise sogar eine kulina-
rische Dimension verleihen und nicht mehr, wie bei den früheren Filmkan-
nibalen üblich, roh und direkt vom Körper essen – nach Lévi-Strauss ein
wesentliches Charakteristikum menschlicher Kulturleistung.37
Das, was diesen neuen Typus von Kannibalen so furchteinflößend macht,
ist vor allem, dass er nicht mehr sofort als solcher zu erkennen ist. Die wilden
Eingeborenen der italienischen Kannibalenfilme sind noch deutlich als Men-
schenfresser markiert und leben meistens in einem – durch aufgespießte To-
tenköpfe und ähnliche Warnhinweise – mehr oder weniger klar abgegrenzten
Raum. Die Opfer ihrer kannibalischen Bräuche müssen erst diese Grenzen
überwinden, was – auch aufgrund der geografischen Lage – nur absichtlich
geschehen kann. Entsprechend handelt es sich bei den Protagonisten und po-
tentiellen Opfern dieser Filme um Forscher, Reporter und Abenteurer.
Der moderne Filmkannibale dagegen führt „das unauffällige Leben eines
normalen Bürgers, während er im Verborgenen seine kannibalischen Gelüste
zu befriedigen sucht.“38 Als Opfer kommt daher auch prinzipiell jedes Mit-
glied der Gesellschaft in Frage – das Meiden von Territorien, die mit auf-
gepfählten Schrumpfköpfen umzäunt sind, reicht nicht mehr aus, um sich
in Sicherheit wiegen zu können. Dem entspricht die bei Moser besprochene
These Andrew Tudors, dass ab den 1970er Jahren der „secure horror“ lang-
sam durch den „paranoid horror“ abgelöst wird: „Horror-movie psychosis
trades on our fear of what is hidden in ourselves. In its world, any of us might
suddenly be transformed into unpredictable and inexplicable killers.“39
Einen gewissen Sonderstatus in dieser Typologie nimmt Tobe Hoopers The
Texas Chainsaw Massacre, das „Gone with the Wind of meat movies“40, ein.
Zwar handelt es sich bei Leatherface und seiner kannibalischen Familie ein-
36
Moser: Kannibalische Katharsis, S. 84.
37
Claude Lévi-Strauss: Mythologica I. Das Rohe und das Gekochte. Frankfurt am Main 1971,
S. 191.
38
Moser: Kannibalische Katharsis, S. 84f.
39
Zit. nach ebd., S. 86.
40
Zit. nach Krützen: Ein Menschenfresser im Klassischen Hollywoodkino, S. 494.
564deutig um psychopathische Serienmörder41, doch einige Elemente scheinen
eher für eine Einordnung in die vorangehende Kategorie des exotischen Kan-
nibalismus zu sprechen: erstens handelt es sich um einen sozialen Verband
von Kannibalen und nicht um ein einzelnes Individuum, zweitens lebt die
Familie irgendwo im Niemandsland der texanischen Einöde und schlach-
tet nur solche Menschen, die sich in ihr Gebiet verirren. Allerdings gibt es
keine markierten Grenzen mehr, die absichtlich überquert werden müssten:
„it is the Hansel-and-Gretel story of apparently innocent youth stumbling
upon unexplained and unimaginable evil.“42 Die Kannibalen befinden sich
hier nicht außerhalb der Zivilisation, sondern lediglich in einem Randgebiet.
Ein wesentlicher Unterschied zu anderen westlichen Kannibalen ist jedoch
die Tatsache, dass sich vor allem der arbeitslose Schlachter Leatherface des
Tabubruchs gar nicht bewusst ist: Er ist „eine degenerierte Version von James
Fenimore Coopers edlem Lederstrumpf, eine mit der Kettensäge mordende,
aber auch bemitleidenswerte, geistig zurückgebliebene Figur.“43
Der Prototyp des modernen Filmkannibalen dagegen wird verkörpert durch
die Figur Hannibal Lecters aus The Silence of the Lambs, der mit dem primi-
tiven Leatherface außer der kannibalischen Neigung nichts gemein hat (Abb.
2).
Abb. 2: Hannibal „The Cannibal“ Lecter – eine kannibalische
Ikone der Populärkultur
41
Die Geschichte basiert auf der wahren Begebenheit des vermutlich auch kannibalischen
amerikanischen Serienmörders Ed Gein, der zuvor schon Alfred Hitchcock zu Psycho (USA
1960) inspirierte.
42
Christopher Sharrett: The Idea of Apocalypse in The Texas Chainsaw Massacre. In: Planks
of Reason. Essays on the Horror Film, hg. von Barry Keith Grant, Metuchen, N.J. and
London 1984, S. 255-276, hier S. 257.
43
Christian Rzechak: Blutgericht in Texas/Das Kettensägenmassaker. In: Filmgenres. Horror-
film, hg. von Thomas Koebner, Stuttgart 2004, S. 203-207, hier S. 205.
565Nach Michaela Krützen ist er „der einzige urbane Kannibale im Klassischen
Kino, der wissentlich, regelmäßig, aus freien Stücken und sogar genüßlich
Menschenfleisch verzehrt.”44 Er zeichnet sich durch seine dämonische Intelli-
genz und Heimtücke aus und ist ein gut gekleideter, belesener und überhaupt
in höchstem Maße kultivierter Bildungsbürger. Seiner Transgression ist er
sich nicht nur vollkommen bewusst, sondern er beansprucht für sich sogar
das Recht auf diese Praxis. So wie die Überlebenden des Flugzeugabsturzes
in Alive sich durch unbedingten Überlebenswillen auszeichnen, zeichnet sich
Hannibal Lecter durch einen unbedingten Willen zur Macht aus, der es ihm
erlaubt, sich über alle Regeln der Gesellschaft hinwegzusetzen.
Geht man mit Freud davon aus, dass Kannibalismus und Kannibalismusta-
bu den eigentlichen Ursprung menschlicher Kultur bilden45, stellt die Über-
tretung dieses größten Tabus mehr als alle anderen Regelbrüche und Norm-
verletzungen die Gesellschaft als solche in Frage. Genau hierin liegt Hanni-
bal Lecters Motivation, er handelt nicht aus einem fehlgeleiteten Sexualtrieb
oder einem unverarbeiteten Mutterkomplex heraus46, wie die meisten anderen
filmischen Serienmörder, sondern aus der Überzeugung, dass Gesellschaft
und Zivilisation „überwunden“, sozusagen zu Ende gedacht werden können.
Es ist „ihm gelungen, den kannibalischen Konsum zu einer Kunstform zu
erheben.“47
Interessant dabei ist, dass er trotz all dieser Eigenschaften keineswegs
so eindeutig das „satanisch Böse“ 48 verkörpert, wie häufig behauptet wird.
Vielmehr ist er derjenige, der der FBI-Agentin Clarice Sterling die entschei-
denden Hinweise liefert, die für die Auflösung des eigentlichen Falles (des
Serienmörders Buffalo Bill) notwendig sind. Krützen bezeichnet Hannibal
Lecter als einen „Adjuvanten“ im Sinne des Aktantenmodells, ihm kommt
die Funktion eines Helfers oder Beraters und damit einer positiven Figur zu.49
Alle von ihm während der Filmhandlung getöteten Figuren sind dagegen ein-
44
Krützen: Ein Menschenfresser im Klassischen Hollywoodkino, S. 496. Seit Erscheinen ih-
res Aufsatzes sind allerdings weitere Filme erschienen, in denen Kannibalen mit ähnlichen
Qualitäten auftauchen, zuletzt etwa in Sin City (USA 2005, Regie: Robert Rodriguez).
45
Sigmund Freud: Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden
und der Neurotiker. In: Studienausgabe. Band IX. Fragen der Gesellschaft. Ursprünge der
Religion, hg. von Alexander Mitscherlich, Frankfurt 1974, S. 287-444, hier S. 426f.
46
Der letzte Teil der Hannibal-Romantrilogie von Thomas Harris legt zwar das Gegenteil
nahe, doch in The Silence of the Lambs selbst gibt es keine Hinweise darauf. Vgl. Moser:
Kannibalische Katharsis, S. 195.
47
Ebd., S. 110.
48
Thomsen: Menschenfresser in Mythen, Kunst und fernen Ländern, S. 17.
49
Krützen: Ein Menschenfresser im Klassischen Hollywoodkino, S. 507.
566deutig negativ konnotiert, vor allem der Gefängnisleiter Chilton, den zu ver-
speisen er in der Schlussszene des Films mit derselben zweideutigen Pointe
ankündigt, die bereits im Titel des ersten Kannibalenfilms von 1899 anklingt:
„I do wish we could chat longer, but I am having an old friend for dinner.“
In Mosers These der „kannibalischen Katharsis“ steht Chilton denn auch für
„die Zivilisation in ihrer staatlich-institutionalisierten Ausprägung, die das
kannibalische Verlangen durch repressive Mittel […] zu bezwingen sucht, es
aber eben dadurch bestialisiert.“50
Nach Woods Theorie des amerikanischen Horrorfilms, die psychoanalyti-
sche und ideologiekritische Aspekte vereint, gibt es durchaus Ähnlichkeiten
zwischen Hannibal Lecter und dem klassischen Filmmonster – King Kong
oder Godzilla etwa –, das sich auch in den allermeisten Filmen durch große
Ambivalenz auszeichnet:
Few films have totally unsympathetic monsters […]; in many […] the
monster is clearly the emotional center […]. But the principle goes far
beyond the monster being sympathetic. Ambivalence extends to our atti-
tude to normality. Central to the effect and fascination of horror films is
their fulfillment of our nightmare wish to smash the norms that oppress
us and which our moral conditioning teaches us to reverse.51
In einer später erschienenen Kritik zu The Silence of the Lambs schreibt
er: „The humanity of Hannibal Lecter is clearly a central issue: if we see
Lecter as only a monster, quite distinct from ourselves, then the film fails,
becomes ‚just another horror movie’.“52
Das Filmmonster steht bei Wood für die Rückkehr des Verdrängten, des Ta-
buisierten und gesellschaftlich Überformten.53 Besonders zutreffend scheint
dies für die Figur Hannibal Lecter zu sein, er ist das personifizierte „Unbeha-
gen an der Kultur“ und die offenbar große Faszination, die von ihm ausgeht,
verweist „auf ein komplementäres Bedürfnis nach Grenzüberschreitung“, mit
Daniel Fulda auf „ein Behagen an der Unkultur.“54
50
Moser: Kannibalische Katharsis, S. 111.
51
Wood: An Introduction, S. 177.
52
Robin Wood: The Silence of the Lambs. In: International Dictionary of Films and Film-
makers. Volume 1. Films, hg. von Sara Pendergast/Tom Pendergast, Detroit et al. 2000, S.
1106-1108, hier S. 1108.
53
Wood: An Introduction, S. 173ff.
54
Fulda: Unbehagen in der Kultur, S. 13. Herv. i. O.
5675. Schlussbetrachtung
Es hat sich gezeigt, dass die Bandbreite der Verwendungsformen des Kan-
nibalismusmotivs im Spielfilm sehr groß ist: In manchen Gestaltungen wird
der Aspekt der Vernichtung des Verspeisten besonders betont (Delicates-
sen), in anderen wird genau dieser Aspekt negiert – etwa in Alive, der die
Nähe des christlichen Abendmahls mit seiner Theophagie zu rituellen kan-
nibalischen Praktiken sichtbar macht. Die rituelle Anthropophagie indigener
Völker und den Kannibalismus psychotischer Serienmörder verbindet in der
Filmgeschichte wiederum mehr, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.
Reduziert man beide Motivtraditionen auf ein grobes Schema, scheint inter-
essanterweise die letztere eine strukturelle Inversion der ersten zu sein. Die
Mengenverhältnisse der wichtigen Elemente und ihre Beziehung zueinan-
der werden umgekehrt: auf der einen Seite die Gesellschaft von Kannibalen,
die einen isolierten und von westlicher Zivilisation weitgehend unberührten
Raum bewohnen, in den eine einzelne Person – oder eine kleine Gruppe –
eindringt und dadurch Gefahr läuft, verspeist zu werden; auf der anderen
Seite die okzidentale Zivilisation mit ihrem Kannibalismustabu, in der ein
anthropophager Fremdkörper gleichsam von selbst entsteht und dadurch die
gesamte Gesellschaft zur potentiellen Mahlzeit macht.
Eine Mischung aus all dem wird in Soylent Green präsentiert, dessen Zu-
kunftsgesellschaft in einem ewigen Kreislauf der Selbstkonsumption gefan-
gen zu sein scheint.
Offensichtlich verfügt die Kannibalismusmetapher über gewisse Leerstel-
len, die nach Belieben mit Inhalt gefüllt werden können, noch deutlicher wird
dies, wenn man zusätzlich zu den in diesen Beitrag besprochenen Hauptmo-
tivtraditionen noch einige weniger bedeutende Variationen berücksichtigt:
etwa solche Filme, die sich durch eine ironische Brechung des Motivs aus-
zeichnen oder die Figur des Kannibalen in ganz neue Kontexte integrieren,
wofür deutsche Verleihtitel wie Zombies unter Kannibalen55 oder Die Kung
Fu Kannibalen56 symptomatisch sind. Diese postmoderne Form des Zitie-
rens selbst kann metaphorisch als Kannibalismus beschrieben werden, wenn-
gleich auch „eine Grenze jener Analogie darin [liegt], daß die intertextuelle
Bezugnahme den Prä- bzw. Hypotext nicht vernichtet, mag der hypertextu-
elle Umgang mit ihm noch so ‚gewaltsam’ sein, d. h. ohne Rücksicht auf
den ursprünglichen Sinnhorizont ausfallen“57, wie Fulda einwendet. Bezogen
55
Zombi Holocaust (Italien 1980, Regie: Marino Girolami)
56
Diyu Wu Men (Hong Kong 1980, Regie: Tsui Hark)
57
Fulda: Unbehagen in der Kultur, S. 24.
568auf die Praxis zweitklassiger Filme, sich die erfolgreichen Elemente ande-
rer Filme „einzuverleiben“, scheint die Metapher dennoch durchaus Sinn zu
machen, auch wenn der Originalfilm dabei erhalten bleibt: „Nun setzten sie
im Akte des Verzehrens die Identifizierung mit ihm [dem Patriarchen der Ur-
herde, d. Verf.] durch, eigneten sich jeder ein Stück seiner Stärke an“58, so be-
schreibt Freud den ersten Fall von Kannibalismus, aus dessen Sublimierung
ihm zufolge die menschliche Kultur entsteht.
Literatur
Arens, William: The Man-Eating Myth. Anthropology & Anthropophagy,
Oxford/New York 1979.
Aster, Christian von: Horror-Lexikon. Von Addams Family bis Zombieworld:
Die Motive des Schreckens in Film und Literatur, Berlin 1999.
Brinckmann, Christine N.: Unsägliche Genüsse. In: Montage/AV. Zeitschrift
für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation 10 (2001), H.
2, S. 77-94.
Brottman, Mikita: Eating Italian. In: The Bad Mirror. A Creation Cinema
Collection Reader, hg. von Jack Hunter, London 2002, S. 109-124.
Freud, Sigmund: Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenle-
ben der Wilden und der Neurotiker. In: Studienausgabe. Band IX. Fragen
der Gesellschaft. Ursprünge der Religion, hg. von Alexander Mitscherlich,
Frankfurt am Main 1974, S. 287-444.
Fulda, Daniel: Unbehagen in der Kultur, Behagen an der Unkultur. Ästhe-
tische und wissenschaftliche Faszination der Anthropophagie. Mit einer
Auswahlbibliographie. In: Das andere Essen. Kannibalismus als Motiv und
Metapher in der Literatur, hg. von Daniel Fulda/Walter Pape, Freiburg im
Breisgau 2001, S. 7-50.
Kachel, Jörg C.: …Jahr 2022… die überleben wollen. In: Filmgenres. Sci-
ence Fiction, hg. von Thomas Koebner, Stuttgart 2003, S. 258-262.
Krützen, Michaela: „I’m having an old friend for dinner“. Ein Menschenfres-
ser im Klassischen Hollywoodkino. In: Das andere Essen. Kannibalismus
als Motiv und Metapher in der Literatur, hg. von Daniel Fulda/Walter Pape,
Freiburg im Breisgau 2001, S. 483-531.
Lévi-Strauss, Claude: Mythologica I. Das Rohe und das Gekochte, Frankfurt
am Main 1971.
Moser, Christian: Kannibalische Katharsis. Literarische und filmische In-
szenierungen der Anthropophagie von James Cook bis Bret Easton Ellis,
Bielefeld 2005.
O. V.: Überleben! In: Lexikon des internationalen Films. Das komplette An-
gebot in Kino und Fernsehen seit 1945. 21000 Kurzkritiken und Filmogra-
phien, hg. von Klaus Brüne, Hamburg 1991, S. 3922.
Rauscher, Andreas: Delicatessen. In: Filmgenres. Science Fiction, hg. von
Thomas Koebner, Stuttgart 2003, S. 472-476.
58
Freud: Totem und Tabu, S. 426.
569Rzechak, Christian: Blutgericht in Texas/Das Kettensägenmassaker. In: Film- genres. Horrorfilm, hg. von Thomas Koebner, Stuttgart 2004, S. 203-207. Sharrett, Christopher: The Idea of Apocalypse in The Texas Chainsaw Mas- sacre. In: Planks of Reason. Essays on the Horror Film, hg. von Barry Keith Grant, Metuchen, N.J. and London, S. 255-276. Slater, Jay: Eaten Alive. Italian Cannibal and Zombie Movies, London 2006. Thomsen, Christian W.: Menschenfresser in Mythen, Kunst und fernen Län- dern, Erftstadt 2006. Wood, Robin: An Introduction to the American Horror Film. In: Planks of Reason. Essays on the Horror Film, hg. von Barry Keith Grant, Metuchen, N.J/London 1984, S. 164-200. Wood, Robin: The Silence of the Lambs. In: International Dictionary of Films and Filmmakers. Volume 1. Films, hg. Von Sara Pendergast/Tom Pender- gast, Detroit et al., S. 1106-1108. 570
Sie können auch lesen