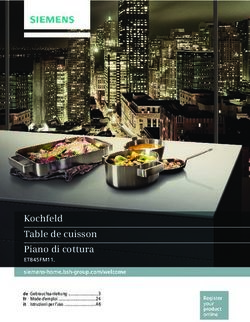Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est. Jacques Cujas und die Grundlage der normativen Befugnis des römischen Senates
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
VIII.
Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est.
Jacques Cujas und die Grundlage
der normativen Befugnis des römischen Senates
Vo n
Salvatore Marino*)
Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est. Jacques Cujas and the foundation of
the normative power of the Roman Senate. Jacqes Cujas identifies in his Paratitla, in his Obser-
vationes and extensively in the texts of his posthumously collected lectures, necessity to be the
source and foundation of the normative power of the Roman Senate. In doing so, he revisited,
rectified and refined the achievements of the medieval jurists, he connected literary and legal
sources with philological precision and historical awareness, and achieved results, which are
*) salvatore.marino@unina.it, Dipartimento Studi Umanistici, Università di Na-
poli Federico II, I-80133 Napoli, Italy. – Für sprachliche Verbesserungen danke ich
Gregor Albers (Münster) und Carina Nüdling (Freiburg). Weiteren Dank schulde
ich Pierangelo Buongiorno (Macerata), im Rahmen von dessen Forschungsprojekt
an der WWU Münster diese Untersuchung entstanden ist. – Die noch von Cujas
selbst redigierten Werke (Opera priora) werden nach den Erstausgaben zitiert (alle
online zugänglich), diejenigen, die erst nach seinem Tod publiziert wurden (Ope-
ra posteriora) nach deren Erstausgabe durch C h a r l e s -A n n i b a l Fa b r o t , Jacobi
Cuiacii opera omnia, 10 Bände, Lutetiae Parisiorum 1658 [Fabrot + Bandzahl]. Die
italienischen Ausgaben aus dem 18. Jh. (Napoli 1722–1727 = Napoli 1758; Venezia
– Modena 1758–1783) gehen über Fabrot nicht hinaus. Auch die Gesamtausgaben
aus dem 19. Jh. (Prato 1836–1844; Prato 1859–1871 = Torino – Paris 1874) basieren
auf Fabrot, sie ordnen aber den Stoff anders und unterscheiden nicht zwischen den
Opera priora (Fabrot I–III) und den postum edierten Werken (Fabrot IV–X); dazu
ausführlich P r é vo s t , Cujas (u. Fn. 1) 123ff., 131f., Annexe 520ff. Zusätzlich zu den
Erstausgaben [EA bzw. Fabrot] werden in diesem Aufsatz auch die neapolitanische
Gesamtausgabe 1722 [Opera (Napoli)] und die Gesamtausgabe Prato 1836–44 [Ope-
ra (Prato)] zitiert. Dabei sind Druckfehler gegenüber den Erstausgaben angemerkt,
Abweichungen in der Orthographie oder Interpunktion hingegen nicht. Cujas’ Zitate
aus dem Corpus iuris sind mit der heutigen Zitierweise in eckigen Klammern er-
gänzt worden.
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est 291
also particularly useful to the contemporary historiographical and historical legal reflection.
This study attempts to render all these aspects, on the basis of the numerous testimonies in the
Opera omnia, showing the context and the implications.
Key Words: Jacques Cujas; roman Senate; normative power; necessity; source of roman
law, legal Humanism
Inhalt: I. Einführung: Paratitla, Observationes, Commentarii, Recitationes. – II. Das Ver-
hältnis zwischen Rechtsakten des Volkes, des Senates und des Kaisers, S. 294, 1. Die alte
Fragestellung, 2. Eine neue Methode, 3. Leges et senatus consulta: Ähnlichkeiten und Unter-
schiede. – III. Historische und normative Bedeutung der senatus consulta, S. 308, 1. Sena-
tus quoque consulit, id est, judicat, statuit, decernit, 2. Philologischer Exkurs: Stulti sunt qui
malunt censuerunt, 3. Historisierung der Senatsbeschlüsse: Antiqua Senatusconsulta manent,
ut leges antiquae. – IV. Ursprung des Unterschiedes zwischen den gesetzesähnlichen Akten,
S. 316, 1. Die graduelle historische Entwicklung, 2. Consensus und necessitas, 3. Menander und
Modestin, 4. Eine Diatribe aus dem 17. Jh. – V. Die Darstellung in den Recitationes, S. 327. –
VI. Schlussbetrachtungen und Ausblick, S. 333.
I . E i n f ü h r u n g . Pa r a t i t l a , O b s e r v a t io n e s ,
C o m m e n t a r i i , R e c i t a t io n e s
Jacques Cujas1) erklärt in einem seiner berühmten Paratitla2) zum Titel 1,3
der Digesten den Unterschied zwischen Volksgesetzen und Senatsbeschlüs-
sen sowie ihr Verhältnis zum Gewohnheitsrecht:
1) Gegen die im Deutschen geläufige Schreibvariante „Cujaz“ s. G . Hu g o , Civi
listisches Magazin 3, Berlin 1812, 193: „Der Familienname hieß Cujaus; um ihn
einer bequemen lateinischen Endung (Cuiacius) auch im Französischen ähnlicher
zu machen, oder auch als Anagramm von Cajus, wie Teissier sagt, nannte er sich
Cujas […]. Die Deutschen, welche ihn nun Cujaz oder gar Cujatz schreiben, ma-
chen dadurch nicht nur die Landsmannschaft unkenntlich, sondern sie verderben
sich auch alles, was in Doneaus Anspielung: quidam, nescio cujas, etwa noch Wit-
ziges liegt.“; s dazu auch E . S p a n g e n b e r g , Cujas und seine Zeitgenossen, Leipzig
1822, 5f. Die Literatur über Cujas ist umfangreich; für alle s. die Nachweise bei
X . P r é vo s t , Jacques Cujas (1522–1590), Jurisconsulte humaniste, Genève 2015;
und Rez. dazu von M . S c h m ö c k e l , ZRG RA 134 (2017) 632–635. Als Ergänzung
zum gedruckten Buch stehen die mit Vergleichstafeln und nützlichen Registern ver-
sehenen Annexe in digitaler Form auf der Verlagswebseite (www.droz.org) zur Ver-
fügung.
2) Paratitla in libros quinquaginta Digestorum, seu Pandectarum imperatoris
Iustiniani, Opus Iacobi Cuiacii, Coloniae Agrippinae 1570; für die von Cujas ge-
fertigten, kurz gefassten und sehr erfolgreichen Erklärungen, die Einblicke in die
justinianische Systematik bieten, s. X . P r é vo s t , Les Paratitla des Temps modernes:
réinterprétations d’un genre consacré par Justinien, Revue d’histoire des facultés de
droit et de la culture juridique 33 (2013) 125–153. „Supergloses“ nennt sie L . W i n -
k e l s.v. Cujas (Cuiacius) Jacques, in P. A r a b e y r e / J.- L . H a l p é r i n / J. K r y n e n
(dir.), Dictionnaire historique des juristes français (XIIe –XXe siècle), Paris 2007,
222 ; s. auch u. Fn. 6. Der Frage quid sint paratitla widmete sich schon Cujas’ Schü-
ler G u i l l a u m e M a r a n (1549–1621) in der Präambel zu seinen eigenen Paratitla
in XLII priores Digestorum libros, Tolosae 1628, 89 = G . M a r a n , Opera omnia,
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)292 Salvatore Marino
Parat. ad D. 1,3. De legibus senatusque consultis et longa consuetudine3): Iuris
civilis hoc titulo partes exequitur tres, leges, quo nomine non populi tantum, sed
etiam plebis scita significantur, quae ex lege Hortensia non minorem vim habent,
quam totius populi iussa. Senatusconsulta quae solus Senatus decrevit sine lege. Et
longam consuetudinem, id est, tacitum populi consensum plurimorum annorum
observatione inveteratum. Quas in extremo tituli conclusit his verbis, Ergo omne
ius aut consensus fecit, aut necessitas constituit, aut firmavit consuetudo. Ius enim
quod expressus consensus populi vel plebis fecit, lex est. Quod necessitas constitu-
it, Senatusconsultum, l. ij4) §. deinde quia difficile. supra tit. proximo. [D. 1,2,2,9]
Das Paratitlon5) fasst in wenigen Sätzen6) zwei Themen zusammen, die Cu-
jas auch an anderen Teilen seiner intensiven wissenschaftlichen Produktion
eingehend behandelt. Zuerst beschreibt er die allgemeinen und unterschied-
lichen Merkmale von leges, senatus consulta und consuetudo. Dann zeich-
net er bündig und schlaglichtartig den besonderen Ursprung der normativen
Kraft der senatus consulta innerhalb des Systems der römischen Rechtsquel-
len nach. Beide Themen sind von Bedeutung sowohl aus historiographischer
Sicht als auch als Zeugnisse für die exegetische Methode und hermeneutische
Kunst des Cujas und für die von ihm erzielten Ergebnisse.
1. Hinsichtlich der Unterscheidung zwischen leges und senatus consul
ta präzisiert Cujas die Auffassungen der Glossatoren über den Gesetzes
charakter der Senatsbeschlüsse. Was daraus resultiert – das wird aus einer
aus einer wissenschaftlich-historische Perspektive auch durch die Einfügung
des Paratitlon als Einleitung zu D. 1,3 in der glossierten Gothofredus-Ausgabe
des Corpus Iuris7) sichtbar –, bildet zugleich ein Beispiel für die Beziehung
Utrecht 1741, 47; zu Marans Herangehensweise an das Werk seines Lehrers s. P r é -
vo s t , Cujas (o. Fn. 1) 189f.
3) C u j a s , Paratitla (o. Fn. 1) 3–4.
4
) Unrichtig steht bereits bei Fa b r o t 1, 741 ‚l(ex) 11‘ statt ‚l(ex) ii‘; so dann auch
die späteren Drucke Opera I (Napoli) 725; Opera III (Prato) 19.
5
) Auch die ältere Literatur verwendet das Wort im Singular selten, und dann aber
lieber in der lateinischen Form paratitulus; so z.B. (und eben nur einmal) in M a r a n ,
Opera (o. Fn. 2) 89.
6) Daher die extreme Popularität der Cujas’schen Paratitla. Mit diesem Werk
strebte Cujas eine Erklärung der digesta anhand der institutiones an, und zwar mit
Erfolg. Es hatte einen erheblichen Einfluss auf die späteren Rechtsauffassungen,
vor allem in Frankreich; vgl. H . E . Tr o j e , Wissenschaftlichkeit und System in der
Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts, in: J. Bl ü h d o r n / J. R i t t e r (Hgg.), Philosophie
und Rechtswissenschaft, Frankfurt a.M. 1969, 75 = H . E . Tr o j e , Humanistische
Jurisprudenz, Goldbach 1993, 31*.
7) Corpus Iuris Civilis Iustinianei, cum commentaris Accursii … Studio et opera
I o a n n i s Fe h i Gaildorphensis IC., Tomus hic Primus Digestum Vetus continet,
Lugduni 1627, 32. Diese letzte gedruckte Ausgabe der Digesten zusammen mit der
Glossa Ordinaria basiert auf der zuletzt 1612 erschienenen Digestenausgabe von
Denis Godefroy (1549–1622); dazu E . S p a n g e n b e r g , Einleitung in das Römisch-
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est 293
zwischen den Rechtshumanisten und den Glossatoren in dem Sinne, wie sie
die neuere Forschung über Cujas hervorgehoben hat8). Cujas’ Auseinander-
setzung mit diesem Thema im Laufe seiner wissenschaftlichen Arbeit bietet
ferner ein deutliches Beispiel für seinen historistischen Ansatz, das heißt
für Cujas’ eigene Position9) innerhalb des breiten kulturellen Spektrums des
Rechtshumanismus. Darauf werde ich in den Abschnitten II und III eingehen.
2. Die hermeneutische Neuartigkeit und die wissenschaftliche Leistung
von Cujas zeichnen sich aber in Bezug auf die Entstehung und Rolle der Se-
natsbeschlüsse als Quelle zur Erzeugung von Recht noch deutlicher ab. Hier
geht das Interesse am von Cujas erzielten Ergebnis auch über historiogra-
phische und methodologische Aspekte hinaus. Der abschließende Satz des
Paratitlon, das Recht, das die Notwendigkeit begründet, sei das von den Se-
natsbeschlüssen geschaffene Recht (quod necessitas constituit, Senatuscon
sultum [est]), findet eine ausführlichere Erklärung in Cujas’ Observationes
(Obs. 14 c. 16.). Durch die Einbindung von juristischen und literarischen
Quellen bietet dort Cujas nicht nur eine systematisch kohärente Einordnung
der senatus consulta in die römischen Rechtsquellen, sondern begründet his-
Justinianeische Rechtsbuch oder Corpus iuris civilis Romani, Hannover 1817,
868–869. Wie jene des Gothofredus (schon seit 1576) ergänzt auch die Ausgabe von
Johann Fehe die mittelalterliche Glossa mit Cujas’ Paratitla. Dazu kommen hier noch
die Noten zur Glossa des Gothofredus und andere Auszüge aus Cujas hinzu, wie
die Notae in pandectas. Diese sind allerdings Exzerpte aus seinem postumen Werk.
Über die Bedeutung dieser „humanistischen Glossa“ s. H . E . Tr o j e , Graeca legun-
tur, Frankfurt a.M. 1971, 91ff., 154ff. und insb. 164ff.; sowie i d ., Crisis digestorum,
Frankfurt a.M. 2011, 147.
8) Ausführlich X . P r é vo s t , Reassessing the Influence of Medieval Jurispru-
dence on Jacques Cujas’ Method, in: P. J. D u Pl e s s i s / J.W. C a i r n s , Reassessing
Legal Humanism and its Claims, Edinburgh 2016, 88–107.
9
) Dazu P r é vo s t , Cujas (o. Fn. 1) 184–190; zur entgegengesetzten Strömung in-
nerhalb des Rechtshumanismus, die sich das Ziel setze, das römische Recht systema-
tisch wiederherzustellen, s. X . P r é vo s t , Ius in artem redigere, Ramisme et systém-
atisme chez quelques jurisconsultes humanistes français (Coras, Doneau, Grégorire),
RHDFE 97 (2019) 463–482; vgl. zu ihnen auch M . B o h a r, Méthode historique et
humanisme juridique, Le discours sur la difficulté et la méthode d’enseignement du
droit civil (1585) de Giulio Pace de Berigs (1550–1635), Paris 2019, 59ff.; M . Ave -
n a r i u s , „neque id sine magna Servii laude ...“, Historisierung der Rechtswissen-
schaft und Genese von System und Methode bei Donellus, TR 74 (2006) 61–93;
Tr o j e , Wissenschaftlichkeit (o. Fn. 6) 63f.; sowie die Beiträge von P. S t e i n , Sys-
tematization of private law in the sixteenth and seventeenth centuries und A . M a z -
z a c a n e , Methode und System in der deutschen Jurisprudenz des 16. Jh., beide in:
J. S c h r ö d e r (Hg.), Entwicklung der Methodenlehre in Rechtswissenschaft und Phi-
losophie vom 16. bis zum 18. Jh., Stuttgart 1998, 117–126 und 127–136.
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)294 Salvatore Marino
torisch die normative Befugnis des römischen Senats. Darauf werde ich in
den Abschnitten IV und V eingehen.
3. Alle diese Aspekte sollen nicht nur anhand der zu Cujas’ Lebzeiten veröf-
fentlichten Werke veranschaulicht werden, sondern auch insbesondere durch
Rückgriff auf die zwar verstreuten, aber aufschlussreichen Hinweise in sei-
nem postum edierten Werk, d. h. auf die in den unmittelbar nach seinem Tod
veröffentlichten Vorlesungen, die für die Ausgaben seiner Opera omnia ge-
sammelt wurden10). Diese ergänzen die zur Veröffentlichung gedachten exe-
getischen Werke11) und verdeutlichen ihre Implikationen. Die Untrennbarkeit
von Lehre und Forschung trifft für Cujas besonders zu, und das erklärt sehr
gut die Gründe für den ‚Hunger‘ nach Cujas’ unveröffentlichten Schriften, der
sich unmittelbar nach seinem Tod in ganz Europa ausbreitete. In diesem Bei-
trag versuche ich mich mit dieser umfangreichen und komplexen didaktischen
Produktion auseinanderzusetzen, insbesondere in den Abschnitten III und V.
I I . D a s Ve r h ä l t n i s z w i s c h e n R e c h t s a k t e n d e s Vol ke s ,
des Senates und des Kaisers
1. D i e a l t e Fr a g e s t el l u n g :
Die in der justinianischen Kompilation mehrmals ausgesprochene Gleich-
stellung der Kaiserkonstitutionen12) und der Senatsbeschlüsse13) mit den le
ges hatte die mittelalterlichen Rechtsgelehrten zu einem relativ differenzier-
10 ) Zur mühseligen und schwierigen Wiederherstellung der Vorlesungstexte des
Cujas ausführlich P r é vo s t , Cujas (o. Fn. 1) 111–123. Dabei soll man natürlich be-
rücksichtigen, dass Cujas die Veröffentlichung seiner Vorlesungen nicht beabsichtigt
hatte, dazu H . E . Tr o j e , Praelectiones Cuiacii, Vorlesungsnachschriften des Frank-
furter Syndicus Heinrich Kellner (1536–1589) aus seiner Studienzeit in Bourges
(1560–1561), Ius Commune 1 (1967) 189 = Tr o j e , Humanistische Jurisprudenz (o.
Fn. 6) 13*; vgl. u. § III.
11) Kommentierte Quellenausgaben, notae, Glossen und kurze exegetische Arbei-
ten bildeten den Hauptteil des von Cujas selbst veröffentlichten Werks, wie P r é vo s t ,
Cujas (o. Fn. 1) 142 hervorhebt. Das postum edierte Vorlesungsmaterial zeichnet ein
anderer Charakter aus. Während die Vorlesungen an Studenten und Schüler gerichtet
wurden, war Cujas’ Druckwerk für ein kultiviertes Publikum gedacht – mit der wich-
tigen Ausnahme der Paratitla (o. Fn. 6), dazu Tr o j e , Praelectiones (o. Fn. 10) 189.
12) Inst. 1,2,6 Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia,
quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potesta
tem concessit; vgl. auch Ulp. D. 1,4,1; C. 1,14,12,3 und 5; C. 1,17,1,17.
13) Inst. 1,2,5 Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit. Nam
cum auctus est populus Romanus in eum modum, ut difficile sit in unum eum con
vocare legis sanciendae causa, aequum visum est senatum vice populi consuli; vgl.
auch Pomp. D. 1,2,2,9; Ulp. D. 1,3,9.
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est 295
ten Ergebnis geführt14). Die Glossatoren beschäftigten sich mit dieser Frage15)
erst aus dem konkreten Anlass der normativen Befugnis des Senats des mit-
telalterlichen Roms, vertieften sie dann wegen ihrer indirekten Verknüpfung
mit der Frage nach der Autonomie der städtischen Statuten, Wirkung der
Herrschaftsübertragung vom Volk auf den Kaiser aufgrund der lex regia
sowie mit dem Recht der Körperschaften16).
Die Debatte entfaltete sich vor allem im 13. Jh., reichte aber auch bis in
das 14. Jh. hinein. Zum einen setzten sich die Juristen mit der ‚gesetzarti-
gen‘ Natur der senatus consulta auseinander, zum anderen versuchten sie,
die tatsächliche Tragweite der Befugnisse des Senats zu ermitteln angesichts
der erfolgten Übertragung der Befugnis zur Gesetzgebung an die Person
des Kaisers. Die Antwort auf die erste Frage ist in der Magna Glossa des
Accursius zusammengefasst: Im Vergleich zur allgemeinen lex stelle sich
das senatus consultum als ein besonderer, g e s e t z e s ä h n l i c h e r normativer
Akt dar17). Der Senat übe gesetzgeberische Gewalt aus, seine Gesetzgebung
sei aber jener des Kaisers untergeordnet. Über den Ursprung und Grad der
14) Dazu S . M a r i n o , Senatus Principi par est, I glossatori e la funzione norma-
tiva del senato romano, Iura 69 (2021) 449–483.
15) Die Diskussion ist in Accursius, Gl. non ambigitur ad D. 1,3,9 zusammen-
gefasst: „[…] Sed an hodie hoc opus possit facere Senatus? Responde: secundum
Ioannem non sic hodie, nisi princeps permiserit: ut C. eod. l. fi. [C. 1,14,12,5], quae
est contra: ubi dicit, quod solus princeps facit legem. Item facit ad idem, quia popu-
lus omne suum imperium in eum transtulit, ut Cod. De ve. iur. enu. l.j. §. Sed et hoc
studiosum [C. 1,17,1,7]. 2. Alii dicunt quod hodie potest populus Romanus et Senatus
eius facere legem, ut hic. Nec obstat dicta lex fi. quia solus imperator potest, id est
ipse solus, et nullus alius solus: et revocare potest populus Romanus quod concessit,
sicut et iudex qui delegat, cum tibi proprietas remanserit, ut hic. Nec obstat dicta
lex fi. quia solus imperator potest, id est ipse solus, et nullusalius solus: et revocare
potest populus Romanus quod concessit, sicut et iudex qui delegat cum sibi proprie-
tas remanserit: ut infra de offic. eius, cui man. est iur. l. j. [D. 1,21,1,1]. 3. Primam
laudo, secundum Hug(olinum)“. Der Text des Accursius ist hier nach der Ausgabe
von Fe h e (o. Fn. 7) 35 zitiert. Für einen Vergleich mit früheren Handschriften und
Digesteninkunabeln, s. M a r i n o , Senatus (o. Fn. 14) 452–453.
16) Siehe zu den einzelnen Themen D. L e e , Popular Sovereignty in Early Mo-
dern Constitutional Thought, Oxford 2016; E . H . K a n t o r ow i c z , Die zwei Körper
des Königs, Stuttgart 1992 [dt. Übers. des englischen Originals 1957]; G . R o s s i ,
Representation and Ostensible Authority in Medieval Learned Law, Frankfurt 2019;
F. C a l a s s o , I Glossatori e la teoria della sovranità, Milano 1957; J. P. C a n n i n g ,
Law, Sovereignty and Corporation Theory, 1300–1450, in: J. H . B u r n s (Hg.), The
Cambridge History of medieval political thought c. 350–c. 1450, Cambridge 1988,
454–476; vgl. M a r i n o , Senatus (o. Fn. 14) 447–451, Fnn. mit weit. Lit.
17
) Siehe Gl. neque ad D. 1,3,10: „Leges, nomen generale. Senatusconsulta, nomen
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)296 Salvatore Marino
Eigenständigkeit dieser Befugnis gingen die Meinungen jedoch auseinander.
In Azos Vorstellung hatte die Machtübertragung nichts an der ursprünglich
vom Volk erlangten Legitimation des Senats zur Gesetzgebung geändert,
nur dass sie jetzt der kaiserlichen Autorität untergeordnet sei18). Die Legiti-
mation des Senates bestehe fort, wie auch die Macht des Volkes, denn selbst
die Übertragung der Befugnis von Volk an den Kaiser sei weder vollständig
noch endgültig19). Für Accursius hingegen, der wie Irnerius von einer end-
gültigen Übertragung des imperium an den Kaiser ausging, hing auch die
Senatsbefugnis nunmehr vollständig vom Willen des Kaisers ab20).
Die Meinung des Accursius setzte sich durch. Die andere wurde aber durch
Odofredus und seine Schule weiter vertreten und hatte Einfluss – da der rö-
mische Senat das Modell einer gesetzgebenden universitas bildete – auf die
Rechtsschule von Orléans bei der dortigen Diskussion über die iura univer
sitatis21).
Auch methodisch war die Diskussion bemerkenswert, denn die Glossa-
toren verfügten über ein gewisses historisches Bewusstsein. Doch fehlt bei
ihnen eine umfassende Berücksichtigung der antiken Quellen, eine philolo-
gisch präzise terminologische Unterscheidung, eine kohärente Darstellung
dieser drei ‚Arten von Gesetzen‘ in dem antiken System der Rechtsquel-
speciale“; Gl. Senatus ad Inst. 1,2,5: „constituit, nam poterat facere legem …“; s. a.
o. Fn. 15.
18) Summa Azonis, Locuples iuris civilis thesaurus, Venetiis 1581, Sp. 28 ad
C. 1,16 de senatusconsultis: „[…] ideo elegit populus centum senatores, ut ipsi vice
populi consulerentur; et quicquid statuerent, lex esset […]. Et parificantur senatus
principi, utpote, cum habeatur vice populi, et ante Imperatorem per populum, et post
Imperatorem fuit per principem constitutus senatus […]. Quamvis autem senatuscon-
sulta per se valeant, ut dictum est, tamen Imperator ad maiorem eorum authoritatem
ea confirmat […]“.
19) Azonis Summa super Codicem, Papie 1506, Nachdr. Augustae Taurinorum
1966, ad C. 1,14 de legibus et constitutionibus: „[…] a populo autem Romano forte
et hodie potest condi lex, licet dicantur potestas translata in principe […] dicitum
enim translata id est concessa non quod populus omnino a se abdicaverit eam […]“;
zu Azos besonderen Auffassung vgl. W. Pe r r i n , Azo, Roman Law and Sovereign
European States, Studia Gratiana 15 (1972) 87–101.
20) Siehe o. Fn. 15; Diskussion und Literaturnachweise in M a r i n o , Senatus
(o. Fn. 14) 454–461.
21) Vgl. J a c o b u s d e R a v a n i s , Lectura super Digesto Veteri, Hs. Leiden ABL
2 (L) fol. 5vb: „Tu dixisti solus princeps, existens solus, potest condere legem. Pone:
numerus senatorum redactus est ad unum: ille unus poteritve facere legem? Quidam
dicunt quod sic, nam iura totius universitatis salvantur in uno […] “; dazu s. M a r i n o ,
Senatus (o. Fn. 14) 469–477, Fnn. mit Lit.
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est 297
len und schließlich eine historisch begründete Antwort auf die Frage nach
der Aktualität der normativen Befugnis des Senats. All diese Lücken füllte
Jacques Cujas.
2 . E i n e n e u e M e t h o d e:
Die im Italien des 14. Jh. entstandene Kulturbewegung des Humanismus
durchdrang im Laufe der darauf folgenden Jahrhunderte auch dank der be-
schleunigenden Kraft des Buchdrucks22) allmählich die Universitäten und
Kulturzentren Europas. Im Frankreich des 16. Jh. schlug sie eine besondere
auf das Recht23) fokussierte Richtung ein, deren neue Methode sich beträcht-
lich von der Vergangenheit unterschied. Insbesondere waren ihre Ziele an-
ders: Im Zentrum der Erforschung der Rechtshumanisten standen nun eher
die originalen Rechtstexte und ihre Wiederherstellung als deren Kommen-
tierung und Auslegung 24). Das betraf vor allem die Strömung des Historis-
mus, bei der die Wiederherstellung der in der justinianischen Kompilation
überlieferten Rechtstexte in ihrer ursprünglichen Form unter Beseitigung
von Textveränderungen im Vordergrund stand 25). Dieser Ansatz ist bei Cujas
auch in Bezug auf die Rolle des römischen Senats erkennbar.
22 ) Dazu S . F ü s s e l , Gutenbergs Bedeutung für die Geistes- und Kulturgeschich-
te der Neuzeit, in: J. M . L i e s (Hg.), Wahrheit – Geschwindigkeit – Pluralität, Chan-
cen und Herausforderungen durch den Buchdruck im Zeitalter der Reformation, Göt-
tingen 2021, 21–37; sowie im Allgemeinen M . G i e s e c k e , Der Buchdruck in der
frühen Neuzeit, Frankfurt a.M. 1998.
23) Zutreffend bemerkt Tr o j e , Wissenschaftlichkeit (o. Fn. 6) 63: „Juristen er-
scheinen, warum auch immer, in der Geschichte häufig als Nachzügler geistiger
Strömungen. Der Rechtshistoriker darf vermuten, dass einer Bewegung unter Juris-
ten vor einer gewissen Anzahl von Jahren entsprechende, meist tiefere Bewegungen
im allgemeinen Denken vorausgegangen sein werden und dass umgekehrt ein im
Jahre A bei den Philosophen diskutiertes Anliegen im Jahre A plus X die juristische
Literatur berühren wird.“
24
) P r é vo s t , Cujas (o. Fn. 1) 87. Eine besondere Rolle kommt den Rechtshuma-
nisten („das heroische Zeitalter der Jurisprudenz“) in Jherings wirkungsvoller Dar-
stellung der „Flucht aus dem Leben“ der modernen Jurisprudenz zu, s. R . v. J h e -
r i n g , Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft?, hg. von O. B e h r e n d s , 2. Aufl.
Göttingen 2009, 61: „Die Titanenarbeit erforderte Titanenkräfte […] Jene Riesen
versammelten auf der steilen Höhe nur ein kleines Häuflein um sich, die Masse
blieb in den Niederungen; nicht sie hatte sich von der Wissenschaft zurückgezogen,
sondern die Wissenschaft von ihr.“
25
) Siehe o. Fn. 9; zur ‚Historisierung‘ des römischen Rechts in Folge des Rechts-
humanismus s. Tr o j e , Verwissenschaftlichung und humanistische Jurisprudenz, in:
i d ., Humanistische Jurisprudenz (o. Fn. 6) 61, 275*f.; für ein konkretes Beispiel von
Cujas in Bezug auf die Senatsbeschlüsse s. u. § III.3; im Bezug auf die Bürgschafts-
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)298 Salvatore Marino
Beispielhaft dafür ist seine Auseinandersetzung mit der präliminaren Fra-
ge der Beziehung zwischen den Rechtsquellen, wie sie in den Digesten er-
scheinen. In Einklang zu bringen waren hier die von Papinian 26) aufgelisteten
und von Pomponius27) in ihrer historischen Entwicklung28) beschriebenen
partitiones des ius civile29). Dabei war gerade der Beginn von Pomp. l. s.
enchirid. D. 1,2,2,12 exegetisch schwierig. Insbesondere ging es um die Aus-
legung der Worte iure id est lege, wie ihn die littera Florentina30) und die
mittelalterlichen litterae vulgatae31) überliefern. Inhaltlich hatten schon die
konfusion S . M a r i n o , Quando debitore e garante si riuniscono in una sola persona,
Index 45 (2017) 479f.
26) Pap. 2 def. D. 1,1,7: Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis scitis, senatus
consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit. 1. Ius praetorium est,
quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis
gratia propter utilitatem publicam. Quod et honorarium dicitur ad honorem prae
torum sic nominatum.
27) Pomp. l. s. enchirid. D. 1,2,2,12: Ita in civitate nostra aut iure, id est lege,
constituitur, aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium inter
pretatione consistit, aut sunt legis actiones, quae formam agendi continent, aut plebi
scitum, quod sine auctoritate patrum est constitutum, aut est magistratuum edictum,
unde ius honorarium nascitur, aut senatus consultum, quod solum senatu constitu
ente inducitur sine lege, aut est principalis constitutio, id est ut quod ipse princeps
constituit pro lege servetur.
28
) D. N ö r r, Divisio und partitio, Berlin 1972, 8: „Zum anderen kontami-
niert er – einem häufiger festzustellenden antiken Denkansatz gemäß – den his-
torischen und den systematischen Ansatz“; zum Aufbau der Pomponiusstelle s.
D. N ö r r, Pomponius oder Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen, in:
ANRW II.15, 517f.
29) Dazu N ö r r, Divisio (o. Fn. 28) 7ff.; M . B r e t o n e , Motivi ideologici dell’En-
chiridion di Pomponio, Labeo 11 (1965) 7–35, insb. 10ff.; W. F l u m e , Gewohnheits-
recht und römisches Recht, Düsseldorf 1975, 7ff. Dazu kommt dann noch die (im
Ausgangsparatitulus erwähnte) Einteilung Modestins hinzu, unten § IV.3.
30
) A . C o r b i n o / B . S a n t a l u c i a (Hgg.), Justiniani Augusti pandectarum codex
Florentinus, Firenze 1988, 21v; zur Ausgabe s. D. N ö r r, Zur neuen Faksimile-Aus-
gabe der littera Florentina, Iura 39 ([1988] 1991) 121–136; zu Cujas’ Zugang zur
Handschrift der littera Florentina u. Fn. 92; zur Geschichte und Bedeutung des Co-
dex s. u. a. W. K a i s e r, Zur Herkunft des Codex Florentinus, Zugleich zur Floren-
tiner Digestenhandschrift als Erkenntnisquelle für die Redaktion der Digesten, in:
A . S c h m i d t - R e cl a (Hg.), Sachsen im Spiegel des Rechts, Ius Commune Propri-
umque, Köln 2001, 39–57.
31
) Vgl. z. B. Hs. Frankfurt, Universitätsbibl., Barth. 9 (Digestum vetus cum Glos-
sa ordinaria; Bologna, um 1300), fol. 4r. Die aus dem Frankfurter Bartholomäusstift
stammende Handschrift ist „wohl bolognesische Arbeit vom Ende des XIII. Jahrhun-
derts“, so R . S c h i l l i n g in: G . S w a r z e n s k i (Hg.)/ R . S c h i l l i n g (Berab.), Die
illuminierten Handschriften und Einzelminiaturen des Mittelalters und der Renais-
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est 299
Glossatoren den Satz richtig verstanden: Der Verweis bezieht sich nicht auf
das Gesetz im Allgemeinen, sondern spezifisch auf die XII Tafeln32). Die For-
mulierung war also ungeschickt, aber verständlich. Cujas ging jedoch über
die bloße Auslegung hinaus und schlug in seinem Commentarius zu D. 1,2
eine Verbesserung des Textes vor:
Comm. ad D. 1,2: aut iure id est lege] Scribendum videtur, aut ius, id est, quod
lege constituitur. Lege scilicet XII. et quod ex ea fluxit iure civili et legitimis
actionibus33).
Dank der Emendation von aut iure id est lege constituitur zu aut ius, id
est quod lege constituitur34) ist der Bezug eindeutig und der Satz besser les-
bar. Dabei ging Cujas’ überzeugende Textrekonstruktion über eine gewöhnli-
che philologische Wiederherstellung des Textes hinaus, da er gleich mehrere
Wörter ergänzte. Die von ihm vorgeschlagene Lesart konnte sich deshalb
auch nicht durchsetzen. Sowohl die littera Norica35) als auch Torellis36) Aus-
gabe der littera Florentina gaben den überlieferten Text wieder, und nicht
einmal Mommsen sah, Jahrhunderte später, die Notwendigkeit, die Emen-
dation von Cujas zu erwähnen37).
sance in Frankfurter Besitz, Frankfurt a.M. 1929, Nr. 83, 89; dazu auch H . B u c k ,
Ms Barth 9, Digestum Vetus, in: G . Pow i t z / H . B u c k , Die Handschriften des Bar
tholomaeusstifts und des Karmeliterklosters in Frankfurkt am Main, Frankfurt a. M.
1974, 22–24; zur sog. littera Bononiensis oder Vulgata, auch mit Beziehung auf die
späteren humanistischen Editionen, s. Tr o j e , Crisis (o. Fn. 7) 19ff. sowie i d ., Grae-
ca leguntur (o. Fn. 7) 10ff.
32) Gl. lege ad D. 1,2,2,12: hic ponitur pro lege XII tabularum; zum Verhältnis
des Pomponiustexts mit dem Zwölftafelnkommentar des Sextus Aelius Paetus Catus
(2. Jh. v. Ch.) s. O. B e h r e n d s , Der Kommentar in der römischen Rechtsliteratur, in:
i d ., Institut und Prinzip, Göttingen 2004, 232f. mit Fn. 19; sowie B r e t o n e (o. Fn.
29) 11, 13, nach dem sich Pomponius allgemein „alla lex come momento fondamen-
tale dell’ordinamento cittadino“ bezieht.
33) J. C u j a s , De origine iuris ad Pomponium Commentarius, in: Iacobi Cuia-
ci Observationum lib. XXI. XXII. XXIII. XXIV, Eiusdem De origine iuris ad
Pomponium Commentarius, et in libros IV Institutionum Notae posteriores, quibus
parum aut nihil prioribus derogatur, ita ut et has et illas suo periculo ratas esse velit,
Parisiis 1585, 101; Fa b r o t 1, 916; Opera I (Napoli) 898; Opera VI (Prato) 292.
34
) Auch bei Fabrot und den hierauf basierenden Ausgaben sind nur die Worte
aut ius kursiviert. Die ganze Emendation ist aber offensichtlich aut ius, id est quod.
35
) G . H a l o a n d e r (Hg.), Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta, I–III,
Norembergae 1529 (= Frankfurt a.M. 2005) Tomus I, 5.
36) L . u. F. Ta u r e l l i u s (Hgg.), Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta
ex Florentinis pandectis repraesentati, I–III, Florentiae 1553 = Frankfurt a.M. 2004,
Tomus I, 4.
37
) T h . M o m m s e n (Hg.), Digesta Iustiniani Augusti, Bd. 1, Berlin 1870, 5.
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)300 Salvatore Marino
Nichtdestotrotz blieb Cujas’ textkritischer Ansatz nicht ohne Echo. Seine
Idee tauchte in der Zeit der Interpolationenkritik wieder auf, wohl aber ohne
auf ihn zurückgeführt zu werden. So werden sowohl Philipp Eduard Huschke
in seinen postum publizierten textkritischen Beiträgen 38) als auch Vittorio
Scialoja in einer Anmerkung seiner Mailänder Ausgabe der Digesta39) noch
vorschlagen, iure id est lege zu ius est quod lege zu korrigieren. Beide Vor-
schläge, die in den Index Interpolationum aufgenommen wurden40) und Ak-
zeptanz fanden41), sind Varianten desjenigen von Cujas42).
3. L e g e s e t s e n a t u s c o n s u l t a : Ä h n l i c h ke i t e n u n d Un t e r
s c h i e d e:
Was leges und senatus consulta unterscheidet und was sie gemeinsam ha-
ben, wird von Cujas an verschiedenen Stellen diskutiert. Seine Ausführun-
gen lassen sich folgendermaßen gruppieren.
a) Ähnlichkeiten:
Der Ausgangspunkt ist zunächst, dass nicht alle Rechtsquellen gleich-
wertig sind. Unter den am Anfang der Institutionen Justinians aufgelisteten
Quellen des ius scriptum43) weisen insbesondere die Rechtsakte des Kaisers,
des Senates und des Volkes einen besonderen normativen Charakter und
38) M . W l a s s a k , Weitere Beiträge zur Pandektenkritik aus Ed. Huschkes Nach-
lass, ZRG RA 9 (1888) 335.
39) P. B o n f a n t e /C . Fa d d a /C . Fe r r i n i / S . R i c c o b o n o / V. S c i a l o i a (Hgg.),
Digesta Iustiniani Augusti, I, Milano 1908 = Bd. I–II Milano 1960, 33. Ziel dieser
Ausgabe war allerdings, den textkritischen Apparat so kurz wie möglich zu belassen
(s. Praefatio ibidem ix).
40) E . L e v y/ E . R a b e l (Hgg.), Index Interpolationum I, Weimar 1929, 4: „a) iure
id corr.; ius est, quod; constituitur corr.; constitutum; Huschke SZ 9, 335; – b) iure id
est corr.; ius est quod; Scialoja Dig. Milan. ad h.l.“
41) Zur Emendation durch Scialoja s. N ö r r, Divisio (o. Fn. 28) 8: „Für Pomponius
scheint ius der Oberbegriff zu sein“; ibidem Fn. 29: „wenn man der recht einleuchten-
den Emendation Scialojas in der Mailänder Digestenausgabe folgt“; auch B r e t o n e
(o. Fn. 29): „La frase […] non è in ordine […] e si può supporre che egli dicesse (come
suggerisce lo Scialoja) aut est ius, quod lege constituitur“.
42) Zum Verhältnis zwischen der radikalen Textkritik Ende des 19., Anfang des
20. Jhs. und der Textkritik der Bourges-Schule s. Tr o j e , Verwissenschaftlichung
(o. Fn. 25) 279*f. Unter Umständen können die Rechtshumanisten als Wegbereiter
der Interpolationenforschung angesehen werden, jedoch unter Berücksichtung des
entscheidenden Unterschiedes, dass ihr Ziel, anders als das der Interpolationenfor-
schung, die Wiederherstellung des justinianischen und nicht des klassischen Rechts
war. Übrigens war Cujas vorsichtig im Hinblick auf Interpolationen, s. P r é vo s t ,
Cujas (o. Fn. 1) 235, 239.
43) Inst. 1,2,3–8.
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est 301
damit eine Ähnlichkeit auf, was sie z.B. von dem Edikt des Prätors unter-
scheidet. Das erklärte Cujas in seiner 1575–76 in Bourges44) gehaltenen und
postum in die Recitationes in Codicem aufgenommene Vorlesung:
Recit. ad C. 5,30: […] Non est igitur praetoris edictum legi simile: senatusconsul-
tum est legi similis45): constitutio principis est legi similis. Idem noo (lies: non)
dicitur de edicto praetoris, sed dicitur tantum edictum Praetoris modicam obtinere
iuris auctoritatem, § pretorum, Instit. de iur natur. [I. 1,2,7] Edictum praetoris
partem esse iuris, non legis […]46).
Anders als die drei ‚gesetzesähnlichen‘ (legi similes) Rechtsakte hat das
Edikt des Prätors nur (tantum) Rechtskraft (iuris auctoritatem) von gerin-
gerer Art (modicam), da es keinen legislativen Charakter hat (partem iuris
non legis).
Hier liegt aber möglicherweise ein Satzfehler (oder ein Fehler in der für
den Druck bei Fabrot benutzten Vorlage vor) und ein non ist ausgefallen47).
Denn in den Institutionen Justinians ist von non modicam auctoritatem die
Rede48) und die Litotes bedeutet eine Verstärkung (‚nicht unerheblich‘, ‚be-
trächtlich‘)49). Bei Cujas geht es also hier wahrscheinlich nicht um eine ‚nor-
44) Die Vorlesung zu C. 5,30 hielt Cujas 1575 oder in dem darauffolgenden Jahr
während seiner dritten Professurzeit in Bourges, s. P r é vo s t , Cujas (o. Fn. 1) 59, 63,
Annexe, 518.
45) So Fa b r o t 9, 581; legi simile: Opera IX (Napoli) 557; Opera IX (Prato) 838.
46) J. C u j a s , Recitationes solemnes sive commentarii in Quintum librum Codi-
cis, ad Titulum XXX: De legitima tutela, in: Fa b r o t 9, 581; Opera IX (Napoli) 557;
Opera IX (Prato) 838.
47
) Dabei handelt es sich um einen häufigen Fehler der Textüberlieferung, mit dem
sich gerade die Rechtshumanisten oft auseinandersetzten mussten, s. H . E . T r o j e ,
Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluss des Humanismus, in:
H . C o i n g (Hg), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen
Privatrechtsgeschichte II.1, München 1977, 646. Mit einer fehlenden Negation be-
schäftigt sich Cujas in der allerersten seiner Observationes, s. Iacobi Cuiacii Ob-
servationum et emendationum libri II, Lutetiae 1556, lib. I. cap. I, 5–6: „restituta
negatio in l. apud procons. D. de manum. vind.“; Fa b r o t 3, 1; Opera 3 (Napoli) 1, 3
(Prato). Für einen komplexen Fall unklarer Textüberlieferung s. auch S . M a r i n o , La
(doppia) negazione mancante in Scevola D. 46,3,93,1–2 e in Papiniano D. 46,3,95,3,
BIDR 111 (2017) 207–235.
48
) Inst. 1,2,7: Praetorum quoque edicta non modicam iuris optinent auctoritatem
[…].
49
) Vgl. zur Litotes J. B . H of m a n n /A . S z a n t y r, Lateinische Syntax und Sti-
listik, München ²1972 = 1997, 777f. Der Litotes non modicam in Inst. 1,27 entspricht
amplissimus ius in Gai. Inst. 1,6: Ius autem edicendi habent magistratus populi Ro
mani. Sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini …
Die Verstärkung kann demzufolge sowohl im qualitativen als auch im quantitativen
Sinne verstanden werden.
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)302 Salvatore Marino
mative Kraft geringerer Art‘ (tantum … modicam … iuris auctoritatem),
sondern eher um ‚Rechtskraft allein‘ (tantum … iuris auctoritatem) des edic
tum praetoris, die, obwohl beträchtlich, im Gegensatz zur Gesetzeskraft der
anderen Rechtsakte steht. Die Unterscheidung dient jedenfalls Cujas, um
damit die besondere Regelung der datio tutoris50) zu erklären, wonach nur
Volk, Kaiser oder Senat – und nicht etwa der Prätor – jemanden zum gesetz-
lichen tutor machen können. Wie er in dem vorhergehenden Text diskutiert,
war der Anlass für die Ausführung:
Nam si veram istius iuris originem quaeramus et spectemus, si libeat adire fontes,
et non rivulos consectari (coosectari Fabr), sola lex heredem facit, vel senatus, vel
Princeps, §. Quos autem. Instit. de bon. poss. Sola lex tutorem facit, vel senatus
(seoatus Fabr.), vel princeps, l. muto, § tutoris D. de tut. [D. 26,1,6,2] Tres dico,
legem, id est, populum, senatum, et principem. Praetor autem non facit tutorem,
sed dat iubente (iubeote Fabr.) lege Attilia et confirmante dationem. Nec ullum
extat praetoris edictum, quo tutor detur51).
Gewiss wird der Vormund durch den Prätor bestellt, die Bestellung erfolgt
jedoch auf der Grundlage eines Volksgesetzes, eines Senatsbeschlusses oder
einer Kaiserkonstitution52). Ihnen steht es zu, einen tutor zuzuweisen, das
imperium des Magistrates schließt diese Befugnis nicht automatisch ein53).
Will man sich den Quellen ( fontes) des römischen Rechts zuwenden und sich
nicht mit seinen Rinnsalen (rivulos) zufriedengeben, so Cujas, muss man die
lex und die beiden ihr gleichgestellten Rechtsakte von denen unterscheiden,
die zwar ius hervorbringen, aber anderer Art sind.
b) Unterschiede:
Besteht die Ähnlichkeit zwischen Volksgesetzen, Kaiserkonstitutionen
und Senatsbeschlüssen darin, dass sie im Vergleich zu den anderen Quellen
einen besonderen rechtssetzenden Charakter haben, unterscheiden sie sich
doch durch einige Merkmale.
50 ) Ulp. 38. Sab. D. 26,1,6,2: Tutoris datio neque imperii est neque iurisdictio
nis, sed ei soli competit, cui nominatim hoc dedit vel lex vel senatus consultum vel
princeps.
51
) C u j a s , Recitationes solemnes in libros Codicis (o. Fn. 46), in: Fa b r o t 9, 581;
Opera IX (Napoli) 557; Opera IX (Prato) 837.
52
) Wie die Lex Atilia (in der Stadt Rom), die Leges Iulia et Titia (in den Pro-
vinzen) und die Bestimmungen aus der Zeit des Kaisers Claudius und Mark Aurel;
dazu D. N ö r r, Zur Palingenesie der römischen Vormundschaftsgesetze, ZGR RA
118 (2001) 27–33; M . K a s e r / K . H a c k l , Das römische Zivilprozessrecht, Mün-
chen 1996, 187 Fn. 32; A . Wa c k e , Zur iurisdictio voluntaria, ZRG RA 106 (1989)
197f.
53
) So eben N ö r r, Zur Palingenesie (o. Fn. 52) 27f., der allerdings ausdrücklich
davor warnt, diesen Text „zur Begründung von Verfassungs- oder Verfahrenstheo-
rien“ zu verwenden.
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est 303 Dies gilt insbesondere für die senatus consulta. Die Senatsbeschlüsse unterscheiden sich nämlich von Haus aus und begrifflich von den leges, an- ders als z.B. die plebiscita. Diesen in unserem Ausgangtext Parat. ad D. 1,3 zusammengefassten Aspekt – Senatsbeschlüsse sind die Entscheidungen des Senats; Gesetze sind die Entscheidungen des Volkes und der Plebs – hatte Cujas ausführlicher in einer nach 156654) gehaltenen und postum veröffentli- chen Vorlesung im Bezug auf Gai. 6. ad leg. XII Tab., D. 50,16,238 pr. (plebs est ceteri cives sine senatoribus) erklärt: Recit. ad D. 50,16,238 pr.: […] Lex 12. Tab. dixit scitum populi, non, scitum plebis, quoniam eo tempore plebi non erat ius ferendae legis, nullique erant tribuni plebis. Dixit igitur scitum populi, quod plus est quam scitum plebis. Nam in populo omnes ordines, in plebe (ut ait) sunt ceteri cives sine Senatoribus. […]55).. Gesetz im eigentlichen Sinne ist das Resultat eines Willensaktes des gan- zen römischen Volkes. Ursprünglich gab es für eine allgemein bindende Ent- scheidung des römischen Volkes einen einzigen Rechtsakt, die lex. Hingegen waren das scitum plebis und das consultum Senatus Ausdruck nur eines Teils des Volkes, jeweils der Plebs und des Patriziats. Außer Acht ließ Cujas die staatsrechtlich relevante (und von den modernen Alt- und Rechtshistorikern besonders diskutierte) Frage der Bestätigung des Volksgesetzes durch die auctoritas des Senats und die Tatsache, dass die lex publica gerade dadurch den Gesamtwillen des römischen populus und se natus erfassen konnte56). Seine Darstellung gibt hier aber das ursprüngliche symmetrische Schema klar wieder: Die Plebejer ohne die Patrizier äußerten sich mittels Plebiszits, die Patrizier ohne die Plebs mittels Senatsbeschlusses. Setzt man die Senatoren mit den Patriziern gleich57), stellte das consultum 54 ) P r é vo s t , Cujas (o. Fn. 1) Annexe 516, 533. 55 ) J. C u j a s , Recitationes solemnes (sive Commentarii) ad Titulum XVI libri 50 Digestorum, De verborum significatione, ad Leg. 238, in: Fa b r o t 8, 696; Opera VIII (Napoli) 646, Opera VI (Prato) 1830. 56) Die Pomponiusstelle bietet eine indirekte Bestätigung dafür, dass ein Senats- beschluss benötigt wurde, damit ein Volksgesetz durch die auctoritas des Senates allgemeinverbindlich werden konnte. Anders als die Gesetze brauchen die plebiscita hingegen nicht die auctoritas des Senates, und das blieb auch nach der Lex Hortensia so, s. W. K u n k e l / R . W i t t m a n n , Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik, 2: Die Magistratur, München 1995, 639; J. Bl e i c k e n , Lex publica, Berlin 1975, 95 Fn. 23; K .- J. H öl k e s k a m p , Senatus populusque romanus, Die politische Kultur der Republik, Stuttgart 2004, 67f.; C . Pe l l o s o , Along the Path Towards Exaequatio: Auctoritas Patrum and Plebiscita in the Republican Age, in: A . G a l l o / P. B u o n g i o r n o / S . L o h s s e , Miscellanea senatoria II, Stuttgart 2022. 57) Wie eben Gaius in D. 50,16,238 pr. tut und was ungefähr der Lage zur Zeit der XII Tabulae bis zumindest zur endgültigen Gleichstellung von Plebejern und Patriziern in Folge der Leges Liciniae-Sextiae (367 v.Chr.) entsprechen konnte; s. ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)
304 Salvatore Marino
des Senats also das patrizische Gegenstück des plebejischen scitum in die-
sem Sinne dar.
Doch war diese Symmetrie nicht perfekt, denn das Plebiszit lag eigentlich
näher an dem Volksgesetz als der Senatsbeschluss. Das ist aus der Termino-
logie ersichtlich und Cujas betont dies. Für die Entscheidung der Plebs ist
das Verb sciscere bezeugt. Wird die lex in den Quellen als scitum populi
definiert, so ist der Unterschied zwischen dem scitum populi und dem scitum
plebis quantitativ (scitum populi, quod plus est quam scitum plebis). Zwar
scheinen die XII Tafeln den Ausdruck scitum populi nicht enthalten zu ha-
ben58); Cujas kann aber darauf verweisen, weil der Ausdruck bei Festus59)
und Livius60) belegt ist und das Wort im Zusammenhang mit den XII Tafeln
vorkommt61).
Schließlich wurde dieser quantitative Unterschied durch die Lex Horten-
sia (wohl 287 v. Chr.) ausgeglichen: Die plebis scita sind den leges gleich-
gestellt. Scitum plebis und scitum populi wurden seitdem in einem einzigen
Gesetzesbegriff vereint, lex. Damit begann der Gesetzesbegriff auch nor-
mative Rechtsakte einzuschließen, die ursprünglich andere Namen trugen,
weil sie nur von einem Teil des Volkes ausgingen. Die der terminologischen
Verwandtschaft entsprechende Entwicklung konnte durch die philologische
Analyse des Wortes nachvollzogen werden.
jedoch die Literatur zur Identifikation der von den Quellen bereits seit dem Ende
der Königzeit belegten patres conscripti (vgl. Livius 1,1,10–11; Dion. Hal. 5, 13,2;
Fest. 304L) und zu den (vielleicht weder Patrizier noch Plebejer) gentes minores, zu
denen die conscripti hätten gehören können; dazu nur D. M u s t i , Patres conscripti
(e minores gentes), Mél. École française de Rome, Antiquité 101 (1989) 207–227;
A . M o m i g l i a n o , Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei, in: Les ori-
gines de la République romaine, Genève 1967, 199–221; K .- J. H öl k e s k a m p , Die
Entstehung der Nobilität, Stuttgart 1987, 32f.; F. X . Ry a n , Rank and Participation
in the Republican Senate, Stuttgart 1998, 107–109, 139.
58
) Vgl. M . H . C r a w fo r d , Roman Statutes II, London 1996, 578ff.
59
) Fest. 372L: Scita plebei appellantur ea, quae pleps suo suffragio sine patribus
iussit, plebeio magistratu rogante. Fest. 442L: Scitum populi ... ‹magistr›atus patri
cius ... ‹su›ffragis iussit ...us ex patribus et ... iam leges scrib‹ta ...
60) Vgl. z.B. Liv. 45,25,7: … ut nullum de ea re scitum populi fieret …
61
) Den Ausdruck decemviralia scita findet man bei Arnobius, adv. Nat. 4,34,7:
Carmen malum conscribere, quo fama alterius coinquinetur et vita, decemviralibus
scitis evadere noluistis inpune, im Zusammenhang mit der von Cic. rep. 4,10,11 er-
wähnten Regelung aus XII Tab. 8.1; dazu C r a w fo r d , Roman Statutes II (o. Fn. 58,
677ff.). Mit allgemeinem Bezug auf die Gesetzgebung vgl. auch Cic. de leg. 2,11: …
beatam inventas esse leges, eosque, qui primum eius modi scita sanxerint, populis
ostendisse …
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est 305
c) Consulere:
Bei den senatus consulta scheint der Unterschied nicht bloß quantitativ.
Der lex steht der Senatsbeschluss als normativer Akt terminologisch gegen-
über62). Diese Entscheidung wird consultum genannt und consulere bezeich-
net die eigentliche Tätigkeit der Senatoren, wie Cujas in seinen Observa-
tiones anmerkt (Obs. 6 c. 30): „… Consulere dicuntur senatores l. 2. D. ad
Velleia. [D. 16,1,2]“63). Der Unterschied ist qualitativ. Das consultum der Se-
natoren ist der lex ähnlich, doch es ist per definitionem keine lex: Es ist eben
das, was solus senatus decrevit sine lege 64). Es kann ius schaffen65), aber ius
sine lege und nicht ius quod lege constitutum.
Andererseits erklären die Institutionen Justinians aber auch, dass durch
sein consultum der Senat iubet und constituit66), also genau wie die lex67).
Nicht ohne Zweideutigkeit fügen sie jedoch noch hinzu, dass dies aus Billig-
62) Doch bestand eine terminologische Verwandtschaft – Cujas beschäftigt sich
aber nicht damit – auch zwischen consultum und scitum. Denn wie decretum und
consultum wurde auch scitum im Lateinischen verwendet, um (in der Bedeutung
von Lehrsatz bzw. Grundsatz) der griechischen δόγμα entsprechend philosophische
Konzepte wiederzugeben, vgl. K . E . G e o r g e s , Ausführliches lateinisch-deutsches
Handwörterbuch II, Hannover 81918 = Darmstadt 1998, Sp. 2535f. s.v. scītum; vgl.
z. B. Seneca ep. 95,10: Praeterea nulla ars contemplativa sine decretis suis est, quae
Graeci vocant dogmata, nobis vel decreta licet appellare vel scita vel placita; quae
et in geometria et in astronomia invenies.
63) J. C u j a s , Ad titulum Digestorum de excusationibus commentarius, Obser-
vationum lib. VI. VII. VIII., Lugduni 1664, cap. 30, 63; Fa b r o t 3, 172; Opera III
(Napoli) 159; Opera I (Prato) 254; mehr zu Cujas’ Observationes u. Fn. 128.
64) Vgl. o. Fn. 56–57 und J. Bl e i c k e n , Lex Publica (o. Fn. 56) 244: „Obwohl der
Senat von dem Begriff der lex her nicht Kontrahent ist, haben wir seine Beteiligung
an dem Willensbildungsprozeß als eine Norm anzusehen.“.
65) Ulp. 16 ed., D. 1,3,9 pr.: Non ambigitur senatum ius facere posse.
66) Inst. 1,2,5: Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit. nam
cum auctus est populus Romanus in eum modum, ut difficile sit in unum eum convo
care legis sanciendae causa, aequum visum est senatum vice populi consuli.
67) Vgl. die Definition von lex als generale iussum populi bei Ateius Capito in
Gell. 10,20,2: Lex, inquit, est generale iussum populi aut plebis, rogante magistratu.
Noch offensichtlicher als bei Justinian ist die Gleichstellung bei den Institutionen
des Gaius (von denen Inst. 1,2,5 abweicht), vgl. Gai. Inst. 1,4: Senatus consultum
est, quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis fuerit
quaesitum. Durch die präzisierende Angabe idque legis vicem optinet verlagert Gaius
nämlich den inhaltlichen Fokus von vice populi consuli zu vicem legis und daher von
der Legitimationsebene auf die normative Ebene; zu der Gaiusstelle s. die jeweiligen
Beiträge in: S . L o h s s e / P. B u o n g i o r n o , Die Senatus consulta in der klassischen
Jurisprudenz, Stuttgart 2022.
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)306 Salvatore Marino
keit geschah: aequum visum est senatum vice populi consuli. Die Frage, wie
sich dies auf die normative Kraft der senatus consulta auswirkt, bleibt offen.
Noch einmal wird die philologische Untersuchung der Schlüssel zum Ver-
ständnis der eigentlichen Tätigkeit des Senates. Die genauere Bedeutung des
Wortes consulere diskutiert Cujas mit exegetischer und philologischer Akri-
bie in seinen Notae in libros Institutionum68):
Nota ad consuli, Inst. 1,2,5: Id est, rogari. unde illud: Consul consule: et Accius
in Bruto: Qui recte consulat Consul cluat. denique consulere commune est nomen
Consulis qui senatum consulit, et Senatus qui qua de re consultus est consulit,
atque decernit. unde et S.C. nomen. et recte in Velleiano, De ea re universi ita
consuluerunt: et Tertull. in apologetico, hoc69) Senatus consulit70).
Das Resultat stellt die Symmetrie zwischen lex und senatus consultum
wieder her, denn consulere bezeichnet sowohl die an den Senat gerichte-
te Anfrage eines Magistrats, der um einen Beschluss ersucht, als auch den
vom Senat gefassten Beschluss selbst71), der über die Anfrage entscheidet.
Die Bedeutung von vice populum consuli sei daher analog zum rogari bei
der lex populi zu verstehen: über den Antrag des zuständigen Magistraten
zu beschließen72).
68) Das in den Gesamtausgaben (o. Fn. *) als ‚Notae in IV libros Institutionum
D. Iustiniani‘ betitelte Werk ist die Vereinigung von zwei verschiedenen Werken, den
Notae in Libros Institutionum (1556) und den Notae posteriores in libros IV Institu-
tionum (1585, o. Fn. 33). Die ersten (deshalb auch notae priores genannt) hatte Cujas
schon während seiner Tolosaner Professurzeit veröffentlicht, um dem Anliegen der
Fakultät nachzukommen, einen didaktisch gedachten Kommentar zu den Institu-
tionen anzufertigen. Die letzten publizierte er während seiner dritten Professurzeit
in Bourges, und sie sind viel ausführlicher und besser ausgearbeitet als die 30 Jahre
älteren. Die kommentierte Ausgabe der Institutionen ist nicht erhalten, aber die No-
tae priores erschienen 1559 separat in Lyon, s. P r é vo s t , Cujas (o. Fn. 1) 45f. mit.
Fn. 120, 106f. mit. Fn. 104, Annexe 512.
69) So die Ausgabe der Notae posteriores in libros IV Institutionum 1585 (o.
Fn. 33). Fa b r o t 1, 10 hat ita (vielleicht eine Korrektur, s. ebenda Fn. 70 Anm. q und
unten § III.2.b); und so auch die Nachdrucke.
70) J. C u j a s , Notae posteriores in libros IV Institutionum (o. Fn. 33) 133 Nr. 17;
Fa b r o t 1, 10 Nr. *22; Opera I (Napoli) 10 Nr. *22; Opera II (Prato) 618 Nr. *22.
Die folgenden Scholien sind in den Gesamtausgaben (o. Fn.*) unter dem Text ange-
merkt: Zu rogari: m) Glossae latinogr. consulit; πυνθάνεται. L. Florus l. 7 per nuncios
consulenti. Zu consuli: n) Trebell. Pollio in trig. tyr.; zu Bruto o) Apud Varron. 5. de
ling. lat. Zu consuluerunt: p) l. 2. D. de Senat. Vell. Zu apologetico: q) cap. 2. Hoc
Senatusconsulta, hoc principum mandata definiunt, Cuiacius legisse videtur, Hoc
Senatus consulit [...].
71) Vgl. Thesaurus Linguae latinae, Bd. 4, Con – Cyulus, Lipsiae 1906–1909, s.v.
consulo I. und III., 576–584.
72) Ausführlich zum Rogationsverfahren J.- L . Fe r r a r y, L’iter legis, de la ré-
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est 307 Dieser Aspekt ist sehr wichtig, denn schon Accursius hatte darauf hinge- wiesen, dass der Unterschied zwischen Gesetzen und Senatsbeschlüssen der Antrag an das Volk sei73). Durch die philologische Anmerkung belegt Cujas die technische Verwendung des Ausdrucks consulere. Das Wort liegt der Amtsbezeichnung der Konsuln zugrunde und seine Anwendung ist ebenso präzis technisch. So wie ein Magistrat bei seinem Antrag senatum consulit, so auch senatus consulit, indem er über den Antrag entscheidet und somit ein consultum gibt. Auf die inhaltlichen Nuancen in den Zitaten aus Accius/Varro74) und aus der Historia Augusta75) geht Cujas nicht ein und nimmt nur auf den allgemei- nen Gebrauch des Wortes Bezug. Dessen technischen Charakter unterstützt er aber durch zwei weitere Zitate, bei denen es sich lohnt, sie im Detail anzu- sehen. Denn das Ausmaß an philologischer Arbeit dieser 1585 veröffentlich- ten kleinen Nota ist viel größer, als die zur Opera-Ausgabe hinzugefügten Scholia76) erkennen lassen. Die Ausarbeitung der Nota ‚consuli‘ zu Inst. 1,2,5 liegt einige Jahre zu- rück: Ihren Inhalt und Wortlaut findet man großenteils schon in einer Vor- lesung aus den späten 1570er Jahren77). Dort erörtert Cujas die Frage aber ausführlich und erlaubt uns größere Aufschlüsse in Bezug auf seine Arbeits- weise. daction de la rogatio à la publication de la lex rogata, et la signification de la lé- gislation comitiale dans le système politique de la Rome républicaine, in: d e r s . (Hg.), Leges publicae, La legge nell’esperienza giuridica romana, Pavia 2021, 12–19. 73) Gl. sine lege ad D. 1,2,2,12: id et sine interrogatione populi. Nec enim in sena tusconsulto interrogatur populus, ut fiebat in compositione legis. 74) Accius 41 (= Varr. Ling. Lat. 5. 80): Consul nominatus qui consuleret populum et senatum, nisi illinc potius unde Accius ait in Bruto: Qui recte consulat, consul clu at. ,Consul siet‘, nach der Ausgabe Livius Andronicus, Naevius, Pacuvius, A ccius, Remains of Old Latin, II, Cambridge 1936, 564; ,consul cluat‘ nach der Ausgabe Varro, On the Latin Language, I, Cambridge 1938, 78. Andere Ausgaben ersetzen den vermutlich als untechnisch empfundenen Ausdruck cluat (von cluere ‚jubeln‘, ‚durch Akklamation wählen‘) mit consul fiat. 75) HA 24,21,4 (Trebellius Pollio, Tyranni Triginta 21,4): Consul, consule. 76) Oben Fn. 70. 77) In den Opera-Ausgaben sind die Notae posteriores mit einem * gekennzeich- net, so auch die Nota Consuli ad Inst. 1,2,5, die also 1585 publiziert wurde (o. Fn. 33). Dabei bediente sich Cujas des Materials, das er schon seit seinen ersten Professur- jahren gesammelt hatte (o. Fn. 68). In diesem Fall handelt sich nur um wenige Jahren zuvor, s. sogleich Fn. 78. ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, Roman. Abt. [ZRGR] 139 (2022)
Sie können auch lesen