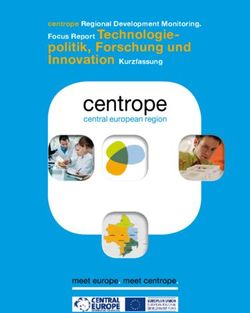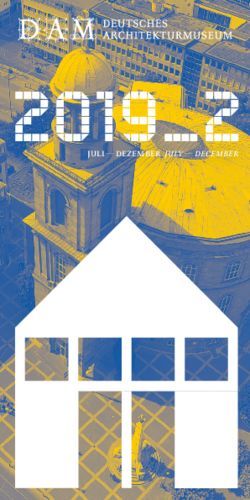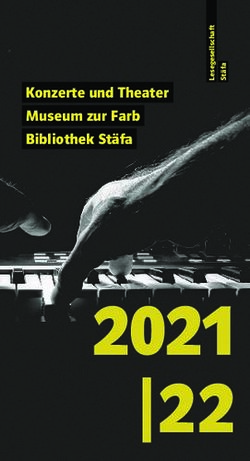Karl Renner - Ein österreichisches Phänomen - Eine Sonderausstellung anlässlich seines 150. Geburtstages - Teil 1: 1870 1918
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Karl Renner –
Ein österreichisches Phänomen
Eine Sonderausstellung anlässlich seines
www.rennermuseum.at
150. Geburtstages
Teil 1: 1870 - 1918Ereignisse aus dem Leben Karl Renners
und parallel dazu wesentliche Ereignisse der
österreichischen Geschichte in der Monarchie
Sonderausstellung 2020
Dr. Karl Renner – Museum
Rennergasse 2
2640 Gloggnitz
www.rennermuseum.atWerte BesucherInnen, liebe FreundInnen! Das Jahr 2020 ist in Bezug auf die Person Karl Renner ein besonders Jubiläum. Es ist sein 150. Geburtstag und es jährt sich zum 70. Mal sein Todestag. Anlass genug, um sich in einer detaillierten Ausstellung mit dem Leben und Wirken dieses heraus- ragenden österreichischen Politikers zu beschäftigen. Seine Kindheit in ärmlichsten Verhältnissen und im Herzen des habsburgischen Vielvölkerreichs sind für den Kurator Peter Dörenthal die Ausgangspunkte der Reise durch die turbulente Geschichte Österreichs und die turbulente Biografie Karl Renners. Sein Weg nach Wien und der Kontakt zur österreichischen Sozialdemokratie führen zu seinen politischen Theorien und seinem wissenschaftlichen Werk, das im Laufe seines Lebens sehr umfangreich und in einigen Publikationen wegweisend wurde. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf Renners federführende Rolle bei der der Gründung der Republik 1918/19 und bei deren Wiedererrichtung 1945 gelegt, da hier sein besonderes Gespür für das politisch Notwendige in Krisensituationen sichtbar gemacht werden kann. Selbstverständlich wird – das ist für ein Gesamtbild Karl Renners unerlässlich – auch sein Familienleben dargestellt, um zu zeigen, wie sehr dieses, vor allem in der Villa in Gloggnitz, sein Leben und Wirken prägte. Einige Schautafeln nehmen Bezug auf besonders bedeutende theoretische Ansätze in Karl Renners Werk (u.a. seine Rechtssoziologie und seine Nationalitätenprogramme), die Rolle des Antisemitismus in der Ersten Republik und seine politischen Entscheidungen im Jahr 1938. Alles in allem ist Karl Renner eine „typisch" österreichische Gestalt. Kein anderer Politiker ist seit der Monarchie derart mit den Höhen und Tiefen dieses Landes verbunden wie er. Wenige andere haben Österreich geprägt wie er. Daher sind seine Widersprüche auszu- leuchten, aber eben auch seine großen Leistungen anzuerkennen und zu würdigen. Die Ausstellung "Karl Renner – Ein österreichisches Phänomen" zeichnet ein Panoramabild der ereignisreichen österreichischen Geschichte, dargestellt anhand des Lebens eines österreichischen Ausnahmepolitikers und des Gestalters der Republik. Besonderer Dank gilt dem Archivar des Karl-Renner-Museums Peter Dörenthal. Umsichtig wie immer trug er die Materialien zusammen und kuratierte eine umfangreiche und informative Ausstellung für das Jubiläumsjahr. Michael Wilczek Michael Rosecker Direktor wissenschaftlicher Leiter
1860-1870
Karl Renner wurde am 14. Dezember 1870 in Unter-
Tannowitz (heute Dolni Dunajovice) in Mähren als Sohn
von Maria und Matthäus Renner geboren.
Wie er selbst schreibt, war er das 17. oder 18. Kind dieser
schon teilweise verarmten Bauernfamilie.
Er besuchte die Volksschule im Ort und
absolvierte die vorgesehenen 6 Klassen
in nur 4 Jahren. Sein Lehrer empfahl dem
Vater dringend, den Buben anschließend Renners Elternhaus
am Gymnasium in Nikolsburg weiter lernen zu lassen.
Taufmatrik 1870 der Pfarre Unter-Tannowitz
Eintragung für „Carl und Anton Renner“1870 Die österreichisch-ungarische Monarchie, auch als k.u.k. Monarchie oder inoffiziell als Donaumonarchie bezeichnet, wurde 1867 als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. Am 8. Juni 1867 wurde Kaiser Franz Joseph I. von Österreich auf dem Burghügel im damaligen Ofen (ungarisch Buda), später rechtsufriger Teil von Budapest, zum Apostolischen König von Ungarn gekrönt.
1885/86
Am 29. Juni 1885 wurde vom
Bezirksgericht Nikolsburg das
Versteigerungsedikt für Karl Renners
Elternhaus in Unter-Tannowitz
bekannt gemacht.
Versteigerungsedikt
vom 29. Juni 1885
Karl Renner selbst hatte sich - nach anfänglichen
Schwierigkeiten - im Gymnasium gut eingelebt
und war ab der vierten Klasse zum Vorzugs-
schüler geworden.
Renners Zeugnisnoten der
vierten Gymnasium-Klasse
Am 11. März 1885 wurde die Kinderarbeit und die Nacht-
arbeit für Frauen verboten. Die maximale Arbeitszeit pro
Tag wurde auf elf Stunden beschränkt.
Am 11. Dezember 1886
wurde von Victor Adler
die „Gleichheit“ als
sozialdemokratisches
Wochenblatt neu
herausgegeben.1886 Berühmt wurde die "Gleichheit" für ihre sozial engagierten Reportagen. Unter dem Titel "Die Lage der Ziegelarbeiter" veröffentlichte Victor Adler am 1. Dezember 1888 einen Artikel, in dem er die katastrophalen Lebens- und Arbeitsumstände der sogenannten "Ziegelböhm" am Wienerberg drastisch schilderte und die dort herrschenden Missstände, allen voran das verbotene "Trucksystem" anprangerte. "Truck" bedeutete soviel wie Tausch, d.h. die ohnedies schlecht bezahlten Arbeiter wurden nicht mit Geld entlohnt, sondern erhielten Blechmarken, die sie nur bei einem bestimmten Kantinenwirt einlösen konnten, der dadurch eine Monopolstellung besaß und weit überhöhte Preise verlangte. Die aufsehenerregende Reportage erreichte zweierlei: Das Gewerbeinspektorat inspizierte die Wienerberger Ziegelwerke und untersagte u.a. die weitere Anwendung des Trucksystems; Victor Adler aber und zwei Ziegelarbeiter wurden wegen unbefugter Verbreitung der "Gleichheit" zu Geldstrafen verurteilt. (dasrotewien.at)
1889
Karl Renner maturierte am Gymnasium
Nikolsburg (heute Mikulov) 1889 mit
Auszeichnung.
Ursprünglich wollte er sich einer
musisch / dichterischen Karriere
zuwenden, entschied sich dann aber
doch Jus zu studieren.
Maturazeugnis Renners
Vom 30. Dezember 1888 bis zum 1. Jänner 1889 fand in Hainfeld in
Niederösterreich, der Einigungsparteitag der SDAP statt.
Hainfeld wurde als Tagungsort gewählt, einerseits weil im Ort
durch seine Sägemühlen und Eisenwarenfabriken eine bestehende
Arbeiterorganisation bestand und andererseits weil wegen des für
Hainfeld zuständigen Bezirkshauptmanns, dem für sein soziales
Bewusstsein bekannten Graf Leopold Auersperg, die Gefahr eines
behördlichen Veranstaltungsverbotes nicht bestand.
110 Delegierte aus allen Kronländern nahmen die von Victor Adler
verfasste „Prinzipienerklärung“ an.Prinzipienerklärung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs. („Hainfelder-Programm“ 1888/1889) Prinzipienerklärung „Die sozialdemokratische Arbeiterpartei in Österreich erstrebt für das gesamte Volk ohne Unterschied der Nation, der Rasse und des Geschlechtes die Befreiung aus den Fesseln der ökonomischen Abhängigkeit, die Beseitigung der politischen Rechtlosigkeit und die Erhebung aus der geistigen Verkümmerung. Die Ursache dieses unwürdigen Zustandes ist nicht in einzelnen politischen Einrichtungen zu suchen, sondern in der das Wesen des ganzen Gesellschaftszustandes bedingenden und beherrschenden Tatsache, dass die Arbeitsmittel in den Händen einzelner Besitzender monopolisiert sind. Der Besitzer der Arbeitskraft, die Arbeiterklasse, wird dadurch zum Sklaven der Besitzer der Arbeitsmittel, der Kapitalistenklasse, deren politische und ökonomische Herrschaft im heutigen Staate Ausdruck findet. Der Einzelbesitz an Produktionsmittel, wie er also politisch den Klassenstaat bedeutet, bedeutet ökonomisch steigende Massenarmut und wachsende Verelendung immer breiterer Volksschichten. Durch die technische Entwicklung, das kolossale Anwachsen der Produktivkräfte erweist sich diese Form des Besitzes nicht nur als überflüssig, sondern es wird auch tatsächlich diese Form für die überwiegende Mehrheit des Volkes beseitigt, während gleichzeitig für die Form des gemeinsamen Besitzes die notwendigen geistigen und materiellen Vorbedingungen geschaffen werden. Der Übergang der Arbeitsmittel in den gemeinschaftlichen Besitz der Gesamtheit des arbeitenden Volkes bedeutet also nicht nur die Befreiung der Arbeiterklasse, sondern auch die Erfüllung einer geschichtlich notwendigen Entwicklung. Der Träger dieser Entwicklung kann nur das klassenbewusste und als politische Partei organisierte Proletariat sein. Das Proletariat politisch zu organisieren, es mit dem Bewusstsein seiner Lage und seiner Aufgabe zu erfüllen, es geistig und physisch kampffähig zu machen und zu erhalten, ist daher das eigentliche Programm der sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich, zu dessen Durchführung sie sich aller zweckdienlichen und dem natürlichen Rechtsbewusstsein des Volkes entsprechenden Mitteln bedienen wird. Übrigens wird und muss sich die Partei in ihrer Taktik auch jeweils nach den Verhältnissen, insbesondere nach dem Verhalten der Gegner zu richten haben.
Es werden jedoch folgende allgemeine Grundsätze aufgestellt: 1. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei in Österreich ist eine internationale Partei, sie verurteilt die Vorrechte der Nationen ebenso wie die der Geburt, des Besitzes und der Abstammung und erklärt, dass der Kampf gegen die Ausbeutung international sein muss wie die Ausbeutung selbst. 2. Zur Verbreitung der sozialistischen Ideen wird sie alle Mitteln der Öffentlichen Presse, Vereine, Versammlungen, voll ausnützen und für die Beseitigung aller Fesseln der freien Meinungsäußerung (Ausnahmegesetze, Press-, Vereins- und Versammlungsgesetze) eintreten. 3. Ohne sich über den Wert des Parlamentarismus, einer Form der modernen Klassenherrschaft, irgendwie zu täuschen, wird sie das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht für alle Vertretungskörper mit Diätenbezug anstreben, als eines der wichtigsten Mittel der Agitation und Organisation. 4. Soll noch innerhalb des Rahmens der heutigen Wirtschaftsordnung das Sinken der Lebenshaltung der Arbeiterklasse, ihre wachsende Verelendung einigermaßen gehemmt werden, so muss eine lückenlose und ehrliche Arbeiterschutzgesetzgebung (weitestgehende Beschränkung der Arbeitszeit, Aufhebung der Kinderarbeit u.s.f.), deren Durchführung unter der Mitkontrolle der Arbeiterschaft, sowie die ungehinderte Organisation der Arbeiter in Fachvereinen, somit volle Koalitionsfreiheit angestrebt werden. 5. Im Interesse der Zukunft der Arbeiterklasse ist der obligatorische, unentgeltliche und konfessionslose Unterricht in den Volks- und Fortbildungsschulen sowie unentgeltliche Zugänglichkeit sämtlicher höheren Lehranstalten unbedingt erforderlich; die notwendige Vorbedingung dazu ist die Trennung der Kirche vom Staate und die Erklärung der Religion als Privatsache. 6. Die Ursache der beständigen Kriegsgefahr ist das stehende Heer, dessen stets wachsende Last das Volk seinen Kulturaufgaben entfremdet. Es ist daher für den Ersatz des stehenden Heeres durch die allgemeine Volksbewaffnung einzutreten. 7. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei wird gegenüber allen wichtigen politischen und ökonomischen Fragen Stellung nehmen, das Klasseninteresse des Proletariats jederzeit vertreten und aller Verdunkelung und Verhüllung der Klassengegensätze sowie der Ausnützung der Arbeiter zu Gunsten von herrschenden Parteien energisch entgegenwirken. 8. Da die indirekten, auf die notwendigen Lebensbedürfnisse gelegten Steuern die Bevölkerung umso stärker belasten, je ärmer sie ist, da sie ein Mittel der Ausbeutung und der Täuschung des arbeitenden Volkes sind, verlangen wir die Beseitigung aller indirekten Steuern und Einführung einer einzigen, direkten progressiven Einkommenssteuer.“
1889/90
Zu aller erst musste Renner allerdings - wie alle Männer - den
Militärdienst in der k. u. k. Armee absolvieren. Er rückte im
Herbst 1889 als „Einjährig-Freiwilliger“ in Wien ins Arsenal ein.
Hier waren junge Männer aus allen Kronländern zur Ausbildung
zum Leutnant vertreten und Renner
erlebte zum ersten Mal die großen
Gegensätze, ja den Hass zwischen
den Völkern der Monarchie.
Arsenal (ca. 1890)
Am 14. Juni 1889 wurde die „Gleichheit“ - nachdem sie seit
Beginn ihres Erscheinens 45 Mal von der Zensur beschlag-
nahmt worden war - zur Einstellung gezwungen.
Victor Adler gab allerdings auch diesmal nicht auf. Am
12. Juli 1889 fand die „Gleichheit“ in der neugegründeten
„Arbeiter-Zeitung“ ihren Nachfolger. Diese wurde nach
über 100 Jahren wechselvoller Geschichte am
31. Oktober 1991 eingestellt.1890 Mitte 1890 musterte Karl Renner aus dem Militärdienst im Range eines k.u.k. Leutnants aus. Seine Vorgesetzten stellten ihm ein gutes Führungszeugnis aus, attestierten ihm aber „…nicht zur Führung einer größeren Gruppe geeignet zu sein“. Renner begab sich in Wien auf die Suche nach einer Unterkunft nahe der Universität. Dabei lernte er seine Lebensgefährtin und spätere Ehefrau Luise Stoicsics kennen. Die österreichischen Sozialdemokraten feiern im Wiener Prater zum ersten Mal den „Tag der Arbeit“. Hauptforderung des friedlichen Aufmarsches von rund 200.000 Menschen war der 8 Stunden- Tag. In der Arbeiter-Zeitung vom 23. Mai 1890 schreibt Friedrich Engels: „Feind und Freund sind sich einig darüber, dass auf dem ganzen Festland Österreich, und in Österreich Wien den Festtag des Proletariats am glänzendsten und würdigsten begangen hat“.
1891 Ab Mitte Juli wurde Karl Renner als Ferien-Hofmeister für den vierzehnjährigen Sohn des Barons auf Schloss Johnsdorf bei Mährisch-Schönberg engagiert. Von dort kehrte er Mitte September zurück und begrüßte glücklich seine schon am 16. August geborene Tochter Leopoldine. Ab Herbst studierte Renner an der Wiener Universität Jus und arbeitete nebenbei als Schreiber in der Kanzlei des Advokaten Kurt Ritter von Wiedenfeld. Von 1.-4. März wurden im österreichischen Teil der Doppel- monarchie (Cisleithanien) Reichsratswahlen nach dem Kurienwahlrecht abgehalten. Die Wähler wurden nach ihrem Stand und Vermögen in vier Kurien eingeordnet - das waren Großgrundbesitzer, Handels- und Gewerbekammern, Groß- und Mittelbauern und alle anderen in Städten lebenden männlichen Bürger, die jährlich mindestens 5 Gulden direkte Steuern entrichteten. Dies entsprach gesamt nur etwa 6% der erwachsenen Bevölkerung. Ab dem Wintersemester dürfen erstmals Frauen an der Wiener philosophischen Fakultät inskribieren.
1891
Reichsteile und Kronländer der Österreichisch -
Ungarischen Monarchie:
Cisleithanien
Transleithanien
Bosnien und Herzegowina (seit 1878 verwaltet)
(von Herrn Ziffer - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=23380662)1892/1893 Renners Engagement für die Arbeiter erregte die Aufmerk- samkeit der Polizei. Er erhielt eine Vorladung in das Kommissariat Neubau, konnte dort aber von seiner Harmlosigkeit überzeugen. Der Beamte verabschiedete ihn mit den Worten: „Sie sind kein Sozialist, Sie sind höchstens ein Idealist!“ Trotzdem bemerkte Renner am nächsten Morgen, dass er überwacht wurde. Er machte sich allerdings ein Vergnügen daraus, den beleibten Beamten bei der Verfolgung durch mehrere Durchhäuser zu hetzen. Ab 1893 verfügte die österreichische Reichshälfte über keine stabilen Regierungen mehr, da diese nacheinander an der Lösung der brennenden sozialen Probleme und angesichts des nationalistischen Extremismus scheiterten. Das Militär und der Beamtenapparat wurden somit zur wichtigsten Stütze der Monarchie, die nach veralteten Prinzipien weiterverwaltet wurde, ohne dass es zu einer grundlegenden Bereinigung der Missstände kam.
1892/93 Polizei-Überwachungs- Protokoll (Relation) über „Stud.jus. Carl Renner“ verfasst vom „k k Polz. Agent“ Franz Frosch 9. April 1893.
1895
22. März: Karl Renner zählte zu den ersten, die sich auf eine
Annonce in der Arbeiter-Zeitung „zur Gründung einer
touristischen Gruppe“ meldeten.
Im Sommer arbeitete Renner als Hauslehrer
in Grundlsee und wohnte mit Frau und Kind
in „Markt Aussee“. Im Hotel „Zur Traube“ traf
er sich zu Diskussionsabenden mit der
örtlichen Arbeiterschaft. Hotel „Zur Traube“
(etwa 1900)
Am 1. Dezember trat er den Dienst im Archiv des Reichsrates
an.
Der Lehrer Georg Schmiedel rief
den Verein der Naturfreunde im
September ins Leben.
Um 1895 war der überwiegende
Teil der Bevölkerung der
Monarchie (rund 85%) in der
Landwirtschaft, im Kleingewerbe
und als gering entlohnte Taglöhner
und Hauspersonal tätig.1895 „Die Theilung der Erde“ Gedicht verfasst von Karl Renner, gewidmet den Naturfreunden.
1897
Am 28. Februar heiratet Karl Renner seine
Luise auf Druck seiner Vorgesetzten, die eine
„wilde Ehe eines Staatsbeamten“ unwürdig
empfanden, in der Pfarre St. Othmar in Wien.
Renner publizierte unter Pseudonymen
laufend zu aktuellen Fragen der Politik in der Renners Trauungssschein
Monarchie. Als Staatsbeamter war es ihm ja
untersagt, sich aktiv der Politik und schon gar
nicht der Arbeiterbewegung zu widmen.
Kasimir Graf Badeni
Ministerpräsident Kasimir Graf Badeni gelang
es eine Wahlrechtsreform durchzubringen.
Es war allerdings noch immer nicht - wie von
den Sozialdemokraten gefordert - ein freies
und gleiches Wahlrecht. Es wurde lediglich
eine fünfte Kurie eingerichtet, in der alle über
25 Jahre zählenden Männer die Wahlberechtigung erhielten.
Mit 15 Mandaten zogen im März erstmals auch Sozial-
demokraten ins Parlament ein.
2. April: erstmals wurde eine Frau, Gabriele Possaner,
in Wien zur Doktorin der gesamten Heilkunde
promoviert.1897
Das Wiener Riesenrad wurde
am 3. Juli eröffnet. An diesem
heißen Sommertag waren
große Besuchermengen im
Prater. Allerdings konnten
sich die wenigsten eine
Fahrt leisten, die acht Gulden
kostete (ein Beamter verdiente
damals 30 Gulden im Monat)
Am 16. April wurde der
Christlichsoziale Karl Lueger -
nachdem seine Wahl vorher
schon zweimal wegen seiner
antisemitischen Haltung von
Kaiser Franz Joseph I.
abgelehnt worden war -
Wiener Bürgermeister.
Bürgermeister Karl Lueger1898
Am 18. November promovierte
Karl Renner an der Universität
Wien zum Doktor beider Rechte.
Sein Studium dauerte acht Jahre,
wofür er sich als Familienvater,
der ständig nebenbei arbeitete,
nicht genieren musste.
Dokument der Universität Wien
2. Dezember: 50-jähriges Regierungsjubiläum
Franz Josephs I.
Aus diesem Anlass wurde
von Mai bis Oktober eine
Jubiläumsausstellung in
Wien am Rotundengelände
abgehalten.
Am 10. September wurde Kaiserin Elisabeth in Genf durch den
Anarchisten Luigi Lucheni ermordet.1898 Die österreichische Regierung war vor allem dem Kaiser verpflichtet und weniger dem Parlament. Die Minister waren in erster Linie Berater des Kaisers, galten als „Instrumente des kaiserlichen Willens“ und nicht als Exekutivorgane des Willens des Volkes. Verstärkt wurden Franz Josephs Einflussmöglichkeiten auf die Regierung dank seines Rechtes auf Vertagung oder gar Auflösung des Reichsrates. Im Krisenfall war der Kaiser ermächtigt, das Reich ohne Parlament mittels Notparagrafen zu regieren, ohne vor einer Volksvertretung Rechenschaft ablegen zu müssen – was vor allem während des Ersten Weltkrieges die Macht des Reichsrates stark beschneiden sollte. Ein weiteres Instrument der kaiserlichen Macht war die Armee, denn diese war der parlamentarischen Kontrolle entzogen und nur dem Kaiser als „Obersten Kriegsherrn“ verpflichtet, und nicht der Regierung oder gar dem Volk. Die k.u.k. Armee wurde zum staatstragenden Symbol der Gesamtmonarchie und war zentral für das Selbstverständ- nis von Franz Joseph, der sich zeitlebens als Soldat sah.
1905/06
Als aktiver Bibliothekar beteiligte sich Renner in diesem
Jahr innerhalb des hauptsächlich von Staatsbeamten
gelenkten „Ersten Wiener Consumvereins“ an der Herbei-
führung von Reformen.
Renner entwickelte eine Fülle von Gedanken über Fragen der
Volksernährung, Arbeitsbeschaffung, die Anordnung von
Höchstpreisen, die Invaliden-, Witwen- und Waisenfürsorge,
u.v.m.
Im Januar 1905 fand von Petersburg
ausgehend die erste russische Revolution
statt. Etwa 150.000 unbewaffnete
streikende
Arbeiter demonstrierten vor dem Winter- russische Arbeiter
palast und wurden von der Armee zusammengeschossen.
Mit dem sogenannten „Mährischen Ausgleich“ versuchte
die österreichische Regierung vergeblich die Nationalitäten-
konflikte mit den Tschechen beizulegen.
Am 28. November 1905 fand in Wien auf der Ringstraße
eine Großkundgebung mit etwa 250.000 Menschen für ein
allgemeines und gleiches Wahlrecht statt.1905/06 Als Folge des Ringstraßenaufmarsches legte der Ministerpräsident Baron Gautsch am 23. Feber 1906 dem Reichsrat den Entwurf eines neuen Wahlgesetzes für Cisleithanien vor. Damit sollte dem bisher gültigen Kurienwahlrecht ein Ende bereitet werden. Aber erst der denkwürdige Aufruf in der Wiener Arbeiter- zeitung vom 10. Juni 1906 mit der Drohung eines General- streiks führte zu einer Annahme des Gesetzes im Reichsrat. Am 10. Dezember 1905 wurde in Oslo der Friedensnobelpreis an Bertha von Suttner verliehen. Sie war die erste Frau, die diesen Preis erhielt. Die aus Prag stammende, ehemalige Mitarbeiterin Alfred Nobels wurde damit u.a. für ihren Antikriegsroman „Die Waffen nieder“, mit dem sie Weltruhm erlangte, geehrt.
1907/1908
Renner wurde von der SDAP als Kandidat für den Wahl-
kreis Neunkirchen nominiert und bei der Wahl am 14. Mai
1907 mit großer Mehrheit gewählt.
Am 17. Juni wurde er für dieses Amt
angelobt. Damit vollzog sich sein
Aufstieg von der Bibliothek im
Erdgeschoß des Parlaments in den
Sitzungssaal im ersten Stock.
Renner mit größerer Gruppe
anlässlich der Wahl 1907
1907
Stärkste Fraktionen nach der Wahl am 14. Mai 1907 waren
die Christlichsozialen mit 96 Mandaten und die Sozial-
demokraten mit 87 Mandaten. Es gab fast 20 Fraktionen im
Reichsrat.
In Wien errangen die Sozialdemokraten 10 der hier
vergebenen 33 Mandate. Karl Renner wurde im Wahlkreis
Neunkirchen für die Sozialdemokraten gewählt.1907 Verteilung der Mandate im Reichsrat: Nationalität Mandate Deutsche 232 Tschechen 108 Polen 83 Ukrainer 31 Slowenen 24 Italiener 19 Kroaten und Serben 13 Rumänen 5 Juden 1 Gesamt 516
1908 „Ich habe mich bestimmt gefunden, die Rechte Meiner Souveränität auf Bosnien und die Herzegovina zu erstrecken...“). Mit diesen dürren Worten wurde 1908 die Annexion Bosnien-Herzegovinas von Franz Joseph I. verkündet und damit ein neues Kapitel Balkangeschichte eröffnet, das schließlich zur Ermordung des Thron- folgers Franz Ferdinand und zum Ersten Weltkrieg führte. Im Volk wurde die Annexion Bosnien-Herzegowinas mit sehr gemischten Gefühlen gesehen. Österreich-Ungarn entstanden dadurch enorme finanzielle Lasten für den Ausbau von Infrastruktur, Schulen, Spitälern in diesem bitterarmen, von den Osmanen vernachlässigten Land.
1910
Am 20. Juli kaufte Familie Renner von Katharina Skobl
die Villa in Gloggnitz.
Karl Renner gründete zusammen
mit dem Geschäftsführer der
Gloggnitzer Konsumgesellschaft,
Andreas Vukovich, eine Wohnbau-
Genossenschaft in Gloggnitz.
Die Geschäftsführung
der Genossenschaft
(links oben Karl Renner)
In der Monarchie fand die letzte Volkszählung vor dem
Zerfall 1918 statt. Beide Reichshälften zusammen hatten
51.390.223 Einwohner; Wien hatte damals über 2 Mill.
Einwohner (um 350.000 mehr als noch 10 Jahre davor).
Ein Arbeiter verdiente rund 20-24 Kronen, Frauen weniger
als die Hälfte, ein Volksschullehrer 120 Kronen im Monat;
ein Laib Brot kostete rund 20 Heller, ein Wiener Schnitzel
mit Salat 70 Heller, ein Herrenanzug 30 Kronen, Damen-
schuhe 6-12 Kronen, eine bessere Vorstadtwohnung
(Zimmer, Küche, Kabinett) rund 28 Kronen im Monat.
(1 Krone entsprach damals nach Kaufkraft ca. 5 €)1910
Am 17. Februar erhielt das 1908
annektierte Bosnien und Herzegovina
eine Verfassung. Sie räumte einen
Sonderstatut ein, da dieses Gebiet
weder der österreichischen noch
der ungarischen Reichshälfte
zugeordnet wurde. Die Verwaltung
dieses Gebietes wurde dem
Finanzministerium übertragen.
Ab Dezember lähmte die
Obstruktionspolitik der
nationalen Parteien den
parlamentarischen Prozess.
Handelsminister Viktor Mataja
veröffentlichte das Buch „Die Reklame“
und begründete damit die moderne
Werbewirtschaft.1912 Renner machte sich im Niederösterreichischen Landtag für die Rechte der Frauen stark. Er plädierte für das aktive und passive Wahlrecht der Frauen. Er initiierte die Gründung des „Kreditverbandes Österreichischer Arbeitervereinigungen“, der mit einem Schlag die Abhängigkeit der „GöC“ (Großeinkaufs- gesellschaft österreichischer Consumgenossenschaften) von den Großbanken beendete und der letztlich zur Vorläuferin der Arbeiterbank wurde. Mit der Kriegserklärung Montenegros an das Osmanische Reich am 8. Oktober begannen die kriegerischen Auseinander- setzungen am Balkan. Am 8. Oktober versuchten Österreich-Ungarn und Russland in Istanbul vergeblich zu vermitteln. Am 17. Dezember begann in London eine Botschafterkonferenz zur Regelung der Balkanprobleme. Italien und Österreich- Ungarn verhinderten gemeinsam, dass Serbien einen Zugang zur Adria erhielt. Albanien sollte ein selbständiger Staat werden.
1912 In diesem Jahr wurde der Islam als gleichberechtigte Religionsgemeinschaft in der österreichischen Reichshälfte der Monarchie staatlich anerkannt. In der christlichen Staatenwelt Europas nahm die Habsburgermonarchie in dieser Sache eine Vorreiterrolle ein. Das Gesetz gilt in Grundzügen bis heute. Durch die Okkupation (1878) und Annexion (1908) Bosniens und der Herzegowina wurde ein Land mit muslimischer Bevölkerung Teil der Habsburgermonarchie. Im Zuge der Integration Bosniens in die Gesamt- monarchie zogen Muslime auch in andere Reichsteile, sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Schon seit dem frühen 18. Jahrhundert hatten Muslime in der Monarchie das Niederlassungs- und Handelsrecht.
1912/13 „Sollen sich die Kerle die Schädel einhauen; wir schauen in der Loge zu“ (Zitat) - so äußerte sich Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand in seiner gewohnt „diplomatischen Art“ über die Balkankrise 1912 in Verkennung der wahren Situation. Die Annexion von Bosnien-Herzegowina 1908 führte trotz der Rückgabe des besetzten Sandschak Novi Pazar an das Osmanische Reich zu einer Isolierung Österreich-Ungarns in Südosteuropa. Wien hatte sich Serbien endgültig zum Feind gemacht. Der 1912/13 geführte Erste Balkankrieg war ein Angriffskrieg der jungen Nationalstaaten Serbien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland gegen das Osmanische Reich. Dieser Konflikt war aber auch ein Stellvertreterkrieg zwischen den Großmächten, die durch Bündnisverträge indirekt ihre Rivalitäten ausspielten. Österreich-Ungarn agierte offen gegen die serbischen Expansionsbestrebungen. Wien inszenierte sich als Bewahrer des Gleichgewichts der Kräfte am Balkan und als Bollwerk gegen den eskalierenden Nationalismus der Balkanvölker. Ein Erfolg der anti-serbischen Politik Österreichs war die Durch- setzung der Gründung Albaniens als unabhängiger Staat. Es war dies vor allem eine Maßnahme, den Aufstieg Serbiens einzudämmen und den Serben den Zugang zu Mittelmeer zu verwehren. Dies war aber der einzige „Erfolg“ der österreichischen Balkanpolitik.
1912/13
Karikatur des britischen Zeichners
Leonard Raven-Hill (1912):
Deutschland, Frankreich, Russland,
Österreich-Ungarn und
Großbritannien versuchen, den
Deckel auf dem überkochenden Kessel
mit der Aufschrift „Balkan Troubles“ zu
halten.
(in „Punch“ 2. Oktober 1912)
Ausgangslage
vor Kriegsbeginn
am 25. September
19121912/13
Grenzen nach dem
Ersten Balkankrieg
April 1913
(Albanien noch
provisorisch gezeigt)
Grenzen nach dem
Zweiten Balkankrieg -
festgelegt im
Friedensvertrag von
Bukarest
am 10. August 1913
Die Balkankriege waren Wegbereiter für den Eintritt der südost-
europäischen Staaten in den Ersten Weltkrieg. Das Osmanische
Reich trat ebenso wie das auf dem Balkan isolierte Bulgarien an
der Seite der Mittelmächte in den Krieg ein. Beide Mächte
strebten eine Revision der neu gezogenen Grenzen an.1913
Im Januar hielt sich der junge Josef Stalin
im Auftrag Lenins in Wien auf, um die
Nationalitätenfrage zu studieren. Er
bezeichnete Karl Renner als „Imperialisten“
und sein Nationalitätenprogramm als
„spitzfindige Form des Nationalismus“.
Es ist allerdings nicht belegt, ob sich bei Stalin (ca. 1910)
dieser Gelegenheit Renner und Stalin
persönlich getroffen haben.
Am 7. September bekräftigten die „Dreibundstaaten“
Deutsches Reich, Österreich-Ungarn und Italien ihre
gegenseitige Bündnistreue.
Dies obwohl man besonders
in Wien schon damals sehr
an Italien zweifelte. Die
Deutsche Heeresleitung
bestand auf diesen Vertrag,
da sie erwartete, Italien
werde im Kriegsfall gegen Österreich-Ungarn und Deutschland
Frankreich die deutsche sowie Frankreich, Russland und
England – alle wollen Italien als
Südflanke schützen. Bündnispartner gewinnen.1913 17. August: Erzherzog Franz Ferdinand wurde von Kaiser Franz Joseph I. zum „Generalinspektor der gesamten bewaffneten Macht ernannt“. Er lehnte einen vom Generalstab geforderten Präventivkrieg gegen Serbien ab und plante nach seiner Krönung den Umbau der Doppelmonarchie in eine „Triplemonarchie“, also neben Österreich und Ungarn gleichberechtige Südslawen. Da man von Ungarn nicht erwarten konnte für diesen „Umbau“ der Monarchie große Landesteile im Süden kampflos abzutreten, wollte Franz Ferdinand im Gegenzug den gesamten Norden und Osten des österreichischen Teiles der Monarchie (Krakau, Lemberg, Tarnopol, Czernowitz) Ungarn zuschlagen. Südkärnten bis Villach und Völkermarkt sollte zu den Südslawen gehören.
1914
In den ersten Monaten nach
Ausbruch der Kampfhandlungen
veröffentlichte Renner Artikel über
die „Volksernährung im Krieg“.
Kurz nach Kriegsbeginn machten
sich Pressezensur, Versammlungsverbot
und die Einschränkung der Grundrechte
stark bemerkbar.
hier die AZ vom 4. August mit den
von der Zensur gestrichenen Stellen
Wegen der eskalierenden Nationalitätenkonflikte und
damit verbundener parlamentarischer Obstruktion wurde
das Parlament vom Kaiser vertagt.
Am 28. Juni wurden der Thronfolger
Franz Ferdinand und seine Gattin
Sophie in Sarajevo bei einem
Attentat von dem bosnischen
Studenten Gavrilo Princip erschossen.
Am 25. Juli brach Österreich-Ungarn die diplomatischen
Beziehungen zu Serbien ab.1914
Am 28. Juli erklärte Österreich-
Ungarn auf Drängen des
Österreichischen Generalstabes
Serbien den Krieg.
Ab 31. Juli erfolgte die allgemeine
Mobilisierung der k. u. k. Streit-
kräfte.
Durch den Mechanismus der
europäischen Bündnissysteme
erfolgten dann lawinengleich
Kriegserklärungen vieler Staaten
in Europa gegeneinander.
Es begannen für alle Seiten
extrem verlustreiche Schlachten
und es erwies sich, dass die
k. u. k. Armee in vielen Teilen
auf einen länger andauernden
Krieg überhaupt nicht vorbereitet
und ausgerüstet war.
Der Erste Weltkrieg besiegelte
das Ende der Donaumonarchie...1916
Unter der Regierung Körber
wurde Renner in das vom
Staat gegründete Amt für
Volksernährung berufen.
Seine Aufsätze und Gedanken, wie die
Monarchie in einer erneuerten und
zeitgemäßen Form weiter bestehen
könnte, erschienen in diesem Jahr.
Am 11. Mai kam es in Wien wegen der Lebensmittelknappheit
und der bedrohlichen Teuerung zu ersten
Hungerkrawallen.
Am 21. Oktober erschoss Friedrich Adler
den Ministerpräsidenten Graf Stürgkh im
Hotel Meißel und Schadn in Wien.
Am 21. November starb in Schönbrunn
Kaiser Franz Joseph I. - er hatte 68 Jahre
regiert.1916
Kaiser Franz Joseph I.
wurde am 18. August 1830
in Schönbrunn geboren
und starb am
21. November 1916 im
Schloss Schönbrunn.
Er regierte vom
2. Dezember 1848
nahezu 68 Jahre
bis zu seinem Tod.1917 Für den 15. Mai war von der mittler- weile nach Stockholm übersiedelten Sozialistischen Internationale eine Konferenz einberufen. Renner maß diesem Treffen große Bedeutung im Karl Renner und Victor Adler Hinblick auf einen möglichen Frieden in Stockholm zu. Renner traf bei dieser Gelegenheit auch mit Lenin zusammen. Allerdings entpuppte sich dieses Treffen als eine herbe Enttäuschung. Vielen Sozialisten wurde die Ausreise aus ihren Heimatländern verwehrt und es kam lediglich zu einem Manifest, das auf einen raschen Frieden drängte. Schon kurz nach Kriegsausbruch war das Parlamentsgebäude in ein Lazarett umfunktioniert worden. Am 30. Mai wollte Kaiser Karl I. der Forderung nach Wiedereinberufung des Reichsrates nachkommen. Dabei zeigte sich deutlich, wie überaus skeptisch die einzelnen Nationalitäten dem „alten Staat“ mittlerweile gegenüber standen. Am 18. Mai begann der Prozess gegen Friedrich Adler wegen des Mordes an Graf Stürgkh, der mit einem Todesurteil endete. Adler wurde später von Kaiser Karl I. zu 18 Jahren Haft verurteilt, aber bereits im November 1918 vom Kaiser, als dessen letzte Amtshandlung, begnadigt.
1917
In Wien, Prag und Pilsen streikten die Arbeiter im Sommer
wegen der Teuerung und der Lebensmittelknappheit. Noch
dazu war in diesem Jahr ein Sommer „der glühenden Sonne“,
der Mais, Kartoffeln und Gemüse „zu Tode röstete“, was die
Versorgung noch verschlechterte.
Im Volk grassierte das folgende, grimmige Spottgedicht:
Ernährungsglaube
Ich glaube an den Herrn Ernährungsminister,
an die allein selig machende Mairübe,
die Ernährerin der rationierten Volksmassen.
Ich glaube an die stammverwandte Runkel- und Steckrübe,
empfangen von dem heiligen Ernährungsamte,
gelitten unter der Zentral-Einkaufsgesellschaft,
gesammelt, gepresst und verdorben, zur Erde niedergefallen,
am dritten Tag wieder auferstanden als Marmelade,
von dannen sie kommen wird als Erfrischungsmittel
für die in langen Reihen angestellten Hungerleider.
Ich glaube an den heiligen Profit und Rebbach,
an die allgemeine Wuchergemeinschaft der Hamsterer,
Erhöhung der Steuern, Verteuerung des Fleisches
und an den Ewigen Kriegszustand.
Amen.
(nach einer Tagebuch-Eintragung vom 18. Juni von Josef Redlich)1918
Ab 14. Januar wurden die Mehlrationen von
den bisher schon geringen Mengen nochmals
auf die Hälfte gesenkt.
Darauf hin kam es, ausgehend von Wr. Neustadt,
zu Hungerstreiks in der gesamten Monarchie.
Vereinzelt griffen diese Unruhen auch auf die
Armee - besonders an den Standorten Judenburg, Pecs, Budapest,
Pola und Mährisch-Ostrau - über.
Von Mai bis August fand im Prater eine
„Ersatzmittel-Ausstellung“ statt. Es wurde
gezeigt, was man aus Ersatzprodukten
theoretisch alles herstellen könnte. Das
Problem war, dass auch diese Ersatzmittel
kaum mehr verfügbar waren.
Juni: Die Brotrationen wurden erneut
gekürzt - auf 630 Gramm pro Woche.
Die landwirtschaftliche Produktion
der österreichischen Reichshälfte
betrug nur mehr ca. 50% der Menge
von 1913.
Anstellen vor einer
Kriegsküche 31. Juli1918
stundenlanges Schlange stehen
vor Bäckereien in Wien - Kinder
ohne Schuhe.
Ab Ende Juni kam es zum „Kartoffelkrieg“
zwischen Wien und den Umlandgemeinden.
Tausende Städter fuhren aufs Land und
ernteten widerrechtlich auf den Feldern.
Am 9. August starteten auf eine
Initiative von Gabriele D´Annunzio
von San Pelagio bei Padua 10
Doppeldecker-Flugzeuge, von denen
über Wien Flugblätter abgeworfen
wurden. Für die damalige Zeit ein
beachtlicher Langstreckenflug von
mehr als 1.000 km.
D´Annunzio mit seinen Fliegern
21. Oktober: Die 1911 gewählten deutschen Reichsrats-
abgeordneten Österreichs bildeten in Wien die Provisorische
Nationalversammlung für Deutschösterreich.1918
24. Oktober: die k. u. k. Regierung hatte ihre Autorität
eingebüßt. Ihre Anordnungen wurden zum Teil nicht mehr
befolgt.
28. Oktober: die Tschechen riefen in Prag die tschechische
Republik aus. Galizien schloss sich dem neu entstehenden
Polen an.
29. Oktober: Slowenen und Kroaten waren Mitbegründer des
neuen südslawischen Staates. In Siebenbürgen übernahmen
die Rumänen die Macht.
30. Oktober: der Kaiser erteilte den Befehl, die k. u. k. Kriegs-
marine den Kroaten zu übergeben.
3./4. November: Italien besetzte Tirol südlich des Brenners,
Triest und das österreichische Küstenland.
6. November: Kaiser Karl I. ordnete die
Demobilisierung der Armee an.
11. November – Karl I. verzichtete im
Schloss Schönbrunn „…auf jeden Anteil
an den Staatsgeschäften“.
Nach fast 650 Jahren
ging die Herrschaft
der Habsburger in
Österreich zu Ende.Quellenverzeichnis
Ackerl - Geschichte Österreichs in Daten
Haider - Wien 1914, Alltag am Rande des Abgrunds
Hannak - Karl Renner und seine Zeit
Jelinek - Neue Zeit 1919
Lackner/Mazohl/Pohl/Rathkolb/Winkelbauer -
Geschichte Österreichs
Nasko/Reichl - Karl Renner, zwischen Anschluss
und Europa
Nasko - Karl Renner in Dokumenten und Erinnerungen
Rauchensteiner - Unter Beobachtung,
Österreich seit 1918
Rauscher - Karl Renner, ein österreichischer Mythos
Renner - An der Wende zweier Zeiten
Saage - Der erste Präsident,
Karl Renner - eine politische Biografie
Arbeiterzeitung - Online-Archiv
ONB-Anno - Zeitschriftenarchiv
Archiv des Renner-Museums
wikipedia.org
habsburger.netSie können auch lesen