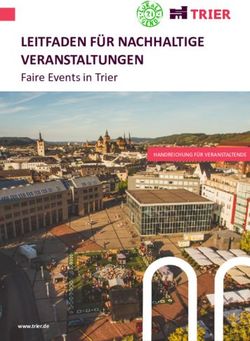Koblenz, Trier und die Bauern. Zur Rolle von Städten und Dörfern im Ständewesen, 15. bis 18. Jahrhundert1
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
1 Johannes Dillinger Koblenz, Trier und die Bauern. Zur Rolle von Städten und Dörfern im Ständewesen, 15. bis 18. Jahrhundert1 Der letzte Landtag des Kurfürstentums Trier tagte 1801 in Ehrenbreitstein. Das 350 Jahre alte kurtrierische Ständewesen hörte auf zu existieren. Die Stände des Kurfürstentums Trier hatten bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts eine Besonderheit aufgewiesen, die sie modernen Demokratien ähnlich zu machen scheint. In aller Regel herrschten die Fürsten des 15 bis 18. Jahrhunderts gerade eben nicht absolutistisch. Sie kooperierten mit den stärksten Gruppen in der Gesellschaft, den Reichen und Einflussreichen. Die Organisation dieser wichtigen Gruppen, auf deren Kooperation die Landesherrschaften lange angewiesen waren, waren die Stände. Die Stände kamen zu den Landtagen zusammen. Auf den Landtagen handelten sie mit der landesfürstlichen Regierung die Steuern aus. Die Stände schafften es dabei immer wieder, die Fürsten zu politischen Zugeständnissen zu bewegen. Über ihre Steuerbewilligungsrechte schafften sie es häufig, eine Art Mitregierung aufzubauen. In der Regel gab es drei Stände: Den Klerus, den Adel und den Dritten Stand. Fast immer wurde dieser Dritte Stand von Vertretern der wichtigsten Städte gebildet. Es ist wichtig, das festzuhalten. Bis ins 19 Jahrhunderte lebte nur eine kleine Minderheit der Einwohner West- und Mitteleuropas in Städten. Über 80 % der Einwohner lebten in Dörfern. Das Kurfürstentum Trier war einer der wenigen Staaten, in denen auch die Landbevölkerung im Dritten Stand vertreten war. In Kurtrier entsandten lange Zeit nicht nur die Städte, sondern auch die Dörfer Vertreter zu den Landtagen. Die Deputierten der Bauern saßen Seite an Seite mit den Deputierten der großen Städte in den Landtagen des Kurfürstentums Trier. Sollte man hier von Mitbestimmung sprechen? War das Kurfürstentum Trier mit seiner politischen Repräsentation der bäuerlichen Bevölkerungsmehrheit etwa eine heimliche Demokratie? Im 17. Jahrhundert wurde Trier wegen dieser Vertretung nicht nur der Städte 1 Dieser Text beruht auf einem Vortrag, den ich am 25.06. im Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek gehalten habe. Alle Nachweise der gedruckten und ungedruckten Quellen, die ich hier auswerte, finden sich meinen Publikationen zu diesem Thema: Die politische Repräsentation der Landbevölkerung. Neuengland und Europa in der Frühen Neuzeit, Stuttgart 2008; Dillinger, Johannes: Demokratie im Kurstaat? Deputierte von Bürgern und Bauern auf den Landtagen des Kurfürstentums Trier, in: Kurtrierisches Jahrbuch, 46 (2006), S. 201-216; Dillinger, Johannes: Die Vertretung der Bauern auf den Landtagen Kurtriers, in: Mertes, Joachim (Hg.): „Was zu des Erzstifftischen Vatterlandes Besten erforderlich und ersprießlich seyn mag...“ Parlamentsgeschichte im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz, Mainz, erscheint 2009.
2 sondern auch der Bauerndörfer auf den Landtagen mit der Schweiz verglichen. Mit der politischen Repräsentation der Bauern ist ein Stück rheinland- pfälzischer Geschichte angesprochen, das fast vollständig in Vergessenheit geraten ist. In der Schweiz, aber auch in Teilen Norddeutschlands und Baden-Württembergs ist die Erinnerung an die Macht des Dritten Standes ein wichtiger Teil der regionalen Identität. Es ist sehr bedauerlich, dass in Rheinland-Pfalz die Bauern des Kurfürstentums Trier und ihre außerordentlichen politischen Mitsprachebefugnissen aus dem historischen Gedächtnis fast ganz verschwunden sind. Sehen wir uns die Stände Kurtrier näher an! Welche Rolle spielte der Dritte Stand? welche Rolle spielten Städte und Dörfer innerhalb des Dritten Standes? Die kurtrierischen Stände entwickelten sich aus zwei Vereinigungen von Adel und Drittem Stand, die 1456 bzw. 1502 ins Leben gerufen wurden. Zu dieser Zeit stritten zwei Prätendenten um das Amt des Erzbischofs. Bevor die streitenden Bischofskandidaten das Land in einen Bürgerkrieg stürzen konnten, fielen ihnen die Stände in den Arm. Der Kurfürst musste der Vereinigung Privilegien zugestehen und die Zusage geben, sich in Zukunft regelmäßig mit Deputierten von Adel und Kommunen zu treffen. Die institutionelle verfestigten Vereinigungen wurden die kurtrierischen Stände. Der Adel schied 1548 aus den Ständen Kurtriers wieder aus. Die Vertreter von wichtigen kirchlichen Einrichtungen stießen jedoch zu den Ständen. Die Landtage wurden danach nur noch vom Klerus und vom Dritten Stand beschickt. Der Dritte Stand wurde von den Städten Trier, Koblenz und einigen kleineren Städten gebildet, aber auch von „Dorffen und Plegen (Pflegen = Vereinigungen von Dörfern).“ Zunächst hatten nur die Städte Dörfer aus ihrem direkten Einflussbereich mit in die Vereinigung gebracht. Die Dörfer waren jedoch einer Erwähnung wert. Der Kreis der landtagsfähigen bäuerlichen Gemeinden weitete sich in der Folgezeit drastisch aus. Die Dörfer, die Gemeinden ohne Stadtrecht, in Kurtrier und dem ganzen Moselraum waren außerordentlich stark. Gemäß lokal unterschiedlichen, zum Teil komplexen Regelungen mussten sie gehört werden, wenn ein Ortsvorsteher, meist Zender, daneben auch Bürgermeister oder Heimburge genannt, bestimmt werden sollte. Den Dörfern standen Selbstverwaltungs- und Gerichtsrechte zu. Die Gemeinde fällte Entscheidungen in Gemeindeversammlungen. Diese standen grundsätzlich allen in der Kommune eingesessenen Männern mit eigenem Hausstand offen. Neben den Landgemeinden standen die kurtrierischen Städte. Der Begriff ‚Stadt’ wird hier im rein rechtlichen Sinn verwandt. Er bezeichnet Siedlungen, denen bestimmte Rechte bezüglich Märkten und der Selbstverwaltung durch einen Stadtrat verliehen worden waren. Urbane Charakteristika in Wirtschaft und Kultur fehlten diesen Städten größtenteils. Sie waren von der Landwirtschaft abhängig und von Landwirten bewohnt wie die Dörfer. Die beiden einzigen Ausnahmen
3 waren Trier und Koblenz. 14 kurtrierische Städte waren auf nahezu jedem Landtag vertreten: Trier, Pfalzel, Saarburg, Oberwesel, Wittlich und Zell für das Obererzstift, d.h. das Kurfürstentum südlich der Elz, Koblenz, Bernkastel, Boppard, Cochem, Limburg, Mayen, Montabaur und Münstermaifeld für das Niedererzstift, d.h. das Kurfürstentum nördlich der Elz. Trier und Koblenz als Hauptstädte des Kurfürstentums ragten aus diesem Kreis privilegierter Orte nochmals heraus: Als so genannte Direktorialstädte übernahmen sie die Führung des ganzen Dritten Standes. Der Stadtrat von Trier zusammen mit den Schöffen und der Oberen Bank des Rates von Koblenz bildeten das weltliche Direktorium. Das Direktorium führte die laufenden Geschäfte der Stände. Entsprechend der Einteilung des Kurfürstentums wurden ein niedererzstiftisches und ein obererzstiftisches Direktorium unterschieden. Für die zentralörtliche Bedeutung von Trier und Koblenz spricht hierbei übrigens auch, dass die geistlichen Direktorien, mit denen die weltlichen kooperierten, großenteils von kirchlichen Einrichtungen beschickt wurden, die sich in oder nahe bei den beiden Hauptstädten befanden. Zumindest in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatten sich die Kompetenzen des Direktoriums denen der Landtage angenähert. In Ausnahmesituationen konnte das Direktorium autonom Steuern bewilligen. Es ist bezeichnend, dass sich im 18. Jahrhundert für die übrigen zwölf der 14 Städten neben der Bezeichnung „Nebenstädte“’ die Vokabel „Nebenstände“ einschlich: Die eigentlichen ständischen Verhandlungspartner der Herrschaft waren Trier und Koblenz. Theoretisch genossen die Stände Kurtriers Selbstversammlungsrecht. Die Ladung zum Landtag ging dabei von den Direktorien aus. In der Praxis aber lud der Kurfürst im Einvernehmen mit dem Domkapitel die Stände zum Landtag. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts wandte sich der Kurfürst mit der Ankündigung eines Landtages an die Räte von Trier und Koblenz. Die Direktorien luden dann die übrigen Landtagsteilnehmer ein. 1622 wurde ihnen pauschal von den Ständen selbst das Recht eingeräumt festzulegen, wie viele Abgeordnete die übrigen Kommunen jeweils deputieren sollten. Sogar die Reise zu Ständeversammlungen konnten die Hauptorte für die Nebenstädte organisieren. Der kurtrierische Dritte Stand blieb undifferenziert die Organisation der Bauern und der Stadtbürger. Den Landgemeinden Kurtriers fehlte buchstäblich die ‚Selbstständigkeit’, sie waren kein eigener Stand. Diese Bindung an die Städte schwächte die Position der Landgemeinden in Kurtrier nachhaltig. Die Stände, der Zusammenschluss der Städte und Dörfer, waren nicht nur einfach Teil des Repräsentationssystems. Sie führten vielmehr ein Eigenleben außerhalb der Landtage. Die Stände besaßen theoretisch das Selbstbesteuerungsrecht, praktisch organisierten sie das Steuerwesen. Der Verfassungsjurist Moser stellte im 18. Jahrhundert lakonisch fest, dass der Kurfürst ohne die Stände „nicht den duennesten Heller“
4 aufbringen könne. Steuerdeputierte sammelten die Steuergelder in den Dörfern und führten sie einmal jährlich an einen Generaleinnehmer ab. 1564 waren je ein Generaleinnehmer aus Saarburg und Bernkastel für das Obererzstift und je ein Generaleinnehmer aus Koblenz und Boppard für das Niedererzstift verordnet worden. Sie verwalteten im Auftrag der jeweiligen Direktorialstadt die dortige Landschaftskasse. Im 18. Jahrhundert übte nicht mehr die Ständeversammlung, sondern nur noch das Direktorium die Kontrolle über die Generaleinnehmer aus und rechnete mit ihnen ab. Die Kassen der Landschaft standen im Rathaus von Trier und in der Liebfrauenkirche in Koblenz. Es ist bezeichnend, dass die Räte von Trier und Koblenz über die Landschaftskasse verfügen durften, ohne die anderen Stände auch nur informieren zu müssen. Bei der Vergabe dieses Amtes hatte die Macht der Stände jedoch einen empfindlichen Einbruch erlitten: Im Niedererzstift wurden die Spezial- und Generaleinnehmer von der Herrschaft frei eingesetzt und vereidigt, im Obererzstift durften die Stände nur noch geeignete Kandidaten vorschlagen. Auf dem jährlichen Landrechnungstag überprüften Vertreter der 14 Städte, häufig jedoch nur Vertreter von Koblenz und Trier, die Buchführung der Generaleinnehmer. Ab dem späten 17. Jahrhundert verschmolzen Landrechnungstag und Landtag. Der Sprecher und Rechtsbeistand der weltlichen Stände, der Syndikus, war in aller Regel ein Koblenzer Jurist. Wie sahen kurtrierische Landtage aus? Es muss differenziert werden zwischen Volllandtagen und Ausschusslandtagen. Ausschusslandtage fanden häufig, etwa alle zwei Jahre, im 18. Jahrhundert fast jährlich statt. Zu diesen Ausschusslandtagen erschienen nur Deputierte der 14 Städte. Die Landgemeinden waren nur auf Volllandtagen vertreten. Diese waren erheblich seltener: So fanden etwa Volllandtage 1598, 1599 und 1603 statt, der nächste aber erst 1619. Falls eine Landgemeinde einmal versuchte, sich ohne Ladung Gehör auf einer Ständetagung zu verschaffen, wurde ihren Vertretern der Status von Abgeordneten versagt. Ihnen wurde lediglich gestattet, ihr Anliegen in Form einer Petition vorzutragen. Die letzten Volllandtage fanden 1652 und 1654 statt. Die Vertretung des Dritten Standes reduzierte sich danach in Kurtrier auf eine bloße Vertretung der Städte. Dies bedeutete eine drastische Veränderung des Landtages. Waren vorher ungefähr 70 Kommunen und Verwaltungsdistrikte landtagsfähig gewesen, waren nun nur noch 14 Stadtgemeinden. Ein Überblick über Kurtriers ‚Verfassung’ aus dem Jahr 1789 stellte schlicht fest, dass der weltliche Stand nur aus den 14 Städten bestünde. In ähnlicher Weise dünnte sich übrigens auch die geistliche Kammer aus: Ab den 1680er Jahren erschienen die Landdekanate dort nicht mehr. Welche Kommunen und Verwaltungseinheiten beschickten nun die Volllandtage? Außer den 14 privilegierten Städten weitere Orte mit Stadtrecht, so etwa die Städte Manderscheid und Kyllburg. Daneben entsandten einzelne Dörfer Deputierte, aber auch Dorfverbände wie Kirchspiele und Pflegen. Darüber hinaus waren einige Ämter, die
5 Zuständigkeitsbereiche der kurfürstlichen Amtleute, mit Abgeordneten vertreten. Die Repräsentationseinheiten waren also uneinheitlich konstruiert: Dörfer standen neben herrschaftlichen Verwaltungseinheiten. Zudem decken die Repräsentationseinheiten zu keinem Zeitpunkt die gesamte Fläche des Kurstaates ab. Mit modernen Wahlkreisen hatten sie also nichts zu tun. Sie waren allerdings auch nicht durch ein positives Privileg der Landstandschaft hervorgehoben. Die Einteilung der Abgeordnete entsendenden Einheiten veränderte sich nämlich immer wieder. Z.B. nahmen in der Mitte des 16. Jahrhunderts das Amt Ehrenbreitstein und die Gemeinde Niederlahnstein getrennt voneinander an Landtagen teil. Um die Jahrhundertwende und in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts erschien nur der Ort Niederlahnstein. Danach verschwand der Ort, und das Amt allein firmierte unter den Landtagsteilnehmern. Eine Liste der beim Landtag erscheinenden Gemeinden lässt sich in keinen sinnvollen Zusammenhang mit den Steuermatrikeln stellen. Der Blick auf die Verfassungswirklichkeit Kurtriers zeigt ein schwer beschreibbares ‚Anti-System’. Um die stets vertretenen 14 Städte stand ein engerer Kreis von Kommunen, die in aller Regel Gesandte zu den Volllandtagen entsandten. Daneben gab es einen größeren und stark wandelbaren Kreis seltener oder gar nur sporadisch vertretener Gemeinden. Auf den Landtagen erschienen offenbar schlicht diejenige Kommune, derjenige Kommunenverband und dasjenige Amt, das von den Direktorialstädten, Koblenz und Trier, eingeladen wurde. Die Direktorialstädte verhielten sich dabei nicht konsequent. Zudem machten sie Fehler. 1589 fehlten vier bäuerliche Gemeinden beim Landtag. Der Stadtschreiber der Direktorialstadt Trier gab treuherzig zu Protokoll, dass er vermutlich vergessen habe, sie einzuladen. Bei einer weiteren sei er sich sogar ganz sicher, sie vergessen zu haben. Das Versäumnis lag freilich oft bei den dörflichen Kommunen: Offiziell zum Landtag eingeladene Gemeinden konnte diese Ladung schlicht ignorieren. In diesem bewussten Verzicht auf Repräsentation sollte man nicht politisches Desinteresse erkennen. Vielmehr zeigte sich hier eine pragmatische Einstellung: War der Landtagsbesuch für die Wahrung der Interessen der jeweiligen Gemeinde unattraktiv, verzichtete sie darauf, einen Abgeordneten zu entsenden. Sanktionen irgendeiner Art drohten diesen Kommunen nicht. Wie viele Deputierte die jeweilige Landgemeinde entsandte, war ihr vor 1622 völlig freigestellt. In der Regel hatten Kommunen einen oder zwei Abgeordnete, in seltenen Fällen drei. Trier und Koblenz dagegen entsandten im 17. und 18. Jahrhundert je zwischen vier und acht Vertretern. Abgeordnete legitimierten sich auf dem Landtag, indem sie die Vollmachten vorlegten, die ihnen von der durch sie vertretenen Gemeinde ausgestellt worden waren. Obwohl sie im Wortlaut voneinander abwichen, folgte ihr Aufbau stets demselben Schema. Die Vollmachten stellten fest, dass der Kurfürst zu einem bestimmten Termin zum Landtag geladen
6 habe. Die Aussteller der Vollmacht bestimmten einen oder mehrere Repräsentanten ihrer Kommune, die sie zum Landtag entsandten. Sie trugen diesen Delegierten auf, zusammen mit den Vertretern der anderen Stände über die Forderungen der Landesherrschaft zu beraten und einen Beschluss zu fassen. Die entsendende Kommune verpflichtete sich, diesen Landtagsbeschluss zu befolgen. Dem Abgeordneten wurde garantiert, dass ihm keine Nachteile aus seiner Tätigkeit erwachsen würden und man ihn nicht haftbar machen wolle. Als Urkunden wurden die Vollmachten gesiegelt. Die ältesten erhaltenen Vollmachten aus dem Jahr 1551 folgten diesem Schema ebenso wie die jüngsten aus dem Jahr 1801. Die Vollmachten sollten keinerlei Instruktionen oder Einschränkungen enthalten. Alle kurtrierischen Mandate waren also grundsätzlich frei. Damit konnte der Landtag ohne Beschränkung für die Kommunen bindende Entscheidungen fällen. Aber die Möglichkeiten der Gemeinden, ihre Repräsentanten zu kontrollieren, wurden noch weiter eingeschränkt. Ab 1601 lässt sich ein Amtseid von Landtagsabgeordneten nachweisen. Die Eidesformel entwickelte sich aus der formelhaften Begrüßung der Deputierten durch den Bürgermeister von Trier als dem Vorsitzenden der weltlichen Kammer. Der Eid blieb bis zum Ende des Kurstaates stets gleich: Die Deputierten schworen, ihre Entscheidungen zum Besten des Landes zu fällen. Dass sie Partikularinteressen der Kommunen wahrnehmen dürften, wurde damit zwar nicht explizit verneint, die Vertretung von kommunalen Anliegen jedoch implizit dem Landesinteresse untergeordnet. Die Deputierten verpflichteten sich weiter zu absolutem Stillschweigen über alle Verhandlungsgegenstände und den Verhandlungsgang des Landtages. In den Kommunen durften sie nur die Ergebnisse der Gespräche ohne jeden Kommentar präsentieren. Mit dieser Geheimhaltungspflicht sicherte sich der Landtag nach zwei Seiten ab. Zum einen selbstverständlich gegenüber dem Kurfürsten. Repressalien gegen bestimmte Abgeordnete, die sich kritisch oder widersetzlich den Ansprüchen der Herrschaft gegenüber zeigten, waren nicht möglich, wenn die Besprechungen innerhalb der weltlichen Kammer geheim blieben. Zum anderen wurde durch die Geheimhaltung den Kommunen jede Chance, ihre Abgeordneten zu kontrollieren, genommen. Die Deputierten waren den Ständen verbunden, nicht ihren Gemeinden. Dazu passt, dass kurtrierische Abgeordnetenämter Ehrenämter waren. Landtagsteilnehmer hatten keinen Anspruch auf eine Entlohnung durch die sie entsendenden Kommunen. Die Deputierten erhielten jedoch Tagegelder und eine Reisekostenerstattung. Diese wurden ihnen von der Ständekasse ausgezahlt. Die Stände trugen damit solidarisch als Kollektiv die finanzielle Belastung durch das Abgeordnetenwesen. In unmittelbarer finanzieller Abhängigkeit von der repräsentierten Gemeinde stand der jeweilige Deputierte damit nicht. Gemäß einer Gebührenordnung von 1655 erhielten Abgeordnete von Trier und Koblenz eineinhalb Reichstaler täglich, wenn der Landtag in der jeweils eigenen Stadt abgehalten wurde, ansonsten zwei Reichstaler. Dazu kamen Spesen für die Reise und Botenlöhne. Am Ende des 18. Jahrhundert wurde moniert, die
7 Abgeordneten erhielten „geringe und zu ihrer Subsistenz kaum hinreichige“ Diäten. Dennoch kam von Trier und Koblenz zu dieser Zeit der Vorschlag, Landtage möglichst selten einzuberufen, da diese der Landschaftskasse wegen der Diäten noch immer zu teuer kämen. Die politischen Absichten der Hauptstädte hinter diesem Vorstoß waren offensichtlich, da sie zugleich empfahlen, den beiden großen Städten noch mehr Spielraum zu geben. Dieses Kostenargument wurde noch stärker gemacht. Ab dem Ende des 16. Jahrhunderts forderte der Vorsitzende des Dritten Standes, der Bürgermeister von Trier, die Abgeordneten der Landgemeinden ausdrücklich auf, den Landtag möglichst schnell zu verlassen. Bereits am ersten Tag der Verhandlungen, unmittelbar nach der Überprüfung der Vollmachten, wurden die Deputierten der Bauern aufgefordert, wieder abzureisen. Ansonsten kämen ihre Tagegelder die Stände zu teuer. Von Anwesenheitspflicht war keine Rede. Von den abreisenden Abgeordneten wurde erwartet, dass sie auf der Ständeversammlung verbleibende Abgeordnete damit betrauten, ihre Interessen zu vertreten. Diese Mandatweitergabe wurde „Constitution“ genannt. Die Vollmachten von Landtagsabgeordneten enthielten häufig eine Klausel, die eine solche Delegation des Mandates in die Verfügung des Abgeordneten stellte. Im 16. Jahrhundert erfolgten Constitutionen noch ad personam: Die den Landtag verlassenden Deputierten benannten einen konkreten Abgeordneten als ihren bevollmächtigten Stellvertreter. 1599 etwa bevollmächtigten die abreisenden Vertreter von Leutesdorf, Hönningen und Arenfels den Koblenzer Deputierten Kaspar Trarbach. Es konnte aber auch statt einer konkreten Person eine andere Gemeinde constituiert werden. Diese Form der Constitution setzte sich durch: Die Vollmacht einer Gemeinde, deren Vertreter sich vom Landtag vorzeitig verabschiedeten, wurde einer anderen Kommune übertragen, so dass deren ganze Landtagsdelegation ein weiteres Mandat erhielt. Die Übertragung der Vollmachten erfolgte rasch nachdem die Sitzung der weltlichen Kammer eröffnet worden war und ohne weitere Formalien zügig vor den versammelten Ständen. 1603 „constituiert[en] die von der Bergpflege; Niederlahnstein, Kunenstein, Engers, Leutesdorf, Hammerstein und der auß der Pellenz die zu diesem tage von der statt Koblenz depuirten“. 1621 vermerkte das Landtagsprotokoll knapp und fast ungeduldig: „Die Bergpflege supportirt ihren gewalt der Statt Koblenz [...] Balduinstein und Hausen similiter Limburg constituerunt, Baldeneck constituit Zell, Pellenz will morgen constituiren.“ Dass mit der Constitution eine weitere Stimme bei Abstimmungen übertragen wurde, geht aus den Quellen nicht hervor. Die Subdelegation ist also weniger als Beauftragung eines Sachwalters zu verstehen, sondern eher als Anschluss an einen Schutzherrn. Wer waren nun die Abgeordneten? Hier stoßen wir auf ein Quellenproblem: Die Landtagsprotokolle verzeichnen nicht bei allen Deputierten, welche sonstigen politischen Ämter diese inne hatten. Selbstverständlich hatte der Großteil der Abgeordneten von Koblenz auch
8 einen Sitz im Stadtrat. Die erhaltenen Quellen lassen immerhin die Aussage zu, dass es sich bei den Abgeordneten der Landgemeinden häufig um Amtsträger der Kommunen oder der Landschaft handelte. Als Abgeordnete fungierten die dörflichen Ortsvorsteher. Seltener erschienen Gerichtsboten als Abgeordnete. Daneben wurden gelegentlich lokale Steuereinnehmer deputiert. Der Großteil der Abgeordneten gehörte jedoch zu den Schöffen der Dorfgerichte. Es war nicht verpflichtend, dass ein Abgeordneter in der Kommune lebte, die ihn entsandte. Tatsächlich entwickelten einige Dörfer reges Interesse daran, von vornherein Personen aus den Räten der 14 Städte als ihre Abgeordneten zu gewinnen. Einige Abgeordnete hatten Mandate von bis zu drei Kommunen gleichzeitig. Begehrt als Deputierte waren Personen, die bereits mehrere Landtage besucht hatten, also Erfahrung und Sachkenntnisse besaßen. Der Trierer Stadtschreiber Wilhelm von Bitburg erhielt für die sechs Landtage zwischen 1598 und 1601 nicht weniger als elf Mandate. Neben Trier vertrat er drei Landgemeinden. Einige Personen, in der Regel die Schreiber der größeren Städte, erwarben sich den Ruf, einflussreiche ‚Landtagsfachleute’ zu sein. Ihre Dienste als Deputierte wurden von den Landgemeinden nachgefragt. Der dörfliche Führungskreis von Schultheiß, Ortsvorsteher und Schöffen entsandte also entweder Personen aus ihrer Mitte, Amtsträger, die administrative Kenntnisse besaßen, oder politisch versierte Experten von außen. Erfahrung mit Recht und Verwaltung, Sachkenntnisse über Politik waren das entscheidende Kriterium bei der Auswahl von Abgeordneten. Man könnte im bescheidenen Rahmen von einer Expertokratie, einer Herrschaft der Fachleute im Dritten Stand Kurtriers sprechen. Die besten Experten für Politik und Verwaltung auf dem Land waren freilich nicht Amtsträger der Kommunen, sondern die Beamten der kurfürstlichen Herrschaft. Bäuerliche Gemeinden entsandten immer wieder die Beamten der Herrschaft, um auf dem Landtag mit der Herrschaft über Steuern zu verhandeln. Dies erschien auch einigen Zeitgenossen widersinnig. Die Städte wehrten sich gegen diese Praxis und verdrängten die Beamten aus den Landtagen. Ihre Vollmachten wurden nicht anerkannt. Das Verschwinden der Beamten des Kurfürsten als Abgeordnete der Landgemeinden um die Mitte des 17. Jahrhunderts fiel zusammen mit dem Verschwinden der Abgeordneten der Landgemeinden überhaupt. Ohne ihre eigenen Fachleute waren die Dörfer auf die Kompetenz der Städte angewiesen. Es schien nun möglich und letztlich sogar geboten, ganz auf die Teilnahme der Landkommunen zu verzichten. Erleichtert wurde diese Verdrängung der Dörfer durch zwei weitere Faktoren. Kurfürst Philipp Christoph von Sötern hatte mit seinen Versuchen, die Macht der Landesherrschaft nach quasi absolutistischem Vorbild auszubauen, einen schweren Konflikt zwischen Ständen und Herrschaft provoziert. Es ist bezeichnend für die tatsächliche Machtverteilung in Kurtrier, dass sich Kurfürst Philipp Christophs Auseinandersetzung mit dem weltlichen Stand als Kampf gegen die Hauptstädte beschreiben lässt. Trier und Koblenz setzte der Landesherr unter militärischen Druck. Den Koblenzer
9 Rat stellte er unter Aufsicht des landesherrlichen Schultheißen und drohte der Stadt umfangreiche Einquartierungen an. Der Kurfürst sprach den Direktorialstädten dezidiert ihre Leitungsfunktion in den Ständen ab. Die Einberufung von Ständeversammlungen sollte in Zukunft ohne ihre Mithilfe erfolgen. Die Stände vermuteten hierin richtig einen Anschlag auf ihr Selbstverwaltungsrecht. Philipp Christoph ging offenbar davon aus, durch einen ‚Enthauptungsschlag’ die Opposition des weltlichen Standes überwinden zu können. 1630 setzte der Kaiser Kurmainz und Kurbayern als Schlichter im Streit zwischen den erzstiftischen Ständen und ihrem Landesherrn ein. Vor den kritischen Schlichtungskommissaren stellten Trier und Koblenz ihr Verhältnis zu den anderen weltlichen Ständen als geordnet und unproblematisch dar. Den Räten der beiden Hauptstädte stünde die führende Rolle unbestritten und „per naturam“ zu. Juristisch begründet wurde diese Führungsposition mit der essentiellen Feststellung, der weltliche Stand sei eine universitas, die als solche eine klare Führung durch „officiales“ habe und brauche. Andernfalls drohten „lautere confusiones“. Angezweifelt würde die Stellung von Trier und Koblenz nur von Kurfürst Philipp Christoph, der damit aber die ständische Verfassung insgesamt in Frage stelle. Auch wenn das Eigeninteresse von Trier und Koblenz hier offensichtlich war: Die Selbstverständlichkeit, mit der sie die Aufgaben- und damit die Machtverteilung innerhalb der Stände schilderten, spricht dafür, dass die Partizipationschancen der Landbevölkerung im Erzstift bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich kein Thema waren. Trier und Koblenz betrachteten sich als Führungsmächte des Dritten Standes und wurden auch von den übrigen Kommunen Kurtriers und von der Landesherrschaft als solche verstanden. Die Einigung zwischen Kurfürst und Ständen im Jahr 1650, der Binger Rezess, brachte keine Überraschungen: Es wurde pauschal akzeptiert, dass die Dörfer zu den Ständen gehörten. Die Führungsrolle der Städte, insbesondere der Hauptstädte, wurde aber bestätigt. Die übrigen Kommunen der Trierer Landstände wurden mehr denn je zu ihrer Klientel. Ihre aktive Partizipation an der ständischen Repräsentation musste, zumindest was die Landgemeinden anging, verzichtbar erscheinen. Hinzu kamen die Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges. Diese trafen unterschiedliche Gemeinden unterschiedlich stark. Generell lässt sich aber festhalten, dass die großen Städte und die Herrschaft unter dem klugen Kurfürsten Karl Kaspar von der Leyen sich rascher als die Dörfer erholten. Nur vier Jahre nach dem Binger Rezess verschwanden die Dorfdeputierten endgültig von den Landtagen. Ein klarer Rechtsbruch, aber völlig im Einklang mit der politischen und ökonomischen Realität des Dritten Standes Kurtriers. In der Folgezeit erhoben Nebenstädte nur selten Kritik an den Eigenmächtigkeiten des Direktoriums. So beklagte sich etwa Wittlich 1654, dass das Direktorium mehr Steuern erhob, als beim Landtag vereinbart worden waren. Zudem sollten die Direktorialstädte auch außerhalb von Krisenphasen eigenmächtig neue Steuern bewilligt haben. Ihren Landtagsabgeordneten trugen die Wittlicher Ratsherren auf, nachzuforschen, wie mit den Steuermitteln seitens des Direktoriums umgegangen werde, denn sie „verspihren […], das Geld vile weeg habe.“
10 Aber niemand stellte die Führungsposition von Trier und Koblenz ernsthaft in Frage. Den Landgemeinden gegenüber entwickelten die Direktorialstädte nun geradezu den Charakter einer Obrigkeit, einer zweiten Regierung. 1735 wurden die Direktorialstädte von Zender und „Gemeindsleuten“ Welschbilligs, einer formal über Stadtrecht verfügenden, jedoch nicht zu den 14 Städten gezählten ländlichen Kommune, als „Eurer Wohl- und hoch Edel geborne Unterthänig fußfällig angeeflehet großgünstigst“ Steuerforderungen zu reduzieren. Der Kontakt zwischen Trier und Koblenz wurde mit einigem Aufwand unterhalten, im 18. Jahrhundert kommunizierten die Räte „per Estafette“ miteinander. Dennoch war ihre Kooperation durchaus nicht immer harmonisch. Dem Versuch Triers, sich als der unbestreitbare Wortführer des Dritten Standes zu etablieren, begegnete Koblenz gelegentlich durch eine demonstrative Verweigerungshaltung. Der Konflikt zwischen Koblenz und Trier war einer der Gründe für das endgültige Versagen der Stände in ihrer letzten Krise: den Jahren nach der Französischen Revolution. Wirtschaftliche Schwierigkeiten und Zunftunruhen belasteten das Verhältnis der Städte zum letzten Kurfürsten, Clemens Wenzeslaus von Sachsen, schon während der 1780er Jahre. Durch den Bau der neuen Residenz in Koblenz hatte sich das Verhältnis zwischen Obererzstift und Niedererzstift, zwischen Trier und Koblenz, rapide verschlechtert. Das Obererzstift sah sich übervorteilt. Man hatte nicht nur die endgültige Verschiebung des Herrschaftsmittelpunktes nach Koblenz mit allen negativen ökonomischen und wirtschaftlichen Folgen hinnehmen müssen, man hatte dafür durch Steuern für den Palastbau auch noch selbst gezahlt. 1789 reichte das Trierer Direktorium ein Beschwerdeschreiben bei der Landesregierung ein, in dem verlangt wurde, den Ständen, insbesondere dem Obererzstift, ihre hergebrachten Rechte zu garantieren. Der Plan setzte sich nicht durch. Das Kurfürstentum hatte drängendere Probleme. Kurfürst Clemens Wenzeslaus gewährte Adeligen, die aus dem revolutionären Frankreich geflohen waren, Asyl. Diese Adeligen rüsteten offen für einen Feldzug gegen Frankreich. Die Stände befürchteten völlig zu Recht, dass die offene Unterstützung dieser aggressiven Emigranten durch den Kurfürsten, Frankreich zu einem militärischen Erstschlag provozieren könnte. Die Stände versuchten in den 1790ern Einfluss auf die Außenpolitik zu gewinnen. Als Clemens Wenzeslaus sich solche Einreden verbat, drohten die Stände nicht nur mit einer Klage beim obersten Reichsgericht. Sie kündigten darüber hinaus mit einem beispiellosen Schritt in die Öffentlichkeit an: Die Stände wollten die Anordnungen des Kurfürsten und ihre Reaktionen darauf veröffentlichen und so demonstrieren, dass sie keine Schuld am drohenden Krieg mit Frankreich traf. Mehr noch: Die Landstände warnten den Kurfürsten davor, dass sie selbstständig Kontakt mit der Assemblée Nationale aufnehmen würden. Keine dieser Drohungen machten die Stände wahr. Die anhaltenden Spannungen zwischen Trier und Koblenz verschlechterten die Verhandlungsposition der Landstände massiv. Die Koblenzer im Direktorium hatten sich zunächst ganz passiv verhalten,
11 später blockierten sie eine Veröffentlichung der Proteste der Stände gegen die kurfürstliche Frankreichpolitik. Daran waren auch die harten Maßnahmen des Kurfürsten schuld: Er drohte seinerseits offen mit Strafverfahren und ließ den Syndikus des weltlichen Stands, Peter Ernst von Lassaulx, verhaften. In dieser angespannten Lage wurden hektisch Verfassungsreformen diskutiert. Auf den ersten Blick scheinen der drohende Krieg und die drohende Revolution weitgehende Neuerungen denkbar gemacht zu haben. Auf den zweiten Blick erkennt man sehr alte Konflikte und Interessen in neuer Aufmachung. 1789 verlangten die Trierer Zünfte ein Ende der geheimen Landtagsberatungen, da die „Landständ nur das Volck, und die unterthanen repäsentiren und folgsam letzteren […] von allem dem, was die repräsentanten vornehmen und Beschliessen nicht geheimgehalten werden dörfte, Besonders, wo die unterthanen […] alles zalen müssen.“ 1791 machte sich das Trierer Direktorium Forderungen aus dem Obererzstift zu eigen, nach denen das Freie Mandat der Deputierten abgeschafft werden sollte. Sehen wir hier Ansätze zur Rechenschaftspflicht von Abgeordneten? Die Argumente der Revolution wurden von Trier eingesetzt, um einem ganz anderen politischen Zweck zu dienen. Auf der Agenda Kurtriers stand weit oben der Streit zwischen Trier und Koblenz. Die größere Kontrolle über die Landtagsverhandlungen, die das Trierer Direktorium befürwortete, sollte dem Regionalinteresse des Obererzstiftes dienen. Man hoffte so, sich dem Zugriff einer befürchteten informellen Koalition zwischen der Herrschaft und dem Niedererzstift entziehen zu können. Dies wird aus den weiteren Forderungen der Gravamina und des Memorandums deutlich: Die Landtage sollten jährlich stattfinden, und zwar jährlich alternierend in den beiden Hauptstädten. Mehr noch: Trier entwickelte den Plan die Landtage sollten künftig nicht mehr in zwei Kammern, nämlich einem geistlichen und einem weltlichen, sondern in vier Kammern tagen: Die alte Teilung der geistlichen und weltlichen Stände in die des Oberstifts und des Niedererzstifts, sprich in den Trierer und den Koblenzer Einflussraum, sollte damit konsequent weitergeführt werden zur Schaffung von zwei kurtrierischen Landtagen. Es ging hier um regionale Einflusssphären, nicht um Volkssouveränität. Die Rhetorik der Revolution griffen die Stände auf. In ihrem Kampf gegen die Emigrantenpolitik Kurfürst Clemens Wenzeslaus’ argumentierten die Landstände, dass sie ein Recht auf Opposition hätten. Sie repräsentierten nämlich das Volk. Die Direktorialstädten verkündeten, es sei immer die Aufgabe der Landtage gewesen, alle Angelegenheiten zu diskutieren, „welche den underthan druken“. Angesichts der Dominanz der Steuerverwaltung und der Herrschaft der elitären Ratsgremien der Direktorialstädte über die Ständeversammlung konnte hiervon in Wirklichkeit keine Rede sein. Auf dem Landtag von 1792 forderte Trier die Abgeordneten des Obererzstiftes ausdrücklich auf, „als Repräsentanten
12 des Volkes“ gegen die Emigranten zu protestieren. Die Herrschaft wischte dieses Argument mit der schlichten Feststellung vom Tisch, dass den Direktorialstädten Trier und Koblenz „keine Repräsentantschaft der Untertanen“ zustehe. Ein wirklich revolutionärer Vorschlag griff die alte politische Repräsentation der Landgemeinden auf. Im Jahr 1790 bat die Stadt St. Wendel darum, wieder in den Kreis der privilegierten Städte aufgenommen zu werden und damit wieder Sitz und Stimme beim Landtag zu erhalten. Der weltliche Syndikus Peter Ernst von Lassaulx verfasste daraufhin ein Memorandum, in dem er versuchte, aus der widersprüchlichen Praxis der Vergangenheit Sinn im revolutionären Kontext zu machen. Es ging ihm dabei freilich weniger um historisch korrekte Angaben als darum, ein neues politisches Programm zu rechtfertigen. Lassaulx behauptete, grundsätzlich sei in Kurtrier „ein jedes Amt, ja ein jedes Kirchspiel“ landtagsberechtigt. Selbst wenn dieses Recht über Jahrhunderte nicht ausgeübt bzw. delegiert worden sei, bestünde es weiter. Alle Kommunen sollten mit Deputierten beim Landtag vertreten seien. Zur Teilnahme am Landtag berechtige die Steuerpflicht. Lassaulx akzeptierte hier wie selbstverständlich Kommunen und alte Verwaltungsdistrikte, die z. T. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts ja tatsächlich Standschaft genossen hatten, als Repräsentationseinheiten. Er verstand die Repräsentation der in diesen Bezirken zusammengefassten Landgemeinden jedoch als Repräsentation des ganzen als souverän gedachten Volkes. Diese Sicht war in der Tradition der kurtrierischen Landstände gerade eben nicht angelegt gewesen: Lassaulx entwickelte vielmehr ein neues, revolutionäres Argument. Die Landgemeinden sollten einen Ausschuss wählen, der ebenso viele Mitglieder wie die Deputationen der 14 Städte zählen und dieselben Rechte genießen sollte, quasi eine Bauernkammer neben einer Städtekammer innerhalb des Dritten Standes. Von dieser Reform versprach sich der Syndikus eine Stärkung des Landtages gegenüber dem Kurfürsten. Die Erweiterung der Zahl der Landtagsteilnehmer würde neue personelle Ressourcen erschließen. Dadurch könnte der Landtag größere Kompetenz in Sachfragen gewinnen. Das Trierer Direktorium, das mit dem Fall St. Wendels unmittelbar befasst war, lehnte den Vorstoß dieser Stadt ebenso wie Lassaulx’ Reformvorschlag rundheraus ab. Die Erfahrung des 16. Jahrhunderts habe gezeigt, dass die Dörfer und ländlichen Repräsentationsbezirke schlicht nicht in der Lage seien, kompetente Abgeordnete zu entsenden. Sie seien bloß eine Belastung des politischen Systems. Lassaulx, der vergessene Revolutionär von Koblenz, scheiterte nicht an der Herrschaft, sondern an den Ständen. Er scheiterte auch an den Bauern, die an seinem Vorschlag offenbar gänzlich desinteressiert waren. Dieses Scheitern von Lassaulx bedeutet keinesfalls, dass er und sein mutiger Plan in Vergessenheit geraten dürfen. Es ist hoch an der Zeit, sich an einen Vorkämpfer politischer Freiheit zu erinnern, der lange vor Hambach und vor der Mainzer Republik versuchte, aus der Geschichte des Rhein- und Mosellandes Argumente für eine eigene Revolution zu destillieren.
13 Das Kurfürstentum Trier war sicherlich keine Demokratie und auch keine Republik. Die Stände sind zusammen mit dem Kurfürstentum untergegangen; es gibt keine kontinuierliche Entwicklung bis hin zur parlamentarischen Demokratie der Gegenwart. Die politische Repräsentation der Landbevölkerung Kurtriers kann nicht im Kontext des Grundgesetzes verstanden werden; sie muss im Kontext ihrer eigenen Zeit gesehen werden. Und in diesem Kontext ist sie spektakulär. Durch die Mitbestimmungsbefugnisse, die bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts bestanden, waren die Bauern Kurtriers deutlich stärker ihre Standesgenossen in den meisten anderen Territorien des Reiches. Die Bauern der meisten europäischen Staaten genossen keine politischen Rechte, die auch nur annähernd so groß waren. Dass die Landbevölkerung des Kurfürstentums ihre politischen Privilegien kaum nutzte und daher schließlich verlor, erklärt sich nicht aus dem Einfluss der Kurfürsten. Die Dörfer stießen innerhalb des Dritten Standes auf ihren eigentlichen Widerpart: die übermächtigen Städte. Deren Überlegenheit in wirtschaftlicher Kraft, politischer Macht und Sachkompetenz wurde akzeptiert. Ohne Widerstand, ja offenbar bereitwillig, begab sich die Landbevölkerung unter die Vormundschaft der Städte. Und damit verloren sie ihr altes Recht auf Mitsprache.
Sie können auch lesen