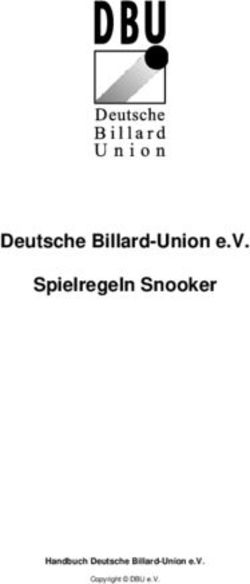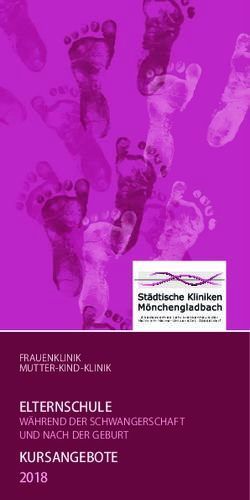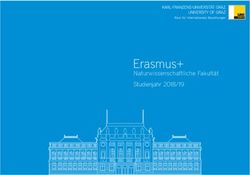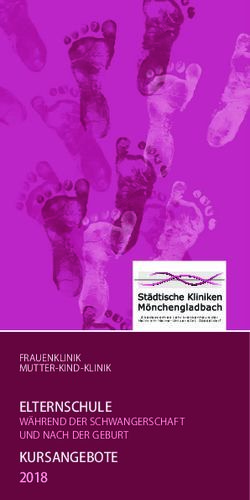Konzernbetriebsrat informiert: Schwangerschaft, Karenz und Wiedereinstieg
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
BILLA Betriebsrat
Alfred Greis Franz Marosits
Vorsitzender BILLA Angestelltenbetriebsrat Vorsitzender des BILLA Arbeiterbetriebsrat
Tel.: 02236/600 4990 Tel.: 02236/600 2620
Mobil: 0664/200 01 20 Mobil: 0664/100 66 53
E-Mail: a.greis@rewe-br.at E-Mail: f.marosits@billa.co.at
MERKUR Betriebsrat
Renate Sabeti Elfriede Lippert
Vorsitzende des Vorsitzende des
MERKUR Angestelltenbetriebsrat MERKUR Arbeiterbetriebsrat
Tel.: 02236/600 4581 Tel.: 02236/600 4980
Mobil: 0664/620 98 15 Mobil: 0676/408 21 08
E-Mail: r.sabeti@merkur.co.at E-Mail: e.lippert@merkur.co.at
BIPA Betriebsrat PENNY Betriebsrat
Helga Rath Elfriede Ott
Vorsitzende BIPA Betriebsrat Vorsitzende des PENNY Betriebsrat
Tel.: 02236/600 4410 Tel.: 02236/600 7550
Mobil: 0664/620 95 31 E-Mail: b.ott@penny.at
E-Mail: h.rath@bipa.co.at
2 Impressum:
Herausgeber: REWE Konzernbetriebsrat – Auflage: 9-2006 – Inhalt: Mag. Sabine TillingerKapitel 1: SCHWANGERSCHAFT
Schwanger – was ist zu tun?
Melden beim Arbeitgeber
Sobald eine Schwangerschaft bemerkt wird, sollte man diese dem
Arbeitgeber mitteilen. Man muss jedoch nicht und es bleibt jeder
Arbeitnehmerin selbst überlassen, wann sie bekannt gibt, dass sie
schwanger ist. Solange der Arbeitgeber jedoch nichts von der
Schwangerschaft weiß, kann er auch nicht auf die besonderen
Rechte und Schutzmaßnahmen für Schwangere Rücksicht
nehmen.
Was hat der Arbeitgeber zu tun?
Sobald der Arbeitgeber von der Schwangerschaft erfährt, muss er
dies dem Arbeitsinspektorat mitteilen. Dieses kann jederzeit die
Bedingungen, unter denen die Schwangere zu arbeiten hat, über-
prüfen. Weiters ist es seine Pflicht die Schwangere nicht mehr für
Arbeiten heranzuziehen, die ihr selbst oder dem Kind schaden
zufügen würden.
Welche Rechte habe ich – was muss der
Arbeitgeber beachten?
Beschäftigungsverbote während man schwanger ist
Jene Tätigkeiten, die die Gesundheit des Kindes oder der Mutter
beeinträchtigen würden, müssen nicht mehr ausgeführt werden:
• Heben und Tragen von schweren Lasten
• Einwirkungen von Hitze, Kälte oder Nässe, wenn diese
schädigend sein könnten.
• Arbeiten im ständigen Sitzen oder Stehen, wenn nicht Ge-
legenheiten zu kurzen Unterbrechungen möglich sind. Ab der
20. Schwangerschaftswoche maximal 4 Stunden!
• Arbeiten mit häufigem Strecken, Beugen oder Bücken
• Arbeiten unter Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden
Stoffen
• Arbeiten unter Zeit- und Leistungsdruck (Akkordlohn)
3Kapitel 1: SCHWANGERSCHAFT
Liege- und Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen
Der Arbeitgeber ist weiters dazu verpflichtet, eine Möglichkeit zum
Hinlegen und Ausruhen zu gewährleisten z. B.: Liegemöglichkeiten
oder Sitzmöglichkeiten. Diese Ruhezeiten sind als Arbeitszeit zu
bezahlen. Weiters muss die schwangere Arbeitnehmerin vor
Tabakrauch geschützt werden.
Versetzung – Fortzahlung des Entgelts
Sollte es notwendig sein, die Arbeitnehmerin auf einen geeigneten
Arbeitsplatz zu versetzen, hat der Betriebsrat ein Mitwirkungs-
recht. Sollte kein geeigneter Arbeitsplatz gefunden werden und die
Mitarbeiterin nicht mehr eingesetzt werden können, so muss trotz-
dem das volle Gehalt/Lohn weiterbezahlt werden.
Überstunden und Überstundenpauschale
Schwangere dürfen keine Überstunden leisten, d. h. wöchentlich
nicht mehr als 40 Stunden und täglich nicht mehr als 9 Stunden
arbeiten. Die Überstundenpauschale MUSS NICHT weitergezahlt
werden, KANN jedoch.
Vor allem bei Filial- und AbteilungsleiterInnen, die weiterhin die
Verantwortung für den reibungslosen Ablauf in der Filiale tragen.
Untersuchungen
Die Zeiten für schwangerschafts-
bedingte Vorsorgeuntersuchungen
werden dann als Arbeitszeit ge-
schrieben, wenn die Untersuchun-
gen außerhalb der Arbeitszeit nicht
möglich oder zumutbar sind.
Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsverbot
Schwangere dürfen in der Nacht von 6.00 bis 20.00 Uhr, am
Sonntag und am Feiertag nicht arbeiten. Es gibt keine Ausnahme
für den 8. Dezember oder für Saisonfilialen!!
4Kapitel 1: SCHWANGERSCHAFT
Kündigungs- und Entlassungsschutz
Während der Schwangerschaft
Die Dienstnehmerin hat ab Bekanntgabe der Schwangerschaft
einen Kündigungs- und Entlassungsschutz. Das heißt, eine Kün-
digung ist nur aus im Gesetz aufgezählten Gründen möglich und
bedarf vorher der Zustimmung des Arbeits- und Sozialgerichtes.
Wird eine Kündigung ausgesprochen und gibt eine Arbeitnehmerin
eine Schwangerschaft innerhalb der nächsten 5 Arbeitstage
bekannt, so ist die Kündigung rechtsunwirksam. Ist die Arbeit-
nehmerin zum Zeitpunkt der Kündigung schon schwanger und
weiß es jedoch noch nicht, so wird die Kündigung rechtsunwirk-
sam, wenn die Schwangerschaft unverzüglich nach Kenntnis-
erlangung (am gleichen oder spätestens darauf folgenden Tag)
dem Arbeitgeber mitgeteilt wird.
Befristete Dienstverhältnisse
Wird die Arbeitnehmerin schwanger und befindet sich in einem
befristeten Dienstverhältnis, so wird das Ende der Befristung durch
die Schwangerschaft bis zum Beginn des absoluten Beschäf-
tigungsverbotes (oder einer vorherigen Freistellung) hinausgezö-
gert. Das Dienstverhältnis ist dann beendet. Im Konzern wird ein
Dienstverhältnis meist nach dem ersten Monat (= Probemonat)
noch für zwei weitere Monate befristet und geht erst nach den
ersten drei Monaten in einen unbefristetes Dienstverhältnis über.
Probemonat
Wird eine Dienstnehmerin während des Probemonats schwanger
hat sie keinen Kündigungs- und Entlassungsschutz. Durch das
Gleichbehandlungsgesetz besteht die Möglichkeit die Auflösung im
Probemonat wegen Diskriminierung anzufechten, wenn die
Arbeitnehmerin glaubhaft machen kann, dass das Probedienst-
verhältnis nur wegen ihrer Schwangerschaft gelöst wurde.
5Kapitel 1: SCHWANGERSCHAFT
Nach der Schwangerschaft und während der Karenz
Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gilt bis 4 Monate nach
der Entbindung. Nach dem Ende der gesetzlichen Karenz
(2. Geburtstag) gilt er noch 4 Wochen.
Während der Elternteilzeit
Sofort bei Bekanntgabe einer Elternteilzeitbeschäftigung beginnt
der Kündigungs- und Entlassungsschutz, frühestens jedoch 4 Mo-
nate vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung. Der Kündigungs- und
Entlassungsschutz dauert bis 4 Wochen nach dem Ende der
Teilzeitbeschäftigung, längstens jedoch bis 4 Wochen nach dem
4. Geburtstag des Kindes. Allerdings gibt es danach einen so
genannten Motivkündigungsschutz bis zum 7. Lebensjahr des
Kindes. Die Kündigung kann beim Arbeits- und Sozialgericht ange-
fochten werden, wenn die Kündigung wegen der beabsichtigten
oder in Anspruch genommenen Teilzeitbeschäftigung ausgespro-
chen wurde.
Väter
Auch für den Vater gilt ein Kündigungs- und Entlassungsschutz,
sobald er den Wunsch in Karenz oder Elternteilzeit zu gehen,
äußerst, bei der Karenz frühestens jedoch mit der Geburt des
Kindes, bei der Elternteilzeit frühestens 4 Monate vor dem Antritt.
Urlaub
Urlaub erwirbt man pro gearbeiteten Monat ca. 2,5 Tage, also 30
Tage pro Jahr. (36 Tage nach 25 Dienstjahren). Auch während des
Wochenschutzes 8 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin
und 8 (bis 16 Wochen) nach der Geburt erwirbt man Urlaub.
Während der Karenz erwirbt man keinen neuen Urlaub. Kann der
Urlaub nicht konsumiert werden, so bleibt dieser bis zum
Wiedereintritt stehen, er verfällt nicht!
6Kapitel 1: SCHWANGERSCHAFT
Sonderzahlungen
Bis zum Beginn des Wochenschutzes hat man Anspruch auf
Weihnachts- und Urlaubsgeld. Allerdings nur im aliquoten Ausmaß
zu den gearbeiteten Monaten im Kalenderjahr. Zuviel bezahltes
Urlaubsgeld wird mit dem noch ausstehenden Weihnachtsgeld
aufgerechnet. Beginnt der Wochenschutz wird daher auch das
Urlaubs- und Weihnachtsgeld abgerechnet!
Wochenschutz
Absolutes Beschäftigungsverbot
8 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin beginnt der
Wochenschutz = absolutes Beschäftigungsverbot. Die Dienst-
nehmerin darf dann nicht mehr arbeiten! Die Schutzfrist beträgt
nach der Geburt mindestens 8 Wochen, bei Früh-, Mehrlings-
geburten und Kaiserschnittgeburten verlängert sie sich auf zwölf
Wochen. Verkürzt sich die 8 Wochen Frist vor der Geburt, so ver-
längert sich die Wochenfrist nach der Entbindung um die gekürz-
ten Wochen maximal bis zu 16 Wochen.
7Kapitel 1: SCHWANGERSCHAFT
Wochengeld
Während des Wochenschutzes bekommt die Arbeitnehmerin das
Wochengeld. Das Wochengeld errechnet man aus dem durch-
schnittlichen Nettoeinkommen der letzten 13 Wochen vor Beginn
der Schutzfrist zuzüglich Sonderzahlungen (idR ca. 17%).
Das Wochengeld muss bei der zuständigen Krankenkasse
unter Vorlage der ärztlichen Bestätigung und einer Arbeit- und
Entgeltsbestätigung des Arbeitgebers von der Arbeitnehmerin
beantragt werden.
Wird die Dienstnehmerin schon vorher freigestellt, so erhält sie ab
diesem Zeitpunkt schon das Wochengeld. Schwangere, die nicht
in einem aufrechten Dienstverhältnis sind und Arbeitslosengeld er-
halten, bekommen ein Wochengeld von 180% des Letztbezuges.
Geringfügig Beschäftigte erhalten nur dann ein Wochengeld, wenn
sie sich in der Kranken- und Pensionsversicherung selbst ver-
sichert haben. Der Tagessatz beträgt in diesen Fällen € 7,01.
Geringfügig Beschäftigte, die nicht selbstversichert sind, bekom-
men kein Wochengeld.
8Kapitel 2: KARENZ
Was ist nach der Geburt zu erledigen
Geburtsurkunde
wird beim zuständigen Standesamt ausgestellt. Mitzubringen sind
Geburtsurkunde der Mutter, Staatsbürgerschaftsnachweis der
Eltern, Meldezettel der Eltern, Heiratsurkunde, Scheidungs-
urkunde.
Geburtsbestätigung
Ist ebenfalls am Standesamt erhältlich und wird für den Antrag auf
das Wochengeld gemeinsam mit dem Entlassungsschein des
Krankenhauses gebraucht.
Meldezettel
Das Kind muss am Bezirksmeldeamt angemeldet werden.
Babypakete
Jedes Bundesland bietet verschiedene Babypakete an, für die man
sich anmelden kann. Informieren Sie sich auch über den BIPA
Babyclub.
Arbeitgeber und Betriebsrat
Auch der Arbeitgeber muss verständigt werden, schicken Sie die
Geburtsurkunde gemeinsam mit der Mitteilung über eine Karenz
an das Personalbüro.
Auch der Betriebsrat unterstützt jede Mitarbeiter/in, die schon län-
ger als ein Jahr (MERKUR 3 Jahre) bei uns beschäftigt ist, mit
Gutscheinen.
Schicken Sie dazu die Geburtsurkunde an das
Betriebsratsbüro
IZ NÖ-Süd
Straße 3, Objekt 16
2355 Wr. Neudorf
9Kapitel 2: KARENZ
Die Karenz ist eine Dienstfreistellung gegen Entfall der Bezüge mit
Kündigungs- und Entlassungsschutz. Das heißt, man muss nicht
arbeiten gehen, bekommt aber auch keinen Gehalt / Lohn und
erwirbt auch sonst keinerlei Ansprüche. Voraussetzung für eine
Karenz ist, dass das Kind im gemeinsamen Haushalt lebt.
Wie lange?
Eine Karenz kann in Anspruch genommen werden frühestens nach
dem absoluten Beschäftigungsverbot bis spätestens 1 Tag vor
dem 2. Geburtstag des Kindes (Ausnahme: aufgeschobene
Karenz). Die Karenz kann zweimal zwischen den Eltern geteilt wer-
den, wobei ein Teil mindestens 3 Monate dauern muss. Beim
ersten Wechsel kann 1 Monat gemeinsam in Karenz gegangen
werden, der Anspruch auf Karenz verringert sich dadurch aber um
dieses eine Monat.
Aufgeschobene Karenz
Beide Elternteile haben die Möglichkeit jeweils 3 Monate der
Karenz bis zum Ablauf des 7. Lebensjahres des Kindes (bzw. spä-
teren Schuleintritt) aufzuheben. Je nachdem wie viel aufgescho-
ben wird, verkürzt sich die Karenz auf bis zum 18. Lebensmonat
des Kindes.
Verhinderungskarenz
Ist der Elternteil, der das Kind bisher betreut hat, durch ein unvor-
hersehbares und unabwendbares Ereignis für eine längere Zeit
verhindert, so kann der andere Elterteil für diese Zeit kurzfristig
einspringen, allerdings nur bis zum 2. Geburtstag des Kindes. Er
hat dies dem Arbeitgeber schnellstmöglich mitzuteilen. Der
Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt mit der Meldung und
dauert bis 4 Wochen nach dem Ende
der Karenz.
10Kapitel 2: KARENZ
Adoptiv- und Pflegeeltern haben gleiche Ansprüche. Wird ein Kind
erst nach dem 18. Lebensmonat, jedoch vor dem 2. Lebensjahr
adoptiert oder in unentgeltliche Pflege genommen, so besteht ein
Anspruch auf Karenz von maximal 6 Monaten über das zweite
Lebensjahr hinaus. Wird ein Kind erst nach dem 18. Lebensmonat,
jedoch vor dem 7. Lebensjahr adoptiert oder in unentgeltliche
Pflege genommen, so besteht ein Anspruch auf maximal 6 Monate
Karenz.
Was ist zu tun?
Die Karenz ist dem Arbeitgeber bis spätestens 8 Wochen nach der
Geburt zu melden. Möchte man eine Karenz teilen oder verlängern
(bis zum 2. Geburtstag des Kindes), so muss dies immer 3 Monate
vor der Änderung dem Arbeitgeber bekannt gegeben werden.
Auch der Wunsch einen Teil der Karenz aufzuschieben, muss dem
Arbeitgeber 3 Monate vor dem Karenzende (Achtung 18. oder
21. Lebensmonat) mitgeteilt werden. Auch die Inanspruchnahme
der aufgeschobenen Karenz muss 3 Monate vorher dem Arbeit-
geber mitgeteilt werden.
11Kapitel 2: KARENZ
Arbeiten während der Karenz
Geringfügige Beschäftigung
Neben der Karenz kann geringfügig dazu verdient werden. Sollte
dies bei einem anderen Arbeitgeber sein, so wird empfohlen dies
dem Arbeitgeber des karenzierten DV zu melden. Es darf die
Geringfügigkeitsgrenze von monatlich € 333,16 (2006) nicht über-
schritten werden. Für die geringfügige Beschäftigung wird ein
komplett neues Dienstverhältnis begründet, das auf das alte
Dienstverhältnis nicht angerechnet wird!!
Vollzeit – Beschäftigung von höchstens 13 Wochen
Weiters ist es möglich höchstens 13 Wochen pro Kalenderjahr
Vollzeit oder Teilzeit zu arbeiten. Ist man allerdings nicht mehr das
ganze Jahr in Karenz, so müssen die 13 Wochen anteilsmäßig
gerechnet werden. Achtung! Es ist möglich zusätzlich zum
Kinderbetreuungsgeld monatlich ca. € 1.140 dazuzuverdienen –
Nähere Infos zur Grenze bei Ihrem Betriebsrat. Werden die
13 Wochen überschritten, führt dies jedoch zum Verlust des
Kündigungs- und Entlassungsschutzes. Meist wird auch die
Karenz dadurch stillschweigend vorzeitig beendet! Möchte man bei
einem anderen Arbeitgeber arbeiten, so muss der bisherige
Arbeitgeber am besten schriftlich zugestimmt haben.
12Kapitel 2: KARENZ
Wie wirkt sich die Karenz auf das
Dienstverhältnis aus?
Prinzipiell ruhen alle Pflichten sowohl des Arbeitgebers, als auch
Arbeitnehmers, das Arbeitsverhältnis ist „stillgelegt“. 10 Monate
der ersten Karenz werden allerdings für die Bemessung der
Kündigungsfrist für das Urlaubsausmaß (25 Jahre – 36 Tage) für
die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall angerechnet! Sie zählen
jedoch nicht für die Abfertigung, Jubiläum und dgl.
Kinderbetreuungsgeld
Voraussetzungen für den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld
• Vorliegen des Anspruch auf Familienbeihilfe
• Ein gemeinsamer Wohnsitz mit dem Kind
• und nicht mehr als jährlich € 14.600 verdiene
also vollkommen unabhängig von einer Karenz!!!
Ab wann und wie lang?
KBG bekommt man ab dem Geburtstag des Kindes, es ruht aller-
dings während des Wochengeldbezugs. Liegt der Wochengeld-
bezug unter täglich € 14,53, so bekommt man die Differenz aus
dem Kinderbetreuungsgeld!
KBG kann von einem Elternteil bis zum 30. Lebensmonat bezogen
werden, von beiden Elternteilen bis zum 36. Lebensmonat.
Die gesetzliche Karenz endet jedenfalls mit dem
24. Lebensmonat.
13Kapitel 2: KARENZ
Höhe
Das Kinderbetreuungsgeld beträgt täglich € 14,53.
Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Kinderbetreuungsgeld für
jedes weitere Kind um 50%. Das KBG wird ab dem 21. Lebens-
monat halbiert, wenn die Mutter-Kind-Pass Untersuchungen nicht
gemacht werden.
Versicherung
Während des Bezuges von KBG ist man voll kranken- und
unfallversichert. Für die Pension werden 24 Beitragsmonate an-
gerechnet.
Zuverdienst beim Kinderbetreuungsgeld
Die Grenze für alle steuerpflichtigen Einkommen (nicht z. B. Fami-
lienbeihilfe) ist € 14.600 brutto, monatlich ca. € 1.140.
Besteht der Anspruch auf KBG nicht das ganze Jahr, so muss ent-
sprechend der Monate aliquotiert werden! Die Einhaltung wird jähr-
lich im Nachhinein überprüft, bei Überschreitung muss das gesam-
te KBG des ganzen Jahres zurückgezahlt werden!!!
Das Kinderbetreuungsgeld kann auch neben einer Teilzeit-
beschäftigung im Anschluss an die gesetzliche Karenz oder neben
der Elternteilzeit bezogen werden, wenn die Einkünfte im Monat
nicht € 1.140 überschreitet!
Auch beim Wiedereintritt nach der gesetzlichen Karenz mit einem
höheren Einkommen (> € 1.140) während des Jahres, kann KBG
(bis zum 30. / 36.Lebensmonat des Kindes) beantragt werden,
wenn das Durchschnittseinkommen aufs ganze Jahr hochgerech-
net, nicht höher als € 1.140 beträgt.
14Kapitel 3: WIEDEREINSTIEG
Die Karenz geht zu Ende? Welche Möglichkeiten
gibt es?
Verlängerung – außer-
ordentliche Karenz
Es ist möglich eine Ver-
längerung der Karenz zu
beantragen. Der Arbeit-
geber muss allerdings
damit einverstanden sein
und kann dies auch ableh-
nen. Jedenfalls ist eine
schriftliche Vereinbarung
der so genannten außeror-
dentlichen Karenz empfeh-
lenswert! Aber Vorsicht
während dieser Zeit be-
steht kein Kündigungs- und
Entlassungsschutz und
auch die Möglichkeit des
Mutterschaftsaustrittes ist
in der außerordentlichen
Karenz nicht mehr möglich.
Mutterschaftsaustritt
Abfertigung alt
War eine Arbeitnehmerin mindestens 5 Jahre vor der Geburt
beschäftigt und gibt sie während der Wochenhilfe oder bis späte-
stens 3 Monate vor Ende der gesetzlichen Karenz (einen Tag vor
dem 2. Geburtstag des Kindes) die Beendigung ihres Dienstver-
hältnisses bekannt, so bekommt sie die Hälfte der gesetzlichen
Abfertigung maximal jedoch das Dreifache des monatlichen
Entgelts.
16Kapitel 3: WIEDEREINSTIEG
Abfertigung neu
Für alle Dienstverhältnisse, die nach dem 1. 1. 2003 begonnen
haben gilt die Abfertigung neu. Hier wird vom Arbeitgeber 1,53%
vom Bruttogehalt an die so genannte Mitarbeitervorsorgekasse
einbezahlt. Während der Karenz werden 1,53% vom Kinder-
betreuungsgeld aus dem Familienlastenausgleichsfonds an die
MVK einbezahlt. Beendet die Mutter während der Schutzfrist oder
Karenz das Dienstverhältnis so kann sie die Auszahlung der
Abfertigung von der zuständigen MVK verlangen.
Elternteilzeit
gibt Eltern einen Anspruch auf Veränderung der
Arbeitszeit und/oder auf Veränderung der
Arbeitszeiteinteilung!
Gilt nicht für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, auch
Lehrlinge sind ausdrücklich aus der Regelung ausgenommen.
Voraussetzungen für die Elternteilzeit
• im Betrieb müssen mehr als 20 Dienstnehmer beschäftigt sein!
Abgestellt wird auf den Betrieb und nicht auf die Filiale
• für den Anspruch muss eine Wartezeit von 3 Jahren erfüllt sein,
d. h. der Dienstnehmer muss bereits 3 Jahre im Unternehmen
beschäftigt sein, wobei die Karenzzeit miteingerechnet wird. Ist
der Dienstnehmer weniger als 3 Jahre dabei, kann er die Eltern-
teilzeit beantragen, wenn er die 3 Jahre erreicht hat.
• rechtzeitige Geltendmachung mindestens 3 Monate vor Antritt
der Elternteilzeit in schriftlicher Form, wobei Beginn, Dauer,
Arbeitszeit und Lage genau angeführt werden muss.
• Wenn Kind und Eltern im selben Haushalt leben oder eine
Obsorgepflicht nach ABGB vorliegt. Der andere Elternteil darf
sich jedoch nicht in Karenz befinden.
17Kapitel 2: KARENZ
Sogar neben dem Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe kann KBG
bezogen werden, wenn man arbeitswillig und arbeitsfähig ist.
Allerdings wird dieses auf die jährliche Zuverdienstgrenze ange-
rechnet!
Es gibt auch einen Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld unter
bestimmten Voraussetzungen, dieser Zuschuss muss von den
Eltern jedoch wieder zurückgezahlt werden.
Familienbeihilfe
Die Eltern haben außerdem einen
Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn
das Kind den gewöhnlichen
Aufenthalt in Österreich hat. Die
Familienbeihilfe ist am Finanzamt zu
beantragen, benötigt werden die
Geburtsurkunde und der Meldezettel
von Kind und Eltern. Die
Familienbeihilfe wird 2 Monate im
Vorhinein ausbezahlt.
Für das dritte und jedes weitere Kind
gibt es den so genannten Mehrkind-
zuschlag, der abhängig vom versteu-
ernden Familieneinkommen ist und
vom Anspruch auf Familienbeihilfe. Ist
das Kind erheblich behindert erhöht
sich die Familienbeihilfe.
15Kapitel 3: WIEDEREINSTIEG
Wie beantragt man Elternteilzeit?
Schriftlicher Antrag Der DN sollte schriftlich Elternteilzeit
verlangen und seine Wünsche möglichst genau festhalten.
(Mustertext: siehe Anhang) Es wird empfohlen den schriftlichen
Antrag dem Rayonsleiter zu übergeben und eingeschrieben
sowohl an das Personalbüro, als auch den Betriebsrat in Kopie zu
übermitteln. Mindestdauer der Elternteilzeit ist 3 Monate bis
maximal zum 7. Lebensjahr des Kindes oder eines späteren
Schuleintritt! Wie lange Elternteilzeit beantragt wird, bleibt jeden
selbst überlassen, es wäre auch bis zum 3. Lebensjahr des Kindes
möglich oder bis zu einem fixen Datum z. B.: bis zum 1. 1. 2008.
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber Ist der Antrag beim
Arbeitgeber eingelangt, muss der Arbeitgeber Verhandlungen auf-
nehmen, wenn er mit der beantragten Elternteilzeit nicht einver-
standen ist. Kommt binnen 4 Wochen keine Einigung zustande,
muss der Arbeitgeber einen Antrag auf Durchführung eines
Vergleichsversuchs bei Gericht einbringen. Es besteht die
Möglichkeit während der Verhandlungen den Betriebsrat (AK, WK)
beizuziehen. Reagiert der Arbeitgeber innerhalb von 4 Wochen auf
das eingelangte Schriftstück nicht und nimmt keine Verhandlungen
auf, so kann der Dienstnehmer die Elternteilzeit zu seinen
Bedingungen antreten!! Der Arbeitgeber kann nicht einfach NEIN
sagen oder bestimmte Wünsche von vornherein ablehnen (z.B. nie
am Samstag arbeiten, nur Vormittag). Es müssen Verhandlungen
aufgenommen werden, bei denen sowohl betriebliche Interessen
als auch die des Dienstnehmers (z. B. Kinderbetreuung, wer passt
auf, wann hat der Kindergarten offen) beachtet werden und eine für
beide Seiten akzeptable Lösung gefunden werden muss.
Gerichtliche Entscheidung Vor Gericht wird mit Hilfe des
Richters eine Einigung versucht. Kommt auch hier kein Vergleich
zustande, muss der Arbeitgeber binnen einer weiteren Woche
(11.Woche) Klage bei Gericht einbringen, wobei danach der
Richter entscheidet!
18Kapitel 3: WIEDEREINSTIEG
Im Unterschied zu einer normalen Teilzeitvereinbarung, hat man
bei einer Elternteilzeitvereinbarung einen Kündigungs- und
Entlassungsschutz. Den Antrag auf Elternteilzeit kann man jeder-
zeit (auch im laufenden Dienstverhältnis), immer 3 Monate vor dem
gewünschten Antritt bis zum 4. Lebensjahres des Kindes stellen.
So ist es auch möglich die Lage der Arbeitszeit durch eine
Elternteilzeit bei Veränderung der familiären Situation zu bestim-
men.
Kündigungs- und Entlassungsschutz
heißt, dass der Dienstnehmer nur mit gerichtlicher Zustimmung
des Arbeits- und Sozialgerichts und nur aus bestimmten Gründen
gekündigt werden kann. Der Kündigungsschutz gilt ab Antrags-
stellung – frühestens 4 Monate vor Antritt der Elternteilzeit – bis
zum 4. Lebensjahr des Kindes plus 4 Wochen!
Danach besteht noch ein weiterer Kündigungsschutz durch die
Anfechtungsmöglichkeit wegen Motivkündigung! Nur wenn sich ein
Dienstnehmer schon in der Kündigungsfrist befindet, greift der
Kündigungs- und Entlassungsschutz nicht mehr!!!
19Kapitel 3: WIEDEREINSTIEG
Stillende Mütter
Für stillende Mütter gelten bezüglich Beschäftigungsverbote,
Weiterzahlung des Arbeitsentgeltes, Nachtarbeit, Sonn- und
Feiertagsarbeit, sowie Überstundenleistung und Ruhemöglich-
keiten dieselben Bestimmungen wie für schwangere Dienst-
nehmerinnen. Stillenden Müttern ist die erforderliche Zeit zum
Stillen des Kindes freizugeben. Bei einer Arbeitszeit von mehr
als 4 1/2 Stunden täglich 45 Minuten, ab 8 Stunden 90 Minuten.
Pflegefreistellung
Das Gesetz sagt, dass
der/die ArbeitnehmerIn aus
wichtigen, in seiner Person
gelegenen Gründen einen An-
spruch auf Entgeltfortzahlung
trotz unterbliebener Arbeits-
leistung hat. Die Pflegefrei-
stellung ist in Gesetzen (§ 16
UrlG, § 8 Abs 3 AngG,
§ 1154b Abs 1 Satz 2 ABGB)
geregelt und im Kollektiv-
vertrag nur näher ausge-
legt, d.h. sie gilt für alle
ArbeitnehmerInnen egal ob
Handel, Fleischer oder Gast-
gewerbe.
Die Pflegefreistellung nach § 16 UrlG
Der/Die ArbeitnehmerIn hat einen Anspruch auf bezahlte Fehlzeit,
wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt
lebenden erkrankten Angehörigen im Ausmaß einer Woche
(wöchentliche Normalarbeitszeit). Anspruch auf eine weitere
Woche innerhalb eines Arbeitsjahres bei einer neuerlichen
Erkrankung eines Kindes unter 12 Jahren.
20Kapitel 3: WIEDEREINSTIEG
1. Bezahlte Fehlzeit: Der/die ArbeitnehmerIn bekommt seinen
Gehalt wie gewohnt.
2. Notwendige Pflege: ist im Einzelfall von Art und Intensität
der Erkrankung und Alter des Erkrankten abhängig. Entscheidend
ist, dass es durch die Erkrankung des Angehörigen dem/der
ArbeitnehmerIn nicht möglich ist, am Arbeitsplatz zu erscheinen.
3. Gemeinsamer Haushal:: Der nahe Angehörige muss im
gemeinsamen Haushalt leben.
4. Erkrankten Angehörigen: Nahe Angehörige sind Eltern,
Großeltern, Urgroßeltern, Kinder, Enkel, Urenkel, Wahlkinder und
Pflegekinder, sowie Ehepartner und Lebensgefährten aber auch
anderen nahen Angehörigen möglich z.B. Stiefkinder.
5. Ausmaß einer Woche: Der Anspruch nach § 16 UrlG
besteht im Ausmaß von einer Woche (Kindern unter 12 eine weite-
re Woche), pro Arbeitsjahr. Das Arbeitsjahr beginnt immer mit
Datum des Eintrittes, also z.B. 3. 4. 2005 – 2. 4. 2006. Für die
Woche wird die regelmäßige wöchentliche Normalarbeitszeit
herangezogen; sie kann auch tageweise oder stundenweise in
Anspruch genommen werden!!!
Betreuungsfreistellung
Die Betreuungsfreistellung ist ein Anspruch auf Freistellung im
Ausmaß einer Woche (wöchentliche Normalarbeitszeit) für die
Betreuung eines Kindes, wenn die ständige Betreuungsperson
ausfällt.
1. Die ständige Betreuungsperson kann ein Familienan-
gehöriger sein, kann aber auch eine nicht zur Familie gehörende
Person z.B. Tagesmutter sein.
2. Die Betreuungsperson muss durch ein unvorhersehbares
und unabwendbares Ereignis ausfallen, also z.B. Aufenthalt
im Spital, schwere Erkrankung, Verbüßung einer Freiheitsstrafe
oder Tod.
3. Die Freistellung kann im Ausmaß von einer Woche in
Anspruch genommen werden.
21Kapitel 3: WIEDEREINSTIEG
Kosten für die Bestätigung
Die Pflegefreistellung muss nicht vereinbart werden, sondern kann
einfach in Anspruch genommen werden, der/die ArbeitnehmerIn
kann den Nachweis der Voraussetzungen einfach mündlich erbrin-
gen, will der Arbeitgeber z.B.: eine Pflegefreistellungsbestätigung
vom Arzt, so muss der Arbeit-geber die eventuell anfallenden
Kosten dafür tragen!
Andere Gesetze, die die Pflegefreistellung regeln
Auch in anderen Gesetzen wie § 8 Abs 3 AngG oder
§ 1154b Abs 1 Satz 2 ABGB wird geregelt, dass für jene
Fälle, in denen der Arbeitnehmer
• aus wichtig persönlichen Gründen
• ohne sein Verschulden
• für eine verhältnismäßig kurze Zeit
an der Arbeit verhindert ist, das Entgelt weiter bezahlt werden
muss, obwohl der Arbeitnehmer nicht arbeitet. So ist auch eine
Pflegefreistellung nach dem Konsum der 2 Wochen nach § 16 UrlG
in wichtigen Fällen möglich.
Eigenmächtiger Urlaubsantritt
Ist die Pflegefreistellung tatsächlich (!) verbraucht und ist eine not-
wendige Pflege eines Kindes unter 12 Jahren weiterhin notwendig,
so kann der Arbeitnehmer eigenmächtig Urlaub antreten und wei-
terhin zu Hause bleiben. Der Urlaub muss nicht vereinbart werden,
es muss dem Arbeitgeber jedoch der Urlaubsantritt mitgeteilt wer-
den und der Nachweis erbracht werden, dass die Pflege weiter not-
wendig ist!!
Arbeitnehmerveranlagung
Die AV ist immer ratsam, da das Wochengeld und das KBG kein
steuerpflichtiges Einkommen sind und mit einer Gutschrift zu
rechnen ist. Auch wegen des Alleinverdiener- oder Alleinerzieher-
absetzbetrages, den man beantragen kann! Außerdem können
Alleinerzieher auch Kinderbetreuungskosten als außergewöhnli-
che Belastungen abgeschrieben.
22MUSTERTEXT ELTERNTEILZEIT
EINSCHREIBEN
Betrifft: Elternteilzeit
Wien, am
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich teile Ihnen mit, dass ich aufgrund der Geburt meines Kindes
am ………………… im Anschluss an das absolute Beschäftigungs-
verbot/an meinem Urlaub nach dem Beschäftigungsverbot/an die
Karenz/ab ………..…… (bestimmtes Datum) eine Teilzeitbeschäf-
tigung (Anspruch auf Elternteilzeit) entsprechend den Bestimmun-
gen des § 15 h Mutterschutz-gesetz/§ 8 Väterkarenzgesetz in
Anspruch nehme. Das Ausmaß der Elternteilzeit soll ……. Stunden
pro Woche betragen.
Die Arbeitszeit soll wie folgt verteilt sein:
Montag Donnerstag
Dienstag Freitag
Mittwoch Samstag
Die Elternteilzeit soll bis zum ……... Geburtstag meines Kindes/bis
zum …………………… (bestimmtes Datum) dauern.
Ich darf Sie bitten, mir sowie dem Betriebsrat Ihr Einverständnis
schriftlich mitzuteilen und allenfalls einen Terminvorschlag für die
Verhandlungen gem. § 15k Mutterschutzgesetz/§ 8c Väterkarenz-
gesetz zu machen.
Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift
Kopie an den Betriebsrat
Beilage: Geburtsurkunde
Bestätigung über Karenz (des anderen Elternteils)
23Informationen erhalten Sie auch
bei Ihrem Betriebsrat
oder im Beratungszentrum des
Konzernbetriebsrat
Mag. Sabine Tillinger
Mariahilferstrasse 105 /1/ 20
1060 Wien
Tel. Nr. 01/ 522 13 90 -10
Mobil: 0664 / 92 00 609
Zentrale: 02236 / 600 47 90
e-mail: s.tillinger@rewe-br.atSie können auch lesen