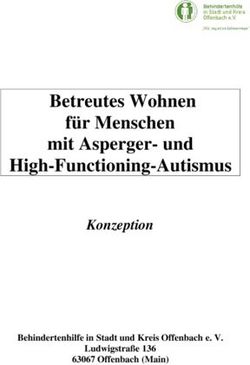Kooperation von Logopädinnen und Logopäden in Forschung und klinischer Praxis im Aphasieprojekt "E-Inclusion"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
logopädieschweiz | 01 / März 2022
Fachartikel
Kooperation von Logopädinnen und Logopäden in Forschung und
klinischer Praxis im Aphasieprojekt «E-Inclusion»
Katrin P. Kuntnera, Sandra Widmer Beierleina, Claudia Elsenera,b,e, Fanny Dittmann-Aubertc, Norina Hauserd,
Matthias Morize, Maria Wegeled, Manon Winklera, Morgaine Harveya, Noelia Falcón Garcíaa, Sven Altermattf,
Christine Müllerg, Markus Degenf, Claire Reymondg, Simone Hemmf und Anja Blechschmidta
a
Professur für Kommunikationspartizipation und Sprachtherapie, Institut Spezielle Pädagogik und Psychologie, Pädagogische Hochschule,
Fachhochschule Nordwestschweiz, Muttenz, Schweiz; bTeam der Logopädie, Rehaklinik REHAB, Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegio-
logie, Basel, Schweiz; cLogopädische Praxis – Fanny Dittmann-Aubert, Pratteln, Schweiz; dTeam der Logopädie, Kantonsspital Baden, Baden,
Schweiz; eAbteilung der Logopädie, Klinik Reha Rheinfelden, Rheinfelden, Schweiz; fInstitut für Medizintechnik und Medizininformatik, Hoch-
schule für Life Sciences, Fachhochschule Nordwestschweiz, Muttenz, Schweiz, gInstitut Visuelle Kommunikation, Hochschule für Gestaltung
und Kunst, Fachhochschule Nordwestschweiz, Basel, Schweiz.
Abstract
Im Zuge der evidenzbasierten Praxis sind im Bereich der Logopädie/Sprachtherapie neben der Praxisexper-
tise wissenschaftliche Erkenntnisse in die Therapie zu integrieren. Dafür wird mehr fachspezifische Forschung
benötigt, die auf Unterstützung der Praxis angewiesen ist. Das Ziel des Artikels ist es, die für Logopädie-For-
schung notwendige intradisziplinäre Kooperation von logopädischen Forscherinnen und Forschern sowie Prak-
tikerinnen und Praktikern anhand des interdisziplinären Aphasieprojektes «E-Inclusion» der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW) zu beleuchten. Dazu wird das Aphasieprojekt vorgestellt, welches vier Ziele verfolgte:
(1) Auswirkungen von Dialekt und Hochdeutsch sowie (2) von Fotografien und Illustrationen auf die Bildbenenn-
leistung bei u. a. Personen mit Aphasie zu untersuchen, (3) mithilfe akustisch-objektiver Sprachsignalanalysen
Leistungsveränderungen der Aphasie zu ermitteln und (4) aus diesen Erkenntnissen eine Prototypen-Appli-
kation zu entwickeln. Nach der Projektvorstellung gewähren logopädische Praktikerinnen und Praktiker aus
Partnerinstitutionen sowie das logopädische Forschungsteam Einblick in die intradisziplinäre Kooperation. Ins-
besondere die Rekrutierung der Studienteilnehmenden erforderte eine enge Zusammenarbeit. Als Resultat des
Artikels zeigt sich, dass die Kooperation auch unter erschwerten Bedingungen wie zunehmender Zeitdruck im
klinisch-therapeutischen Setting für beide Seiten erfolgreich, bedeutsam und bereichernd war. Daraus abgelei-
tete Erkenntnisse für kooperative Projekte werden im Fazit dieses Artikels formuliert. Zukünftig können so Logo-
pädinnen und Logopäden aus Forschung und Praxis, wie auch Betroffene, von der inter- und intradisziplinären
Kooperation im Bereich der Logopädie bzw. in Folgeprojekten des «E-Inclusion»-Forschungsteams profitieren.
When it comes to evidence-based practice, scientific findings are to be integrated into speech and language
therapy along with practical experience. To accomplish this, more field-specific research is needed, which is
dependent on support from practicing speech and language therapists. The aim of this article is to highlight the
much-needed intradisciplinary cooperation between researchers and speech and language therapists by the
example of the interdisciplinary aphasia research project «E-Inclusion» of the University of Applied Sciences
and Arts Northwestern Switzerland (FHNW). The project will be presented briefly which pursued four goals: (1)
to examine the effects of dialect and High German (2) and of photographs and illustrations on picture naming
performance in e. g. people with aphasia, (3) to determine changes in aphasia by using acoustic-objective speech
signal analyses and (4) to develop a prototypical application with these gained findings. After the presentation
of the project, practicing speech and language therapists from partner institutes as well as the research team
will provide insight into the intradisciplinary cooperation. Especially the recruitment phase of the participants
required a close cooperation. It is shown that the cooperation was successful, meaningful, and enriching despite
difficult conditions like increasing time pressure in the clinical-therapeutic setting. To conclude, derived insights
for cooperative projects are defined. In the future, therapists, researchers, and patients as well as follow-up
projects of «E-Inclusion» in the field of speech and language therapy will thus benefit from the inter- and intra-
disciplinary cooperation.
1101 / März 2022 | logopädieschweiz
1 Einleitung Das heisst, für die Logopädie ist nicht nur eine gleich-
berechtigte Kooperation zwischen Behandelnden und
Die Kooperation von beispielsweise Personen mit
Behandelten, sondern auch eine Kooperation von
Aphasie (PmA) oder anderen Betroffenen und sprach-
logopädischen Forscherinnen und Forschern sowie
therapeutischem Fachpersonal ist ein zentrales Ele-
Praktikerinnen und Praktikern sinnvoll, um beispiels-
ment der logopädischen Intervention, wobei die aktive
weise für die Schweizer Logopädie mittels Schweizer
und gleichberechtigte Teilhabe Betroffener in der
Projekten die Schweizer Sprach- und Therapiesitua-
logopädischen Praxis und Forschung als ein wesent-
tion zu erforschen. Eine gleichberechtigte Koopera-
licher Faktor für den Interventionserfolg angesehen
tion wird in diesem Zusammenhang als Mitwirkung
wird (vgl. Hansen 2016). Zur Sicherung der Qualität
und gemeinsames Handeln von Logopädinnen und
sind die Interventionen auf ihren Erfolg hin zu über-
Logopäden aus unterschiedlichen Institutionen und
prüfen und Forschungsergebnisse in die Logopädie1
mit unterschiedlichen Funktionen sowie Spezialisie-
einzubeziehen (vgl. Beushausen 2016). Neben der
rungen zur Erreichung eines gemeinsamen (Projekt-)
fachspezifischen klinisch-therapeutischen Praxisex-
Ziels verstanden (vgl. Hansen 2016). Eine derartige
pertise wird in der Logopädie (und nicht zuletzt somit
Kooperation von Logopädie-Forschung und -Praxis
auch für Betroffene) demnach auch fachspezifisches
soll am Beispiel des Aphasieprojektes «’E-Inclusion’
Forschungswissen benötigt (vgl. Grohnfeldt 2012).
– Teilhabe an digitalen Technologien von Menschen
Dies führt zu drei wesentlichen Aspekten:
mit Behinderungen in der alternden Gesellschaft am
1. Im Sinne der Evidenzbasierten Praxis sollen wis-
Beispiel von Sprachstörungen durch den reflektierten
senschaftliche Erkenntnisse in die Logopädie-
Einsatz der Visuellen Kommunikation» der Fachhoch-
Praxis integriert werden (vgl. z. B. Beushausen
schule Nordwestschweiz (FHNW) vorgestellt werden.
2016; Hartmann 2016).
2. Es wird mehr Forschung im Bereich der Logo- Für die Projektrealisierung haben auf der Forschungs-
pädie benötigt (vgl. z. B. Hartmann 2016) – all- seite die drei Hochschulen der FHNW interdisziplinär
gemein, im deutschsprachigen Raum (vgl. Hart- zusammengearbeitet – namentlich das Institut für
mann 2016) sowie in der Schweiz (vgl. Hartmann Medizintechnik und Medizininformatik der Hoch-
in Edthofer 2011). Ausserdem kann die schweize- schule für Life Sciences, das Institut Visuelle Kom-
rische Forschung von Logopädinnen und Logo- munikation der Hochschule für Kunst und Gestaltung
päden für die Schweiz relevante Fragestellungen sowie die Professur für Kommunikationspartizipation
behandeln (vgl. Hirschbühl in Edthofer 2011). und Sprachtherapie des Instituts Spezielle Pädago-
3. Als Kompetenzbereich der Logopädinnen und gik und Psychologie der Pädagogischen Hochschule.
Logopäden sind auch zur Stärkung (des Ansehens) Die drei Hochschulen waren gemeinsam für die Initi-
der Profession nationale (und internationale) For- ierung, Planung, Durchführung und Auswertung des
schungsprojekte zu entwickeln, zu leiten und zu Forschungsprojektes zuständig. Jede Hochschule
unterstützen (vgl. Grohnfeldt 2012). brachte zur Erreichung der Projektziele ihr spezifi-
sches Fachwissen im Bereich der Aphasiologie ein.
Der Bedarf und die Praxisintegration von fachspezifi-
schem Forschungswissen auch zur Kompetenzerwei- Auf der Praxisseite war für die Realisierung des Pro-
terung bedeutet, dass die Forschung z. B. bei der jektes auch eine intradisziplinäre Zusammenarbeit
Beantwortung von praxisrelevanten Forschungsfragen mit sogenannten Praxispartnern, das heisst Teams,
auch auf ein aktives Mitwirken der Praxis (z. B. logo- Abteilungen und Fachbereichen der Logopädie ver-
pädische Fachpersonen aus Spitälern, Kliniken, Pra- schiedener Institutionen – Akutspitäler, Rehabilita-
xen, Ambulatorien, vgl. Kohler 2016) angewiesen ist. tionseinrichtungen und logopädische Praxen – aus
der Deutschschweiz von entscheidender Bedeutung.
1 Nachfolgend werden die Begriffe «Logopädie» und «Sprach- Insgesamt arbeiten praktisch tätige logopädische
therapie» synonym verwendet. Im Gegensatz zu Deutschland Fachpersonen von 20 Institutionen mit den (logopä-
existieren in der Schweiz keine weiteren Berufsbezeichnungen dischen) Forschenden des Projektteams zusammen.
ausser Logopädinnen und Logopäden für die in der klinischen
Das Forschungsprojekt «E-Inclusion» konnte folglich
Sprachtherapie tätigen Personen. Alle Schweizer Logopädin-
nen und Logopäden verfügen mindestens über einen Bachelor nur dank einer Kooperation von Logopädie-Praxis und
in Sprachtherapie, welcher zur Berufsausübung im pädago- (Logopädie-) Forschung erfolgreich verwirklicht und
gischen und klinischen Setting befähigt. Ein Masterabschluss realisiert werden (siehe Kapitel 7 für eine Liste der
kann zusätzlich seit ein paar Jahren auch in der Deutschschweiz
beteiligten Praxispartner).
absolviert werden.
12logopädieschweiz | 01 / März 2022
Fachartikel
«E-Inclusion» leistete daher wichtige Beiträge zum Prototypen-App eingebunden werden (4. Wie ist eine
einen zur Kooperation zwischen logopädischer Praxis Prototypen-App zu entwickeln?), durch
und Forschung und zum anderen zur Forschungssitu- d. geeignete Bilder für das Benennen bei Aphasie,
ation in der Deutschschweiz und damit zu einer evi-
e. die Möglichkeit zur Benennung in Dialekt oder
denzbasierten logopädischen Versorgung im Bereich
Hochdeutsch,
der Aphasiologie.
f. die technisch-automatisierte Messung von mög-
Ziel dieses Beitrags ist es, nach einer Vorstellung
lichen Veränderungen über die Zeit bei wiederhol-
des Aphasieprojektes in den Kapiteln 2, 3 und 4.1 die
tem Benennen;
kooperative Zusammenarbeit aus Sicht verschiede-
ner logopädischer Praxispartner aus unterschiedli- zum anderen sollen in die Prototypen-App – zusätz-
chen Institutionen sowie aus Sicht der logopädischen lich zu einer nach wie vor wertvollen und notwendigen
Forscherinnen und Forscher in den Kapiteln 4.2 und logopädischen Begleitung in einer Therapiesitzung –
5 aufzuzeigen, um danach förderliche Bedingungen g. alltagsrelevante Nomen und Verben sowie
für eine gewinnbringende Kooperation in Kapitel 6 h. die Möglichkeit für ein therapeutisch begleitetes
zusammenzutragen. und kooperativ erarbeitetes Eigentraining von
PmA integriert werden, indem auf der Basis einer
2 Aphasieprojekt «E-Inclusion» automatisierten Spracherkennung Rückmeldun-
gen zum Bildbenennen wie auch zum individuel-
Mit dem Aphasieprojekt werden zwei Ziele verfolgt:
len Fortschritt gegeben werden können.
(1) Zum einen soll das Benennen von Bildern in der
Aphasie, als Beispiel einer (neurogenen) Sprachstö- 2.2 Methodik
rung, (für die sprachliche Situation in der Schweiz)
Mittels fünf ergänzenden und vergleichenden (Vor-)
grundsätzlich erforscht werden. (2) Zum anderen
Studien sowie zwei Hauptstudien2, die in der Deutsch-
sollen die aus dieser Grundlagenforschung gewonne-
schweiz mit Bewilligung der Ethikkommissionen
nen Erkenntnisse praktisch in die Entwicklung einer
Nordwest- und Zentralschweiz sowie Zürich durchge-
Prototypen-Applikation (kurz: App) zum mündlichen
führt wurden, sollen die aktuellen Forschungsfragen
Benennen von Bildern einfliessen.
(siehe Kapitel 2.1) exploriert und zusätzlich eine Pro-
2.1 Projektziele und allgemeine Fragestellungen totypen-App zur Unterstützung der kommunikativen
Rehabilitation – vorerst von PmA – entwickelt werden.
Die Projektziele (und Fragestellungen) auf For-
schungsseite (1) setzen sich mit dem Bildbenennen Die fünf ergänzenden Studien dienen vornehmlich
auseinander und beinhalten einem Vergleich mit der Hauptstudie 1, die sich mit
den Fragen nach den Bildarten und den Sprachvarie-
a. die Ermittlung von optimalen Benennbildern –
täten befasst. Aufgrund dessen wird zuerst kurz auf
Fotografien oder Illustrationen – für PmA (1. Wel-
diese fünf Studien eingegangen.
che Bildart – Farbfotografie oder Illustration – ist
geeignet?), 2.2.1 Ergänzende und vergleichende Studien
b. die Erforschung des Einflusses der beiden Um die Benennleistung bei PmA in Abhängigkeit von
Sprachvarietäten Dialekt und Hochdeutsch beim Bildart und Sprachvarietät zu untersuchen, wurden
Benennen (2. Wie wirkt sich die Verwendung der zunächst Begriffe nach linguistischen und visuellen
beiden Sprachvarietäten Dialekt und Hochdeutsch Kriterien ausgewählt:
auf das Benennen von Bildern aus?) sowie
Es wurden 128 alltagsnahe (vgl. Palmer et al. 2017),
c. die Untersuchung von akustisch-objektiven Para- konkrete und gut abbildbare Nomen und Verben aus-
metern zur technikbasierten und automatisier- gesucht. Diese wurden beispielsweise nach Wort-
ten Abbildung von Leistungsveränderungen beim frequenz, -länge- und -komplexität (z. B. Barry et
Benennen (3. Welche akustisch-objektiven Para- al. 1997; Bastiaanse et al. 2016; Bates et al. 2003;
meter erfassen die Benennleistung und intraindi- Kemmerer 2014; Meyer et al. 2003; Snodgrass &
viduelle Veränderungen?). Vanderwart 1980) sowie phonologischem Abstand (in
Als Projektziele auf Praxisseite (2) sollen zum einen
diese genannten Forschungserkenntnisse in die 2 Für eine Übersicht und Kurzbeschreibung aller Studien siehe
Widmer Beierlein et al., (2021).
1301 / März 2022 | logopädieschweiz
Anlehnung an Gallmann 2009) zwischen Dialekt und Güte mittels den fünf ergänzenden und vergleichen-
Hochdeutsch kontrolliert, weil diese Kriterien nach- den Studien überprüft:
weislich die Benennleistung beeinflussen. Ziel war es, 1. Die erstellten Bilder wurden als Pretest in Form
dass die ausgewählten Wörter (Lexeme) in Schweizer- einer schriftlichen Online-Umfrage bei 73 Pro-
deutsch3 und Schweizerhochdeutsch4 möglichst gut banden ohne Aphasie (PoA) untersucht. Hierbei
miteinander vergleichbar waren, z. B. wurden die Bildkomplexität (sogenannte visuelle
• Kein phonologischer Abstand vorhanden: «Zebra» Komplexität5), das Ausmass, wie sehr das Bild der
in Zürichdeutsch (ZHD), Baseldeutsch (BSD) und eigenen mentalen Vorstellung entspricht (soge-
Schweizerhochdeutsch (CH-HD) nanntes Image Agreement; vgl. z. B. Alario et
• Abstand/Unterschied vorhanden: «Mugge» in al. 2004), sowie die schriftliche Benennvariation
ZHD und BSD sowie «Mücke» in CH-HD pro Bild in Hochdeutsch (sogenannte schriftliche
• Abstand/Unterschied vorhanden: «Chriesi» in Namensübereinstimmung6) analysiert.
ZHD, «Kirsi» in BSD und «Kirsche» in CH-HD 2. Weiter wurden die Namensübereinstimmung
Auf der Basis der 128 Begriffe wurde jeweils eine (Benennvariationen) und deren Häufigkeit pro Bild
Farbfotografie und eine vergleichbare Illustration zur Bestimmung der Begriffseindeutigkeit für
(siehe Abbildung 1 und 2) erstellt. Für die beiden Bild- die beiden Sprachvarietäten Schweizerdeutsch
arten wurde ein gemeinsames Bildkonzept entwickelt. und Hochdeutsch auch in mündlicher Modalität
Dieses berücksichtigte die empirischen Erkenntnisse mit 123 PoA mit Erstsprache Schweizerdeutsch
zum Einfluss von Bildeigenschaften auf das Benen- erhoben. Diese Benennuntersuchung ist mit der
nen, wie z. B. Grösse der abgebildeten Objekte, pro- Hauptstudie 1 (siehe Kapitel 2.2.2) vergleichbar.
totypische Farbe und Ansicht der Objekte (vgl. z. B. Dies ist aus zwei Gründen besonders hervorzu-
Adlington et al. 2009; Krull et al. 2003; Mohr 2010; heben. Einerseits ist die mündliche Namensüber-
Naor-Raz et al. 2003; Palmer 1981; Rossion & Pour- einstimmung bei den Bildern ein wichtiger Ein-
tois 2004; Snodgrass & Vanderwart 1980; Therriault et flussfaktor auf die Leistungen beim mündlichen
al. 2009). Benennen dieser Bilder (vgl. Bates et al. 2003;
Abb. 1: Abbildung 1: «tauchen», links Fotografie Abb. 2: Abbildung 2: «Kirsche», links Fotografie
(iStock Photo 2015), rechts Illustration. (iStock Photo 2017), rechts Illustration.
Székely et al. 2003). Andererseits liefert diese
Die soeben beschriebenen Bilder und Begriffe/
Untersuchung aufgrund der grossen Anzahl an
Lexeme wurden vor ihrer Verwendung in der Haupt-
PoA weitere Vergleichswerte zur Personengruppe
studie 1 zum Benennen von Fotografien und Illustra-
mit Aphasie der Hauptstudie 1 bzw. vertiefte
tionen in Dialekt und Hochdeutsch hinsichtlich ihrer
5 Mit der Überprüfung der visuellen Komplexität wird aufgezeigt,
3 Schweizerdeutsch ist ein Sammelbegriff für alle Schweizer wie detailliert ein Bild ist (z. B. Anzahl der Linien) (vgl. z. B. Ala-
Dialekte (Haas 2004). Repräsentativ für das Schweizerdeutsch rio et al. 2004).
wurden bei der Wortauswahl für die Hauptstudie 1 die beiden 6 Mit der schriftlichen Namensübereinstimmung, auch schriftli-
Dialekte Zürich- und Baseldeutsch bestimmt. ches Name Agreement, werden unterschiedliche Bezeichnun-
4 Schweizerhochdeutsch stellt die Standardvarietät in der Schweiz gen pro Bild und deren Häufigkeit beim schriftlichen Bildbenen-
dar. nen untersucht (vgl. z. B. Bates et al. 2003).
14logopädieschweiz | 01 / März 2022
Fachartikel
Einblicke in die Verarbeitung der Sprachvarietä- Benennen erfolgte in insgesamt vier Blöcken, wobei
ten Dialekt und Hochdeutsch beim Bildbenennen. ein Teil der Studienteilnehmenden zuerst Nomen (32)
3. Die Daten jener soeben genannten Studie zur und Verben (32) im Dialekt, gefolgt von Verben (32) und
mündlichen Namensübereinstimmung in Dialekt Nomen (32) auf Hochdeutsch benannte. Beim ande-
und Hochdeutsch wurden ebenfalls verwendet, ren Teil der Studienteilnehmenden war es hingegen
um die automatisierte Spracherkennung für die umgekehrt, diese begannen mit Nomen oder Verben
Prototypen-App zu entwickeln. Da dafür ein gros- auf Hochdeutsch und schlossen die Untersuchung im
ser Datensatz benötigt wurde, wurden zusätz- Dialekt ab. Die Auswertung der Hauptstudie 1 ist noch
lich Benenndaten weiterer 78 Schweizerdeutsch nicht abgeschlossen. Die Ergebnisse der Hauptstu-
sprechender PoA gesammelt und Mithilfe einer die 1 sind allerdings sowohl in praktischer als auch
selbstentwickelten Analysesoftware bearbeitet. wissenschaftlicher Hinsicht für die (Schweizer) Logo-
4. Die ausgewählten Benennbegriffe wurden in Dia- pädie bedeutsam: Sie liefern zum einen Hinweise zur
lekt und Hochdeutsch auf ihre Alltagsrelevanz Bilderkennung bei Aphasie und somit zur adäqua-
bzw. auf deren subjektiv empfundene Auftretens- ten Auswahl von Bildmaterial in der logopädischen
häufigkeit im Alltag überprüft. Bei der online Therapie. Zum anderen geben sie Informationen zur
stattfindenden Überprüfung nahmen insgesamt Sprachverarbeitung sowie zur Verwendung von Dia-
547 Personen teil, davon 482 mit Schweizer- lekt und/oder Hochdeutsch während der logopädi-
deutsch als Erstsprache. Die gewonnenen Daten schen Intervention.
könnten neben der Relevanz für die Hauptstudie 1
2.2.3 Hauptstudie 2 zur Messung intraindividu-
auch für die Entwicklung von Therapie- und Diag-
eller Veränderungen anhand quantitativer
nostikmaterial relevant sein.
Parameter
5. Diese soeben dargestellte Online-Umfrage
beinhaltete auch Fragen zur Einschätzung der In der Hauptstudie 2 wurde die technisch-automa-
Sprachkompetenz und -wahrnehmung in Dia- tisierte Messung akustisch-objektiver Parameter
lekt und Hochdeutsch. Personen mit Erstsprache des Sprachsignals untersucht, um Leistungsverän-
Dialekt schätzen sich beim Sprechen im Dialekt derungen der Aphasie aufzeigen zu können, die als
verglichen mit Sprechen in Hochdeutsch kompe- Ergänzung zur notwendigen (subjektiven) auditiven
tenter ein. Daher wird auch für die Hauptstudie 1 Beurteilung durch Logopädinnen und Logopäden die-
der Dialekt als vorherrschende Erstsprache in der nen könnten (siehe Kapitel 2.1). Dafür wurden über
Schweizer Sprachsituation angenommen. zwei bis vier Messzeitpunkte hinweg in einer Unter-
suchungssituation Audioaufnahmen des Benennens
Diese genannten Studien wurden nur mit PoA durch-
von 20 Nomen (10 einfache und 10 zusammengesetzte
geführt. Die Zusammenarbeit von logopädischen
Wörter aus dem Untertest «Benennen» des Aachener
Praktikerinnen und Praktikern sowie Forscherin-
Aphasie Tests, AAT, Huber et al. 1983)7 gemacht. Die
nen und Forschern war also vornehmlich bei den
Untersuchungen führten die behandelnden logopädi-
zwei Hauptstudien von Bedeutung, welche nun im
schen Fachpersonen mittels eines vom Projektteam
Anschluss vorgestellt werden.
zur Verfügung gestellten Tablets durch. Die Analyse
2.2.2 Hauptstudie 1 zum Benennen von Fotografien der aufgezeichneten Sprachsignale ist ebenfalls noch
und Illustrationen in Dialekt und Hochdeutsch nicht abgeschlossen. Dazu werden unterschiedliche
In der Hauptstudie 1 wurden anhand der mündlichen Zeit- und Frequenzparameter mithilfe verschiede-
Benennleistung (die Bestimmung der Benennkorrekt- ner Algorithmen und mathematischer Berechnungen
heit und die Messung der Benenngeschwindigkeit), analysiert, um potenzielle intraindividuelle Verände-
die zwei ersten Fragestellungen zur Bilderkennung rungen feststellen zu können. Erste Erkenntnisse z.
(Vergleich zwischen Fotografie und Illustration) sowie B. zur Veränderung der Benenngeschwindigkeit über
zur Verarbeitung der Sprachvarietäten Dialekt und die verschiedenen Messzeitpunkte hinweg sind jedoch
Hochdeutsch (siehe Kapitel 2.1) beantwortet. Dafür vielversprechend.
waren in einer Untersuchungssituation die 128 Bil-
der, die je hälftig aus Farbfotografien und Illustra-
tionen bestanden, zur einen Hälfte im Dialekt (z. B. 7 Die Verwendung der AAT-Bilder in der Hauptstudie 1 fand mit
freundlicher Genehmigung des Hogrefe Verlags GmbH & Co.
ZHD «lupfe», BSD: «lüpfe») und zur anderen Hälfte
statt.
auf Hochdeutsch (CH-HD «heben») zu benennen. Das
1501 / März 2022 | logopädieschweiz
3 Studienteilnehmende für das Aphasieprojekt (logopädischen) Forschenden einig waren, dass das
«E-Inclusion» Erfassen von Leistungsveränderungen beim Benen-
nen auch bei Vorliegen einer Zweit- oder Drittsprache
Das Aphasieprojekt war so aufgestellt, dass sich die
möglich ist, sofern die Sprache Deutsch alltagsrele-
beiden Hauptstudien inhaltlich ergänzen. Somit war
vant bleibt. Darüber hinaus wurde die Aphasiedauer
eine Studienteilnahme von PmA bei beiden Haupt-
auf die akute Phase ausgeweitet und PmA konnten
studien möglich. Es wurden für die zwei Hauptstudien
schon früher rekrutiert werden. Damit stiegen auf-
nur Studienteilnehmende aus der deutschsprachigen
grund der Spontanremission die Chancen, Verände-
Schweiz rekrutiert.
rungen in der Benennleistung feststellen zu können,
Um die Forschungsfragen der Hauptstudie 1 bezüg-
was im Rahmen dieser explorativen Studie wichtig
lich der Sprachvarietät und der Bildart zu beantwor-
war, um künftig gezielter auch bei chronischen Apha-
ten (siehe Kapitel 2.1 und 2.2.1), wurden Personen mit
sien nach entsprechenden Parametern zu suchen.
und ohne Aphasie8 gesucht. Zu Beginn der Studien-
durchführung wurden Personen mit einer allgemein
Durch die Kompatibilität zwischen Hauptstudie 1 und 2,
minimal bis mittelschweren Aphasie rekrutiert, deren
z. B. durch ähnliche Studienunterlagen, konnten Stu-
Benennstörung laut AAT maximal mittelschwer war.
dienteilnehmende ohne grösseren Mehraufwand für
Im Verlauf der Rekrutierung stellte sich durch die
alle Beteiligten an beiden Hauptstudien teilnehmen.
wertvolle Rückmeldung von logopädischen Praxis-
Die folgenden Einschlusskriterien gelten für beide
partnern heraus, dass sich auch Personen mit einer
Hauptstudien (siehe Tabelle 1):
gemäss AAT allgemein schweren
Aphasie für die Hauptstudie 1 eig-
nen, vorausgesetzt ihre Benenn-
leistung war – wie bei den anderen
Studienteilnehmenden mit Apha-
sie – nur maximal mittelschwer
betroffen. Infolgedessen wur-
den die Einschlusskriterien mit
Zustimmung der Ethikkommissio-
nen in Bezug auf den allgemeinen
Schweregrad der Aphasie im Pro-
jektverlauf angepasst.
Die Hauptstudie 2 explorierte
intraindividuelle akustische Ver-
änderungen der Benennleistung.
Es wurden daher ausschliess-
lich PmA untersucht. Bei Stu-
dienbeginn wurden nur PmA mit
Erstsprache Deutsch9 also ohne
zusätzliche Erstsprachen ein-
geschlossen. Allerdings wur-
den auch bei dieser Hauptstudie
während des Aphasieprojekts die
Einschlusskriterien angepasst,
da sich die logopädischen Prakti- Tabelle 1: Einschlusskriterien für die Hauptstudien 1 und 2 des Aphasie-
kerinnen und Praktiker sowie die projekts «E-Inclusion» rechts Illustration.
8 Für PoA (Kontrollgruppe) gelten abgesehen von den aphasie-
spezifischen Kriterien dieselben Einschlusskriterien.
9 Unter «Deutsch» werden hier alle gesprochenen Standardva-
rietäten (z. B. bundesdeutsches Hochdeutsch, österreichisches
Hochdeutsch, Schweizerhochdeutsch) sowie Dialekte (z. B. Bay-
risch, Tiroler Dialekt, Baseldeutsch) des Deutschen verstanden.
16logopädieschweiz | 01 / März 2022
Fachartikel
Schliesslich konnten anhand dieser Einschlusskrite- zu personen- und gesundheitsbezogenen Angaben
rien in die erste Hauptstudie 33 PmA (18 m, 15 w) mit (inklusive logopädischen und medizinischen Diagno-
einem durchschnittlichen Alter von 58.1 Jahren (R = sen) aus. Danach geben sie den Studienteilnehmen-
20-84; SD = 13.6) sowie 33 nach Alter gematchte PoA den einen weiteren Fragebogen mit oder füllen diesen
(16 m, 17 w) mit einem durchschnittlichen Alter von ggf. gemeinsam mit den PmA aus.
58.2 Jahren (R = 20-81; SD = 14.2) eingeschlossen Die studienteilnehmende Person wird von der behan-
werden. In die zweite Hauptstudie konnten 22 PmA delnden logopädischen Fachperson auf einer soge-
inkludiert werden (Durchschnittsalter: 64.6; R = 36-82 nannten Identifikationsliste erfasst, wo jede Person
SD = 12.4). eine anonymisierte Studienidentifikationsnummer
(ID) erhält. Diese ID wird aus Datenschutzgründen für
4 Rekrutierung geeigneter Praxispartner und alle Studienunterlagen verwendet und gewährt damit
Studienteilnehmender für das Aphasiepro- die Anonymität der Daten. Die Praxispartner bewah-
jekt «E-Inclusion» ren die ID-Liste für zehn Jahre gesichert auf und
übernehmen damit einen wichtigen Teil zur Sicher-
Für die Durchführung der beiden Hauptstudien muss-
stellung der ethischen Vorgaben im Rahmen des
ten zunächst Personen aus der logopädischen Praxis
Datenschutzes.
(siehe Kapitel 1) für das Aphasieprojekt gewonnen
werden. Anschliessend rekrutierten Logopädinnen Sofern alle Einschlusskriterien erfüllt sind (siehe
und Logopäden aus Praxis und Forschung gemein- Kapitel 3), werden die Studienteilnehmenden für die
sam geeignete Personen mit und ohne Aphasie (siehe Hauptstudie 1 entweder oder von den logopädischen
Kapitel 3). In den nachfolgenden Kapiteln werden Fachpersonen für einen Untersuchungstermin auf-
diese beiden Rekrutierungsprozesse – die des logo- geboten. Die Benennuntersuchung führen jeweils
pädischen Fachpersonals und die der Studienteil- zwei (logopädische) Forscherinnen des Projektteams
nehmenden – wie sie geplant und wie sie tatsächlich vornehmlich am Ort der Praxispartner-Institutionen
umgesetzt wurden, vorgestellt. durch, welche den PmA vertraut sind. Für die Kont-
rollgruppe mit den PoA werden auch Angehörige von
4.1 Geplanter Rekrutierungsablauf PmA teilweise über die logopädischen Praxispartner
angefragt.
Als ersten Schritt fragen logopädische Fachpersonen
der gewonnenen Praxispartner geeignete Studien- 4.2 Tatsächlicher Rekrutierungsablauf
teilnehmende mündlich an und stellen sie dem Pro-
jektteam anonym vor. So können bereits erste Ein- Wie bereits angedeutet mussten für eine erfolgreiche
schlusskriterien gemeinsam überprüft werden. Die Umsetzung des Aphasieprojektes im Ablauf der Rek-
Studieninformation ist (in Teilen) aus ethischen Über- rutierung Veränderungen vorgenommen werden. Die
legungen und für ein erleichtertes Lesesinnverstehen Sichtweisen zum tatsächlich durchgeführten Rekru-
und damit für ein einfacheres Ausfüllen in leicht ver- tierungsprozess vom logopädischen Forschungsteam
ständlicher Sprache und mit übersichtlichem Layout und von drei Praxispartnern – einer Abteilung der
im Sinne einer aphasiefreundlichen Gestaltung ver- Logopädie einer Rehabilitationsklinik, einem Logopä-
fasst (vgl. Brennan et al. 2005; Connect 2007; Rose die-Team eines Akutspitals und einer logopädischen
et al. 2011a, b). Für die Teilnahme am Aphasiepro- Praxis – werden nachfolgend ausgeführt.
jekt müssen aktuelle AAT-Werte10 vorliegen. Falls 4.2.1 Rekrutierung aus Sicht des Logopädie-For-
keine neuen AAT-Werte vorhanden sind, wird der für schungsteams des Aphasieprojektes (Katrin
beide Hauptstudien notwendige AAT in der Regel von P. Kuntner, Sandra Widmer Beierlein, Claudia
den logopädischen Praxispartnern durchgeführt. In Elsener und Prof. Dr. Anja Blechschmidt)
Ausnahmefällen führen die Logopädinnen des Pro-
Um Studienteilnehmende für die beiden Hauptstudien
jektteams den AAT durch. Die behandelnden Logo-
zu rekrutieren, mussten ab Januar 2019 zuerst in der
pädinnen und Logopäden füllen einen Fragebogen
Praxis tätige Logopädinnen und Logopäden für eine
10 Bei postakuten Aphasien (sechs Wochen bis zu einem Jahr post Zusammenarbeit gewonnen werden.
onset) sowie bei chronischen Aphasien (ab einem Jahr) mit Die Forscherinnen der Professur für Kommunika-
intensiver Therapie (fünfmal pro Woche) dürfen die AAT-Werte
tionspartizipation und Sprachtherapie (KuS) des Insti-
nicht älter als zwei Wochen sein; bei chronischen Aphasien dür-
fen die AAT-Werte nicht weiter als drei Monate zurückliegen. tuts Spezielle Pädagogik und Psychologie (ISP) als Teil
1701 / März 2022 | logopädieschweiz
des Projektteams «E-Inclusion» traten dafür direkt 2021 und damit über knapp zwei Jahre, u. a. auch
mit den Logopädinnen und Logopäden möglicher beeinflusst durch die Coronavirus-Pandemie. Zeit-
Kooperationspartner in Kontakt. Dabei konnten sie, weise waren einige der Praxispartner-Institutionen
selbst auch diplomierte, EDK11-anerkannte Logopä- für externe Personen wie z. B. Forschende geschlos-
dinnen, zunächst ihr eigenes Berufsnetzwerk für eine sen. Es mussten zusammen mit den Logopädinnen
Zusammenarbeit anfragen. Zudem war es hilfreich, und Logopäden vor Ort Wege gefunden werden, um
dass eine Forscherin von «E-Inclusion» gleichzeitig in das Projekt unter strengsten hygienischen Massnah-
zwei der Praxispartner-Institutionen klinisch tätig war. men fortzuführen; dies möglichst ohne zusätzliche
Dennoch war es auch notwendig, weitere potenzielle Belastung für die schon ausgelasteten logopädischen
logopädische Praxispartnerinnen und Praxispartner Praktikerinnen und Praktiker.
auf schriftlichem und/oder telefonischem Wege zu Die Motivation der Studienteilnehmenden war sehr
kontaktieren, um eine genügend grosse Stichproben- gross, so dass einige auch lange Anfahrtszeiten zur
grösse für die Hauptstudien zu rekrutieren. Nach einer Untersuchung auf sich nahmen. Insgesamt zeigte
Zusicherung für eine Forschung-Praxis-Kooperation sich, dass die Betroffenen gegenüber Anfragen von
seitens der Praxispartnerinnen und Praxispartner den behandelnden logopädischen Fachpersonen zur
mussten die vom Projektteam vorbereiteten Unterla- Projektteilnahme offener gestimmt waren, als wenn
gen von den praktisch tätigen logopädischen Fachper- bspw. unbekannte (logopädische) Forschende das
sonen ausgefüllt und unterzeichnet werden, damit sie Projekt vorstellten. Die Unterstützung beim Anfragen,
anschliessend der zuständigen Ethikkommission vor- Informieren und beim gemeinsamen Ausfüllen der
gelegt werden konnten. Mit dem positiven Bescheid Studienunterlagen durch die Kolleginnen und Kolle-
der entsprechenden Ethikkommission durfte mit dem gen in der Praxis war daher besonders bedeutsam.
Rekrutierungsprozess gestartet werden. Die Rekru-
tierung und die Studiendurchführung erforderten prä- 4.2.2 Rekrutierung aus Sicht der Logopädie-Abtei-
zise Absprachen und eine genaue Planung zwischen lung der Rehaklinik Rheinfelden (Dr. Matthias
den logopädischen Forschenden und Praxispersonen. Moriz)
Nur so konnten die terminlichen Vorgaben eingehal- Die Abteilung Logopädie der Reha Rheinfelden hat an
ten werden. Herausfordernd war dies vor allem in Hin- beiden Hauptstudien teilgenommen. Die Rekrutie-
blick auf die Gültigkeit der AAT-Werte, weil diese bei rung der Studienteilnehmenden konnte teilweise für
PmA in der postakuten Phase bis zum Zeitpunkt der beide Hauptstudien kombiniert werden (siehe Kapi-
Untersuchung nicht älter als zwei Wochen sein durf- tel 3). Bei der Rekrutierung war es besonders güns-
ten. Dies funktionierte aufgrund eines kollegialen und tig, dass eine logopädische Nachwuchs-Forscherin
gleichberechtigten Umgangs allerdings sehr gut. aus dem Projektteam befristet für die Projektlauf-
Über die Projektlaufzeit zeigte sich, dass aufgrund zeit als Forschungspraktikantin in der Rehaklinik
der strengen Einschlusskriterien (siehe Kapitel 3) nur tätig war und so wöchentlich an den Besprechungen
ungefähr mit ein bis zwei PmA pro logopädischem Pra- der Abteilung Logopädie teilnehmen konnte. Damit
xispartner zu rechnen war. Deshalb wurden im Ver- konnte der Rekrutierungsprozess gestärkt werden
lauf mithilfe von Kontakten der logopädischen Praxis- und eine Ansprechperson stand vor Ort direkt für Fra-
personen zu Aphasie-Selbsthilfegruppen oder durch gen sowie für die Koordination und Organisation zur
Anfrage von ehemaligen oder sich in Therapiepause Verfügung. Die PmA konnten an den Hauptstudien in
befindenden PmA weitere Studienteilnehmende für die ihrer gewohnten Reha-Umgebung wie bei einer nor-
Hauptstudie 1 angefragt. Auch ein im Dezember 2020 malen Therapie teilnehmen, was sich als ein opti-
publizierter Zeitungsartikel (vgl. Goldhahn 2020) über males Prozedere erwies. Schwieriger war dagegen
das Aphasieprojekt stiess auf grosses Interesse und die Durchführung kürzerer Untersuchungsteile für
ergab weitere Studienteilnehmende. Die Rekrutierung die Hauptstudie 2 mit wiederholten Diagnostikteilen,
von statistisch gesehen genügend grossen Stichpro- wenn diese nicht mit dem Therapieziel in Verbindung
ben in den beiden Hauptstudien erstreckte sich jedoch zu bringen waren und keinen unmittelbaren The-
trotz all dieser Bemühungen von April 2019 bis Januar rapieeffekt für die PmA hatten. Generell wurde von
den logopädischen Praktikerinnen und Praktikern
11 EDK ist die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie- bemängelt, dass die Inhalte der beiden Hauptstudien
hungsdirektoren. Sie regelt die Anerkennung der Hochschul- nicht unmittelbar in eine Therapie umgesetzt werden
diplome u. a. in der Logopädie.
18logopädieschweiz | 01 / März 2022
Fachartikel
können. Eine zeitnahe Rückmeldung zu den Unter- PmA wünschten, die Unterlagen im Beisein der
suchungsergebnissen wäre deshalb wünschenswert, behandelnden Logopädin zu lesen und zu unterzeich-
da die Logopädinnen und Logopäden mit den PmA nen. So konnten einige Fragen oder Unsicherheiten
oft monatelang (weiter) arbeiten und die Resultate geklärt werden. Eine PmA konnte an beiden Haupt-
des Projekts dafür eventuell relevant oder zumindest studien teilnehmen, die andere bedingt durch die Ein-
von Interesse sind. Unproblematisch war die Durch- schlusskriterien nur an der Hauptstudie 2. Die PmA
führung und Auswertung von Standardtests (wie dem haben positiv auf die Anfrage zur Teilnahme reagiert,
AAT), wenn dies ohnehin vorgesehen war und nahtlos v. a. im Hinblick auf eine mehrmalige Untersuchung
aus dem gewohnten klinischen Ablauf hervorging. der mündlichen Benennfähigkeit für Nomen (Haupt-
studie 2). Die im Voraus geplanten Termine wurden
4.2.3 Rekrutierung aus Sicht des Logopädie-Teams
jeweils dem Projektteam gemeldet, so dass die für
des Kantonsspitals Baden (Norina Hauser und
die Hauptstudie 2 aufgenommenen Audioaufnahmen
Maria Wegele)
zeitnah in der Praxis abgeholt wurden. Kurz nach
Das Team der Logopädie des Kantonsspitals Baden dem Beginn der Studiendurchführungen begann der
hat sich an der Hauptstudie 1 zur Benennleistung Coronavirus-Lockdown. Für eine PmA folgte dadurch
von PmA beteiligt. Im Vorfeld wurden übersichtlich ein langer Unterbruch der logopädischen Therapie
dargestellte und detaillierte Informationen sowohl und damit auch in der Durchführung der Hauptstu-
zum Ablauf als auch zu den Einschlusskriterien aus- die 2. Der letzte Messzeitpunkt für die Hauptstudie
gehändigt. Letztere bedingten eine geringere Anzahl 2 bei dieser PmA konnte schliesslich aber noch vor
an Studienteilnehmenden als anfangs gedacht. Den- Abschluss der Studiendurchführungsphase Ende Juni
noch konnte ein Beitrag zur Hauptstudie 1 geleistet 2021 erfolgen.
werden. Durch Anpassungen im Rekrutierungsver-
lauf entstanden neue Herausforderungen, wie z. B. 5 Kooperation von logopädischer Praxis und
eine datenschutzkonforme Aufbietung ehemaliger Forschung im Aphasieprojekt «E-Inclusion»
PmA (siehe Kapitel 4.2.1). Durch unkomplizierte und
schnelle Kontaktaufnahme mit den Logopädinnen Anhand der Vorstellung der Ziele und der Fragestel-
und Logopäden des Forschungsteams konnte auch lungen des Aphasieprojektes «E-Inclusion» sowie
dies schnell geklärt werden. Insgesamt war es als insbesondere der Hauptstudien 1 und 2 wurde die
logopädischer Praxispartner ein guter Ablauf mit Relevanz einer Kooperation zwischen im Feld und in
entsprechend angemessenem Zeitaufwand für einen der Forschung tätigen Logopädinnen und Logopäden
Beitrag zur spannenden Forschung. Auch auf Seiten vor allem hinsichtlich der Rekrutierung und Untersu-
der Studienteilnehmenden konnte schnell Interesse chung von Studienteilnehmenden deutlich. Ableitend
geweckt werden. Unter den Studienteilnehmenden daraus soll wiederum aus den beiden Sichtweisen von
wurde grosse Freude geäussert, als selbstbetroffene Praxis und Forschung eine grundsätzliche sowie eine
PmA einen Beitrag zur Forschung in der Aphasiologie auf dieses Projekt bezogene kooperative Zusammen-
leisten zu können. Auch das Gefühl, die behandeln- arbeit diskutiert werden.
den Logopädinnen und Logopäden mit diesem For-
5.1 Kooperation aus Sicht der logopädischen Prak-
schungsprojekt unterstützen zu können, schien eine
tikerinnen und Praktiker
Motivation zur Teilnahme zu sein. In einem Einzelfall
gab es jedoch zunächst auch eine verhaltene Reak- Zunächst wird die Kooperation aus Sicht der drei
tion, da der Aufwand einer Studienteilnahme zunächst bereits genannten logopädischen Praxispartner –
zu gross erschien. Dennoch entschied sich die PmA Rehaklinik, Akutspital, Praxis – verdeutlicht, danach
nach mehreren gewünschten Erklärungen zu einer die des Forschungsteams.
Teilnahme. Alle Beteiligten warten nun gespannt auf 5.1.1 Kooperation aus Sicht der Logopädie-Abtei-
die Ergebnisse. lung der Rehaklinik Rheinfelden (Dr. Matthias
4.2.4 Rekrutierung aus Sicht der Logopädischen Moriz)
Praxis – Fanny Dittmann-Aubert (Fanny Die Logopädie-Abteilung der Reha Rheinfelden war
Dittmann) sehr gerne bereit, am Aphasieprojekt teilzunehmen
Zwei PmA der logopädischen Praxis konnten zur Teil- und fand die Hauptstudien 1 und 2 spannend, berei-
nahme am Aphasieprojekt motiviert werden. Beide chernd, auch herausfordernd, aber sinnhaft, wichtig
1901 / März 2022 | logopädieschweiz
und letztlich doch machbar, trotz der herausfordern- Fortbildungen, Lektüre von Fachliteratur sowie
den (auch belastenden) Balance zwischen dem vollen interdisziplinärer Austausch. An einem Forschungs-
klinischen Arbeitstag und der zusätzlichen Aufgabe. projekt einen Beitrag leisten zu können, ist ebenso
Es gab im Jahr 2020 noch einen gravierenden Verzer- wichtig. Motiviert haben das Thema Benennfähigkeit
rungsfaktor: Die Coronavirus-Pandemie, die in jeder bei Aphasie und die Interdisziplinarität des Aphasie-
Hinsicht, sowohl bezüglich der Studiendurchführung projekts. Ebenso hat das Projektvorhaben, eine App
selbst als auch bezüglich der Erschwerung und Inten- zum Benennen für PmA zu entwickeln, motiviert am
sivierung der alltäglichen klinischen Arbeit, viele Res- Projekt mitzuhelfen. Die Möglichkeit einer objektiven
sourcen verbrauchte. Phasenweise war der Zugang Auswertung der Benennleistungen mittels definierter
zur Klinik und zu den PmA stark eingeschränkt, was Parameter und automatisierter Spracherkennung zu
die Arbeitsbelastung allgemein und auch für das erhalten ist sehr spannend (Hauptstudie 2). Es konnte
Aphasieprojekt erhöhte. Die Reha Rheinfelden fühlte festgestellt werden, dass bei beiden PmA die Leis-
sich dem Aphasieprojekt verbunden, konnte aber tungen zum letzten Messzeitpunkt der Hauptstudie 2
weitere Aufgaben nicht in dem Umfang wie selbst merklich besser waren. Subjektiv entstand sogar der
gewünscht übernehmen. Dennoch sind die Logopä- Eindruck, auch die Benenngeschwindigkeit – ein viel-
dinnen und Logopäden der Reha Rheinfelden froh, versprechender objektiver Parameter zur Abbildung
einen Beitrag dazu geleistet zu haben. von Leistungsveränderungen bei Aphasie – sei höher,
so dass nun gespannt auf die Auswertung und Ergeb-
5.1.2 Kooperation aus Sicht des Logopädie-Teams
nisse vor allem der Hauptstudie 2 gewartet wird (siehe
des Kantonsspitals Baden (Norina Hauser und
Kapitel 2.2.3). Der Austausch und die Unterstützung
Maria Wegele)
der (logopädischen) Mitglieder des Forschungsteams
Im Logopädie-Team des Kantonsspitals Baden hat die waren hervorragend und anregend.
Forschung allgemein einen hohen Stellenwert und,
wenn möglich, wird gerne ein Beitrag dazu geleistet. 5.2 Kooperation aus Sicht der logopädischen For-
Natürlich muss der Aufwand einer Forschungskoope- scherinnen (Katrin P. Kuntner, Sandra Widmer
ration stets neben dem klinischen Alltag zu bewältigen Beierlein, Claudia Elsener und Prof. Dr. Anja
sein. Aufgrund dessen machte das Logopädie-Team Blechschmidt)
bei diesem Aphasieprojekt ausschliesslich bei der Für uns als logopädische Forscherinnen war es berei-
Hauptstudie 1 mit. Die Forschungsarbeit allgemein chernd, ein interdisziplinäres Forschungsprojekt (zum
stellt eine Ergänzung zur alltäglichen Arbeit dar und Thema Aphasie) mitzuentwickeln und mitzuleiten.
eröffnet auch bereits vor abgeschlossener Studien- Darüber hinaus war das Aphasieprojekt aber auch
auswertung und Projektende einen neuen Blickwinkel aus intradisziplinärer Sicht bedeutsam. Es zeigte
auf die eigene Arbeit, z. B. dass der Faktor Zeit bei sich, wie entscheidend Vernetzungen (vgl. Hartmann
der Benennreaktion in Dialekt oder Hochdeutsch eine in Edthofer 2011) innerhalb der Profession sind – auf
Rolle spielen kann. Motivierend für die Teilnahme war Forschungsseite bei der Rekrutierung von Praxis-
insbesondere die hohe alltägliche Relevanz der Frage- partnern und damit auch von Studienteilnehmenden
stellungen in der Hauptstudie 1, wozu es aktuell noch sowie auf Forschungs- und Praxisseite beim Erhalten
sehr wenige Daten gibt. Durch die gut strukturierte und Aufbauen beruflicher Netzwerke. Die Praxisre-
Führung und detaillierten Hintergrundinformatio- levanz zeigte sich ebenfalls im Verlauf des Projektes
nen war die Mitarbeit sehr unkompliziert, angenehm immer wieder: Die Ziele des Aphasieprojekts zu Bild-
und erfreulich. Es konnten neue Bekanntschaften art, Sprachvarietät und technisch-automatisierter
für zukünftige Projekte oder fachlichen Austausch Messung von Leistungsveränderungen sowie die Ent-
geknüpft werden. Zusätzlich ergab sich dadurch für wicklung einer Prototypen-App stammen aus der Pra-
einige des Logopädie-Teams erstmals die Chance, in xis und sollen auch wieder in die Praxis zurückflies-
die noch kleine, aber (zunehmend) sehr wichtige Welt sen. Das Studiendesign beider Hauptstudien greift
der «Logopädie-Forschung Schweiz» einzutauchen. das häufig in der Logopädie genutzte Paradigma des
5.1.3 Kooperation aus Sicht der Logopädischen Pra- Bildbenennens auf. Gemäss den Rückmeldungen der
xis – Fanny Dittmann-Aubert (Fanny Dittmann) logopädischen Praxispartnerinnen und Praxispartner
war insbesondere diese persönliche Vernetzung (vgl.
Zum Berufsbild der Logopädie gehören neben der
Sallat & Siegmüller 2016; siehe Kapitel 4.2.1) und
diagnostischen und therapeutischen Arbeit auch
20logopädieschweiz | 01 / März 2022
Fachartikel
diese praxisnahe Gestaltung ein wesentlicher Grund einmal mehr die Bedeutung und Notwendigkeit der
zur Teilnahme am Aphasieprojekt. Daneben stand für Forschung von Logopädinnen und Logopäden (vgl.
einige Logopädinnen und Logopäden die Motivation im Kapitel 1).
Vordergrund, die Möglichkeit zu nutzen, Forschung in Mittels der Projektvorstellung konnte jedoch auch die
den eigenen Praxisalltag zu integrieren. Die begeis- Wichtigkeit einer Kooperation und die Bedeutung der
terte Teilnahme der logopädischen Praktikerinnen Vernetzung von logopädischen Praxispersonen und
und Praktiker hatte wiederum einen positiven Einfluss Forschenden vor allem bei der Durchführung der zwei
auf die Forschenden. Gemeinsam wurden die (Pro- Hauptstudien dargelegt werden (vgl. z. B. Kapitel 5.1.2,
jekt-) Ziele für die PmA und zur Stärkung der Logo- 5.1.3 und 5.2). In gleichberechtigter Zusammenarbeit
pädie verfolgt. Der fachliche Austausch und die hilf- konnte das Aphasieprojekt mit einem gemeinsamen
reichen Rückmeldungen vor allem zu Projektbeginn Ziel, die logopädische Therapie und Diagnostik in der
(siehe Kapitel 3 und 4.2.1) gingen in beide Richtungen Schweiz (bzw. in Dialektgebieten) für PmA zu verbes-
und zeigten auch die unterschiedlichen Fach-Speziali- sern, umgesetzt werden (z. B. Bilder, Sprachvarietät,
sierungen innerhalb der Logopädie (vgl. Sallat & Sieg- App; vgl. Kapitel 5.1.3 und 5.2). Für die Logopädinnen
müller 2016; siehe Kapitel 1) auf. und Logopäden in der Praxis beinhaltete diese Koope-
ration administrative und organisatorische Aufgaben
6 Fazit wie die Koordination von Untersuchungsterminen, die
Im vorliegenden Artikel wurde das Aphasieprojekt Rekrutierung von Studienteilnehmenden oder anteilig
«E-Inclusion» näher vorgestellt und insbesondere die Sicherstellung des Datenschutzes. Die logopädi-
die inter- und intradisziplinäre Kooperation zwischen schen Praktikerinnen und Praktiker führten auch in
Hochschule(n) und logopädischer Praxis beleuchtet. Teilen Studienuntersuchungen (AAT und/oder Durch-
führung der Hauptstudie 2) selbst durch (vgl. Kapitel
Damit konnte zum einen festgehalten werden, dass
4.1. und 4.2).
mit einem solchen Projekt im Bereich der Logopä-
die sowohl wissenschaftliche als auch praktische Bei der Planung und Umsetzung eines solchen koope-
bzw. anwendungsorientierte Fragen verfolgt werden rativen Forschungsprojekts sind jedoch die Rahmen-
können: Es ergaben sich kurzfristige Implikationen bedingungen, in denen sich Logopädinnen und Logo-
aus der Forschung für die Praxis – wie aktuelle AAT- päden im klinisch-therapeutischen Umfeld bewegen,
Ergebnisse, Bewusstwerdung über Qualitätskrite- zu beachten. Aus eigener beruflicher Praxiserfahrung
rien von Bildmaterial in der Aphasietherapie sowie der logopädischen Forschenden wurde beispielsweise
reflektierter Einsatz von Dialekt und Hochdeutsch in das Aphasieprojekt im Bewusstsein der knappen Res-
der Therapie bei Aphasie (vgl. Kapitel 2.2.1 und 5.1.2). sourcen bewusst praxisnah gestaltet (vgl. Kapitel 5.1.1
Nach Abschluss der Studienauswertungen können und 5.1.2). Folgende vorläufige Prinzipien können für
auch mittelfristig bedeutsame Implikationen für die eine kooperative Zusammenarbeit aus dem Aphasie-
Aphasiediagnostik und -therapie wie Erkenntnisse projekt abgeleitet werden:
zur Bild- und Sprachverarbeitung bei Aphasie sowie • Es sollen regelmässige Kontaktaufnahmen statt-
Empfehlungen für Bildmaterial und den Einsatz von finden, um die Kolleginnen und Kollegen der logo-
Sprachvarietäten in der Aphasietherapie abgeleitet pädischen Praxispartner in den Studienaufgaben
werden (vgl. Kapitel 2.2.2). Zudem wird eine Proto- anzuleiten und sie zu unterstützen sowie um nach
typen-App für Aphasie inklusive automatisierter dem Befinden zu fragen und ihre Bedürfnisse
Spracherkennung und Abbildung von Leistungsver- abzuholen, z. B. aufgrund veränderter Verhält-
änderungen beim Benennen entwickelt, welche die nisse während der Coronavirus-Pandemie (vgl.
bisherige logopädische Arbeit längerfristig ergänzen Sallat & Siegmüller 2016; vgl. Kapitel 4.2.1, 4.2.2.,
kann (vgl. Kapitel 2.2.3 und 5.1.3). 4.2.3, 4.2.4, 5.1.1 und 5.1.3).
• Der administrative Aufwand ist klein zu halten,
Zum anderen hat die Vorstellung des Aphasieprojek-
indem z. B. die auszufüllenden Ethikkommis-
tes aufgezeigt, z. B. durch die Grösse des Projektes
sionsdokumente zum einfacheren und schnel-
oder durch die insgesamt sieben aufeinander abge-
leren Ausfüllen für die Logopädinnen und Logo-
stimmten Studien (ergänzende/vergleichende Studien
päden vorbereitet werden (vgl. Kapitel 4.2.1 und
und Hauptstudien), wie umfang- und facettenreich
5.1.2) oder indem die Einverständniserklärungen
und zugleich spannend und komplex der Bereich der
für die PmA aphasiefreundlich gestaltet sind (vgl.
Logopädie (und seine Erforschung) ist. Dies betont
Kapitel 4.1).
2101 / März 2022 | logopädieschweiz
• Es ist möglichst wenig (Therapie-)Zeit für die Stu- • Logopädie-Teams der Kantonsspitäler Aarau
diendurchführung zu verwenden, weshalb z. B. in (Christine Richner), Baden (Nicole Bruggisser),
der Hauptstudie 1 die (logopädischen) Forschen- Baselland (Claudia Poncioni-Erne) und Olten
den (und nicht die logopädischen Praxispersonen) (Solothurner Spitäler, Andrea Meister).
nur einmalig und ausserhalb der Therapie Daten • Logopädie-Abteilung der Rehaklinik Rheinfelden
erhoben haben (vgl. Kapitel 4.1). Bei der Haupt- (Dr. Matthias Moriz) und des Stadtspitals Waid und
studie 2 wurden beispielsweise die mehrmaligen Triemli (Yvonne Fahrni).
Benennuntersuchungen durch die logopädischen • Logopädie-Teams der Rehakliniken REHAB Basel
Praktikerinnen und Praktiker während der Thera- (Svenja Ginters) und Bad Schinznach (Privat-Kli-
pie kurzgehalten (lediglich 20 Benenn-Items; vgl. nik Im Park, Selina Furrer).
Kapitel 2.2.3, 4.2.2 und 4.2.4). • Logopädie-Teams der Spitäler Schaffhausen
• Die Untersuchungen sind allgemein therapienah (Bernadette Heim) und Zofingen (Priska Huckele).
zu gestalten, z. B. am Ort der bekannten Insti- • Fachbereiche Logopädie der Universitären
tution und nach Möglichkeit zeitlich koordiniert Altersmedizin Felix Platter (Julia Klauke) und
mit der logopädischen Therapie (vgl. Kapitel 4.1, des Kantonsspitals Graubünden (Susanne
4.2.1). Brunelli-Steiger).
• Durch einen offenen Dialog mit viel gegenseiti- • Logopädie-Team des Universitätsspitals Zürich
gem Verständnis können institutionsindividuelle (Klinik für Neurologie, Leonora Graber).
Lösungen gefunden werden (vgl. z. B. Kapitel 4.1 Ausserdem ist den Logopädie-Studierenden FHNW
und 4.2.2) und dadurch der allgemeine zuneh- der Studiengängen 2016–2019 sowie 2018–2021 für ihr
mende Kosten- und Zeitdruck auf das klinische engagiertes Mitwirken unter fachlicher Supervision
Setting minimiert werden (vgl. Sallat & Siegmül- als Teil des Untersuchungsteams für die Hauptstudie
ler 2016). 1 zum Benennen von Fotografien und Illustrationen
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte und im Hin- in Dialekt und Hochdeutsch sowie für die ergänzende
blick auf die im Verlauf dieses Jahres zu erwartenden Studie zur Überprüfung der Benennbegriffe hinsicht-
Studienergebnisse war die Kooperation von Logopä- lich mündlicher Namensübereinstimmung in Dialekt
dinnen und Logopäden mit unterschiedlichen Aufga- und Hochdeutsch zu danken:
bengebieten bedeutsam, erfolgreich und für alle Sei- Liliane Affolter, Eleanor V. Anklin-Lowen, Katharin
ten bereichernd, sodass weiterführende Projekte, bei Ballmer, Karin Balsiger, Cornelia E. Baschnagel,
denen die (logopädischen) Forschenden von «E-Inclu- Selina Baur, Fabienne Blattner, Tarja Bolks, Nicole
sion» mit (neuen) interessierten logopädischen Prak- Brunner, Miriam Bukies Schaefer, Sandra Corrigan,
tikerinnen und Praktikern kooperativ zusammen- Julia Diener, Naomi Drewlow, Claudia Elsener, Laura
arbeiten, bereits in Planung sind. M. Fuchs, Sarah Geuze, Nicole Gysin, Thalia Gysin,
Morgaine Harvey, Johanna M. Hemkens, Clara Henge-
7 Danksagung voss, Fabian Hess, Annika D. Hofer, Stefanie Hofmann,
Das Aphasieprojekt «E-Inclusion» konnte nur dank Claudia Imesch, Alena Knörr, Simone M. Küry, Ste-
der Finanzierung der FHNW im Rahmen der Strategi- phanie J. Ledermann, Nadine Leu, Lea Lehnert, Luise
schen Initiative 2018–2020, der motivierten Teilnahme S. Löprich, Sandro S. Monti, Mike Obermeier, Noëmi
von Personen mit und ohne Aphasie sowie dem gros- Plattner, Annika Ryhult, Saskia Sautter, Rebecca K.
sen Engagement der logopädischen Praxis, nament- Schoch, Kaja Seywald, Franziska Stähli, Ylenia Sum-
lich der Logopädinnen und Logopäden nachfolgend mermatter, Noelle Suter, Denise A. Weibel, Manon
gelisteter logopädischer Praxispartner, realisiert Winkler, Ivana Wolf, Susanne Wyrsch, Seline Zibret
werden: und Noemi Zihlmann.
• Logopädische Praxen Fanny Dittmann-Aubert,
Isabelle Facchini-Baumann, LogoTreffpunkt 8 Link zur Projektwebsite
(Helen Amstad), mund’art logopädie (Nina Säges- https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/strategische-
ser), rundum therapie (Petra Seccia-Reutlinger), entwicklungsschwerpunktestrategische-initiativen/
Dietiker (Petra Dietiker) und Unterstrass (Brigitte e-inclusion
Bertoni).
22Sie können auch lesen