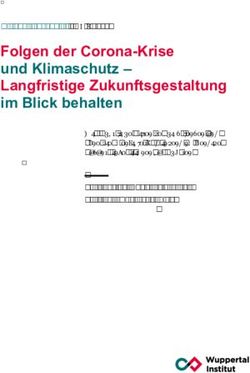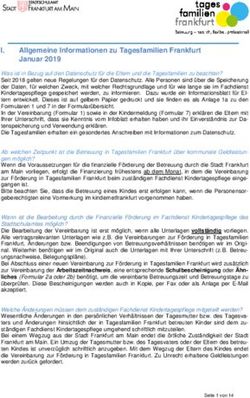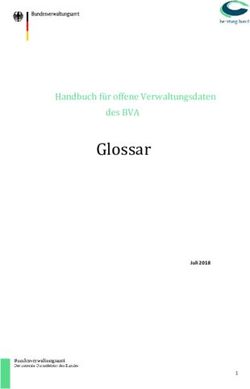KULTURLANDSCHAFTSWANDEL IM THURTAL - Zwischen Frauenfeld und Weinfelden 1850 2000
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
KULTURLANDSCHAFTSWANDEL
IM THURTAL
Zwischen Frauenfeld und Weinfelden
1850 – 2000
AUTOREN:
Basil Schmid, Florian Meier, Beat Müller, Marco Schmucki
LEITUNG:
Prof. Dr. Lorenz Hurni
BETREUUNG:
Stefan Räber, Institut für Kartografie ETH Zürich
Sommersemester 2006
___________________________________________________________________________
1/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal
Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung........................................................................................ 3
2. Entwicklung der Kulturlandschaft im Thurtal........................... 4
2.1 Veränderungen im Bereich Siedlungen...................................................... 4
2.1.1 Siedlungen von 1880 - 1912...................................................................................... 4
2.1.2 Siedlungen von 1912 - 1945...................................................................................... 5
2.1.3 Siedlungen von 1945 - 1973...................................................................................... 6
2.1.4 Siedlungen von 1973 - 2003...................................................................................... 7
2.2 Veränderungen im Bereich Infrastruktur................................................... 8
2.2.1 Verkehrsentwicklung der Stadt Frauenfeld.............................................................. 8
2.2.2 Eisenbahnbau............................................................................................................ 9
2.2.3 Autobahn................................................................................................................. 11
2.3 Veränderungen der Thurlandschaft.......................................................... 13
2.3.1 Die Thurlandschaft ................................................................................................ 13
2.3.2 Die 1. Thurkorrektion............................................................................................. 13
2.3.3 Die 2. Thurkorrektion............................................................................................. 14
2.3.3.1 Grundlagen.................................................................................................................... 14
2.3.3.2 Ziele............................................................................................................................... 15
2.4 Veränderungen im Bereich Landwirtschaft............................................. 18
3. Zukunftsaussichten...................................................................... 21
4. Quellenverzeichnis....................................................................... 22
4.1 Literatur………………………................................................................ 22
4.2 Internet...................................................................................................... 22
4.3 Karten………………………………………………………………...… 23
5. Anhang………………………………………………………….. 23
___________________________________________________________________________
2/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
1. Einleitung
Die Vorgabe für unsere Projektarbeit war, in einem frei wählbaren Bereich den
Kulturlandschaftswandel der letzten 150 Jahren zu untersuchen und zu dokumentieren. Wir
haben uns für das Thurtal zwischen Frauenfeld und Weinfelden entschieden. Dabei haben wir
die Arbeit in vier Teilbereiche gegliedert, die wir alle getrennt voneinander untersucht haben.
Einerseits befassten wir uns mit den Veränderungen in den Themenbereichen Landwirtschaft,
Siedlungen und Infrastruktur, andererseits haben wir die Thurverbauungen und die
Veränderungen der Thurlandschaft etwas genauer unter die Lupe genommen.
Als Quellen standen uns diverses Kartenmaterial der swisstopo und des Amts für Umwelt des
Kantons Thurgau in verschiedenen Massstäben seit 1880 zur Verfügung. Weiter waren wir in
der Stadtverwaltung von Frauenfeld und in der Kantonsbibliothek, um geeignete Literatur,
Broschüren und Statistiken zu bekommen, welche wir auch untersuchten und in unsere Arbeit
einfliessen liessen. Einzelne Informationen zu den verschiedenen Themen haben wir auch im
Internet recherchiert.
Am Schluss unserer Arbeit gehen wir auch noch auf die Zukunftsaussichten des Thurtals ein.
___________________________________________________________________________
3/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
2. Entwicklungen der Kulturlandschaft
2.3 Veränderungen im Bereich Siedlungen
2.3.1 Siedlungen von 1880-1912
Im Jahre 1880 lebten in den acht grössten Gemeinden (Frauenfeld, Warth-Weiningen, Felben-
Wellhausen, Pfyn, Müllheim, Märstetten, Hüttlingen, Amlikon-Bissegg) im Thurtal zwischen
Frauenfeld und Märstetten ungefähr 13'100 Menschen. Diese Zahl stieg bis 1910
gleichmässig, auf knapp 16'400 Einwohner, an. Das Ortsbild der kleineren Orte blieb während
diesem Zeitabschnitt praktisch unverändert.
Frauenfeld verzeichnete hingegen, wie auf der unteren Karte zu sehen ist, einen erkennbaren
Zuwachs. Eine klare Siedlungsstruktur ist aber nur teilweise feststellbar. Ein wichtiger Grund
dafür ist, dass erst zu dieser Zeit die ersten Übersichtspläne entstanden und so auch
unbebautes Gebiet in die Planungsarbeit einbezogen werden konnten. Beispielsweise sah der
Übersichtsplan von 1899 ein schachbrettartiges Strassennetz im Westen für eine "Neustadt"
vor. Dies ist auch auf der bearbeiteten Karte von 1912 zu sehen.1
Abb. 1: Frauenfeld 1912, mit Neubauten von 1880-1912 rot eingefärbt
(Siegfriedkarte, Ausschnitt Blatt 58, Ausgabe 1912, Massstab 1:25’000 reduziert, bearbeitet durch Autor)
1
B. Gnädinger, G. Spuhler: Frauenfeld, Geschichte einer Stadt im 19. und 20. Jahrhundert, 1996
___________________________________________________________________________
4/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal
Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
2.3.2 Siedlungen von 1912-1945
Während den beiden Weltkriegen stieg die Bevölkerungszahl im Thurtal noch ein bisschen
weniger stark an als zwischen 1880 und 1912. Dies stimmt auch mit den schweizerischen
Statistiken überein und ist angesichts der militärischen Bedrohung auch nicht weiter
erstaunlich. Jährlich verzeichneten die acht Gemeinden Frauenfeld, Pfyn, Felben-Wellhausen,
Warth-Weiningen, Müllheim, Wigoltingen, Märstetten, Hüttlingen und Amlikon-Bissegg
zwischen 1910 und 1940 einen prozentualen Zuwachs von 0.25%. Aus dem Diagramm ist vor
allem ersichtlich, dass der Zuwachs in Frauenfeld stark abgenommen hatte. Waren es in den
Jahren von 1880 bis 1910 noch 1.2% gewesen, so sind es von 1910-1950 nur noch 0.4%
gewesen.2
Bevölkerungsentwicklung von 1850 bis 1940
Thurtal
Frauenfeld
Pfyn, Felben-Wellhausen, Müllheim, Märstetten, Warth, Weiningen, Wigoltingen, Hüttlingen, Amlikon-Bissegg
20 000
18 000
16 000
14 000
Bevölkerun
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940
Jahr
Abb. 2: Bevölkerungsentwicklung von 1850-1940
(http://www.statistik.tg.ch)
2
http://www.statistik.tg.ch/documents/Bevoelkerung_TG_Gemeinden_ab1850.pdf
___________________________________________________________________________
5/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
2.3.3 Siedlungen von 1945-1973
Nach dem 2. Weltkrieg entstand in Frauenfeld ein Bauboom, welcher bis 1970 anhielt. Die
für die Jahrhundertwende prognostizierten Werte waren 1962 bereits erreicht oder sogar
überschritten. Neben dem Zuwachs an privaten Häusern sind auf der unteren Karte auch erste
industrielle Bauten im Norden der Stadt zu erkennen.
Abb. 3: Frauenfeld 1973, Neubauten zwischen 1945 und 1973 rot eingefärbt
(Landeskarte, Ausschnitt Blatt 1053, Ausgabe 1973, Massstab 1:25’000, swisstopo, bearbeitet durch Autoren)
Das rasante Wachstum brach erst Anfangs der 70er Jahre ab. Gründe für das Ende des
uneingeschränkten Wachstums sind die Ölkrise sowie die ersten Auswirkungen des
"Pillenknicks".3
Auch die Gemeinden Warth-Weiningen, Felben-Wellhausen, Pfyn, Müllheim und Märstetten
konnten einen positiven Bevölkerungswachstum vorweisen, währenddessen in Hüttlingen,
Wigoltingen und Amlikon-Bissegg die Einwohnerzahlen stagnierten oder sogar zurückgingen.
Allgemein kann gesagt werden, dass die ländlichen Gebiete während dieser Zeit nicht- oder
nur sehr gering wuchsen.
3
B. Gnädinger, G. Spuhler: Frauenfeld, Geschichte einer Stadt im 19. und 20. Jahrhundert, 1996
___________________________________________________________________________
6/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal
Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
2.3.4 Siedlungen von 1973-2003
Bis ins Jahre 1980 blieben die Verhältnisse in den ländlichen Räumen etwa gleich. Doch
zwischen 1980 und 1990 verzeichnete der Thurgau und somit auch das Thurtal einen im
gesamtschweizerischen Vergleich überdurchschnittlichen Bevölkerungszuwachs. Was waren
die Gründe? Einerseits verbesserte sich das "Steuerklima" markant. Andererseits war in den
meisten Gemeinden erschlossenes und relativ preiswertes Bauland erhältlich, sodass sich viele
ein Einfamilienhaus "im Grünen" leisten konnten. Die Folge bestand darin, dass in den
Gemeinden in ländlichen Gebieten ein ausserordentlich starker Wachstumsschub resultierte,
während Frauenfeld vergleichsweise weniger Zuwachs zu verzeichnen hatte. Dies führte zu
einer Zersiedlung der Landschaft. Dieses Phänomen zeigt auch die folgende Statistik.4
Bevölkerungsentwicklung von 1850 bis 2000
Frauenfeld
Pfyn, Felben-Wellhausen, Müllheim, Märstetten, Warth-Weiningen, Wigoltingen, Hüttlingen, Amlikon-Bissegg
25 000
20 000
Bevölkerun
15 000
10 000
5 000
0
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Jahr
Abb. 4: Bevölkerungsentwicklung von 1850 bis 2000
(http://www.statistik.tg.ch)
4
http://www.raumplanung.tg.ch/documents/200-ziele_raumprdnungspolitik-oa.pdf
___________________________________________________________________________
7/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
2.2 Veränderungen im Bereich Infrastruktur
2.2.1 Verkehrsentwicklung in der Stadt Frauenfeld
Die Frauenfelder Verkehrsplanung hat ihre Anfänge in den späten 1910er Jahren. Auf kühne
Anfänge mit utopisch anmutenden "Ortsgestaltungsplänen" folgte bis in die 40er Jahre eine
Phase der punktuellen Strassen- und Quartierplanung. Trotz rascher Zunahme der
Fahrzeugzahlen in der Zwischenkriegszeit ahnte noch niemand, wie nachhaltig das Auto die
Gesellschaft prägen und welche Konsequenzen dies für die Planung der öffentlichen
Infrastruktur haben sollte. In den sechziger Jahren wurde die Stadt damit konfrontiert, für die
zukünftigen Verkehrsströme eine angemessene Infrastruktur bereitstellen zu müssen. 1962
entstand so der erste Netzplan der Stadt Frauenfeld:
Abb. 5: Diesen Netzplan sah das Verkehrsingenieur-Büro Rapp aus Basel 1962 für Frauenfeld vor: zwei
Ringstrassen, die den Verkehr der A7 abnehmen und um die Stadt verteilen sollten, sowie zahlreiche
Radialstrassen für den Binnenverkehr.
(B. Gnädinger, G. Spuhler: Frauenfeld, Geschichte einer Stadt im 19. und 20. Jahrhundert, 1996)
___________________________________________________________________________
8/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
Dieser Verkehrsplan wurde jedoch bald darauf wieder verworfen, da er zu kompromisslos in
Bezug zur Umgebung und Umwelt war und zu wenig Rücksicht auf bereits bestehende
Bauten nahm. In den nächsten Jahren machte sich die Stadt an die Ausarbeitung eines
Verkehrsrichtplans, der die kurzfristigen Massnahmen mit langfristigen Lösungen zu
verbinden suchte und der die die Grundlage für die Planung der neuen Strassenzüge bilden
sollte. Der erste offizielle Verkehrsrichtplan verabschiedete der Gemeinderat 1970. Dieser
wurde aber bis in die späten 80er Jahre immer wieder überprüft und verbessert. 5
2.2.2 Eisenbahnbau
Das Verkehrswesen ist einer derjenigen Bereiche des Alltags, die sich in den letzten 150
Jahren wohl am einschneidensten verändert haben. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts setzte die
Eisenbahn zu einem Siegeszug an, der sie innert fünfzig Jahren zum wichtigsten
Verkehrsmittel Europas machte.
Die neue Bundesverfassung vom Jahre 1948 schuf die nötigen politischen und
wirtschaftlichen Voraussetzungen für ein Streckennetz in der Schweiz. Im Jahre 1852 erliess
der Bund ein nationales Eisenbahngesetz, welches dann der Auslöser für den Bau
verschiedener Eisenbahnstrecken sein sollte.
Alfred Escher, damals auch bekannt als der Zürcher Eisenbahnkönig und Besitzer der NOB
(Schweizerische Nordostbahn), bemühte sich um einen direkten Anschluss Zürichs an den
Bodensee. 1853 fusionierte dann die NOB mit den Bodensee- und Rheinfallbahnen und bald
darauf wurde die Strecke Oerlikon-Winterthur-Romanshorn eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt
war die die Schweizerische Nordostbahn mit einem Streckennetz von 853km die grösste
Schweizerische Bahngesellschaft.
5
B. Gnädinger, G. Spuhler: Frauenfeld, Geschichte einer Stadt im 19. und 20. Jahrhundert, 1996
___________________________________________________________________________
9/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
Abb. 6: Das Thurtal im Jahre 1880: rot eingefärbt die Strecke Frauenfeld-Weinfelden
(Siegfriedkarte, Ausschnitt aus Blätter 58 und 59, Massstab 1:25’000 verzerrt, bearbeitet durch Autoren)
Der Thurgau gehörte also schweizweit zu den ersten Kantonen, die eine direkte
Zugsverbindung nach Zürich hatte, was natürlich von diesem Zeitpunkt an erhebliche
wirtschaftliche und kulturelle Vorteile mit sich zog. 1911 wurde die Mittelthurgaubahn
(MThB) gegründet, die mit einer Stammstrecke Wil (SG) - Weinfelden - Kreuzlingen -
Konstanz (D) den Thurgau mit einer Nord-Süd-Verbindung ergänzte. Die MThB baute ihr
Streckennetz in den folgenden Jahren aus; es entstand eine Seelinie, die von Rorschach (SG)
nach Schaffhausen führte. Ausserdem weitete die MThB ihr Eisenbahnnetz mir der Strecke
Konstanz - Singen (D) bis nach Deutschland aus. Die Thurgau-Bodensee-Bahn (THURBO)
ist die Nachfolgergesellschaft der MThB, die 2002 Konkurs ging.
Die Zugsverbindungen gewährleisten heute einen guten Anschluss ans Städtenetz der
Schweiz; in Frauenfeld halten halbstündlich Schnellzüge von und nach Zürich und eine
S-Bahn nach Zürich ermöglicht angenehmes Pendeln.
Abb. 7: Das Streckennetz des THURBO 2004
(www.thurbo.ch)
___________________________________________________________________________
10/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
2.2.4 Die Autobahn
Im Gegensatz zu den Eisenbahnlinien im Thurtal, die jeweils sehr schnell realisiert wurden,
war der Prozess des Autobahnbaus im Thurgau eher langwierig und streckte sich über
Jahrzehnte hinweg. Noch während der Stadtrat mit den Verkehrsrichtplänen an der Arbeit
war, wurde am 26. August 1976 die Autobahn A7 (dazumal noch N7) durchgehend von
Attikon bis Frauenfeld-Ost eröffnet.
Abb. 8: Stand 1966: Frauenfeld und Umgebung vor dem Autobahnbau
(Landeskarte, Ausschnitt Blatt 28, Massstab 1:100’000 reduziert, swisstopo)
Abb. 9: Stand 1978: In den Jahren 1976 bis 1978 wurde das Teilstück
von Frauenfeld-Ost bis nach Felben-Wellhausen eröffnet.
(Landeskarte, Ausschnitt Blatt 28, Massstab 1:100’000 reduziert, swisstopo)
___________________________________________________________________________
11/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
Abb. 10: Stand 1984: In den nächsten 6 Jahren wurde die Autobahn nur gerade
bis zum Autobahndreieck Grüneck ausgebaut, mit der Ausfahrt Müllheim.
(Landeskarte, Ausschnitt Blatt 28, Massstab 1:100’000 reduziert, swisstopo)
Abb. 11: Stand 2002: Im Jahre 2002 war das letzte Teilstück vor Kreuzlingen immer noch nicht fertig.
(Landeskarte, Ausschnitt Blatt 28, Massstab 1:100’000 reduziert, swisstopo)
Der letzte Abschnitt bei Kreuzlingen mit dem neuen Autobahnzoll wurde erst 2001
fertiggestellt und ist deshalb noch nicht auf der aktuellsten Kartenausgabe von 2000
eingezeichnet.
Heute profitiert die Region Frauenfeld von der Nähe zum Wirtschaftsraum Zürich. Über die
Autobahnen A1 und die A7 ist der Flughafen in Zürich-Kloten in 30 Minuten erreichbar.
___________________________________________________________________________
12/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
2.3 Veränderungen der Thurlandschaft
2.3.1 Die Thurlandschaft
Wie jede andere Flusslandschaft, hat sich auch die Thurlandschaft im Laufe der Jahrhunderte
immer wieder verändert. Früher floss der Fluss ganz am Fusse des Hügels, dann suchte er sich
sein Bett wieder in der weiten Ebene, die der Thurgletscher und der sich danach bildende
Thursee hinterlassen hatte. Es entstanden Flussschlaufen, die sich verengten und zu Altläufen
wurden, weite delta-ähnliche Strecken mit Kies- und Sandbänken.
Die Thur neigt je nach Witterung und Klima sehr schnell zu Hochwassern. Sie bringt noch
immer viel Geschiebe mit sich, das sie je nach Fliessgeschwindigkeit ablagert, umlagert oder
liegenlässt. Aus der Zeit des freien Mäandrierens sind noch Reste der Ufervegetation erhalten
geblieben: Auen und Altläufe.
2.3.2 Die 1. Thurkorrektionen
Schon immer haben die Menschen an der Thur versucht, sich gegen die immer
wiederkehrenden Hochwasser zu schützen. Die alten Verbauungen vermochten die Thur nicht
zu bändigen. Die zunehmende Bevölkerungszahl und der wirtschaftliche Druck durch die
Industrialisierung der Gesellschaft wuchsen beträchtlich. Verschiedene Hochwasser im 19.
Jahrhundert richteten enorme Schäden an. Ab 1851 wurden Pläne zur Korrektion erarbeitet,
1862 wurde die Korrektion dem Parlament vorgelegt, und 1869 lag das Projekt vor, das dann
ab 1874 ausgeführt wurde.
Aber erst als die Landschaft Thurgau schon eine Weile zum unabhängigen Kanton Thurgau
geworden war, wurde 1890 diese erste Korrektion abgeschlossen. Damals wurde begradigt.
An den engsten Stellen der Mäander wurden die Durchbrüche gemacht.
Der begradigten Thur entlang wurden die ersten Dämme gebaut, allerdings aus so
unterschiedlichem Material, dass deren Sicherheit vergleichsweise gering war.
___________________________________________________________________________
13/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
Aus dieser Zeit stammen auch die Binnenkanäle. Sie waren notwendig geworden, weil es
nicht ratsam war, überall, wo kleine Bäche in die Thur mündeten, wieder eine Dammlücke
entstehen zu lassen. So werden nun immer noch die kleinen Bäche im Binnenkanal
gesammelt und an geeigneten Stellen der Thur zugeführt.
In den 60er und 70er (1978 Jahrhunderthochwasser) Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts
brachen die Dämme kurz nacheinander und bescherten dem Thurtal riesige
Überschwemmungen. Darauf wurden schleunigst Projekte zur Sicherung der
Hochwasserbauten erarbeitet. Sie mussten dann auf Druck des Bundes ökologischer gestaltet
werden, bevor dann, zwanzig Jahre nach den Hochwassern, endlich realisierbare und
ökologisch vertretbare Projekte umgesetzt wurden.
Seit 1993, rund hundert Jahre nach der ersten Korrektion, wurde zum zweiten Mal in den
Thurlauf eingegriffen: Die zweite Thurkorrektion wurde in Angriff genommen. Der Abschnitt
von der Rorerbrücke bei Frauenfeld bis zur Zürcher Grenze beim Fahrhof (Niederneunforn)
wurde bereits fertig gestellt. In der Vorbereitungsphase ist der Abschnitt Bürglen-Weinfelden,
mit dem Beginn von Bauarbeiten noch im Jahr 2005 rechnet das Amt beim Abschnitt
Schönenberg-Kradolf.
Abb. 12: Vergleich des Thurflusslaufes vor und nach der ersten Thurkorrektion 1890
(Massstab 1:50’000 verzerrt, Karte vom Amt für Umwelt TG, bearbeitet durch Autoren)
___________________________________________________________________________
14/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
2.3.3 Die 2. Thurkorrektion
2.3.3.1 Grundlagen
Das Thurrichtprojekt 1979 (TRP79) wurde nach den Hochwassern in den 70er Jahren des
letzten Jahrhunderts ausgearbeitet und beschlossen. Es beinhaltet im Wesentlichen:
- Die Wiederherstellung der Durchflusskapazität so, dass sie gross genug ist, ein
Hochwasser zu fassen, wie es alle hundert Jahre einmal zu erwarten ist (das
Hundertjährliche)
- Die Gewährleistung der Standfestigkeit der Hochwasserschutzdämme
- Die nachhaltige Sicherung der Grundwasservorkommen der ganzen Region
- Die ökologische Aufwertung des Lebensraumes
Die Anforderungen an den modernen Wasserbau sind im Wasserbaugesetz von 1993
definiert. Es bezweckt den Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten vor
schädlichen Auswirkungen des Wassers. Dieses Ziel soll mit minimalen Eingriffen ins
Gewässer realisiert werden. Das bedingt aber:
- Eine klare Gefahrenanalyse
- Eine klare Definition der Schutzziele
- Eine zweckmässige Planung der Massnahmen
- Eine funktionierende Einsatzplanung für den Notfall
Die darauf basierenden Grundsätze für die Revitalisierung der Thur sind:
- Ausreichender Gewässerraum
- Ausreichende Wasserführung
- Gute Wasserqualität
- Haushälterischer Umgang mit den natürlichen und wirtschaftlichen Grundlagen
Auf diese Grundsätze haben sich die fünf Anrainer-Kantone geeinigt. Die wichtigste und auf
jeden Fall massgebliche Grösse für Korrektionsprojekte ist der Raumbedarf des
Fliessgewässers für den schadlosen Abtransport des Wassers.
___________________________________________________________________________
15/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
2.3.3.2 Ziele
Aufgrund der hohen Schäden der Hochwasser von 1977 und 1978 wurde das Thurrichtprojekt
von 1979 (TRP79) für den Thurgau ausgearbeitet. Sein Kernsatz lautet: "Das Thurvorland
gehört der Thur".
Am 29. März 1982 wurde das TRP79 vom Parlament angenommen. Im September 2001
haben die zuständigen Regierungsräte aller Thurkantone ein Grundsatzpapier zur nachhaltigen
Entwicklung der Thur unterzeichnet.
Damit gelten nachfolgende Leitsätze zur Weiterentwicklung des Lebensraumes Thur:
Hochwasserschutz:
- Schutz für Menschen und erheblicher Sachwerte
- Schutz von Kulturland
- Kontrollierte Ableitung der Hochwasser
Genügend Platz ermöglicht schadlosen Abtransport von Wasser und Geschiebe und gleicht
das Hochwasser aus.
Ökologie:
- Flussdynamik zulassen
- Lebensräume im Flussraum aufwerten
- Auengebiete aufwerten
- ökologisch verträgliche Naherholungsgebiete an der Thur
Standorttypisch bewachsenes Ufer und Umland erhöhen die Selbstreinigungskraft des Flusses
und bauen Nährstoffe ab. Das ist wichtig für den Erhalt der Grundwasserqualität.
Nutzung:
- Extensive Nutzung im Flussraum
- Sicherstellung der Grundwassernutzung d.h. der Trinkwasserversorgung
- Koordination der verschiedenen Amtsstellen und Fachgebiete
Die Uferbereiche verbinden Lebensräume und Landschaftsteile. Wie der Flussraum nach der
Korrektion genutzt werden kann, bleibt in der politischen Diskussion.
___________________________________________________________________________
16/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
Oberstes Ziel der Thurkorrektion ist jedoch die Hochwassersicherheit für die Menschen, die
Siedlungen, das bewirtschaftete Land und die Verkehrswege einschliesslich der Brücken und
Stege. Dafür werden Dämme erhöht und verstärkt sowie die Höhe der Vorländer
ausgeglichen. Das zweite Ziel ist die ökologische Aufwertung des ganzen Flussgebietes.
Drittens soll die Sohlenerosion gestoppt werden. Dafür wird grobes Material in die Sohle
beigegeben und das Gerinne verbreitert. Das trägt wesentlich zum Erhalt der
Grundwasserreserven bei.6
Abb. 13: Jahrhunderthochwasser 1978: Felben-Wellhausen
(Foto vom Amt für Umwelt, bearbeitet durch Autoren)
6
http://www.umwelt.tg.ch
___________________________________________________________________________
17/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
2.4 Veränderungen im Bereich Landwirtschaft
Um 1850 wurde die Landwirtschaft im Thurgau folgendermassen beschrieben: Das
Hauptgewicht lag auf dem Ackerbau, aber auch der Obstbau hatte grosse Bedeutung. Der
Boden wurde intensiv genutzt und die Erträge stiegen an. Die Bauern wurden selbstbewusster
und hatten eine bessere politische Mitsprache. Doch der Einsatz von Maschinen kam nur
schleppend voran. Da nach dem Sonderbund der Söldnerdienst untersagt und die Industrie nur
schwach vertreten war, gab es viele billige Arbeitskräfte und das Wirtschaftsleben bestand
weitgehend aus Selbstversorgung. Diese Selbstversorgung zeigte seine Schwäche bei
Missernten den Fehljahren 1846 und 1847, wo die Gemeinden „Sparsuppen“ austeilen
mussten.
Der vermehrte Mangel an Arbeitskräften zwang die Bauern Personal aus dem Ausland zu
engagieren und Maschinen anzuschaffen. Diese mussten jedoch zumeist aus Übersee
importiert werden und waren teuer, erst mit der serienmässigen Herstellung in der Schweiz
durch die Landmaschinenfabrik Aebi in Burgdorf, waren die Maschinen auch für
Kleinbetriebe erschwinglich. Als dann die Ackerfläche zurückging, bot die Grasfläche eine
bessere Kombinationsmöglichkeit mit dem Obstbau und die Bauern bauten diesen Zweig
noch weiter aus.
Der Ackerbau verlor nach und nach an Bedeutung. Durch die Abkehr von dem Ackerbau
musste vermehrt Getreide importiert werden. Als dann der Erste Weltkrieg ausbrach, waren
die Landesregierung und die Landwirtschaft nicht auf diese Krise vorbereitet. Als dann im
August 1914 der Krieg ausbrach, kam es zu Hamsterkäufen und die Regierung musste
Einschränkungen für den Kauf von Lebensmittel und Rationierungen (Reis, Zucker und
Fleisch, Eier etc. erst im letzten Kriegsjahr) anordnen. Die Regierung Appellierte den
Getreidebau auszubauen, aber erst in den Jahren 1917 und 1918 wurden Vorschriften und
Prämien für Neuumbrüche ausgerichtet, um die Vermehrung von Winter- und Brotgetreide
um 50`000 Hektaren zu fördern. Vielerorts waren Fehlgriffe nicht zu vermeiden:
- einseitige Forcierung
- Orte mit schlechtem Klima- und Bodenverhältnissen
- falsches Saatgut.
___________________________________________________________________________
18/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
Abb.14: Anteil der Ackerfläche am gesamten Kulturland im Thurgau
(C. Eigenmann, 150 Jahre Thurgauischer Landwirtschaftlicher Kantonalverband 1835-1985)
Der Ackerbau ging nach dem Krieg allmählich wieder zurück, denn der Absatz war mit zum
Teil grossen Verlusten belastet. Deshalb blieb die Propagierung für Ackerbau meist ungehört,
und die Bereitschaftsstellung schwand. Während des Zweiten Weltkrieges erhielt dann die
Landwirtschaft ihre Stellung zurück. Zum Glück waren die Ernten in der Zeit der Isolation
von 1940-1945 erfreulich ausgefallen. Neben der Lebensmittelversorgung mussten die Bauern
auch Militärdienst leisten, deshalb mussten die Frauen nun vermehrt den Betrieb führen, was
ihre Emanzipation förderte.
Im Thurgau musste dann auch das gesetzlich geschützte Territorium Wald zugunsten der
Ackerbaufläche weichen. Der Thurgau wurde verpflichtet 650 Hektaren Wald umzunutzen.
Abb.15: Jährliche Rodungsfläche im Thurgau
(C. Eigenmann, 150 Jahre Thurgauischer Landwirtschaftlicher Kantonalverband 1835-1985)
___________________________________________________________________________
19/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
Abb.16: Vergleich 1912 zu 1880; Rot: Rodung; Grün: Aufforstung
(Siegfriedkarte, Ausschnitt Blatt 58 1912, Massstab 1:25’000 verzerrt, bearbeitet durch Autor)
Abb.17: Vergleich 1945 zu 1912; Rot: Rodung; Grün: Aufforstung
(Siegfriedkarte, Ausschnitt Blatt 58 1945, Massstab 1:25’000 verzerrt, bearbeitet durch Autor)
Nach dem Krieg nahm die Ackerbaufläche wieder ab und auch die Zahl der Bauern verringert
sich, vor allem die Kleinbetriebe verschwanden ab den Vierziger Jahren immer mehr.
Die Bauern suchten nach neuen Absatzmärkten, so wurden Hühnerbatterieställe, und für den
Fleischkonsum Schweins- und Hühnermästereinen aufgebaut. Weiter veränderte der
Fortschritt im Bauwesen das Aussehen der Häuser und Ställe. Der Import von Gütern aus dem
Ausland führte bei Schweizer Bauern zu grösseren Verschuldungen. In den achtziger Jahren
verliessen viele ihren Hof und zogen in die Stadt oder ins Ausland.
Die thurgauischen Bauern waren anfangs weniger davon betroffen, erst um 1990 verliessen
sie dann ihre Heimat und zogen in die Stadt.
___________________________________________________________________________
20/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
3. Zukunftsaussichten
Durch die Zersiedlung der Landschaft in den 80er und frühen 90er Jahren wuchs der
Individualverkehr stark an. Damit verbunden waren eine Zunahme der Lärmimmissionen und
eine Verschlechterung der Luftqualität. Deshalb wollen die Raumplaner des Kantons
Thurgaus in Zukunft das Wachstum der Siedlungen wieder vermehrt auf die Zentren und die
Entwicklungsräume ausrichten. Wie auf der unteren Karte zu sehen ist, soll das Thurtal als
Entwicklungsraum und Frauenfeld als regionales Zentrum dementsprechend gefördert
werden.
Abb. 14: Siedlungskonzept des Kanton Thurgaus
(www.raumplanung.tg.ch)
Das ländliche Gebiet soll in erster Linie für die Landwirtschaft und als ökologischer
Ausgleichs- und Erholungsraum genutzt werden.
Ob im Bereich Verkehr in den nächsten Jahren eine grössere Entwicklung stattfinden wird, ist
eher zweifelhaft, denn letztes Jahr wurde eine Initiative zum Bau einer Hochleistungsstrasse
von Märstetten nach Arbon (T14) relativ deutlich vom Thurgauer Stimmvolk abgelehnt.
Langfristig wird man aber auch im Thurgau nichts gegen die stetig wachsende
Verkehrsentwicklung unternehmen können.
___________________________________________________________________________
21/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
4. Quellenverzeichnis
4.1 Literatur
Ammann Heinrich: Thurgau gestern, heute morgen, Frauenfeld, 1966
Eigenmann Carl: 150 Jahre Thurgauischer Landwirtschaftlicher Kantonalverband 1835 -
1985, Frauenfeld, 1985
Forstamt Kanton Thurgau: Jahrbuch der Thurgauer Waldwirtschaft 2004, Frauenfeld, 2005
Gnädinger Beat und Gregor Spuhler: Frauenfeld, Geschichte einer Stadt im 19. und 20.
Jahrhundert, Frauenfeld, 1996
Schoop Albert: Geschichte des Kantons Thurgau, Frauenfeld, 1997
Statistisches Amt des Kantons Thurgau: Der Kanton Thurgau in Zahlen, Frauenfeld, 1993
4.2 Internet
http://www.umwelt.tg.ch
http://www.raumplanung.tg.ch
http://www.regio-frauenfeld.ch
http://www.statistik.tg.ch
http://www.thurbo.ch
___________________________________________________________________________
22/23Projektarbeit 2006 Kulturlandschaftswandel im Thurtal Institut für Kartografie
ETH Zürich
____________________________________________________________________________________________________
4.3 Karten
Bundesamt für Landestopografie, www.swisstopo.ch
Siegfriedkarte; 1880, 1912, 1945
Landeskarte; 1966, 1973, 1978, 1984, 2002
Amt für Umwelt, Amt für Raumplanung des Kantons Thurgau
5 Anhang
Entwicklung der Siedlungen
1. Siegfriedkarte, Ausschnitt aus Blätter 56, 57, 58 und 59, Stand 1912, Massstab
1:25’000 verzerrt, bearbeitet durch Autoren
2. Siegfriedkarte, Ausschnitt aus Blätter 56, 57, 58 und 59, Stand 1945, Massstab
1:25’000 verzerrt, bearbeitet durch Autoren
3. Landeskarte, Ausschnitt Blatt 1053, Ausgabe 1973, Massstab 1:25’000, swisstopo,
bearbeitet durch Autoren
4. Landeskarte, Ausschnitt Blatt 1053, Ausgabe 2003, Massstab 1:25’000, swisstopo,
bearbeitet durch Autoren
Entwicklung der Waldfläche
5. Siegfriedkarte, Ausschnitt aus Blätter 56, 57, 58 und 59, Stand 1912, Massstab
1:25’000 verzerrt, bearbeitet durch Autoren
6. Siegfriedkarte, Ausschnitt aus Blätter 56, 57, 58 und 59, Stand 1945, Massstab
1:25’000 verzerrt, bearbeitet durch Autoren
___________________________________________________________________________
23/23Sie können auch lesen