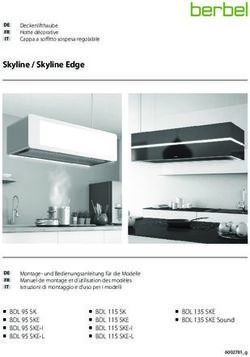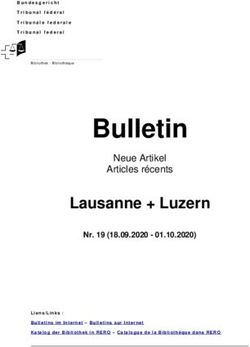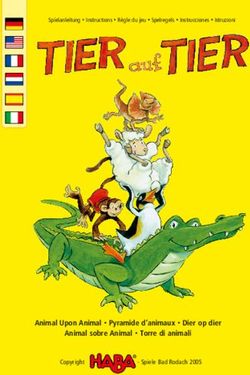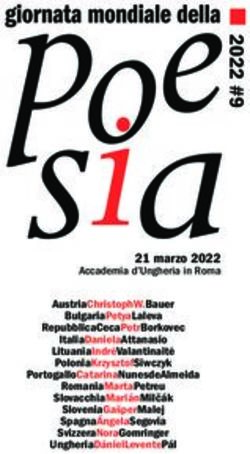Moderhinke Projekt Projet Piétin Progetto Zoppina - Schlussbericht, Juni 2020 - Baselland
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin (FIWI)
Abteilung Wildtiere
Dept. Infektionskrankheiten und Pathobiologie, Vetsuisse Fakultät, Universität Bern
Länggass-Str. 122, Postfach, CH-3001 Bern; Tel. +41 31 631 24 43
Moderhinke Projekt
Projet Piétin
Progetto Zoppina
Schlussbericht, Juni 2020
© Romanens
Gaia Moore-Jones & Marie-Pierre Ryser-Degiorgis2
Zusammenfassung
Hintergrund: Die Moderhinke (Klauenfäule) ist eine weltweit verbreitete, schmerzhafte und wirt-
schaftlich bedeutende Erkrankung der Klauen, die durch das Bakterium Dichelobacter nodosus ver-
ursacht wird. Schafe sind am meisten betroffen, und sowohl gutartige als auch bösartige Stämme
(Bakterientypen) wurden identifiziert, die zu leichten bzw. schweren Fussveränderungen führen kön-
nen. Im Gegensatz dazu können beim Alpensteinbock beide Stämmenarten zu schweren Veränderun-
gen führen. Da die Krankheit in der Schweiz in den Schafherden weit verbreitet ist, soll in Kürze ein
nationales Bekämpfungsprogramm gegen die bösartigen Stämme bei Schafen implementiert werden.
Ziel: Das Hauptziel dieser Arbeit war es daher, die Rolle des Alpensteinbocks und anderer empfäng-
lichen Wildwiederkäuer in der Verbreitung von D. nodosus zu bestimmen, die Infektionsdynamik an
der Schnittstelle zwischen Schalenwild und Haustieren zu verstehen, die verschiedenen Einflussfak-
toren zu identifizieren, die die Wahrscheinlichkeit einer Infektion beeinflussen , inkl. Vorhandensein
klinischer Zeichen, Tierart, Rasse (Nutztiere), Altersklasse, Geschlecht, geographische Herkunft,
zwischenartliche Kontakte mit Haus- und/oder Wildwiederkäuern, Klima; und letztlich die Bedeutung
der Krankheit für den Steinbock abzuschätzen.
Methoden: Um eine nationale Übersicht zu bekommen, haben wir folgende Methoden angewendet:
1) Gleichzeitige Häufigkeitsschätzung des Erregers und Beurteilung von potenziellen Risikofaktoren
bei empfänglichen Wild- und Hauswiederkäuern sowie auch Neuweltkameliden (Mai 2017 - Dezem-
ber 2019); 2) Umfrage bei allen Wildhütern mit Steinbockkolonien in ihren Aufsichtsgebieten, um
die Häufigkeit und das Ausmass vergangener Moderhinke-Ausbrüche zu dokumentieren (April - Juli
2018) zusammen mit einer Zusammenstellung der Steinbock-Sektionsberichte vom FIWI (1999 -
2019) zur Dokumentation vergangener Fälle von Moderhinke; 3) Lokale Häufigkeitsschätzung des
Erregers (von Füßen mit und ohne Veränderungen) in vier ausgewählten Kolonien mit und ohne
gemeldeten Moderhinke Ausbrüchen (August - Dezember 2018), um zu beurteilen, ob die Situation
auf lokaler Ebene sich von derjenigen auf nationaler Ebene dokumentierten Situation unterscheidet.
Resultate: Neben den gesammelten Informationen zu den Hauswiederkäuern, Neuweltkameliden,
Hirschartigen und Gämsen, haben wir Daten aus der gesamten Schweizer Alpensteinbockpopulation
erhalten, sowohl zum Vorkommen von D. nodosus als auch zum Auftreten der Krankheit. Die meis-
ten beobachteten Wechselwirkungen zwischen Schalenwild und Nutztieren wurden mit Schafen und
Rindern beobachtet und es gab diesbezüglich keinen Unterschied zwischen Kolonien mit oder ohne
bekannte Moderhinke-Fälle. Hingegen gab es Hinweise auf eine Rolle des Vorkommens von mit
Moderhinke befallenen Schafen als begünstigender Faktor für das Auftreten der Moderhinke in den
Alpensteinbockkolonien. Es wurden keine anderen Risikofaktoren gefunden. Die Ergebnisse der pa-
rallel laufenden Nutztierstudie zeigten eine hohe Anzahl gesunder (d.h. ohne Fussveränderungen)
Rinder (83.3%) und einen kleineren Anteil gesunder Schafe (7.8%) als Träger der gutartigen Stämme.
In diesem Projekt identifizierte bösartige Stämme wurden fast ausschliesslich bei gesunden Schafen
(17.6%) nachgewiesen. Beim gesamten Schalenwild waren die Infektionshäufigkeiten sowohl auf
nationaler Ebene (2.0% bei allen Wildwiederkäuern zusammen), als auch auf lokaler Ebene bei den
Alpensteinböcken (0.7%) sehr gering. In beiden Fällen befanden sich erkrankte Steinböcke unter den
D. nodosus-positiven Tieren, während der Erreger bei anderen Wild- und Haustierarten hauptsächlich
auf gesunden Füssen nachgewiesen wurde. Zudem waren es mehrheitlich gutartige Stämme, die bei
Wildtieren gefunden wurden. Schliesslich deuten die Daten darauf hin, dass die Moderhinke beim
Steinbock nur eine sporadisch auftretende Krankheit ist. Es gab jedoch Unterschiede zwischen Ko-
lonien, wobei einzelne wiederholt betroffen wurden. Der Grund dafür ist unklar. Insgesamt deuten
die Ergebnisse darauf hin, dass sich D. nodosus bei Wildwiederkäuerpopulationen höchstwahrschein-
lich nicht aufrechterhält, im Gegensatz zur Situation bei Schafen (bösartiger und gutartiger D. nodo-
sus) und Rindern (gutartiger D. nodosus).
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Moderhinke auf der Ebene der gan-
zen Steinbockpopulation keine relevante Rolle zu spielen scheint aber ihre Bedeutung könnte zwischen
den verschiedenen Kolonien stark variieren. In Bezug auf die Planung des bevorstehenden nationalen
Bekämpfungsprogramms bei Schafen scheint es keinen Grund dazu zu geben, die Wildwiederkäuer-
populationen bei dessen Planung zu berücksichtigen.3
Résumé
Contexte: Le piétin est une maladie des onglons, douloureuse et économiquement importante, répandue
dans le monde entier et causée par la bactérie Dichelobacter nodosus. Les moutons sont les animaux les
plus touchés et on a identifié des souches (types de bactéries) bénignes et malignes qui peuvent provoquer
des altérations légères ou graves du pied. En revanche, chez le bouquetin des Alpes, les deux sortes de
souches peuvent entraîner de graves lésions. Comme la maladie est très répandue dans les troupeaux de
moutons en Suisse, un programme national de lutte contre les souches malignes chez les moutons va être
prochainement mis en œuvre.
Objectif: Le principal objectif de ce travail était de déterminer le rôle du bouquetin des Alpes et autres
ruminants sauvages sensibles à l’infection dans la propagation de D. nodosus, de comprendre la dyna-
mique de l'infection à l'interface entre les animaux sauvages et les animaux domestiques, d'identifier les
différents facteurs influençant la probabilité d'infection, notamment pour évaluer la présence de signes
cliniques, l'espèce, la race (animaux d'élevage), le groupe d'âge, le sexe, l'origine géographique, les con-
tacts inter-espèces avec les ruminants domestiques et/ou sauvages, le climat et enfin, l’importance de la
maladie pour le bouquetin.
Méthodes: Afin d'obtenir une vue d'ensemble au niveau national, nous avons utilisé les méthodes sui-
vantes : 1) Estimation simultanée de la fréquence de l'agent pathogène et évaluation des facteurs de risque
potentiels chez les ruminants sauvages et domestiques sensibles ainsi que chez les camélidés du Nouveau
Monde (mai 2017 - décembre 2019) ; 2) Enquête auprès de tous les gardes-faune ayant des colonies de
bouquetins dans leurs districts de surveillance pour documenter la fréquence et l'étendue des foyers de
piétin (avril - juillet 2018) ainsi qu'une compilation des rapports d'autopsie du FIWI portant sur des bou-
quetins atteints de piétin (1999 - 2019) ; 3) Estimation de la fréquence locale de l'agent pathogène (sur
des pieds avec et sans lésions) dans quatre colonies sélectionnées, avec et sans foyers de piétin signalés
(août - décembre 2018) pour évaluer si la situation au niveau local diffère de la situation documentée au
niveau national.
Résultats: En plus des informations recueillies sur les ruminants domestiques, les camélidés du Nou-
veau Monde, les cervidés et les chamois, nous avons obtenu des données sur toute la population de
bouquetins des Alpes suisses, tant sur l'occurrence de D. nodosus que sur celle de la maladie. La
plupart des interactions observées entre les animaux sauvages les animaux domestiques ont été ob-
servées avec des moutons et des bovins, et à cet égard il n'y avait pas de différence entre les colonies
de bouquetins avec ou sans cas connus de piétin. En revanche, il semble que la présence de moutons
atteints de piétin soit un facteur favorisant l'apparition du piétin dans les colonies de bouquetins. Les
résultats de l'étude parallèle sur les animaux domestiques ont montré qu'un grand nombre de bovins
sains (donc sans lésions aux pieds) (83,3 %) et une plus petite proportion d'ovins sains (7,8 %) étaient
porteurs de souches bénignes. Les souches malignes identifiées dans ce projet ont été détectées
presque exclusivement chez des moutons sains (17,6 %). Pour l'ensemble des animaux sauvages, les
taux d'infection étaient très faibles tant au niveau national (2,0 % pour tous le s ruminants sauvages)
qu'au niveau local pour le bouquetin des Alpes (0,7 %). Dans les deux cas, des bouquetins atteints de
piétin ont été trouvés parmi les animaux positifs à D. nodosus, alors que la bactérie a été trouvée
principalement sur des pieds sains chez d'autres espèces animales sauvages et domestiques. De plus,
les souches trouvées chez les animaux sauvages étaient principalement de type bénin. Enfin, les don-
nées indiquent que le piétin n'est qu'une maladie sporadique chez le bouquetin.Il y avait cependant
des différences entre les colonies, certaines ayant été touchées de manière répétée. La raison de ces
différences n'est pas claire. Dans l'ensemble, les résultats suggèrent que D. nodosus ne persiste pro-
bablement pas dans les populations de ruminants sauvages, contrairement à la situation chez les ovins
(D. nodosus malin et bénin) et les bovins (D. nodosus bénin).
Conclusions: Les résultats de cette étude montrent que le piétin ne semble pas jouer un rôle important
au niveau de la population de bouquetin dans son ensemble mais son impact pourrait varier considé-
rablement d'une colonie à l'autre. En ce qui concerne la planification du programme national de con-
trôle du piétin chez les ovins, il n’apparaît pas nécessaire de prendre en compte les populations de
ruminants sauvages.4
Riassunto
Contesto: La zoppina è una malattia degli unghioni dolorosa ed economicamente importante diffusa in
tutto il mondo e causata dal batterio Dichelobacter nodosus. Le pecore sono le più colpite, e sono stati
identificati ceppi sia benigni che maligni che possono causare danni ai piedi da lievi a gravi. Nello
stambecco alpino, invece, entrambi i ceppi possono causare gravi lesioni. Poiché la malattia è diffusa in
tutte le greggi di pecore della Svizzera, a breve sarà attuato un programma nazionale di lotta contro i ceppi
maligni delle pecore.
Obiettivo: L'obiettivo principale di questo studio era determinare il ruolo nella diffusione di D. nodosus
dello stambecco alpino e di altri ruminanti selvatici sensibili, per capire le dinamiche di infezione
all'interfaccia tra animali selvatici e animali domestici. Lo scopo era identificare i diversi fattori che
influenzano la probabilità di infezione, in particolare per valutare la presenza di segni clinici, specie, razza
(animali domestici), fascia d'età, sesso, origine geografica, contatto tra specie di ruminanti domestici e/o
selvatici, clima e, infine, comprendere il significato della malattia per lo stambecco.
Metodi: Per ottenere una panoramica nazionale sono stati utilizzati i seguenti metodi: 1) Stima simultanea
della frequenza dell'agente patogeno e valutazione dei potenziali fattori di influenza negli ungulati
selvatici e domestici sensibili (maggio 2017 - dicembre 2019); 2) Questionario presso tutti i guardiacaccia
con colonie di stambecchi nelle loro aree di controllo per documentare la frequenza e l'estensione della
zoppina (aprile - luglio 2018) e la raccolta di rapporti d'autopsia di tutti gli stambecchi del FIWI (1999 -
2019) riguardanti casi di zoppina; 3) Stima della frequenza locale dell'agente patogeno (da unghioni con
e senza lesioni) in quattro colonie selezionate, con e senza focolai segnalati di zoppina (agosto - dicembre
2018), per valutare un'eventuale differenza tra la situazione al livello locale e a livello nazionale.
Risultati: Oltre alle informazioni raccolte su ungulati domestici, cervidi e camosci, abbiamo raccolto dati
sull'intera popolazione svizzera di stambecchi, sia sull'insorgenza di D. nodosus che sulla malattia. La
maggior parte delle interazioni tra gli animali selvatici e domestici sono state osservate con pecore e
bovini, e a questo proposito non c'è stata alcuna differenza tra le colonie con e senza casi noti di zoppina.
D'altra parte, la presenza di pecore con la zoppina è risultato come un fattore statisticamente favorevole
per l'occorrenza della zoppina nelle colonie di stambecchi. Non sono stati rilevati altri fattori di rischio.
I risultati dello studio parallelo sugli animali domestici hanno mostrato che un gran numero di bovini sani
(83,3%) e una percentuale minore di pecore sane (7,8%) è portatore dei ceppi benigni. I ceppi maligni
identificati in questo progetto sono stati rilevati quasi esclusivamente in pecore sane (17,6%). Per gli
animali selvatici, i tassi di infezione sono stati molto bassi sia a livello nazionale (2,0% per tutti i ruminanti
selvatici messi insieme) sia a livello locale per lo stambecco alpino (0,7%). Stambecchi malati sono stati
trovati tra gli animali positivi a D. nodosus, mentre su altri animali, sia selvatici che domestici, l'agente
patogeno è stato trovato principalmente su piedi sani. Inoltre, la maggior parte dei ceppi tra gli animali
selvatici erano ceppi benigni. I dati mostrano che la zoppina è solo una malattia sporadica nella
popolazione di stambecchi svizzeri. Tuttavia, ci sono state differenze tra le colonie, alcune delle quali
sono state colpite ripetutamente. Il motivo non è chiaro. Nel complesso, i risultati suggeriscono che D.
nodosus non è probabilmente persistente nelle popolazioni di ruminanti selvatici, a differenza che negli
ovini (D. nodosus maligno e benigno) e nei bovini (D. nodosus benigno).
Conclusioni: I risultati di questo studio mostrano che la zoppina non sembra avere un ruolo rilevante a
livello dell'intera popolazione di stambecchi, ma l'entità della sua presenza varia notevolmente da colonia
a colonia, soprattutto proporzionalmente alle dimensioni della colonia. Per quanto riguarda il prossimo
programma nazionale di controllo degli ovini, le popolazioni di ruminanti selvatici non dovrebbero essere
prese in considerazione nella sua pianificazione.5
1. Hintergrund 3 und 4), auf die in diesem Schlussbericht ein-
gegangen wird.
Die Moderhinke (Klauenfäule) ist eine weltweit
verbreitete Erkrankung der Klauen, die durch
das Bakterium Dichelobacter nodosus verur- 2. Ziele des Projektes
sacht wird. Schafe sind am meisten betroffen,
allerdings können auch Wildwiederkäuer wie 1) Schweizweite Abschätzung der Häufig-
Steinböcke und Mufflons schwer erkranken. In keit von D. nodosus bei vier Wildwieder-
den nächsten Jahren soll ein nationales Be- käuern und vier Hauswiederkäuern: Stein-
kämpfungsprogramm beim Schaf implemen- bock, Gämse, Reh, Rothirsch; Schaf,
tiert werden. Ziege, Rind, Neuweltkameliden. Dies soll
Durch die in der Schweiz weit verbreitete Al- bei allen Tieren, mit und ohne Klauenver-
pung der Schafe besteht ein hohes Risiko von änderungen erfolgen.
Interaktionen unter Schafen aus verschiede-
nen Herden mit unterschiedlichem oder sogar 2) Erfassung möglicher Einflussfaktoren,
unbekanntem Gesundheitszustand sowie von die zu einer erhöhten Infektionshäufig-
multiplen Wechselwirkungen (direkt und in- keit führen könnten - wie das Klima, der
direkt) zwischen Schafen und anderen für D. Gesundheitszustand, die Altersklasse
nodosus empfänglichen Tierarten. Daher ist und zwischenartliche Kon-takte.
es denkbar, dass D. nodosus unter diesen Be-
dingungen zwischen verschiedenen Wieder- 3) Schweizweite Erfassung aller schon vor-
käuerarten übertragen wird.Im Hinblick auf gekommenen Moderhinke-Ausbrüche in
die Planung des nationalen Bekämpfungspro- Steinbockkolonien
gramms und in Bezug auf die Auswirkung der
Erkrankung in den geschützten Schweizer 4) Lokale Abschätzung der Infektionshäufig-
Steinbockkolonien war eine bessere Daten- keit mit D. nodosus (bei allen Tieren, mit
grundlage über die Situation dringend not- und ohne Klauenveränderungen) bei vier
wendig. ausgewählte Steinbockkolonien in Grau-
Zu den Projektzielen 1 und 2 (s. 2. Projekt- bünden.
ziele) wurde im 2. Zwischenbericht ausführ-
lich berichtet. Die wesentlichen Erkenntnisse
waren: (a) die Dokumentation einer hohen
Häufigkeit von D. nodosus bei Schafen und 3. Methoden
Rindern ohne Krankheitssymptomen, wäh-
rend dieses Bakterium bei Wildwiederkäuern Moderhinke Umfrage: Zielgruppe: Alle
verhältnismässig selten bis sehr selten nach- Wildhüter mit Steinbockkolonien in ihrem
gewiesen wurde (s. Tabelle 1); (b) bis auf eine Aufsichtsgebiet. Die Umfrage bestand aus
Ausnahme, das Vorkommen von schweren drei Teilen, nämlich Teil I: Persönliche Infor-
Fussveränderungen bei infizierten Steinbö- mationen zum Befragten, Teil II: Angaben zur
cken, sowohl mit sogenannten «gutartigen» Kolonie, Teil III: Detaillierte Angaben zu
wie «bösartigen» Stämmen (Klassifizierung Moderhinke-Ausbrüchen.
aufgrund von Krankheitsfällen bei Schafen); Zusammenstellung von FIWI Sektionsbe-
und (c) auf den Alpweiden haben Wildwie- richten: Zusammenstellung aller FIWI Sekti-
derkäuer– wie erwartet – v.a. mit Rindern und onsberichten von Steinböcken mit Moder-
Schafen Wechselwirkungen gehabt. Diese hinke aus dem Zeitraum 1999-2019.
Daten haben darauf hingewiesen, dass die ein- Abschätzung der lokalen Nachweishäufig-
heimischen Wildtiere keine relevante Infekti- keit von D. nodosus bei ausgewählten Stein-
onsquelle für Haustiere darstellen, während bockkolonien:
eine Einschleppung des Moderhinke-Erregers Anhand der Umfrageresultaten wurden vier
auf die Alpweiden durch Schafe und Rinder Steinbockkolonien im Kanton Graubünden
sehr wahrscheinlich ist. identifiziert, und zwar zwei mit wiederkeh-
Somit blieb nur noch die Frage der Relevanz render Moderhinke (sog. Fallkolonien) und
der Krankheit für die Steinböcke offen (Ziele zwei ohne berichtete Moderhinke (sog. Kon-6
trollkolonien). Die Probenentnahme und Ana-
lysen wurden im Rahmen der Arbeiten für den
ersten Teil der Studie im Sommer/Herbst 2018 Tab. 1: Resultate der Untersuchungen zum Vorkom-
men von D. nodosus bei Wild- und Hauswiederkäuern
durchgeführt. (Positiv = Bakterium nachgewiesen). Gutartig und bösar-
tig beziehen sich auf die Art der identifizierten Bakterien.
4. Resultate Anzahl Positiv Positiv bösar-
Tierart
Proben gutartig tig
4.1 Moderhinke Umfrage bei allen Stein-
bockkolonien in der Schweiz 3 1
Steinbock 589
An der Umfrage haben 76 Wildhüter teilgenom- (0.50%) (0.16%)
men und wir haben somit eine 100% Beteili-
gungsrate erreicht. Alle 16 Kantone mit Stein- 1 0
Gämse 410
bockkolonien haben mitgemacht und 100% (0.24%) (0.00%)
(47/47) der Steinbockkolonien wurden reprä-
sentiert (Abb. 2). 31 0
Rothirsch 408
(7.59%) (0.00%)
1 0
Reh 409
(0.24%) (0.00%)
Total Wild- 1821 36 1
tiere * (1.97%) (0.05%)
58 94
Schaf 690
(7.80%) (17.60%)
Abb. 1 Moderhinke in Schweizer Steinbockkolo- 694 0
Rind 849
nien. Grüne Flächen: Moderhinke-negative Kolo- (83.30%) (0.00%)
nien; Gelbe Flächen: Moderhinke-positive Kolonien
(seltene Ausbrüche); Orange Flächen: Moderhinke-
23 0
positive Kolonien (wieder-kehrende Ausbrüche). Ziegen 790
(2.30%) (0.00%)
Insgesamt wurden 48 Ausbrüche (definiert als
einer oder mehrere Fälle in einem Zeitabstand Neuwelt 13 3
591
von maximal 6 Monaten zwischen einander) in Kameliden (0.90%) (0.20%)
16 aus 47 Kolonien beschrieben. Bei 50% dieser
Kolonien wurde ein einziger Ausbruch pro Ko- Total Haus- 788 97
2920
lonie dokumentiert und in 63% der Kolonien tiere (26.98%) (3.21%)
mit Ausbrüchen wurde nur ein betroffenes Tier *Für fünf Tiere war die Tierart nicht angegeben.
in der gesamten Kolonie beobachtet. Eine Aus-
nahme besteht bei acht der betroffenen Kolo-
nien, in welchen mehrere Ausbrüche über meh- Mögliche Einflussfaktoren auf das Vorkommen
rere Jahre, mit meistens mehr als einem be- der Moderhinke in den Steinbockkolonien, wie
troffenen Tier pro Kolonie berichtet wurde Witterungsbedingungen (Temperatur und Nie-
(Tab. 2). derschlagsmengen) und Kontakte mit Rindern
und Schafen zeigten keinen Einfluss auf das
In Bezug auf Wechselwirkungen mit anderen Vorkommen der Krankheit bei den Steinbock-
Wild- und Hauswiederkäuern wurden in allen kolonien. Allerdings zeigte sich der Kontakt
Steinbockkolonien - ob mit oder ohne Moder- mit von der Moderhinke-befallenen Schafen als
hinke-Ausbrüchen - am meisten Kontakt mit ein Einflussfaktor für das Auftreten der Erkran-
Gämsen, gefolgt von Schafen und Rindern beo- kung in den Steinbockkolonien.
bachtet (Abb. 2).7
Tab. 2: Steinbockkolonien mit mehreren Ausbrüchen
(ABr). Ein Ausbruch wurde definiert als ein bis mehrere
Fälle in einer Kolonie innerhalb von 6 Monaten. Der Total
erkrankter Tiere entspricht der berichteten Spannweite
(min.-max) der Anzahl Fälle pro Ausbruch.
Kanton Name Anzahl Erstes bis Total er-
ABr letztem Jahr krankter
mit ABr Tiere
GR Julier 3 2011 - 2017 1 - 10
GR/TI Safien- 5 1996 - 2016 1 - 10
Rheinwald
BE Justistal 3 2010 - 2018 1 - 10
OW/B Hutstock 5 2006 - 2013 1
E/NW
SG/AI/ Alpstein 3 1996 - 2011 6 – 15
AR
VS Chablais 14 2004 - 2018 1–5
SG/GL Foostock 4 2004 - 2016 1-5
FR Vanil Noir 3 2014 - 2016 >20
Bimmis
Zusätzlich wurden die 8 Kolonien mit wieder-
kehrendem Auftreten (d.h. 3 oder mehr beo-
bachteten Ausbrüche) der Moderhinke mit Ko-
lonien mit nur seltenen Fällen (8 Kolonien mit
einem einzigen gemeldeten Ausbruch für die Abb. 2 Gemeldete Kontakte zwischen Alpen-
ganze Beobachtungsperiode) verglichen. Hier steinböcken und anderen Wiederkäuern in Kolo-
konnten aber keine Einflussfaktoren identifi- nien mit beobachteter Moderhinke (a) und Kolonien
ziert werden, die den Unterschied im Vorkom- ohne bekannte Moderhinke (b) in allen Alpenstein-
bockkolonien der Schweiz. Nwk = Neuweltkameli-
men der Erkrankung erklären konnten.
den. Die Zahlen auf der x-Achse geben die Prozent-
zahl der Kolonien mit gemeldeten Begegnungen
4.3 Abschätzung der lokalen Nachweishäu- zwischen Steinböcken und der jeweiligen Tierart.
figkeit von D. nodosus in ausgewählten
Steinbockkolonien 4.4 Zusammenstellung von Sektionsberich-
ten aus dem FIWI-Archiv
Von 142 erhaltenen Proben aus den zwei Fall-
kolonien waren nur zwei Tiere, eines aus jeder Von 1999 bis 2009 wurden beim FIWI keine
Kolonie, mit gutartigen bzw. bösartigen Moderhinke Fälle dokumentiert, während von
Stämme von D. nodosus infiziert. Bei beiden 2010 bis 2018 insgesamt 11 Steinböcke mit Mo-
Tieren handelte es sich um erwachsene männli- derhinke diagnostiziert wurden. Die meisten
che Steinböcke mit schweren Fussveränderun- Fälle (n=5) wurden 2015 geschickt und stamm-
gen. Weder in den Fallkolonien noch in den ten aus drei Kolonien, bei denen mehrere Tiere
Kontrollkolonien wurden gesunde Träger nach- betroffen waren (2-10 pro Kolonie). Alle an das
gewiesen. Es gab daher keine Unterschiede in FIWI übermittelten Fälle entsprachen Ausbrü-
Bezug auf die Nachweishäufigkeit von D. no- chen, die über die Umfrage gemeldet wurden.
dosus (Tab. 3). Bei allen Tieren handelte es sich um erwach-
sene männliche Tiere mit einem Durchschnitts-
alter von 8,6 Jahren (Alterspanne: 5-12 Jahren),
die aus fünf Kolonien stammten. Für vier Tiere
wurde eine Stammidentifizierung mittels mole-
kularbiologischer Untersuchung durchgeführt
(PCR), die die Beteiligung gutartiger Stämme
bei zwei Ausbrüchen (drei untersuchten Tiere)8
Tab. 3: Schätzung der lokalen Nachweishäufigkeit nationalen Häufigkeit des Erregers bei Wild-
von D. nodosus in ausgewählten Steinbockkolonien wiederkäuern übereinstimmt.
(Positiv = Bakterium nachgewiesen). Gutartig und bös- Bei Wildwiederkäuern im Allgemeinen gab es
artig beziehen sich auf die Art der identifizierten Bak- nur wenige scheinbar gesunde Individuen, die
terien. positiv auf D. nodosus getestet wurden, und
Moderhinke-typische Fussveränderungen wur-
Anzahl Positiv gut- Positiv bös-
Kolonie den nur bei zwei Steinböcken gemeldet. In bei-
Proben artig artig
den Fällen handelte es sich um zwei männliche
Fallkolonien adulte Tiere aus dem Kanton Graubünden, die
mit dem gutartigen bzw. bösartigem D. nodosus
0 1* infiziert waren.
Julier 62
(0.00%) (1.25%)
Hiermit konnten wir nochmals zeigen, dass
1* 0 beim Steinbock - anders als beim Schaf - gra-
SRM † 80
(1.60%) (0.00%) vierende, potentiell lebensbedrohliche Fussver-
1 1 änderungen mit der gutartigen Form von D. no-
Total 142
(0.70%) (0.70%) dosus in Verbindung stehen können.
Da es sich bei den beiden Alpensteinböcken mit
Kontrollkolonien
Moderhinke-typischen Fussveränderungen um
0 0 zwei männliche adulte Tiere handelte, sowie
Albris 75 alle Moderhinke positiven Steinböcke, die ans
(0.00%) (0.00%)
FIWI eingesandt wurden, könnten Verhaltens-
0 0
FR † † 69 unterschiede zwischen Böcken und Geissen ei-
(0.00%) (0.00%)
nen Einfluss auf die Erregerübertragung haben.
0 0 Zum Beispiel könnte das Bilden von Bockru-
Total 144
(0.00%) (0.00%) deln auf niedrig gelegenen Weiden während der
† Safien-Rheinwald-Mesocco (SRM) Sommermonate zur Suche nach besseren Fut-
† † Flüela-Rätikon (FR) tergelegenheiten - im Gegensatz zu den Stein-
*Mit Moderhinke-typischen Fussveränderungen. geissen und deren Kitze, die sich eher in abge-
legenen Gebieten aufhalten -, zu einer vermehr-
und virulenter Stämme bei einem Ausbruch (ein ten Begegnung von Weiden mit Nutztieren füh-
untersuchtes Tier) aufdeckten. ren und damit die Erregerübertragung begünsti-
gen.
Wie vermutet zeigen die erhobenen Daten, dass
die Moderhinke keine Bedrohung für die Er-
5. Schlussdiskussion haltung des Alpensteinbocks darstellt. Aller-
dings sind die erhaltenen Fallzahlen sicher un-
Bei dieser Studie handelte es sich um die erste terschätzt, da nicht alle kranken/toten Tiere ge-
schweizweite Erfassung des Vorkommens von funden werden können. Dazu kann nicht ausge-
D. nodosus bei einheimischen Wild- und Haus- schlossen werden, dass die Krankheit auf Kolo-
wiederkäuern. Aus unseren Ergebnissen ist es nie-Ebene von grösserer Bedeutung sein kann,
ersichtlich, dass das Vorkommen dieses Bakte- insbesondere, weil vor allem die für die Repro-
riums bei Wildtieren im gesamten Schweizer duktion wichtigen grösseren Böcke betroffen
Territorium selten erscheint, und dass die Mo- sind und die Grösse der Kolonien stark variiert.
derhinke bei den Schweizer Steinbockkolonien Allerdings lassen die Populationszahlen der
eine sporadisch auftretende Krankheit ist. Ob- Jagdstatistik keinen langandauernden negativen
wohl sie in zahlreichen Kolonien auftritt, Einfluss der Moderhinke-Ausbrüche auf die Po-
scheint sie meistens nur einzelne Tiere zu tref- pulationsdynamik der Kolonien erahnen. Einzig
fen. Eine Ausnahme besteht bei acht Kolonien, im Chablais könnte eine nähere Betrachtung der
in welchen Fälle immer wieder dokumentiert Situation sinnvoll sein, wo seit 2009 jährlich
wurden. Allerdings war Vorkommen von D. no- mindestens ein befallenes Tier beobachtet
dusus selbst auf lokaler Ebene bei ausgewählten wurde und die Zählungen seit 2011 auf einen
Steinbockkolonien in Graubünden (mit und Populationsrückgang hinweisen. Dabei spielen
ohne Auftreten der Moderhinke) auf wenige aber höchstwahrscheinlich auch weitere Fakto-
Einzeltiere beschränkt, was mit der niedrigen ren eine Rolle.9
Letztlich zeigte die Studie bei den Nutztieren, oder Populationseigenschaften (Populationsdy-
dass Schafe und Rinder die gutartige Form von namik, Genetik), eine Rolle beim Auftreten der
D. nodosus und Schafe die bösartige Form auf- Moderhinke beim Steinbock spielen könnten.
rechterhalten. Die Abwesenheit von Klauenver-
änderungen bei den aller meisten Tieren mit
nachgewiesenen D. nodosus zeigt, dass sie den
Erreger als gesunde Träger verbreiten können.
6. Schlussfolgerung
Durch die häufigen Wechselwirkungen zwi- Im Hinblick auf das kommende Moderhinke-
schen Wildwiederkäuern, Schafen und Rindern Bekämpfungsprogramm beim Schaf zeigen un-
auf Sömmerungsweiden und die hohe Anzahl sere Ergebnisse, dass die einheimischen Wild-
der positiven Nutztiere im Gegensatz zur nied- wiederkäuer D. nodosus in der Schweiz höchst-
rigen Anzahl positiver Wildwiederkäuer, kann wahrscheinlich nicht aufrechterhalten und so-
davon ausgegangen werden, dass Rinder und mit kein Risiko für neu sanierte Schafherden
Schafe als Hauptansteckungsquelle für emp- darstellen sollten. Wechselwirkungen mit Haus-
fängliche Wild- und Haustierpopulationen fun- wiederkäuern, insbesondere mit Schafen und
gieren. Letztlich weisen auch die Umfrage da- Rindern, sind vermutlich die Hauptanste-
rauf hin, dass das Auftreten von Schafen mit ckungsquelle für empfängliche Haus- und
Moderhinke in Steinbockkolonien ein Einfluss- Wildwiederkäuer. Allerdings scheinen Übertra-
faktor für das Auftreten von Moderhinke bei gungen auf den Steinbock verhältnismässig sel-
Steinböcken sein könnte. Es ist denkbar, dass ten zu sein, insbesondere in Anbetracht der
kranke Füsse mehr Bakterien beherbergen und Häufigkeit der Kontakte zwischen Wild- und
streuen als gesunde Füsse. Um eine zwischen- Hauswiederkäuern. Ausserdem weisen die Er-
artliche Übertragung zu beweisen, wären jedoch gebnisse der Studie darauf hin, dass die Moder-
ergänzende molekularbiologische Untersu- hinke auf Populationsebene keine nennens-
chungen notwendig. werte Bedeutung für den Steinbock hat. Es
Darüberhinaus deuten unsere Ergebnisse darauf kann jedoch kurzfristig auf Kolonie-Ebene
hin, dass sowohl der Alpensteinbock als auch anders sein.
alle anderen untersuchten Wildwiederkäuer In Bezug auf die Planung des bevorstehenden
höchstwahrscheinlich keine (Re-)Infektions- nationalen Bekämpfungsprogramms bei
quelle für Schafe darstellen, so dass Wildwie- Schafen scheint es keinen Grund dazu zu ge-
derkäuer bei dem anstehenden nationalen Be- ben, die Wildwiederkäuerpopulationen bei
kämpfungsprogramm nicht berücksichtigt wer- dessen Planung zuberücksichtigen.
den brauchen.
Ausserdem, obwohl sowohl die Verwendung
von Salzlecken als auch die Beobachtung von
Wechselwirkungen zwischen Wildwiederkäu-
ern und Nutztieren (Schafe und Rinder) häufig
gemeldet wurden, gab es eine überraschend
niedrige Anzahl von D. nodosus-positiven
Wildwiederkäuer, sowie nur ein scheinbar spo-
radisches Auftreten von Moderhinke-Fälle in
den Alpensteinbockkolonien.
Im Gegensatz zu anderen Studien, suggerieren
unsere Ergebnisse, dass Witterungsbedingun-
gen (Feuchte und Nässe) keinen nennenswerten
Einfluss auf das Auftreten von Moderhinke ha-
ben. Aufgrund des seltenen Auftretens der
Krankheit, selbst bei häufigen Wechselwirkun-
gen zwischen Wild- und Hauswiederkäuern,
lassen unsere Ergebnisse vermuten, dass andere
Faktoren, wie z.B. bereits vorhandene Fussver-
änderungen, verminderte Einzeltier- Kondition,
Ko-infektionen mit anderen Mikroorganismen10
7. Merkblätter und Artikel Moore-Jones G.; Ardüser F.; Dürr S.; Gobeli-
Brawand S.; Steiner A.; Zanolari P.; Ryser-
Degiorgis M-P; Epidemiological study of Di-
Ryser-Degiorgis M.-P, Moore-Jones G., J.
chelobacter nodosus in free-ranging Alpine
Wimmershoff, 2017. Moderhinke. FIWI-Merk-
ibex (Capra ibex ibex) and other potential hosts:
blatt, Mai 2017. (auch auf Französisch und Ita-
Identifying maintenance hosts and risk factors
lienisch)
for infection. GCB Symposium, Universität
Bern, 31.01.2019 (Poster)
Ryser-Degiorgis M.-P., Moore-Jones G. 2017.
Moderhinke – eine zu bekämpfende Tierkrank-
Moore-Jones G., Ryser-Degiorgis M.-P. Epi-
heit. Schweizer Jäger 6: 58-59.
demiologische Studie der Moderhinke in der
Schweiz. CAS-Kurs, Vetsuisse-Fakultät
Ryser-Degiorgis M.-P., Moore-Jones G. 2017.
Bern, Universität Bern, 29.03.2019 (Vortrag)
Zoppina – una malattia da combattere. Caccia e
Moore-Jones G., Epidemiologische Studie über
Pesca 4: 21-23.
Dichelobacter nodosus im freilebenden Alpen-
steinbock und ander potenzielle Wirte: Identifi-
zierung von Reservoir Spezies und Risikofakto-
8. Vorträge und Poster ren für eine Infektion. Mid-term Evaluation,
Vetsuisse-Fakultät
Moore-Jones G., Ryser-Degiorgis M.-P. Epi- Bern, Universität Bern, 18.04.2019 (Vortrag)
demiologische Studie der Moderhinke in der
Schweiz. CAS-Kurs, Vetsuisse-Fakultät Moore-Jones G.; Ardüser F.; Dürr S.; Gobeli-
Bern, Universität Bern, 26.03.2017 (Vortrag) Brawand S.; Steiner A.; Zanolari P.; Ryser-
Degiorgis M-P; Epidemiologische Studie über
Moore-Jones G., Ryser-Degiorgis M.-P. Un- die Moderhinke in der Schweiz. Moderhinke
tersuchung zur Moderhinke in der Schweiz. Tagung, Tierspital, Vetsuisse-Fakultät
Wildhüter-Versammlung, Jagdinspektorat, Bern, Universität Bern, 25.04.2019 (Vortrag)
Münsingen (BE), 07.04.2017 (Vortrag)
Moore-Jones G.; Ardüser F.; Dürr S.; Gobeli-
Moore-Jones G., Ryser-Degiorgis M.-P. Un- Brawand S.; Steiner A.; Zanolari P.; Ryser-
tersuchung zur Moderhinke in der Schweiz. Degiorgis M.-P.; Epidemiologische Studie über
Wildhüter-Rapport, Amt für Jagd und Fischerei, Dichelobacter nodosus im freilebenden Alpen-
Maienfeld (GR), 04.08.2017 (Vortrag) steinbock und ander potenzielle Wirte: Identifi-
zierung von Reservoir Spezies und Risikofakto-
Moore-Jones G., Ryser-Degiorgis M.-P. Un- ren für eine Infektion. Groupe d'Etude sur l'Eco-
tersuchung zur Moderhinke in der Schweiz. pathologie de la Faune Sauvage de Montagne
Wildhüter-Rapport, Centre de conservation de (GEEFSM), Aostatal, Italien 15.06.2019 (Vor-
la faune et de la nature St-Sulpice (VD), trag)
23.08.2017 (Vortrag)
Moore-Jones G.; Ardüser F.; Dürr S.; Gobeli-
Moore-Jones G., Ryser-Degiorgis M.-P. Die Brawand S.; Steiner A.; Zanolari P.; Ryser-
Moderhinke – eine tierschutzrelevante Krank- Degiorgis M.-P.; Epidemiologische Studie über
heit bei Wild- und Hauswiederkäuern. Nacht Dichelobacter nodosus im freilebenden Alpen-
der Forschung, Universität Bern, 16.09.2017 steinbock und ander potenzielle Wirte: Identifi-
(Poster) zierung von Reservoir Spezies und Risikofakto-
ren für eine Infektion. 7th Mountain Ungulate
Moore-Jones G.; Ardüser F.; Dürr S.; Gobeli- Conference (WMUC), Bozeman Montana,
Brawand S.; Steiner A.; Zanolari P.; Ryser- USA 10.- 13.09.2019 (Poster)
Degiorgis M-P; Epidemiological study of Di-
chelobacter nodosus in free-ranging Alpine Moore-Jones G.; Ardüser F.; Dürr S.; Gobeli-
ibex (Capra ibex ibex) and other potential hosts: Brawand S.; Steiner A.; Zanolari P.; Ryser-
Identifying maintenance hosts and risk factors Degiorgis M-P; Die Moderhinke – Epidemiolo-
for infection. EWDA conference, Larissa, Grie- gische Studie der Moderhinke beim freileben-
chenland, 28.08.2018 (Vortrag) den Steinbock und andere potenzielle Wirte:11
Identifizierung von Reservoir Spezies und Risi-
kofaktoren für eine Infektion. GCB Sympo-
sium, Universität Bern, 30.01.2020 (Poster)
9. Wissenschaftliche Publika-
tionen
Ardüser F.; Moore-Jones G.; Gobeli-Brawand
S.; Dürr S.; Steiner A.; Ryser-Degiorgi M-P;
Zanolari P.; Dichelobacter nodosus in sheep,
cattle, goats and South American camelids in
Switzerland—Assessing prevalence in potential
hosts in order to design tar-geted disease control
measures, Preventive Veterinary Medicine
(PVM), 6.05.2019
Moore-Jones G.; Ardüser F.; Dürr S.; Gobeli-
Brawand S.; Steiner A.; Zanolari P.; Ryser-De-
giorgis M-P; Identifying maintenance hosts for
infection with Dichelobacter nodosus in free-
ranging wild ruminants in Switzerland: a preva-
lence study, PlosOne, 09.01.2020
Moore-Jones G.; Dürr S.; Willisch C.; Ryser-
Degiorgis M-P; Occurrence of footrot in free-
ranging alpine ibex (Capra ibex ibex) colonies
in Switzerland, Journal of Wildlife Diseases,
(eingereicht)
10. Dank Dieser Bericht geht an:
• Alle kantonale Jagdverwaltungen
Wir danken ganz herzlich allen beteiligten Jagd-
verwaltungen, Wildhütern, Jägern und Jägerin- • BAFU, Sektion Wildtiere und Waldbio-
nen, Biologen und Tierärzten für die Teilnahme diversität
an dieser Studie. Ohne Sie wäre die erfolgreiche
Durchführung dieses Projektes nicht möglich
gewesen.
Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit
zwischen dem FIWI, der Wiederkäuerklinik (P.
Zanolari und F. Ardüser), dem Institut für Vete-
rinär-Bakteriologie (S. Gobeli) und dem Institut
für Veterinary Public Health der Universität
Bern (S. Dürr) durchgeführt.
Diese Arbeit wurde vom Bundesamt für Veteri-
närwesen sowie Beiträge von mehreren Jagd-
verwaltungen (FR, GR, NW, TI, SZ) und vom
Bundesamt für Umwelt finanziell unterstützt.Annexe 1:
Tab. 1: Résultats de l’étude sur l’occurrence de D. nodosus chez les animaux sauvages et domestiques. Positif
signifie que la bactérie a été mise en évidence. Bénin et malin font référence au type de bactéries identifié.
Espèces Nombres échantillons Positif bénin Positif malin
3 1
Bouquetin 589
(0.50%) (0.16%)
1 0
Chamois 410
(0.24%) (0.00%)
31 0
Cerf 408
(7.59%) (0.00%)
1 0
Chevreuil 409
(0.24%) (0.00%)
36 1
Total sauvages 1821*
(1.97%) (0.05%)
58 94
Mouton 690
(7.80%) (17.60%)
694 0
Bovin 849
(83.30%) (0.00%)
23 0
Chèvre 790
(2.30%) (0.00%)
13 3
CNM** 591
(0.90%) (0.20%)
788 97
Total domestiques 2920
(26.98%) (3.21%)
* Pour 5 animaux l'espèce n'été pas indiquée.
** Camélidés du Nouveau Monde
Tab. 2: Colonies de bouquetins avec plusieurs foyers de piétin (un foyer étant défini comme un à plusieurs cas
observés en l’espace de 6 mois). Le total des animaux atteints correspond à la gamme du nombre de cas mentionné
(min-max.) pour chaque foyer.
Canton Nom Nombre de fo- De la première à la der- Total des animaux
yers nière année avec des cas atteints
de piétin
GR Julier 3 2011 - 2017 1 - 10
GR/TI Safien-Rheinwald 5 1996 - 2016 1 - 10
BE Justistal 3 2010 - 2018 1 - 10
OW/BE/NW Hutstock 5 2006 - 2013 1
SG/AI/AR Alpstein 3 1996 - 2011 6 – 15
VS Chablais 14 2004 - 2018 1–5
SG/GL Foostock 4 2004 - 2016 1-5
FR Vanil Noir Bimmis 3 2014 - 2016 >20Tab. 3: Estimation de la fréquence locale de D. nodosus dans des colonies de bouquetins sélectionnées. Positif
signifie que la bactérie a été mise en évidence. Bénin et malin font référence au type de bactéries identifié.
Colonies Nombres échantillons Positif bénin Positif malin
Colonies cas
0 1*
Julier 62
(0.00%) (1.25%)
1* 0
SRM † 80
(1.60%) (0.00%)
1 1
Total 142
(0.70%) (0.70%)
Colonies témoins
0 0
Albris 75
(0.00%) (0.00%)
0 0
FR † † 69
(0.00%) (0.00%)
0 0
Total 144
(0.00%) (0.00%)
† Safien-Rheinwald-Mesocco (SRM); † † Flüela-Rätikon (FR)
* Avec des lésions aux onglons typiques du piétin.
Fig. 1 Occurrence du piétin dans les colonies suisses de bouquetins
Les zones vertes : Colonies sans piétin; zones jaunes : Colonies avec de rares foyers de piétin ; zones oranges
: Colonies avec des foyers récurrents de piétin.Fig. 3 Contacts signalés entre des bouquetins des Alpes et d'autres ruminants dans des colonies positives au piétin (observation de la maladie) (a), et des colonies négatives au piétin (pas d'observation de la maladie) (b), dans toutes les colonies de bouquetins en Suisse. CNM = Camélidés du Nouveau Monde. Les nombres à gauche correspondent au pourcentage de colonies où des interactions ont été signalées entre des bouquetins et les espèces indiquées au bas du graphique.
Appendice 2:
Tab. 1: Risultati dei ruminanti selvatici e domestici. Positivo significa che il batterio è stato rilevato. Benigni e
maligni indicano al tipo di batterio identificato.
Specie Numero campioni Ceppi positivi benigni Ceppi positivi maligni
3 1
Stambecco 589
(0.50%) (0.16%)
1 0
Camoscio 410
(0.24%) (0.00%)
31 0
Cervo 408
(7.59%) (0.00%)
1 0
Capriolo 409
(0.24%) (0.00%)
36 1
Totale selvatici 1821*
(1.97%) (0.05%)
58 94
Ovini 690
(7.80%) (17.60%)
694 0
Bovini 849
(83.30%) (0.00%)
23 0
Caprini 790
(2.30%) (0.00%)
13 3
CSA** 591
(0.90%) (0.20%)
788 97
Total domestici 2920
(26.98%) (3.21%)
* La specie non è stata specificata in cinque animali.
** Camelidi sudamericani
Tab. 2: Colonie di stambecchi con diversi focolai (un focolaio è definito come uno o più casi osservati nell'arco di
6 mesi).
Cantone Nome Numero di Dal primo all'ultimo anno Totale degli animali
focolai con focolai malati (per
focolaio)
GR Julier 3 2011 - 2017 1 - 10
GR/TI Safien-Rheinwald 5 1996 - 2016 1 - 10
BE Justistal 3 2010 - 2018 1 - 10
OW/BE/NW Hutstock 5 2006 - 2013 1
SG/AI/AR Alpstein 3 1996 - 2011 6 – 15
VS Chablais 14 2004 - 2018 1–5
SG/GL Foostock 4 2004 - 2016 1-5
FR Vanil Noir Bimmis 3 2014 - 2016 >20Tab. 3: Stima della frequenza locale di D. nodosus in colonie di stambecchi selezionate. Positivo significa
che il batterio è stato rilevato. Benigni e maligni indicano al tipo di batterio identificato.
Colonie Numero di campioni Ceppi positivi benigni Ceppi positivi maligni
Colonie caso
0 1*
Julier 62
(0.00%) (1.25%)
1* 0
SRM † 80
(1.60%) (0.00%)
1 1
Totale 142
(0.70%) (0.70%)
Colonie controllo
0 0
Albris 75
(0.00%) (0.00%)
0 0
FR † † 69
(0.00%) (0.00%)
0 0
Totale 144
(0.00%) (0.00%)
† Safien-Rheinwald-Mesocco (SRM); † † Flüela-Rätikon (FR)
*Con lesioni degli unghioni tipiche per la zoppina.
Fig. 1 Colonie svizzere di stambecchi e la zoppina
Aree verdi: colonie senza zoppina; aree gialle: colonie con zoppina (focolai rari); aree arancioni: colonie
con zoppina (focolai ricorrenti).a. Colonie positive alla zoppina
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Fig. 2 Colonie svizzere di stambecchi
Contatti segnalati tra stambecchi alpini e altri ruminanti nelle colonie di stambecchi positivi (osservazione
della malattia) (a), e nelle colonie di stambecchi negativi (nessuna osservazione della malattia) (b), in tutte le
colonie svizzere di stambecchi. CSA = Camelidi sudamericani. Le cifre sull'asse delle ascisse indicano la
percentuale di colonie in cui sono stati segnalati incontri tra stambecchi e le rispettive specie.Sie können auch lesen