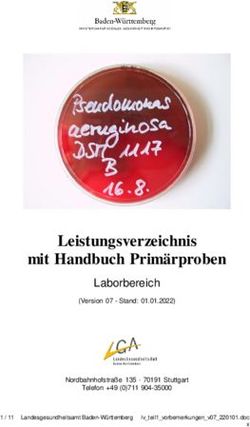Monitoring-Bericht zum Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg - Teil II Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Klimaschutz in Baden-Württemberg
Monitoring-Bericht zum
Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg
Teil II Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept
MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT 01Monitoring-Bericht zum
Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg
Teil II Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept
MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPTLiebe Leserinnen, liebe Leser, Die Treibhausgasemissionen sind im Vergleich zum Bezugsjahr 1990 um 14 Prozent bzw. 12 Mio. t
CO2-Äquivalente zurückgegangen. Allerdings hat sich auf Grund der kühlen Witterung, einem An-
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Um dem Klimawandel entge- stieg der Kohleverstromung sowie den nach wie vor steigenden Treibhausgasemissionen im Ver-
genzuwirken, sind zwei Aspekte von besonderer Bedeutung: An erster Stelle steht ein engagierter kehrsbereich die Situation im Vergleich zum Vorjahr etwas verschlechtert. Um das 2020-Ziel zu errei-
Klimaschutz, der dazu beiträgt, die Treibhausgase zu reduzieren. Gleichzeitig müssen wir uns auch an chen, müssen bis zum Jahr 2020 weitere 10 Mio. t CO2-Äquivalente eingespart werden. So wie es
die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels anpassen. aktuell aussieht, wird das Land, ebenso wie der Bund, dieses Zwischenziel voraussichtlich knapp be-
ziehungsweise stärker verfehlen. Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor ist dabei die Stilllegung des
In Baden-Württemberg ist diese Klimapolitik im Klimaschutzgesetz verankert. Der Landtag von Ba- Kernkraftwerks Philippsburg 2 Ende 2019 und die Frage, wie die bisher atomar erzeugte Strommenge
den-Württemberg hat dieses Gesetz im Jahr 2013 mit großer Mehrheit verabschiedet. Im Gesetz wer- ersetzt wird. In Hinblick auf das 2050-Ziel ist es daher umso wichtiger, dass zum einen das Land seine
den verbindliche Zielvorgaben für den Klimaschutz formuliert und gleichzeitig die Entwicklung einer ambitionierte Klimaschutzpolitik weiter verfolgt und zum anderen der Bund sowie die EU die ent-
Anpassungsstrategie festgeschrieben. Bis 2020 sollen die Treibhausgasemissionen im Land um 25 Pro- sprechenden Rahmenbedingungen schaffen.
zent gemindert werden; für 2050 wird eine Minderung um 90 Prozent angestrebt. Das Erreichen der
Klimaschutzziele soll kontinuierlich überprüft werden. Beginnend mit dem Jahr 2016 sieht das Klima- Ich danke allen beteiligten Ministerien und Fachbehörden für ihr engagiertes Mitwirken an diesem
schutzgesetz dafür alle drei Jahre eine ausführliche Berichterstattung vor. Die Landesregierung kommt Monitoring-Bericht. In den kommenden Jahren kommt es darauf an, die Anstrengungen zum Errei-
dieser Aufgabe in zwei Berichtsteilen nach: chen der Klimaschutzziele auf Bundes- und Landesebene zu erhöhen und die Fortschreibung des
IEKK gemeinsam mit allen Akteuren im Land voranzubringen.
› Monitoring-Bericht zum Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg – Teil I Klimafolgen und Anpassungen
› Monitoring-Bericht zum Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg – Teil II integriertes Energie- und
Klimaschutzkonzept
Der hier vorgelegte zweite Berichtsteil beschäftigt sich mit der Entwicklung der Treibhausgasemissio-
nen in Baden-Württemberg und der Umsetzung des 2014 von der Landesregierung beschlossenen
integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts (IEKK). Das IEKK enthält konkrete Umsetzungsstra- Franz Untersteller MdL
tegien zur Erreichung der Klimaschutzziele und unterlegt diese mit insgesamt 108 Maßnahmen. Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Mehr als 90 Prozent dieser Maßnahmen werden fortlaufend umgesetzt. des Landes Baden-Württemberg
MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPTBerichte der Ressorts zur Umsetzung
Zusammenfassung
S.08
der Maßnahmen des IEKK
S. 74
4.1 Überblick zum Stand der Umsetzung 75
4.2 Umsetzungsstand der Maßnahmen 79
4.3 Vorbildfunktion des Landes 115
4.4 Weitere laufende Maßnahmen 118
Einleitung
S. 14
Bewertung der Entwicklungen
S. 122
Entwicklung der energiewirtschaftlichen 5.1 Entwicklung der Treibhausgasemissionen 123
und energie- und klimapolitischen 5.2 Entwicklung der politischen Rahmenbedingungen
auf EU- und Bundesebene 126
Rahmenbedingungen
S. 16
Prüfung der Erreichung der
1.1 Internationaler Klimaschutz 17
1.2 Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene 17
Klimaschutzziele bis 2020
1.3 Rahmenbedingungen auf Bundesebene 20 S. 134
1.4 Rahmenbedingungen auf Landesebene 28
6.1 Methodisches Vorgehen 135
6.2 Ergebnisse 139
Entwicklung der Treibhausgasemissionen
in Baden-Württemberg Vorschläge zur
S. 32
Weiterentwicklung des IEKK
S. 152
2.1 Energiebedingte Treibhausgasemissionen 34
2.2 Nicht energiebedingte Treibhausgasemissionen 48
2.3 Zusammenfassung der Entwicklung der gesamten 7.1 Sektor Stromerzeugung 154
Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg 51 7.2 Sektor Verkehr 155
7.3 Sektor Private Haushalte 158
7.4 Sektoren Industrie und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 160
7.5 Sektor Land- und Forstwirtschaft 164
Überblick über die weiteren 7.6 Sektor Abfall- und Kreislaufwirtschaft, Abwasserwirtschaft 166
Ziele im IEKK
S. 52
Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis
S. 168 S. 169
3.1 Sichere Versorgung 53
3.2 Kostensicherheit 59
3.3 Regionale Wertschöpfung 63 Literaturverzeichnis Impressum
3.4 Bürgerengagement 66 S. 170 S. 175
3.5 Weitere Ziele des IEKK 72
06 MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT 07Mit dem 2013 verabschiedeten Gesetz zur Förde- ENTWICKLUNG DER TREIBHAUSGAS
rung des Klimaschutzes in Baden-Württemberg EMISSIONEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG
(KSG BW) strebt das Land eine Minderung der Bezogen auf das Referenzjahr 1990 konnte nach
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um ersten Schätzungen für das Jahr 2015 eine Reduk-
mindestens 25 % bis 2020 und um 90 % bis zum tion von 12,0 Mio. t CO2-Äquivalenten (14 %) in
Zusammenfassung Jahr 2050 an. Im Juli 2014 hat die Landesregie-
rung zur Umsetzung der Ziele aus dem KSG BW
Baden-Württemberg erreicht werden. Zur Ziel
erreichung von 25 % Emissionsminderung im Jahr
das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept 2020 ist eine weitere Reduktion des jährlichen
(IEKK) verabschiedet. Das Klimaschutzziel für Treibhausgasausstoßes in Höhe von 10,2 Mio. t
das Jahr 2020 wird im IEKK mit sektorspezifi CO 2-Äquivalenten bzw. 13 % gegenüber dem
schen Emissionsminderungszielen hinterlegt. Jahr 2015 erforderlich. Gegenüber dem Vorjahr
Gleichzeitig werden Strategien und Maßnahmen 2014 zeigt sich nach ersten Schätzungen ein An-
zur Zielerreichung aufgezeigt. Zudem werden stieg der Treibhausgasemissionen um 1,4 Mio. t
weitere übergeordnete energie- und klimapoli- auf 76,7 Mio. t CO2-Äquivalente im Jahr 2015,
tische Ziele der Landesregierung beschrieben. was einem Anstieg um 1,5 % entspricht. Damit
verschlechtern sich im Jahr 2015 die Aussichten
Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 KSG BW ist im Jahr 2016 auf die Zielerreichung im Jahr 2020 gegenüber
erstmals eine zusammenfassende Berichterstat- dem Vorjahr tendenziell. Im Verkehrssektor nah-
tung anzufertigen zu den Entwicklungen der men die Emissionen weiterhin zu, sodass sich
Treibhausgasemissionen im Land, der Entwick- hier eine deutliche Zielverfehlung abzeichnet. Im
lung der energiewirtschaftlichen und -politischen Stromsektor werden Effizienzsteigerungen in der
Rahmenbedingungen sowie dem Umsetzungs- Steinkohleverstromung emissionsseitig durch die
stand wichtiger Ziele und Maßnahmen einschließ erhöhte Stromerzeugung aus Steinkohle über-
lich Bewertung der Ergebnisse und Vorschläge kompensiert. Die kühlere Witterung im Vergleich
zur Weiterentwicklung. zum Jahr 2014 und das starke Wirtschaftswachs-
tum führen auch in den Sektoren Private Haus-
In Kapitel 1 erfolgt eine Beschreibung der ener- halte und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen zu
giewirtschaftlichen und energiepolitischen Rah- einer Zunahme der Emissionen.
menbedingungen. Im Anschluss wird in Kapitel
2 die Entwicklung der Treibhausgasemissionen ÜBERGEORDNETE ENERGIE- UND KLIMA
in Baden-Württemberg unter Berücksichtigung POLITISCHE ZIELSETZUNGEN DES LANDES
der Minderungswirkung des europaweiten Emis- Die Umsetzung des Ziels „Sichere Versorgung“ in
sionshandels dargestellt. In Kapitel 3 werden die Baden-Württemberg muss im Rahmen des deut-
weiteren übergeordneten energie- und klima schen und europäischen Stromversorgungssystems
politischen Ziele der Landesregierung, vor allem betrachtet werden. Auf Basis aktueller Studien
sichere Versorgung, Kostensicherheit, regionale besteht aller Voraussicht nach weiterhin kurz- bis
Wertschöpfung und Bürgerengagement, analy- mittelfristig keine Gefährdung der Versorgungs-
siert. In Kapitel 4 wird über den Umsetzungs- sicherheit. Die Inbetriebnahme der Steinkohle-
stand der Maßnahmen aus dem IEKK durch die kraftwerksblöcke in Mannheim und Karlsruhe hat
zuständigen Ministerien berichtet. Die Entwick- neben dem Ausbau dezentraler Kraft-Wärme-
lungen der Treibhausgasemissionen und der Rah- Kopplungsanlagen zu einem Zuwachs aktiv am
menbedingungen werden in Kapitel 5 bewertet. Strommarkt agierender konventioneller Leistun-
In Kapitel 6 erfolgt eine Prüfung der Erreichung gen in Baden-Württemberg geführt. Die Stromer-
der Ziele des Klimaschutzgesetzes und des IEKK. zeugung in Baden-Württemberg liegt derzeit über
Abschließend werden erste Vorschläge der Gut- dem Niveau von 1990. Jedoch müssen heute im
achterinnen und Gutachter zur Weiterentwick- Vergleich zu 1990 größere Strommengen impor-
lung des IEKK im Kapitel 7 dargestellt. tiert werden, da im Vergleich der Verbrauch einen
stärkeren Anstieg aufweist. Gleichzeitig ist erzeu-
gungsseitig der Anteil der Kernenergie rückläufig.
08 MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT 09Die Möglichkeiten des Landes zur Einflussnahme BEWERTUNG DER EUROPÄISCHEN UND entwicklung unter Berücksichtigung der bekann- CO2-Emissionen. Die Referenzentwicklung stellt
auf das Ziel „Kostensicherheit“ sind begrenzt. BUNDESWEITEN ENERGIE-UND KLIMA ten Rahmenbedingungen verlaufen kann und hauptsächlich die Wirkung von EU- und Bundes-
Die Entwicklung der aggregierten Letztverbrau- POLITISCHEN ENTWICKLUNGEN welches Aktivitätsniveau erforderlich ist, um die maßnahmen dar, die im Jahr 2014 bereits imple
cherausgaben zeigt, mit Ausnahme der Ausgaben Die energie- und klimapolitischen Entwicklun- Entwicklung in die gewünschte Richtung vor mentiert waren und deren Wirkung sich weiter
für Strom, dass die niedrigeren Rohstoffpreise in gen auf EU- und Bundesebene sind mitentschei- anzutreiben. fortsetzt. Zu diesen Maßnahmen zählen bspw.
den letzten Jahren zu geringeren Belastungen der dend für das Erreichen des Landesklimaziels im der europäische Emissionshandel (EU ETS), das
Endenergieverbraucher durch Energieausgaben Jahr 2020. Die Einigung in Paris, die Erderwär- Eine Betrachtung der einzelnen Komponenten, EEG 2014 oder die CO2-Standards für Pkw und
führen. Vergleicht man diese Ausgaben mit dem mung auf unter 2 Grad zu begrenzen, mit An- die den CO2-Ausstoß im Land beeinflussen, zeigt, leichte Nutzfahrzeuge. In der Referenzentwick-
Bruttoinlandsprodukt, fällt aus gesamtwirtschaft- strengungen, den globalen Temperaturanstieg auf dass die Verbesserung der Energieeffizienz und lung sind auch Änderungen der Rahmenbedin-
licher Sicht den Ausgaben für Strom mit unter 2,5 %, 1,5 °C zu halten, ist ein starkes Signal, das auf die Verringerung der CO2-Intensität der Energie- gungen, wie Bevölkerungs- und Wirtschaftsent-
entgegen der öffentlichen Wahrnehmung, ein ge- EU-, Bundes- und Landesebene nun entspre- erzeugung zu einer Reduktion der Treibhausgas wicklung, berücksichtigt.
ringeres Gewicht zu als den Ausgaben für Wär- chend umgesetzt werden muss. Am 14. Novem- emissionen im Vergleich zu 1990 geführt haben.
medienstleistungen. Zudem ist der Anteil der ber 2016 legte hierzu die Bundesregierung mit Diese Reduktion überkompensiert die zusätzli- Eine zusätzliche Minderung im Jahr 2020 gegen-
Stromausgaben am Bruttoinlandsprodukt gegen- dem Klimaschutzplan 2050 ein Strategiepapier chen Treibhausgasemissionen aufgrund des Wirt- über dem Jahr 2015 von 2,06 bis 2,57 Mio. t CO2-
über dem Niveau Anfang der neunziger Jahre für ein treibhausgasneutrales Deutschland im schafts- und Bevölkerungswachstums und führt Äquivalente kommt aus den Maßnahmen des
nicht gestiegen. Jahr 2050 vor, das Leitbilder für 2050, Meilenstei- somit insgesamt zu einer deutlichen Minderung Bundes im Aktionsprogramm Klimaschutz 2020
ne und sektorale Klimaziele für das Jahr 2030 der Treibhausgasemissionen 2015 gegenüber 1990. und im Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz,
Das Ziel „Regionale Wertschöpfung“ zeigt an- sowie strategische Maßnahmen enthält. Jedoch wird gleichwohl das Emissionsminde- d. h. aus den Maßnahmen, die der Bund ab 2015
hand der Beschäftigungswirkung in den energie- rungsziel des Klimaschutzgesetzes Baden-Würt- implementiert hat bzw. deren Implementierung
wenderelevanten Branchen in Baden-Württem- Trotz der ergriffenen Maßnahmen im Rahmen temberg von 25 % weniger Treibhausgasemissio- kurzfristig geplant bzw. bereits beschlossen ist.
berg, dass inzwischen jeder hundertste Arbeitsplatz des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 und des nen im Jahr 2020 gegenüber 1990 nach den Ergänzend wurde zu 17 Landesmaßnahmen im
in Baden-Württemberg direkt oder indirekt mit Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz wird auf Ergebnissen der Projektion voraussichtlich knapp IEKK eine Quantifizierung vorgenommen.
der Energiewende in Verbindung steht. Die Ent- Bundesebene vermutlich das Klimaziel 2020 ver- bzw. stärker verfehlt. Die Spannbreite dieses Min-
wicklung des Anteils der inländischen Primär fehlt. Zudem zeigt die Analyse der Rahmenbe- derungskorridors ergibt sich insbesondere durch
energiegewinnung zeigt eine steigende Tendenz dingungen auf EU- und Bundesebene auch eini- Unsicherheiten bezüglich der Stromerzeugung
auf, gleichzeitig konnten in den letzten Jahren ge Entwicklungen, die aus Landessicht besonders bzw. Strombedarfsdeckung beim Ersatz von Phi
Energieimporte reduziert werden. Auch die kom- aufmerksam zu beobachten sind, wie die zukünf- lippsburg 2. Das Klimaziel besagt, dass die Emis-
munalen Steuereinnahmen aus dem Betrieb von tige Wirkung des EU-Emissionshandelssystems sionen gegenüber 1990 bis 2020 um 25 % gemin-
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien zei- (EU ETS), die Ausgestaltung des Ausschreibungs- dert werden sollen und zwar von 88,7 Mio. t
gen eine steigende Tendenz auf. verfahrens für Stromerzeugung aus erneuerbaren CO2-Äquivalente pro Jahr auf 66,5 Mio. t CO2-
Energien, die Mittelausstattung sowie Inanspruch Äquivalente pro Jahr. Die Projektion der Emis-
Für das Ziel „Bürgerengagement“ lässt sich eine nahme der aufgestockten Fördermaßnahmen im sionen bis 2020 zeigt, dass bis zum Jahr 2020 ge-
positive Bilanz ziehen. So konnte die Zahl der Bereich Gebäudesanierung und Energieeffizienz, genüber dem Jahr 1990 ein Minderungskorridor
Energiegenossenschaften innerhalb von sechs der zukünftige Ausbau der KWK sowie die Bun- zwischen 68,6 und 72,5 Mio. t CO2-Äquivalente
Jahren verdoppelt werden (von 74 im Jahr 2010 desmaßnahmen im Verkehrssektor. erreicht werden kann, was einer Minderung um
auf 150 im Jahr 2016). Zudem wurden seit 2007 18,3 bis 22,7 % entspricht. Die Lücke zur Zieler-
mehr als 60 Stadtwerke im Land gegründet und ERREICHUNG DER KLIMASCHUTZZIELE reichung beträgt 2020 demnach 2,0 bis 5,9 Mio. t
es bestehen derzeit etwa 300 ehrenamtliche IN BADEN-WÜRTTEMBERG CO2-Äquivalente oder 2,3 bis 6,7 Prozentpunkte.
Energieinitiativen im Land. Die Landesregierung Für eine Einschätzung der Frage, ob die Klima-
unterstützt die gesellschaftliche Teilhabe an der schutzziele des Landes erreicht werden können, Die Referenzentwicklung im Jahr 2020 leistet ei- Diese wurden durch die Gutachterinnen und
Energiewende mit einem umfassenden Informa- haben die Gutachterinnen und Gutachter eine nen Minderungsbeitrag von 1,2 bis 4,64 Mio. t Gutachter im Wesentlichen nach Wichtigkeit,
tionsangebot. Das IEKK wurde auf Basis einer Projektion auf Basis plausibler Annahmen durch- CO2-Äquivalenten. Die Unsicherheit hierbei er- Datenverfügbarkeit und Sektor-Zuordnung aus-
umfassenden Bürger- und Öffentlichkeitsbetei- geführt. Bei der Interpretation der Ergebnisse der gibt sich vor allem im Sektor Stromerzeugung. gewählt. Die untersuchten Maßnahmen tragen
ligung (BEKO) mit Bürgerinnen und Bürgern vorgelegten Projektionen muss jedoch berück- Je nach Umstellung der Stromerzeugung infolge im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2015 mit einer
sowie Verbänden erarbeitet und auch die Fort- sichtigt werden, dass diese einer ganzen Reihe des Ersatzes von Philippsburg 2 auf verstärkte Treibhausgasvermeidung von etwa 0,9 Mio. t
schreibung des IEKK soll mit einer frühzeitigen von Unsicherheiten unterliegen, also keine abso- Stromimporte, den weiteren Ausbau der Kapazi- CO2-Äquivalente zur Zielerreichung bei. Jedoch
und umfassenden Bürger- und Öffentlichkeits- lute Genauigkeit darstellen können. Trotzdem lie- täten zur Erneuerbaren Stromerzeugung oder leisten auch die Landesmaßnahmen, deren Wir-
beteiligung umgesetzt werden. fern sie einen „best guess“, der Anhaltspunkte zusätzliche Erzeugung von Strom aus Kohlekraft- kung nicht abgeschätzt werden konnte bzw. die
darüber liefert, in welche Richtung die Emissions- werken ergibt sich die Spannbreite an eingesparten keine direkte Minderungswirkung entfalten, einen
10 MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT 11Auf übergeordneter Ebene wird von den Gutach- In den Bereichen Gewerbe, Handel, Dienstleis-
terinnen und Gutachtern vorgeschlagen, die Maß tungen und Industrie sollte laut den Empfehlun-
nahmen und Ziele operationalisierbarer auszu gen an die schon erfolgreich umgesetzten Maß-
formulieren. Inhaltlich sollte bei der Weiterent- nahmen angeknüpft werden. Flankierung der
wicklung stärker das energiesparende und klima Bundesmaßnahmen durch Beratung, Weiterbil-
freundliche Verhalten sowie einer nachhaltigen dung und Informationsweitergabe, tiefergehende
Lebensweise und Konsum adressiert werden. Vernetzungen, Wettbewerbe, die Förderung in-
novativer Technologien und die Identifizierung
Im Sektor Stromerzeugung sollte an den bisheri- von energie- und ressourcensparenden Quer-
gen Strategien (Flankierung und Ergänzung von schnitts- und Transformationstechnologien (z. B.
Bundesmaßnahmen, Interessenvertretung des Lan- Bioökonomie) tragen zu einer kontinuierlichen
des auf Bundesebene) festgehalten werden. Effizienzsteigerung sowie CO2-Reduktion bei.
Im Verkehrssektor gilt es, vor allem die bisheri- Das Land übernimmt eine Vorbildfunktion und
gen Maßnahmen im IEKK, die schnelle Einfüh- sollte die Maßnahmen für die Erreichung einer
rung und Durchsetzung der auf erneuerbarer klimaneutralen Landesverwaltung fortführen. Im
Energie beruhenden Elektromobilität unter Be- Bereich der Kommunen empfehlen die Gutach-
rücksichtigung der Strategie „Nachhaltige Mobili- terinnen und Gutachter, weiterhin die Bundes-
tät – für Alle“, konsequent umzusetzen. Der förderung zielgerichtet zu vermarkten. Es sollte
wesentlichen Beitrag zur Emissionsminderung, in- dingte Emissionen) wird das Minderungsziel vor- Güter- und Wirtschaftsverkehr sollte stärker ad- geprüft werden, wie die kommunale Wärmepla-
dem sie unter anderem sicherstellen, dass die Maß- aussichtlich erreicht oder gar übererfüllt. Im Sek- ressiert und auch hinsichtlich Verkehrsvermei- nung stärker vorangebracht werden kann. Das
nahmen des Bundes und auch andere Landesmaß- tor Abfall- und Kreislaufwirtschaft werden die dung und Elektrifizierung vorangetrieben werden. Förderprogramm für energieeffiziente Wärme-
nahmen ihre Wirkung in Baden-Württemberg Ziele voraussichtlich knapp erreicht oder nur Strategien und Maßnahmen zur Verkehrsvermei- netze sollte ausgebaut werden.
entfalten können. Sie flankieren das Bundesinstru- knapp verfehlt. Eine deutliche Verfehlung des dung und Verkehrsverlagerung im Personenver-
mentarium, schließen Lücken in diesem und si- Ziels wird es voraussichtlich in den Sektoren kehr sollten weiter ausgebaut und der ÖPNV Im Sektor Landwirtschaft wird empfohlen, die
chern Bundesmittel für Baden-Württemberg. Ge- Stromerzeugung, Verkehr und Land- und Forst- gestärkt werden. bisherigen Strategien des IEKK umzusetzen und
nannt seien an dieser Stelle die zahlreichen „weichen“ wirtschaft, Landnutzung geben. zu verstärken, speziell bei der Senkung des Stick-
Maßnahmen zur Beratung, Information und Ver- Im Sektor Private Haushalte, so die ersten Vor- stoffüberschusses sowie beim Thema Wirtschafts-
netzung, deren Bedeutung unbestritten, deren VORSCHLÄGE ZUR WEITERENTWICKLUNG schläge der Gutachterinnen und Gutachter, sollte dünger. Bei der Biomasse-, insbesondere der Holz
Minderungsbeitrag jedoch kaum quantifizierbar DES IEKK an der schon erfolgreich umgesetzten Flankie- nutzung sollte die Kaskadennutzung einen höheren
ist. Auch die Klimawirkung des Erneuerbare- Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 e) KSG BW sollen im rung der bestehenden Bundesmaßnahmen fest- Stellenwert bekommen.
Wärme-Gesetzes konnte für die Prüfung der Ziel Monitoring-Bericht auch Vorschläge zur Weiter- gehalten werden. Verstärkte Anreize sollten im
erreichung noch nicht berücksichtigt werden, da entwicklung des IEKK genannt werden. Auf Ba- Bereich der Solarthermie, Geothermie, beim Die Abfallvermeidung sollte, so die Gutachterin-
die umfassende Evaluierung gerade erst begon- sis der Untersuchungen im Monitoring-Bericht Austausch veralteter Elektrospeicherheizungen nen und Gutachter, ebenso wie das Recycling ein
nen hat. Des Weiteren konnte die Wirkung von über Verlauf und Wirksamkeit der IEKK-Maß- und bei der Unterstützung sehr ambitionierter größeres Gewicht im Sektor Abfall- und Kreis-
Infrastrukturvorhaben im Verkehrssektor, die nahmen wurden durch die Gutachterinnen und Wärmeschutzstandards erfolgen. Es gilt, Lock-in- laufwirtschaft bekommen. Die weitere Erhöhung
klimafreundliche Verkehrsm ittel stärken, im Gutachter erste mögliche Maßnahmen zur Wei- Effekte zu vermeiden und weitere „No regret“- der Energieeffizienz in Kläranlagen und die Fort-
Rahmen der Prüfung der Zielerreichung nicht terentwicklung des IEKK erarbeitet, die nach Maßnahmen zu adressieren, wie beispielsweise setzung der Erhöhung der energetischen Nut-
bestimmt werden, da eine Datengrundlage da- einer ersten Prüfung durch die Fachebenen der die Verringerung der Temperaturen in Fern- und zung von Bio- und Grünabfällen sind weitere
für fehlt. Insgesamt ist die Minderungswirkung Ministerien aufgeführt sind. Diese Vorschläge Nahwärmenetzen sowie der Vorlauftemperaturen Empfehlungen. Für ein besseres Monitoring ist
des IEKK für die Erreichung des Klimaziels des- werden gemeinsam mit den Ergebnissen des For- in Heizenergieverteilsystemen. Darüber hinaus eine getrennte Ausweisung der Emissionen aus der
halb wesentlich größer, als es aus dem abge- schungsvorhabens Energie– und Klimaschutz- sollten Transformationsthemen für die langfristige Abfall- und der Abwasserwirtschaft erforderlich.
schätzten und ausgewiesenen Minderungsbeitrag ziele 2030 in die Arbeiten für die Erstellung des gesellschaftliche Entwicklung wie das Konsum-
deutlich wird. künftigen IEKK einfließen und dabei erst einer verhalten oder die Bewusstseinsbildung für nach- Die Ergebnisse aus diesem Monitoring-Bericht
abschließenden Beurteilung zugeführt. Dabei haltige Ernährung stärker in den Fokus genom- bilden gemeinsam mit weiteren Untersuchungen
Die Zielerreichung in den einzelnen Sektoren werden auch weitere Untersuchungen vor dem men werden. die Grundlage für die Prüfung und Erarbeitung
sieht unterschiedlich aus: In den Sektoren Private Hintergrund der Entwicklungen auf Bundes- und des künftigen IEKK.
Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen europäischer Ebene berücksichtigt.
und Industrie (prozessbedingte und energiebe-
12 MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT 13Am 17. Juli 2013 hat der Landtag das „Gesetz zur Öko-Instituts e.V. hat die Stabsstelle Klima-
Förderung des Klimaschutzes in Baden-Würt- schutz des Ministeriums für Umwelt, Klima und
temberg“ (KSG BW) verabschiedet. Mit den in Energiewirtschaft den vorliegenden „Monitoring-
§ 4 Abs. 1 KSG BW festgesetzten Zielen, die Bericht zum Klimaschutzgesetz Baden-Württem-
Treibhausgasemissionen bis 2020 um 25 % und berg – Teil II Integriertes Energie- und Klima-
Einleitung bis 2050 um 90 % zu reduzieren, beabsichtigt
das Land, seinen Beitrag zu den internationalen,
schutzkonzept“ als ersten zusammenfassenden
Bericht nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 KSG BW zusam-
europäischen und nationalen Klimaschutzzielen mengestellt. Zur Berichterstattung nach § 9 Abs.
zu leisten. Maßgeblich für das Erreichen der Kli- 2 Nr. 2 c wird auf den „Monitoring-Bericht zum
maschutzziele ist eine nachhaltige Ausgestaltung Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg – Teil I
der Energieversorgung im Land. Klimafolgen und Anpassung“ verwiesen.
Um diese Zielsetzungen zu erreichen, hat die Zusätzlich zu den Inhalten der Monitoring-Kurz-
Landesregierung am 15. Juli 2014 ein Integriertes berichte enthält dieser Monitoring-Bericht eine
Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) ge- Projektion der Treibhausgasemissionen im Land
mäß § 6 Abs. 1 KSG BW beschlossen. Das über- bis 2020 und unverbindliche Vorschläge zur Wei-
geordnete Treibhausgasminderungsziel für das terentwicklung des IEKK.
Land wird im IEKK in Minderungsziele für die
verschiedenen Sektoren aufgeteilt und mit kon- Grundlage der Darstellungen ist die amtliche
kreten Maßnahmen unterlegt. Die Erarbeitung Datenlage bis zum Jahr 2015, soweit sie durch das
des IEKK war geprägt von einer breiten Bürger- Statistische Landesamt bis zum 31. März 2017
und Öffentlichkeitsbeteiligung (BEKO), aus der veröffentlicht wurde. Zusätzlich hat das ZSW
über 1.000 Empfehlungen und Hinweise zum eigene Schätzungen vorgenommen. Die Zuord-
IEKK-Entwurf hervorgingen. Die Mehrheit der nung der Treibhausgasemissionen erfolgt ent-
Empfehlungen fand Eingang in das finale IEKK. sprechend dem im Rahmen der internationalen
Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 KSG BW wurden im und nationalen Treibhausgasberichterstattung
März 2015 und April 2016 Monitoring-Kurzbe- üblichen Quellenprinzip. Wesentliche Aspekte
richte veröffentlicht. Auf Basis der Berichte nach einer verursacherbezogenen Betrachtung sowie
§ 11 Abs. 2 KSG BW und der fachlichen Daten- die Wirkungsbeiträge und Wechselwirkungen
analyse des Öko-Instituts e. V. und des Zentrums für durch Klimaschutzmaßnahmen des Bundes und
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden- der Europäischen Union werden gemäß § 9 Abs.
Württemberg (ZSW) sowie der Projektion des 2 Nr. 2 KSG BW im Bericht mitberücksichtigt.
14 MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT 151.1 Internationaler Klimaschutz
Auf der UN-Klimakonferenz (21st Conference of ziele diskutiert. Die nächste UN-Klimakonferenz
the Parties, COP 21), die vom 30. November bis (COP 23) findet 2017 unter der Präsidentschaft
12. Dezember 2015 in Paris stattfand, wurde ein von Fidschi in Bonn statt.
Entwicklung der energiewirt völkerrechtlich verbindliches Klimaabkommen
verabschiedet. Der Vertrag trat am 4. November Ein weiterer Meilenstein für den internationalen
schaftlichen und energie- und 2016 in Kraft. Bis dahin hatten 94 Staaten mit ei-
nem Emissionsanteil von 66 % das Abkommen
Klimaschutz war das Kigali-Abkommen vom Ok-
tober 2016. In der Erweiterung zum Montreal-Ab-
klimapolitischen Rahmenbedingungen ratifiziert. Als zentrales Vertragselement gilt, die
durchschnittliche Erderwärmung auf deutlich un-
kommen zum Schutz der Ozonschicht wurde
festgelegt, die Verwendung von besonders klima-
ter 2 Grad zu begrenzen, mit dem Bestreben, den schädlichen teilfluorierten Kohlenwasserstoffen
1.1 Internationaler Klimaschutz (17) • 1.2 Rahmenbedingun- globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu be- (FKW) weltweit drastisch zu reduzieren. Bis 2036
grenzen. Dazu soll in der zweiten Hälfte dieses sollen Industrieländer die Produktion und den Ver-
gen auf europäischer Ebene (17) • 1.3 Rahmenbedingungen Jahrhunderts ein Gleichgewicht aus Treibhausgas brauch von FKW um 85 % reduzieren, für Ent-
auf Bundesebene (20) • 1.4 Rahmenbedingungen auf emissionen auf der einen Seite und deren Abbau wicklungs- und Schwellenländer gelten differenzier-
auf der anderen Seite erreicht werden. Die im te Minderungen um 80 bis 85 % von 2024 bis 2047.
Landesebene (28)
Vorfeld der COP 21 von den Ländern eingereich- Baden-Württemberg bringt sich als klimaenga-
ten Reduktionsziele (Intended Nationally Deter- gierte Region in die internationalen Klimaschutz
mined Contributions, INDCs) sollen ausgehend anstrengungen ein. So wurde im Mai 2015 ge-
von 2018 alle fünf Jahre überprüft werden. Begin- meinsam mit Kalifornien und zehn weiteren
nend ab 2020 müssen die Staaten ebenfalls im Mitstreitern ein gemeinsames Memorandum of
fünfjährlichen Rhythmus die für die kommenden Understanding auf den Weg gebracht, in dem
fünf Jahre anvisierten Ziele bestätigen oder nach- sich die Unterzeichner unter anderem auf eine
bessern. Zur Überwachung wird ein sogenanntes Begrenzung des Kohlendioxidausstoßes auf un-
„compliance committee“ eingerichtet. In den ter 2 t pro Jahr und Einwohner verpflichten, um
kommenden Konferenzen sollen die getroffenen so den weltweiten Temperaturanstieg auf unter
Festlegungen konkretisiert und umgesetzt wer- zwei Grad zu halten. Dem deshalb so genannten
den. So wurde auf der UN-Klimakonferenz (COP „Under2 MOU“ sind zwischenzeitlich weltweit
22) im November 2016 in Marrakesch (Marokko) über 160 Unterzeichner aus 33 Ländern und sechs
die Vergleichbarkeit der nationalen Minderungs- Kontinenten beigetreten.
1.2 Rahmenbedingungen auf
europäischer Ebene
1.2.1 KLIMA- UND ENERGIERAHMEN 2030 Ziel nach einer Überprüfung im Jahr 2020 auf 30 %
Aufbauend auf dem bestehenden Rahmen der zu erhöhen. Nach dem sogenannten Governan-
2020-Zielsetzungen1 wurde im Oktober 2014 mit ce-Ansatz der Energieunion sollen bis 2019 von
den Beschlüssen des Europäischen Rats der euro- Seiten der EU-Mitgliedstaaten nationale Ener-
päische Klima- und Energierahmen 2030 festge- gie- und Klimapläne für den Zeitraum 2021 bis
legt. Die drei Hauptziele der EU-Mitgliedstaaten 2030 erstellt werden. Diese stellen die geplanten
bis 2030 sind die Minderung der Treibhausgas Maßnahmen und den voraussichtlichen Beitrag
emissionen um mindestens 40 % gegenüber 1990, zu den Zielen des Energie- und Klimarahmens
ein Anteil der erneuerbaren Energien von min- 2030 dar. In einem europäischen Monitoring wer-
destens 27 % am Bruttoendenergieverbrauch und den die nationalen Pläne überprüft. Falls das Ziel
ein indikatives Energieeffizienzziel von mindes- für den Anteil der erneuerbaren Energien nicht
tens 27 % (Steigerung gegenüber der Referenz- erreicht werden kann, soll ein Back-up-Instru-
entwicklung) – verbunden mit der Option, dieses ment einspringen.
1) V
erpflichtung der EU-Mitgliedstaaten bis 2020: Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 20 % gegenüber 1990, Steigerung
der Energieeffizienz um 20 % (gegenüber der Referenzentwicklung) und Anteil von 20 % erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch.
16 MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT 171.2.3 LASTENTEILUNGSENTSCHEIDUNG verabschieden. Die Aktionspläne sollen die nati- Anteil in ihrer nationalen Gesetzgebung weiter
(EFFORT SHARING DECISION) onalen Gesamtziele sowie die für 2020 vorgese- abzusenken. Für Biokraftstoffe, die nicht aus
Die „Effort Sharing Decision“ (Lastenteilungs- henen Anteile erneuerbarer Energien im Verkehrs-, Nahrungsmitteln stammen, gibt es ein nicht bin-
entscheidung) bezieht sich auf die Emissionen Elektrizitäts- sowie Wärme- und Kältesektor bein- dendes Ziel für 2020 von 0,5 %.
außerhalb des EU ETS, darunter Emissionen von halten. Darüber hinaus sollen die zur Zielerrei-
Gebäuden, Verkehr, Landwirtschaft und Abfall- chung zu ergreifenden Maßnahmen und Strategi- Außerdem sieht die europäische Gesetzgebung
wirtschaft. So besteht das EU-weite Minderungs- en festgehalten werden. vor, den CO2-Ausstoß neu zugelassener Perso-
ziel für den Zeitraum bis 2020 in einer Redukti- nenkraftwagen (Pkw) bis zum Jahr 2021 schritt-
on der Treibhausgasemissionen um 10 % bzw. bis Im Bereich Energieeffizienz gibt es weitere EU- weise zu verringern. Demnach darf der durch-
2030 um 30 % gegenüber 2005. Der Beitrag Richtlinien. Mit der EU-Energieeffizienz-Richt schnittliche Flottenausstoß eines Herstellers im
Deutschlands beläuft sich auf eine Reduktion linie (RL 2012/27/EU) wird das Ziel verfolgt, das Jahr 2015 130 g/km und im Jahr 2021 95 g/km
der Emissionen um 14 % im Jahr 2020 gegenüber Primärenergieeffizienzziel von 20 % bis zum Jahr nicht überschreiten. Für neu zugelassene leichte
2005. Zur Umsetzung des 2030-Ziels veröffent- 2020 zu erreichen. Zur Verbesserung der Energie- Nutzfahrzeuge beträgt der Grenzwert ab dem
lichte die europäische Kommission im Juli 2016 effizienz bis 2030 haben sich die Regierungschefs Jahr 2017 175 g/km und 147 g/km ab dem Jahr
einen Vorschlag für verbindliche Ziele für alle im Herbst 2014 auf ein indikatives Ziel von 27 % 2020. Derzeit wird die Fortschreibung der Nor-
EU-Staaten für den Zeitraum 2021 bis 2030. In Energieeinsparung bis 2030 im Vergleich zu ei- men für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge für den
1.2.2 EU-EMISSIONSHANDEL Abhängigkeit der Wirtschaftskraft ist eine Min- nem Referenzszenario verständigt. Die Gebäude Zeitraum nach 2020 erarbeitet.
Der EU-Emissionshandel (European Union Emis derung der Treibhausgasemissionen zwischen effizienz-Richtlinie (RL 2010/31 EU) unterstützt
sions Trading System, EU ETS) ist eines der zen- null und 40 % gegenüber 2005 von den Mitglied die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Ab September 2017 soll zeitgleich mit dem Test-
tralen Instrumente zur Reduktion der Treibhaus- staaten zu erbringen. Für Deutschland ist eine Gebäuden und regelt u. a. die Anwendung von verfahren im praktischen Fahrbetrieb (Real Dri-
gasemissionen in der Europäischen Union sowie Reduktion der nicht unter das ETS fallenden Mindestanforderungen an die Effizienz neuer so- ving Emission, RDE) für NOX ein neues Prüfver-
in den drei Mitgliedstaaten der europäischen Wirtschaftssektoren bis 2030 um 38 % gegenüber wie bestehender Gebäude. Demnach müssen ab fahren (WLTP, Worldwide Harmonized Light -Duty
Freihandelsassoziation (EFTA) Island, Liechten- 2005 vorgesehen. 2021 Neubauten den Niedrigstenergiegebäude Vehicles Test Procedure) für realitätsnähere Mes
stein und Norwegen. EU-weit werden annähernd standard einhalten. Mit der Ökodesign-Richtlinie sungen der CO2-Emissionen eingeführt werden.
50 % der Treibhausgasemissionen von dem Han- Darüber hinaus wurde von der Kommission ein (RL 2009/125/EG) wurde für energieverbrauchs Die CO2-Grenzwerte sind nach Änderung des
delssystem erfasst; in Baden-Württemberg sind Vorschlag zum Einbezug der Emissionen aus den relevante Produkte ein Anforderungsrahmen er- Prüfverfahrens anzupassen, um Minderungsvor-
es etwa 30 %. Im Jahr 2013 startete die dritte Sektoren Landnutzung, Landnutzungsänderung stellt, während mit der Energieverbrauchskenn- gaben einzuhalten.
Handelsperiode, die sich bis 2020 erstreckt. und Forstwirtschaft (LULUCF) erarbeitet. Dem- zeichnungs-Richtlinie (RL 2010/30/EU) ein Rahmen
nach sollen netto keine Emissionen in diesem zur Harmonisierung der Information der End- In der im Juli 2016 veröffentlichten europäischen
Aufgrund des anhaltend niedrigen Preisniveaus Bereich anfallen, bei Nettoemissionsabbau bei- verbraucher über den Energieverbrauch und An- Strategie für emissionsarme Mobilität zeigt die
entfaltet der Emissionshandel allerdings nicht spielsweise durch Aufforstung können diese in gaben zu energieverbrauchsrelevanten Produk- EU-Kommission Leitprinzipien für die zukünfti-
die erhoffte Lenkungswirkung. Kurzfristig wurde den anderen Sektoren angerechnet werden. Für ten gesetzt wurde. Ende November 2015 haben ge Entwicklung des Verkehrs auf. Dabei ist eine
daher die Versteigerung von 900 Mio. Zertifika- Deutschland sind bis zu 22,3 Mio. t CO2 anre- die EU-Energieministerinnen und -minister die stärkere Nutzung emissionsarmer Energieträger
ten im Zeitraum 2014 bis 2016 verschoben chenbar [1].* Reform der EU-Energieverbrauchskennzeich- durch Innovationsanreize und Schaffung gemein-
(backloading). Im Nachgang wurde entschieden, nung in erster Lesung verabschiedet. Ziel ist samer Standards wie beispielsweise von Lade
diese ab 2019 in die sogenannte Marktstabilitäts- 1.2.4 EU-RICHTLINIEN IN DEN BEREICHEN auch, zukünftig die Aussagekraft des Labels für steckverbindungen vorgesehen. Zudem werden
reserve (MSR) zu überführen. Langfristig soll ERNEUERBARE ENERGIEN UND ENERGIE die Verbraucherinnen und Verbraucher durch die im Strategiepapier die Fortschreibung von Emis-
die Einführung der Marktstabilitätsreserve den EFFIZIENZ Rückkehr zu klaren Effizienzklassen zu erhalten. sionsnormen von Pkw und leichten Nutzfahr-
bestehenden Überschuss verringern, umgekehrt Die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien zeugen für den Zeitraum nach 2020 sowie die
greift das Instrument auch, wenn die Nachfrage (2009/28/EG) schreibt neben der Festlegung von 1.2.5 EU-RICHTLINIEN IM BEREICH VERKEHR Überwachung der Emissionen von Lkw und Bussen
steigt und zu wenige Zertifikate im Umlauf sind. Zielen für den Ausbau der erneuerbaren Energien Die EU hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil an forciert. Weitere Themen sind Maßnahmen zu
Außerdem ist geplant, mit Beginn der neuen u. a. Regeln für statistische Transfers, gemeinsame Kraftstoffen, die aus erneuerbaren Energiequellen einem effizienteren Verkehrssystem (Digitalisie-
Handelsperiode im Jahr 2021 die Zahl der han- Projekte, Herkunftsnachweise und die Nachhal- stammen, bis 2020 auf 10 % zu erhöhen. Mit der rung, Verbesserung des Erhebungssystems von
delbaren Zertifikate um jährlich 2,2 % statt wie tigkeit von Biokraftstoffen und flüssigen Bio Richtlinie 2015/1513/EU vom 13. Juli 2015 wird Mautgebühren) und global das CO2-neutrale
bisher 1,74 % abzusenken. Damit wird die Menge energiebrennstoffen vor. der Anteil von Biokraftstoffen, die aus Nahrungs- Wachstum des internationalen Luftverkehrs und
der ausgegebenen Zertifikate an das 2030-Ziel mittelpflanzen stammen, auf 7 % begrenzt2. Die die Minderung der Emissionen aus dem interna-
angeglichen, wonach die vom EU-Emissionshan- Zur Umsetzung der Ziele sind die Mitgliedstaa- Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, diesen tionalen Seeverkehr.
delssystem erfassten Sektoren ihre Emissionen bis ten nach Artikel 4 dazu verpflichtet, einen Nati-
2030 gegenüber 2005 um 43 % verringern müssen. onalen Aktionsplan für erneuerbare Energie zu 2) D
ie wachsende Verwendung von Biokraftstoffen der sogenannten ersten Generation aus Raps, Soja, Mais oder Palmöl führt in manchen
Ländern zu einer Konkurrenz zum Nahrungsmittelanbau oder zur Abholzung von Regenwäldern mit negativen Folgen für die Ökosysteme
und das Klima.
* Die Zahlen in den eckigen Klammern beziehen sich auf die entsprechenden Quellen im Literaturverzeichnis ab S. 168
18 MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT 191.3 Rahmenbedingungen auf Bundesebene Zentrale politische Maßnahmen sind der „Natio- Heizungen. Die Maßnahmen sollen durch umfas-
nale Aktionsplan Energieeffizienz“ (NAPE, vgl. sende Qualitäts-, Beratungs- und Bildungsoffen-
1.3.1 ZIELE DES ENERGIEKONZEPTS UND stromverbrauchs sowie des Wärmebedarfs. Die Kapitel 1.3.3) und die Strategie „Klimafreundli- siven begleitet werden.
DER ENERGIEWENDE Erreichung der Effizienzziele stellt eine wesentli- ches Bauen und Wohnen“. Mit den Maßnahmen
Die Energiewende in Deutschland wurde mit che Voraussetzung dar, um die gesetzten Ziele des Aktionsprogramms Klimaschutz und des 1.3.4 KLIMASCHUTZPLAN 2050 DER
dem Energiekonzept vom September 2010 und zur Erhöhung der Anteile erneuerbaren Energien NAPE sollen Einsparungen in Höhe von zusätz- BUNDESREGIERUNG
den Kabinettsbeschlüssen vom 6. Juni 2011 be- überhaupt zu realisieren. Langfristig besteht das lich 62 bis 78 Mio. t CO2-Äquivalenten im Jahr Bereits im Koalitionsvertrag für die 18. Legisla-
schlossen. Kern der Energiewende ist der Aus- im Rahmen des Energiekonzepts vom September 2020 erzielt werden. Unter Berücksichtigung des turperiode im Jahr 2013 wurde vereinbart, einen
stieg aus der Kernenergienutzung bis zum Jahr 2010 festgelegte Ziel eines nahezu klimaneutralen aktuellen Umsetzungsstandes liegt die Minde- Klimaschutzplan basierend auf den Ergebnissen
2022 sowie die Reduktion der Treibhausgasemis- Gebäudebestands. Dies setzt voraus, dass Gebäu- rungswirkung des Aktionsprogramms zwischen der UN-Klimakonferenz in Paris und den EU-
sionen um 40 % bis zum Jahr 2020, 55 % bis 2030 de einen sehr geringen Wärmebedarf aufweisen 44 und 56 Mio. t CO2-Äquivalenten bis 2020 [3]. Zielsetzungen vorzulegen. Teil der Entwicklung
und 80 bis 95 % bis 2050 gegenüber dem Jahr und der Restwärmebedarf durch erneuerbare des Klimaschutzplans war ein Dialogprozess zu
1990. Weitere Ziele bestehen im Hinblick auf den Energien gedeckt wird, wobei die jeweilige Ge- 1.3.3 NATIONALER AKTIONSPLAN Maßnahmenvorschlägen unter Beteiligung von
Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) und der wichtung offenbleibt. Im Wärmebereich soll gemäß ENERGIEEFFIZIENZ (NAPE) Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden, Kommu-
Steigerung der Energieeffizienz. Eine Übersicht Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) Mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizi- nen und Bundesländern. Mit dem Kabinettsbe-
der quantitativen Zielsetzungen auf Bundesebe- der Anteil der erneuerbaren Energien auf 14 % enz (NAPE) hat die Bundesregierung am 3. De- schluss vom 14. November 2016 wurde der Kli-
ne ist in Tabelle 1 dargestellt. bis zum Jahr 2020 erhöht werden. zember 2014 ihre Effizienzstrategie für die laufen- maschutzplan 2050 verabschiedet. Der Klimaschutz-
de Legislaturperiode vorgelegt. Die Eckpfeiler plan orientiert sich am Ziel einer weitgehenden
Im Einzelnen soll der Anteil der erneuerbaren 1.3.2 AKTIONSPROGRAMM KLIMASCHUTZ des NAPE bilden die drei Handlungsbereiche Treibhausgasneutralität bis 2050 und zeigt zentra-
Energien am Bruttoendenergieverbrauch bis 2020 2020 Energieeffizienz im Gebäudebereich, Energieeffi- le Weichenstellungen und notwendige strategi-
auf 18 % erhöht werden. Weiterhin sieht das Er- Zur Unterstützung der Reduktion der Treibhaus- zienz als Rendite- und Geschäftsmodell sowie die sche Maßnahmen auf. Für das Jahr 2030 wird das
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2017 eine Stei- gasemissionen bis 2020 um 40 % gegenüber 1990 Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit für Ener- Ziel, eine Minderung der Treibhausgasemissio-
gerung des Anteils der erneuerbaren Energien am wurde von der Bundesregierung am 3. Dezember gieeffizienz. nen um 55 % gegenüber 1990 zu erreichen, mit
Bruttostromverbrauch auf 40 bis 45 % bis zum 2014 das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 Sektorzielen hinterlegt (siehe Tabelle 2). Dabei
Jahr 2025 sowie 55 bis 60 % bis zum Jahr 2035 vor3. (APK 2020) vorgelegt. Im Zuge dieses Programms Mit den im NAPE festgelegten Maßnahmen sol- muss etwa die Hälfte der Gesamteinsparung die
hat die Bundesregierung zusätzliche Maßnahmen len im Jahr 2020 zusätzlich 25 bis 30 Mio. t/a Energiewirtschaft leisten. Maßnahmen des Kli-
Parallel zu den EE-Zielen bestehen ambitionierte beschlossen, um in der Kurzfristperspektive das Treibhausgasemissionen vermieden werden. maschutzplans in diesem Bereich zielen u. a. auf
Ziele zur Reduktion des Primärenergie- und Brutto 2020-Ziel zu erreichen. die Unterstützung des Strukturwandels in den
Zur Unterstützung der Investitionen in Energie- betroffenen Regionen (Kommission „Wachstum,
effizienz wird die öffentliche Förderung für Effizi- Strukturwandel und Regionalentwicklung“) und
2020 2030 2040 2050 enzmaßnahmen ausgebaut und verstetigt. Dazu die Stärkung des ETS ab. Im Gebäude und Ver-
Treibhausgasemissionen min. -40 % mind. -55 % mind. -70 % 80 bis 95 % zählt die Aufstockung der Gebäudesanierungs- kehrsbereich ist jeweils eine Minderung von 39
(gegenüber 1990)
programme um 200 Mio. Euro auf 2 Mrd. Euro bis 41 % gegenüber 2014 vorgesehen. Maßnahmen
Anteil erneuerbarer Energien pro Jahr (ab 2015), die Einführung der steuerli- im Gebäudebereich betreffen Neubaustandards
Bruttoendenergieverbrauch 18 % 30 % 45 % 60 % chen Förderung mit einem Volumen von 1 Mrd. und Anreize für den Einsatz von erneuerbaren
Bruttostromverbrauch mind. 35 % mind. 50 % mind. 65 % mind. 80 % Euro pro Jahr (2015 bis 2019) sowie die Schaffung Energien beim Heizungstausch. Außerdem wird
2025: 40-45 % (EEG 2017), 2035: 55-60 % (EEG 2017) eines Fördervolumens von jährlich 150 Mio. Euro eine anteilige Nutzungspflicht bei Sanierung ent-
Senkung Energieverbrauch (gegenüber 2008) (ab 2018) für das neue Ausschreibungsmodell mit sprechend des EEWärmeG im Neubau geprüft.
Primärenergieverbrauch -20 % -50 % dem Schwerpunkt Stromeffizienz.
Wärmebedarf Gebäude 1
-20 % -80 % Im Verkehr soll durch die Umsetzung noch zu ent-
Endenergieverbrauch Verkehr -10 % -40 % Die steuerliche Absetzbarkeit von Sanierungen wickelnder Maßnahmen im Straßen- und Schie
(gegenüber 2005) wird bis auf Weiteres nicht eingeführt. Stattdes- nenverkehr sowie die Förderung von Elektromo-
Bruttostromverbrauch -20 % -25 % sen sollen Emissionen über ein neu eingeführtes bilität und des Radverkehrs die Minderung erreicht
Endenergieproduktivität 2,1 %/a Förderprogramm „Anreizprogramm Energieeffizi- werden. Geprüft wird zudem die aufkommens-
enz“ mit einem Umfang von 165 Mio. Euro pro neutrale Weiterentwicklung der bestehenden
Tabelle 1: Zielsetzungen der Energiewende in Deutschland
1) Im Jahr 2020 ist eine Reduktion der Endenergie vorgesehen, 2050 bezieht sich das Ziel auf die nicht erneuerbare Primärenergie.
Jahr eingespart werden. Gefördert wird zum Bei- Abgaben und Umlagen zugunsten treibhausgasar-
spiel die Markteinführung von Brennstoffzel- mer Verkehrsmittel.
len-Heizungen oder der Austausch ineffizienter
3) Im Jahr 2015 betrug der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bereits 31,6 % in Deutschland [2].
20 MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT 21In der Industrie werden insbesondere die pro- 1.3.5 STROMMARKTDESIGN 1.3.6 ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ zung von Acker- und Grünlandflächen in, im land
zessbedingten Emissionen und die Nutzung von Das Anfang Juli 2016 verabschiedete Gesetz zur (EEG) wirtschaftlichen Kontext, benachteiligten Gebieten
Abwärmepotenzialen adressiert. In der Landwirt- Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarkt Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat zum zuzulassen. Um die Akteursvielfalt zu wahren,
schaft zielen wesentliche Maßnahmen auf die Re- gesetz) sieht eine Weiterentwicklung des beste- Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien an wurden u. a. für Windenergie an Land Sonderre-
duzierung der Lachgasemissionen aus Überdün- henden Energy-only-Marktes – abgesichert durch der Stromversorgung stetig, kosteneffizient und gelungen für Bürgerenergieprojekte geschaffen.
gung, die Ausweitung des Ökolandbaus und eine verschiedene Reserven – vor. Im Wesentlichen netzverträglich auf 40 bis 45 % im Jahr 2025, 55
Reduktion der Emissionen aus der Tierhaltung sollen bestehende Marktmechanismen und eine bis 60 % im Jahr 2035 und mindestens 80 % im 1.3.7 KRAFT-WÄRME-KOPPLUNGSGESETZ
ab. Auf EU-Ebene setzt sich die Bundesregierung freie Preisbildung zur Refinanzierung von Kapa- Jahr 2050 zu erhöhen. Hierzu regelt das EEG den (KWKG)
zudem für die Orientierung der Agrarsubventio- zitäten gestärkt werden. Anschluss der Anlagen an das Stromnetz sowie die Das Gesetz zur Neuregelung des Kraft-Wärme-
nen an den klimapolitischen Beschlüssen ein. Abnahme und Vergütung des eingespeisten Stroms. Kopplungsgesetzes (KWKG) wurde am 3. De-
Die Emissionen aus der Landnutzung und Forst- Versorgungssicherheit und Systemstabilität wer- zember 2015 verabschiedet und ist am 1. Januar
wirtschaft sind nicht Teil des Zieltableaus, wer- den durch die Netzreserve und den Aufbau einer Mit dem EEG 2017 wurde die bereits im EEG 2016 in Kraft getreten. Die beihilferechtliche No-
den aber mit Maßnahmen im Bereich der nach- Kapazitätsreserve und Sicherheitsbereitschaft au- 2014 vorgesehene Umstellung der Förderung auf tifizierung durch die Europäische Kommission
haltigen Waldbewirtschaftung und des Erhalts ßerhalb des Strommarktes gewährleistet. Klima- wettbewerbliche Ausschreibungen umgesetzt. Da- erfolgte Ende 2016. Das KWKG regelt die Ab-
von Wäldern und Dauergrünland sowie des Schut relevant ist insbesondere die Sicherheitsbereit- bei folgt die Novelle drei Leitgedanken: einem nahme und Vergütung von KWK-Strom und ge-
zes von Mooren in den Klimaschutzplan einbezo- schaft: Von Oktober 2016 bis ins Jahr 2019 werden kosteneffizienten weiteren EE-Ausbau, der Wah- währt Zuschüsse für Wärme- und Kältenetze
gen. Sektorübergreifend soll das Steuer- und Ab- schrittweise fünf Braunkohlekraftwerke mit einer rung der Akteursvielfalt sowie der Einhaltung des bzw. Wärme- und Kältespeicher. In den letzten
gabensystem klimafreundlicher ausgerichtet und Kapazität von 2,7 GW (13 % der gesamten Braun- Ausbaukorridors für erneuerbare Energien. Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für
umweltschädliche Subventionen abgebaut werden. kohlekapazitäten) für vier Jahre vorläufig stillge- neue und bestehende KWK-Anlagen deutlich
legt. Im Anschluss sind die Kraftwerke endgültig Ab dem Jahr 2017 wird die Förderung für Wind geändert.
Ein konkretes Maßnahmenprogramm (samt quan stillzulegen. Neben der Absicherung von vorher- energieanlagen an Land, Windenergieanlagen auf
tifizierter Minderungswirkung der Maßnahmen) sehbaren Extremsituationen kann so der Treib- See, Biomasseanlagen sowie Photovoltaikanlagen Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von
folgt im Jahr 2018. Eine regelmäßige Überprüfung hausgasausstoß um voraussichtlich 12,5 Mio. t im Rahmen von Ausschreibungen ermittelt. Für KWK-Anlagen hat insbesondere die Entwick-
und Fortschreibung des Klimaschutzplans ist im CO2 reduziert werden. Eine Überprüfung der Photovoltaik-Freiflächenanlagen fanden bereits lung der Strompreise. Hierbei ist zu unterschei-
fünfjährigen Rhythmus vorgesehen. tatsächlichen Emissionsminderung ist für das Jahr seit April 2015 Pilotausschreibungen statt. Zur den zwischen sinkenden Börsenstrompreisen und
2018 vorgesehen. Sollte sich abzeichnen, dass die Teilnahme an den Ausschreibungen sind Anlagen steigenden Endkundenpreisen, wozu nicht zu-
angestrebte Minderung von 12,5 Mio. t CO2 bis mit mehr als 750 kW (bzw. 150 kW bei Biomasse) letzt die EEG-Umlage, aber auch weitere Umla-
2020 nicht erreicht wird, müssen die Kraftwerks- verpflichtet. Für die übrigen Anlagen erfolgt die gen und die Stromsteuer beigetragen haben. Die
betreiber geeignete zusätzliche Maßnahmen vor- Förderung weiterhin über die gesetzlich festge- Anreize für die Errichtung von KWK-Anlagen
schlagen. legten Vergütungen. zur Eigenversorgung sind folglich in den vergan-
genen drei Jahren erheblich angestiegen. Diese
Zur Begrenzung der Redispatch-Kosten (Kosten Entwicklung wurde allerdings durch die anteilige
Handlungsfeld 1990 2014 Klimaschutzplan im Jahr 2030 durch die kurzfristige Änderung des Kraftwerk Pflicht zur Entrichtung der EEG-Umlage auch für
(Mio. t (Mio. t
Mio. t CO2-Äq. Minderung Minderung einsatzes zur Vermeidung von Netzengpässen) eigenverbrauchten Strom mit der EEG-Novelle
CO2-Äq.) CO2-Äq.)
ggü. 1990 in % ggü. 2014 in %
wird die Zubaumenge für Windenergieanlagen 2014 gebremst (vgl. 1.3.4).
Energiewirtschaft 466 358 175–183 61–62 49–51
an Land in Gebieten mit Netzengpässen be-
Gebäude 209 119 70–72 66–67 39–41
grenzt, der Offshore-Zubau gezielt gesteuert so- Das in den vergangenen Jahren deutlich gesunke-
Verkehr 163 160 95–98 40–42 39–41
wie ein Instrument zur Nutzung von Strom im ne Preisniveau der Börsenstrompreise führte und
Industrie 283 181 140–143 49–51 21–23 Wärmebereich als zuschaltbare Last eingeführt. führt dazu, dass sich die Erlössituation für KWK-
Landwirtschaft 88 72 58–61 31–34 15–19 Weiterhin wird im Sinne der Kosteneffizienz das Anlagen zur Einspeisung deutlich verschlechtert
Übrige 39 12 5 87 58 zentrale Zielmodell für Wind auf See eingeführt, hat. Dies betrifft nicht nur die Anreize zum Bau
Gesamt 1248 902 543–562 55–56 38–40 wobei der Staat Flächen voruntersucht, sodass neuer KWK-Anlagen, sondern auch den Betrieb
keine eventuell unnötigen Netzanbindungen ge- von Bestandsanlagen. Das gesunkene Erlös- und
Tabelle 2: Sektorziele im Jahr 2030 des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung
baut werden. Außerdem wird für Windenergie- Deckungsbeitragsniveau führte bereits zur Stillle-
anlagen an Land ein einstufiges Referenzertrags gung von Bestandsanlagen. Um die weitere Still-
modell4 eingeführt und für Photovoltaik-Frei- legung von Bestandsanlagen zu verhindern, ge-
flächenanlagen eine Länderöffnungsklausel einge- währt die KWKG-Novelle daher eine bis 2019
führt, die den Bundesländern erlaubt, die Nut- befristete Förderung für bestehende gasbefeuerte
4) D
as Referenzertragsmodell ist Bestandteil des EEGs und gleicht die Ertragsmöglichkeiten von Windkraftanlagen an Standorten mit
unterschiedlicher Windgeschwindigkeit durch eine Differenzierung der Vergütung an. Dadurch sollen vergleichbare Wettbewerbsbedin-
gungen an unterschiedlichen Standorten und damit ein deutschlandweit ausgeglichener Ausbau der Windkraft gewährleistet werden.
22 MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT MONITORING-BERICHT ZUM KLIMASCHUTZGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG – TEIL II INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT 23Sie können auch lesen