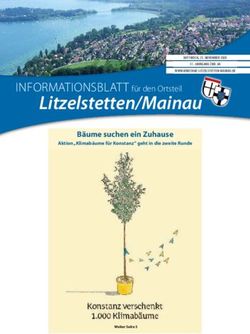ORT UND PROZESS ONLINE-TAGUNG: Uni Bamberg
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ONLINE-TAGUNG: ORT UND PROZESS VERHANDLUNGEN VON ERBE VOM URBANEN BIS ZUM LÄNDLICHEN RAUM 26./27.11.2020 Veranstaltet vom Arbeitsbereich Denkmalpflege des Kompetenzzentrums für Denkmal- wissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT) in Kooperation mit dem Referat “Bürgerbeteiligung und städtebauliches Erbe” des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD)
„Urban Heritage“ umfasst die materiellen Über- REGISTRIERUNG
lieferungen und immateriellen Zuschreibungen Eine Registrierung zur Tagung ist erforderlich. Die
in einem Siedlungsraum und konstituiert sich in Zugangsdaten zur Tagung erhalten Sie automatisch
Bewertungs-, Aushandlungs- und Selektionsprozes- nach der Registrierung unter:
sen immer wieder neu. Diese „Erbe-Verhandlungen“ https://uni-bamberg.zoom.us/webinar/register/
sind eng mit Entwicklungs- und Planungsprozessen WN_EJ7U4_bzTDe0TRUvjPxxbA
verbunden. Akteure aus Politik, Verwaltung, der
Denkmalpflege, aus Bürgerschaft und Betroffenen-
INFOS
kreisen, Interessensgruppen, Institutionen und
Infos zur Tagung sind zugänglich unter:
Wirtschaft diskutieren und bestimmen, wie mit
dem Baubestand umgegangen wird. Welche Werte https://www.uni-bamberg.de/kdwt/arbeits
werden historischen Baustrukturen zugeschrieben bereiche/denkmalpflege/tagung-ort-und-prozess/
und in welchen Formen sollen diese weiterhin zur
Verfügung stehen? POSTERPRÄSENTATION
Die Poster der Postepräsentation sind ebenfalls zu-
Die Tagung „Ort und Prozess. Verhandlungen von gänglich über die Tagungshomepage.
Erbe vom urbanen bis zum ländlichen Raum“ be-
fragt Ortsentwicklungen als Aus- und Verhandlungs- INTERAKTION
prozesse, die ein örtliches Selbstverständnis mit-
Alle aktiv Beitragenden werden als Diskussionsteil-
konstituieren. Der Prozess der Verhandlung wird in
nehmer:innen gelistet und können eigenständig
den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt: Darunter
Kamera und Ton einschalten.
fallen z. B. Formen von Wertsetzungen, Argumen-
Zuschauer:innen verfügen nicht über diese Mög-
tationsstrategien, Interaktionsmuster und formelle
lichkeit. Sie können aber vom Host zu Diskuss-
wie informelle Umsetzungsinstrumente, die den ionsteilnehmer:innen hochgestuft werden, wenn
Umgang mit den gebauten, strukturellen und auch ein Redebeitrag gewünscht ist.
immateriellen Werten vor Ort beeinflussen. Die-
se Prozesse verlaufen selten einvernehmlich oder Nach jedem Panel ist eine moderierte Podiums-
geradlinig. diskussion vorgesehen. Dieses wird nach einer
internen Diskussion für das Publikum geöffnet.
In Orten, in denen gesellschaftlicher Konsens darü- Wir bitten um ein virtuelles Handzeichen, wenn
ber existiert, was als Erbe angesehen wird, scheint ein Redebeitrag während der Diskussionsrunden
ein schonender und reflektierter Umgang mit eben gewünscht ist. So kann die Redner:innenliste auto-
diesem Erbe auch in der Ortsentwicklung vergleichs- matisch geführt werden.
weise üblich zu sein. Ziele der Entwicklung und Kurze inhaltliche Fragen zu den Vorträgen können
der Erhaltung werden dort möglichst miteinander über den Chat gestellt werden und werden am
abgeglichen. Aber auch neu erkannte städtebauliche Ende des jeweiligen Vortrags nach Möglichkeit
und stadträumliche Wertigkeiten und Veränderungs- durch die Moderation an die referierende Person
druck können Aushandlungsprozesse einleiten, in gestellt.
denen Personen und Gruppen vor Ort versuchen,
auf ortsplanerische Entscheidungen Einfluss zu PAUSENRAUM
nehmen und verschiedene Interessen auszuloten, Für den informellen Austausch während der
gemeinschaftlich oder konkurrierend. Zwischen Tagung wurde auf freiwilliger Basis ein virtueller
Dienst nach Vorschrift, Governance, Engagement Pausenraum erstellt. Sie erreichen den Pausen-
und Widerstand fragt die Tagung danach, welche raum unter:
Praktiken und Prozesse bauliche oder ideelle Kon- https://www.wonder.me/r?id=9xea87-co31m
tinuitäten erzeugen oder mit diesen brechen und
inwieweit sie steuerbar sind. Passwort: OrtundProzessDonnerstag, 26. November 2020 Freitag, 27. November 2020
13.50 Zoom geöffnet KOALITIONEN IM ÖFFENTLICHEN INTERESSE
14.00 Grußwörter der Kooperationspartner 08.50 Zoom geöffnet
KDWT, Universität Bamberg / Bayerisches
Landesamt für Denkmalpflege 09.00 Das Kommunale Denkmalkonzept – Akteure, Prozesse
und Öffentlichkeit
14.20 Ort und Prozess. Thomas Gunzelmann, Bayerisches Landesamt für
Einführung ins Tagungsthema Denkmalpflege
Lisa Marie Selitz, Universität Bamberg
09.20 Jenseits des Erbes. Allianzen in lokalen
Kulturerbe-Debatten
ZWISCHEN ERHALT UND ERNEUERUNG Achim Schröer, Landesdenkmalamt Berlin
14.45 Difficult heritage in Belfast: Umnutzung und 09.40 Denkmalwerte im Diskurs. Eine Position der
Neuentwicklung zwischen Konflikt und staatlichen Denkmalpflege
„Normalisierung“ Dorothee Boesler; LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Henriette Bertram, Universität Kassel Baukultur in Westfalen
15.05 Inwertsetzungsprozesse von Rural und Urban 10.00 Pause
Heritage in der Lausitz und in Breslau
Jana Stoklasa und Jenny Hagemann, Universität 10.20 Sondierungen im Feld der Erbevorstellungen –
Hannover Beispiele aus Denkmalpflegelehre und -praxis
Iris Engelmann, Mark Escherich,Heike Oevermann,
15.30 Pause Universität Weimar
15.50 Neubauerneuerungskonzepte am Helene-Weigel-Platz in 10.40 Paneldiskussion
Berlin-Marzahn. Städtische Transformationsprozesse in
Auseinandersetzung mit dem architektonischen DDR-Erbe 11.20 Mittagspause
Anna Fedorova, HU Berlin
16.10 Akteure und Prozesse der Ortsentwicklung um 1900 DIE KURATIERTE STADT
in Bayern 13.00 Kann materielles Erbe transnational sein? Eine Annähe-
Judith Sandmeier, Bayerisches Landesamt für rung am Beispiel der Städtepartnerschaft
Denkmalpflege München – Verona
16.30 Kurze Pause Vivienne Marquart, Stadtarchiv München
16.40 Paneldiskussion 13.20 „Il museo diffuso“ – Verfallsästhetik als Teil der Inwert-
setzung von Difficult Heritage in der Emilia-Romagna
17.20 Posterpräsentationen Uwe Baumann, Universität Freiburg
13.40 Museum der Wohnsiedlungen – Muzeum Osiedli
ABENDVORTRAG Mieszkaniowych MOM / Lublin Polen. Das urbane Erbe
zum Mitgestalten
18.20 Städtebauliches Erbe verhandeln: Rahmenbedingungen,
Karolina Hettchen, BTU Cottbus
Akteure und lokale Varianzen
Daniela Zupan, 14.00 Pause
Bauhaus-Universität Weimar
14.20 Karten als Verhandlungsgrundlage für Erbe in
19.00 Ende Aufbaustädten, 1939–1949
Carmen M. Enss, Universität Bamberg
14.40 Die 750-Jahr-Feier Westberlins als Impulsgeber für die
Wiederentdeckung der Stadt am Beispiel der Colonie
Alsen
Sabrina Flörke, Universität Siegen
15.00 Paneldiskussion
15.40 Pause
16.00 Abschlussplenum
Moderation: Gerhard Vinken,
Universität Bamberg
17.00 EndeDonnerstag, 26. November 2020
ZWISCHEN ERHALT UND ERNEUERUNG
14.45 Difficult heritage in Belfast: Umnutzung und
Neuentwicklung zwischen Konflikt und
„Normalisierung“
Henriette Bertram, Universität Kassel
15.05 Inwertsetzungsprozesse von Rural und Urban
Heritage in der Lausitz und in Breslau
Jana Stoklasa und Jenny Hagemann,
Universität Hannover
15.50 Neubauerneuerungskonzepte am Helene-Weigel-Platz in
Berlin-Marzahn. Städtische Transformationsprozesse in
Auseinandersetzung mit dem architektonischen DDR-Erbe
Anna Fedorova, HU Berlin
16.10 Akteure und Prozesse der Ortsentwicklung um 1900
in Bayern
Judith Sandmeier, Bayerisches Landesamt für
DenkmalpflegeDonnerstag, 26. November 2020 14:45 DIFFICULT HERITAGE IN BELFAST: UMNUTZUNG UND NEUENTWICKLUNG ZWISCHEN KONFLIKT UND „NORMALISIERUNG“ Henriette Bertram, Universität Kassel Langanhaltende innerstaatliche Konflikte hinterlassen Spuren in der gebauten Umwelt, die als difficult heritage bezeichnet werden: Orte, die an einen Teil der Vergangenheit erinnern, der in der Gegenwart zwar als bedeutsam anerkannt wird, dabei aber „contested and awkward for public reconciliation with a positive, self-affirming contemporary identity“ bleibt (MacDonald 2009:1). Diese Orte zeigen Prozes- se, Positionen und Interessen der beteiligten Akteursgruppen wie unter einem Brennglas, da die ehe- maligen Konfliktgruppen sehr unterschiedliche, sich gegenseitig ausschließende Narrative der Vergan- genheit gepflegt haben (Baumann 2008, Graham 2000). Hinzu kommt ein nicht zu unterschätzender Wunsch nach „Normalisierung“ vonseiten der Politik sowie der Bevölkerung, der die Aushandlungs- prozesse zusätzlich erschwert (Bertram 2017). Der Nordirlandkonflikt wurde 1998 offiziell beigelegt. Seitdem steht die Frage nach einem akzeptablen Umgang mit der Vergangenheit ungelöst im Raum (McGrattan 2010, Bell 2002). In der Hauptstadt Bel- fast lag der Schwerpunkt der Stadtentwicklung auf der Revitalisierung der Innenstadt und die Schaf- fung eines attraktiven neuen Images (Neill und Ellis, 2008). Eine bewusste Debatte über den Umgang mit den räumlichen Hinterlassenschaften des Konflikts wird vermieden, sodass die konfliktbezogene Erinnerungskultur lokal und immer neu verhandelt werden muss (Bertram 2018, Graham und Whelan 2007). In meinem Beitrag betrachte ich Aushandlungsprozesse im Zusammenhang mit zwei vom Konflikt geprägten Orten in Belfast, Crumlin Road Gaol und Girdwood Park. Mithilfe einer Diskursanalyse identifiziere ich die sich verändernden Symboliken der Orte sowie die Strategien und Interessen der beteiligten Akteursgruppen und leite daraus die für jede Diskursphase sagbaren Optionen für die Projektentwicklung ab. Ich diskutiere, ob die Projekte als Modelle für wiederholbare Strategien im Um- gang mit difficult heritage herangezogen werden können. Crumlin Road Gaol, ein ehemaliges Unter- suchungsgefängnis, wurde nach seiner Schließung unter Denkmalschutz gestellt und als Touristen- attraktion wiedereröffnet. Es gilt als erfolgreiches Konversionsprojekt, das sowohl Besucher*innen von außen anzieht als auch die anliegende Bevölkerung anspricht. Die Neuentwicklung des angrenzenden Militärgebäudes Girdwood Barracks war aufgrund der Aufteilung Nordbelfasts in unionistische und nationalistische Gebiete besonders schwierig. Herzstück des Projekts ist heute ein sogenannter Com- munity Hub mit Bildungs- und Freizeitangeboten, die die Lebensqualität der Menschen in den angren- zenden Nachbarschaften verbessern und ihre Beziehungen verbessern sollen (vgl. Muir 2014). Dr. HENRIETTE BERTRAM ist Diplom-Kulturwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Architektur Stadtplanung Landschaftsplanung der Universität Kassel. Ihre Dissertation er- schien 2017 unter dem Titel „Schattenorte in Belfast. Stadterneuerung nach dem Ende des Nordirland- konflikts“ bei transcript. Aktuell koordiniert sie den Forschungsverbund Neue Suburbanität.
Donnerstag, 26. November 2020 15:05 INWERTSETZUNGSPROZESSE VON RURAL UND URBAN HERITAGE IN DER LAUSITZ UND IN BRESLAU Jana Stoklasa und Jenny Hagemann, Leibniz Universität Hannover Breslaus Urban Heritage nutzen seit 1989 verschiedene städtische Akteure (allen voran die Stadtregie- rung) als Ressource, um die Stadt in den europäischen Erinnerungsraum zu (re)integrieren und eine positive lokale Identität nach dem 1945-1947 hier erfolgten „Bevölkerungsaustausch“ zu konstruieren. Die Aushandlungsprozesse reflektieren ökonomische sowie soziale Interessen der involvierten Ak- teursgruppen, die dabei auf die ethische Agenda der Umbruchzeit in den 1980ern sowie die „Wieder- entdeckung“ der multikulturellen Vergangenheit der Stadt zurückgreifen. Verhandlungen slawischer Vergangenheiten lassen sich auch in der Lausitz nachvollziehen, insbeson- dere, was die Rolle nationaler Minderheiten wie den SorbInnen/WendInnen betrifft. Beispiele wie die Debatte um das sorbische Siedlungsgebiet von 2017 offenbaren, wie verschiedene Interessengruppen aus Bürgerschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst innerhalb städtischer wie auch ländlicher Räume kulturelles Erbe nutzen, um sich in komplexen sozio-kulturellen Beziehungsge- flechten zu verorten und sich mithilfe vergangener Ereignisse zu positionieren. Dabei werden Überbleibsel von Traditionen sowie historische Artefakte als bewahrenswert und schutz- bedürftig in Wert gesetzt. Diese Inwertsetzungsprozesse sind zentral vom Gedanken der Weitergabe geprägt. Die nur scheinbar in die Vergangenheit gerichtete Handlung ist somit als ein genuin zukunfts- gewandter Prozess zu verstehen. Die Orte, seien es Städte oder Regionen, entwickeln so ein eigenes Selbstverständnis, das – nach innen sowie außen gerichtet –, durch die Verknüpfung von Raum und Vergangenheit zu Rural bzw. Urban Heritage wird. Diese Interaktionsprozesse generieren beständig Bedeutung, die es durch theoretische Annäherungen und konkrete Fallstudien zu untersuchen gilt. Der Beitrag strebt einen mit konkreten Beispielen unter- fütterten Vergleich von Urban und Rural Heritage an. Dieser bildet einen geeigneten Zugang, um den Spezifika räumlich orientierter Heritage-Prozesse näher zu kommen. Anhand der Fallstudien in der Lausitz sowie in Breslau sollen der Umgang mit kulturellem Erbe sowie die damit einhergehenden Selbst-Verortungsprozesse aufgezeigt werden. Im Fokus steht die Frage, welche gemeinsamen Praktiken oder auch unterschiedlichen Wertigkeiten sich in Räumen sowohl urbanen als auch ruralen Charakters ausmachen lassen. JENNY HAGEMANN, M.A., studierte Historisch orientierte Kulturwissenschaften sowie Geschichte in Saarbrücken und Hannover. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Didaktik der Demo- kratie (Leibniz Universität Hannover) sowie am Sorbischen Institut, Zweigstelle für Niedersorbische Studien (Cottbus). Sie promoviert im Rahmen des Forschungsverbundes „CHER: Cultural Heritage als Ressource?“ an der Leibniz Universität Hannover zu vergleichenden Fragen nach Rural Heritage in den Regionen Wendland und Lausitz. Dr. des. JANA STOKLASA studierte Deutsche Sprachwissenschaft und Geschichte in Paris und Han- nover. Sie ist assoziierte Mitarbeiterin am Institut für Didaktik der Demokratie (Leibniz Universität Hannover) sowie wissenschaftliche Assistentin der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen. Sie promovierte 2020 zum Thema: „Umstrittenes Vermögen: Kalter Bürgerkrieg und Vergan- genheitsblindheit in Wiedergutmachungsverfahren für nationalsozialistisches Unrecht (1948–1968)“
Donnerstag, 26. November 2020 15:50 NEUBAUERNEUERUNGSKONZEPTE AM HELENE-WEIGEL-PLATZ IN BERLIN-MARZAHN. STÄDTISCHE TRANSFORMATIONSPROZESSE IN AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM ARCHITEKTONISCHEN DDR-ERBE Anna Fedorova, HU Berlin Der Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf, heute die größte zusammenhängende Großwohnsiedlung in der Europäischen Union, wurde im Rahmen eines groß angelegten und auf staatliche Initiative zurück- gehenden Wohnungsbauprogramms unter der Planung der DDR-Regierung von 1977 bis 1990 errichtet. Der ausschlaggebende Faktor für diese ausgeprägte Bautätigkeit war das enorme Defizit an Wohnraum, das zu Beginn der 1970er Jahre in Ost-Berlin auf 850.000 Wohnungen angewachsen war. Eines der zuerst realisierten Ensembles ist der Helene-Weigel-Platz im Südosten des Bezirks. Er wurde als „Stadtbezirks- zentrum“ konzipiert, das neben der Wohnbebauung über zahlreiche Einrichtungen sozialer Infrastruktur, des Einzelhandels und Freizeitangeboten verfügt und damit einen komplexen Raum mit sich überlagernden funktionalen Ebenen darstellt. Die Gebäude und die Raumordnung unterliegen einem ästhetischen Ge- samtkonzept, das auf die gesamtheitliche und zentralisierte Planung durch die Institutionen der DDR und auf die Architekten Roland Korn und Heinz Graffunder zurückgeht. Am Helene-Weigel-Platz zeigen sich verdichtet allgemeine Gestaltungsprinzipien von Großwohnsiedlungen der DDR, darunter der Rückgriff auf die typisierte Bauweise in Großblock- und Plattenbauweise, die klaren funktionalen Trennungen zwischen den Gebäuden, Auflockerung der offenen Bauweise durch Grünflächen und eine zum Automobilverkehr geschossene Raumplanung. Die Vereinigung der beiden Städte Ost- und West-Berlin 1989/90 stellte die StadtplanerInnen vor funda- mentale Fragestellungen: Wie sollte die Integration der bis dato für fast 30 Jahre getrennt existierenden Städte Ost- und West-Berlin mit ihrer jeweils eigenen Infrastruktur und spezifischen städteplanerischen Entwicklung gelingen? Debatten insbesondere um den ehemaligen Mauerstreifen und die politisch-reprä- sentativen Symbolbauten der DDR (darunter der Palast der Republik und das Palasthotel) warfen Fragen nach dem zukünftigen Umgang mit der DDR-Architektur auf und wurden u.a. medial oder mittels Bürgerin- itiativen großflächig diskutiert. Weniger medial präsent waren hingegen städteplanerische Fragestellungen mit dem Ziel der architektonischen Aufwertung der DDR-Großwohnsiedlungen am Stadtrand. Grund war, dass die Bausubstanz trotz des verhältnismäßig jungen Alters bereits teilweise erhebliche bauliche Mängel aufwies und Prognosen von starker Abwanderung der BewohnerInnen in die zunehmend sanierten Altbau- viertel in der Innenstadt und in die alten Bundesländer ausgingen. Diese städteplanerischen Verhandlungsprozesse sollen exemplarisch am Helene-Weigel-Platz am Beispiel zweier Gutachten der Architekturbüros Müller Reimann Architekten und UrbanPlan, die beide um 1995/96 im Auftrag des Senats angefertigt worden sind, untersucht werden. Die Leitfrage des Vortrages lautet: Welche Perspektiven, Potentiale und Kritiken ergeben sich aus diesen Gutachten auf den Helene-Weigel-Platz? Wie positionieren sich die Gutachten zum Entstehungskontext – als architektonisches Erbe der DDR wie auch konzeptuell als Großwohnsiedlung? Wie lässt sich diese Positionierung in einen breiteren Kontext der Stadtplanung der Nachwendezeit Berlins einordnen? ANNA FEDOROVA studierte Kunst- und Bildgeschichte, Philosophie, Politikwissenschaften und Medien- kommunikation in Berlin, Würzburg und Tübingen. 2020 erhielt sie den Master of Arts im Fach Kunstge- schichte mit einer Masterthesis über „Städtische Transformationsprozesse in Auseinandersetzung mit dem architektonischen DDR-Erbe am Helene-Weigel-Platz in Berlin-Marzahn“. Sie lebt und arbeitet in Berlin als Junior Analyst und User Experience Designerin.
Donnerstag, 26. November 2020 16:10
AKTEURE UND PROZESSE DER ORTSENTWICKLUNG UM 1900 IN BAYERN
Judith Sandmeier, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Nur einen Monat bevor Georg Hager, späterer Leiter des Generalkonservatoriums, auf dem 6. Tag für
Denkmalpflege in Bamberg1 über „Denkmalpflege und moderne Kunst“ referierte, war die von ihm
anhand eines abstraktes Fallbeispiels skizzierte Fragestellung in der 30 km nördlich gelegenen Stadt
Seßlach sehr konkret geworden. Im zentralen Baublock der seit dem 14. Jahrhundert innerhalb der
Stadtmauern stark verdichteten Kleinstadt waren 12 Anwesen und damit rund 10% der innerstädti-
schen Gesamtfläche abgebrannt.2 Das Interessensnetzwerk, in dem sich Architekten und Stadtplaner
genauso wie Verwaltungsbeamte, Historiker und Denkmalpfleger seit 1899 regelmäßig über Erhal-
tungsbestrebungen baulicher und struktureller Überlieferung und deren methodische Grundsätze
austauschten, diskutierte anlässlich der Hagerschen Ausführungen zu den auch in Seßlach virulenten
Fragen der strukturellen oder gestalterischen Rekonstruktion im historischen Siedlungsgefüge. Bei der
Schließung von solchen durch Brand entstandenen Lücken, wäre es nach Auffassung des Konservators
Hager Aufgabe des Architekten die Neubauten durch „Anpassung der Umrisslinien, der Höhen der Dä-
cher, der Ausbauten und der Aufbauten [in] das alte Gesamtbild“ einzufügen.3
Der Tagungsbeitrag will die vom Expertenforum formulierten Grundsätze mit dem vor Ort geführten
Aushandlungsprozess um den Seßlacher Wiederaufbau abgleichen. Dabei wird es weniger darum
gehen, die Anwendungsfähigkeit der Grundsätze selbst zu prüfen, sondern die Bedeutungsgründe, In-
teressenslagen und Argumentationsstrategien der verschiedenen Akteure nachzuvollziehen. Während
sich die beratenden Fachbehörden ganz im Hagerschen Sinn auf einen Expertenstreit mit den aus-
führenden Architekten einließen, handelten die politischen Funktionäre mit den privaten Eigentümern
die eigentlich entscheidenden strukturellen Grundlagen aus. Der Vergleich mit weiteren Wiederaufbau-
projekten ländlicher Siedlungen nach Brandkatastrophen um 1900 zeigt, dass für den Ausgang solcher
Verhandlungen auch die Anschaulichkeit der bestehenden Ortsstruktur ausschlaggebend war.
JUDITH SANDMEIER, 2013–2016 Tätigkeit als Denkmalpflegerin in der städtebaulichen Denkmal-
pflege bei der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen. Seit 2016 Konservatorin
im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Arbeitsschwerpunkt in der fachlichen Begleitung von
Kommunen und Planern bei der Erstellung von städtebaulich-denkmalpflegerischen Gutachten sowie
formellen und insbesondere informellen Planungen wie Denkmalpflegerische Erhebungsbögen und
Kommunale Denkmalkonzepte. Dissertationsprojekt zu den theoretischen Grundlagen und den prak-
tischen Instrumenten der städtebaulichen Denkmalpflege um 1900 am Beispiel ausgewählter Dörfer
und Städte.
1 Der 6. Tag für Denkmalpflege fand am 22. und 23. September 1905 in Bamberg statt.
2 Vgl. Stefan Nöth: Der rote Hahn über Seßlach, in: Geschichte am Obermain, Band 24 (= Jahrbuch Colloquium His-
toricum Wisbergense 2003/2006), S. 61-
3 Georg Hager: Denkmalpflege und Moderne Kunst veröffentlicht in: Georg Hager: Heimatkunst. Klosterstudien.
Denkmalpflege, München 1909, 466-486, 482.Donnerstag, 26. November 2020 17:20 POSTERPRÄSENTATIONEN Erbe und Wertewandel des postsozialistischen Agrarraumes Maren Weissig, TU Dresden Czernowitz – Identitäten einer Stadt Jakob Holzer, Helena Bernhardt, Gunnar Grandel,Maximilian Dietz, Magdalena Bürbaumer,TU Wien Wer gedenkt der Partisaninnen und Partisanen? AkteurInnen, Positionen und Wirkungen des PartisanInnendenkmals am Peršmanhof und in St. Ruprecht/Šentrupert Jakob Holzer, TU Wien Öffentlicher Raum als Erbe – Das Spannungsfeld städtischer Straßenraum Andres Buschmeier, Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg Die Pellerhausdebatte und ihr Einfluss auf das allgemeine Denkmalverständnis Anja Wiegel, Universität Bamberg Die Denkmalagentur Marian Zachow, Carsten Fehr, Landkreis Marburg-Biedenkopf
Donnerstag, 26. November 2020 18:20
ABENDVORTRAG
18.20 Städtebauliches Erbe verhandeln: Rahmenbedingungen,
Akteure und lokale Varianzen
Daniela Zupan,
Bauhaus-Universität Weimar
Die Kritik an den städtebaulichen Ensembles der Nachkriegsmoderne hat bekanntlich
ab den 1960er Jahren zusehends an Einfluss gewonnen. Begleitet wurde dieser Prozess
von einer Wiederentdeckung und neuen Wertschätzung anderer städtebaulicher Ver-
gangenheiten – im bundesdeutschen Diskurs allen voran der gründerzeitlichen Stadt-
produktion. Dem setzt dieser Vortrag eine Betrachtung lokaler Entwicklungs- und Aus-
handlungsprozesse in ausgewählten bundesdeutschen und österreichischen Städten
zwischen 1960 und 1990 gegenüber. Dabei zeigen sich Diskrepanzen zum dominanten
Diskurs, denn auf lokaler Ebene haben zu dieser Zeit vielfältige und durchaus unter-
schiedliche städtebauliche Vergangenheiten eine profunde Re-Evaluierung erfahren. An-
hand dieser lokalen Varianzen und ihrer Veränderung über Zeit werden die Bedeutung
und das Wechselspiel internationaler Einflüsse, nationaler Diskurse und Rahmenbedin-
gungen, örtlicher Traditionen sowie Akteuren auf lokale Verhandlungsprozesse städte-
baulichen Erbes diskutiert.
DANIELA ZUPAN ist Juniorprofessorin für European Cities and Urban Heritage an der
Bauhaus-Universität Weimar. In ihrer Forschung untersucht sie den Einfluss politischer
und ökonomischer Prozesse auf Städtebau und Stadtplanung in europäischen Städten
im 20. und 21. Jahrhundert. Inhaltliche Akzente liegen auf den Aushandlungsprozessen
städtebaulichen Erbes sowie dem Einfluss immateriellen Erbes auf Stadtentwicklungs-
prozesse. Ihre Arbeiten wurden u.a. als Buchform im Rohn-Verlag, in Sammelbänden als
auch in deutsch- und englischsprachigen Zeitschriften wie Antipode, Housing Studies,
Informationen zur Raumentwicklung und Forum Stadt publiziert.Freitag, 27. November 2020
KOALITIONEN IM ÖFFENTLICHEN INTERESSE
09.00 Das Kommunale Denkmalkonzept – Akteure, Prozesse und
Öffentlichkeit
Thomas Gunzelmann, Bayerisches Landesamt für
Denkmalpflege
09.20 Jenseits des Erbes. Allianzen in lokalen Kulturerbe-Debatten
Achim Schröer, Landesdenkmalamt Berlin
09.40 Denkmalwerte im Diskurs. Eine Position der
staatlichen Denkmalpflege
Dorothee Boesler; LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen
10.20 Sondierungen im Feld der Erbevorstellungen –
Beispiele aus Denkmalpflegelehre und -praxis
Iris Engelmann, Mark Escherich,Heike Oevermann,
Universität WeimarFreitag, 27. November 2020 09:00 DAS KOMMUNALE DENKMALKONZEPT – AKTEURE, PROZESSE UND ÖFFENTLICHKEIT Thomas Gunzelmann, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Seit 2015 macht das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege mit dem Kommunalen Denkmalkonzept (KDK) Kommunen ein Angebot, in größerer Eigenverantwortung aktiv die Entwicklung historischer Ortskerne und Quartiere unter dem Aspekt der baulichen und städtebaulichen Überlieferung zukunftsorientiert zu steuern. Im Grundsatz handelt es sich dabei um ein informelles städtebauliches Planungsinstrument, das aber auch einen oder mehrere Umsetzungsteile beinhalten soll. Dies ist insofern ein Novum, als die staatliche Denkmalpflege in den zurückliegenden Jahrzehnten im Rahmen von Stadtentwicklungsprozessen eine eher passive oder reaktive Position einnahm, nun aber selbst aktiv versucht, eine historisch informierte Stadtplanung zu initiieren. Im Sinne der Tagung will der Vortrag dabei das Augenmerk auf die Prozesse legen, die durch das KDK ausgelöst werden. Anhand zweier Fallbeispiele soll aufgezeigt werden, welche Akteure mit welchem Gewicht Einfluss auf den Ablauf eines solchen Prozesses nehmen können. Dabei zeigen sich Verläufe, die von den ursprünglichen Zielsetzungen abweichen und auf unerwartete Interventionen zurückzuführen sind und einen hohen Moderationsaufwand erfordern. Andererseits können aber auch bei einer positiv gestimmten Akteurskonstellation in vergleichsweise kurzer Zeit gute Vermittlungserfolge erzielt werden und längere Zeit kaum lösbar erscheinende Probleme einer Lösung zugeführt werden. Zusammenfassend betrachtet kann festgestellt werden, dass der Erfolg kommunaler Denkmalkonzepte nur in Teilen von guter denkmalfachlicher Analyse und zukunftsorientierten Konzeptionen, umso mehr aber von intensiv geführten Moderations- und Vermittlungsprozessen abhängig ist. Dies stellt hohe Anforderungen an die Ressourcen der Denkmalpflege und ihres Expertennetzwerks, aber auch an die Kommune und ihre aktiven Akteure. Dr. THOMAS GUNZELMANN, 1987 Dissertation zum Thema „Die Erhaltung der historischen Kultur- landschaft“. Seit 1988 beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, nun als Hauptkonservator und Leiter des Referats „Bürgerbeteiligung und städtebauliches Erbe“ am Bayerischen Landesamt für Denk- malpflege. Seit 1996 auch Lehrbeauftragter am Master-Studiengang Denkmalpflege-Heritage Conserva- tion der Universität Bamberg/Hochschule Coburg. Publikationen zur städtebaulichen Denkmalpflege, zur historisch-geographischen Kulturlandschaftsforschung und zur Fränkischen Landeskunde. Weitere Informationen: https://thomas-gunzelmann.net/
Freitag, 27. November 2020 09:20 JENSEITS DES ERBES. ALLIANZEN IN LOKALEN KULTURERBE-DEBATTEN Achim Schröer, Landesdenkmalamt Berlin Debatten und Verhandlungen rund um lokales Kulturerbe bleiben selten monothematisch auf Fragen der Denkmal- oder Stadtbildpflege beschränkt. Zum einen liegt dies in der Natur der Sache, da Stadt- entwicklung stets ein Aushandeln von verschiedensten Interessen und Belangen bedeutet, zum ande- ren suchen die beteiligten Akteure oft ganz bewusst strategische Partnerschaften mit anderen Themen- feldern und deren Akteuren. Gerade da Denkmalpflege auf lokaler Ebene vielmals als Nischenthema gilt und/oder einen schlechten Ruf besitzt, müssen Erbe-Engagierte auf Allianzen setzen. Oft kommt der Erbe-Aspekt sogar erst umgekehrt ins Spiel, wenn ursprünglich anders orientierte Akteure auf der Suche nach Partnern sind und der Denkmalschutz durch sein institutionelles Instrumentarium attrak- tiv erscheint. Auf der anderen Seite führen diejenigen, die in konfrontativen Situationen als Erbe-Geg- ner angesehen werden, für ihre Ziele eine Vielzahl von für wichtiger erachteten Interessen und Belan- gen ins Feld, auf die Antworten gefunden werden müssen. An aktuellen Beispielen, an denen das Denkmalnetz Bayern als unterstützender Akteur beteiligt war, sollen typische Themen- und Akteurs-Allianzen dargestellt werden. Dabei handelt es sich stets um konflikthafte, konfrontative Situationen, in denen der Wunsch nach dem Erhalt historischer Struktu- ren gegen ihren geplanten Abriss oder tiefgreifende Veränderungen steht. Die endgültige Auswahl der Fälle wird erst im Zuge der weiteren Bearbeitung erfolgen, jedoch zeichnen sich als typische Themen ab: Der Erhalt preisgünstigen Wohnraums (z.B. München: Agnesstraße), Zentren- und Einzelhandels- entwicklung (z.B. Fürth: Neue Mitte), politische Gedenkkultur (z.B. Erlangen: Heil- und Pflegeanstalt) oder Stadtökologie und Artenschutz (z.B. Donauwörth: Reichstraße). Das Verhältnis der unterschiedlichen Ziele und Akteure untereinander, ihre Motivationen für eine Ko- operation und das Zusammenwirken ihrer unterschiedlichen instrumentellen Möglichkeiten sollen durch Interviews untersucht werden. Ggf. werden Bezüge zur methodisch im Ansatz verwandten, aber weit tiefergehenden Diskursanalyse, wie sie z.B. von Oevermann (2012) für die Denkmalpflege nutzbar gemacht wurde, hergestellt; der Fokus liegt jedoch auf der Darstellung einer breiteren Vielfalt von Bei- spielen. Mit der Weiterführung der für die Tagung zentralen Fragen nach Akteuren und Prozessen über die eigentlichen Erbe-Debatten hinaus hoffe ich, einen Beitrag zur Untersuchung der realen Aktionsmög- lichkeiten von Erbe-Akteuren und ihren Erfolgen und Misserfolgen leisten zu können. Literatur: Oevermann, Heike: Über den Umgang mit dem industriellen Erbe. Eine diskursanalytische Untersuchung städti- scher Transformationsprozesse am Beispiel der Zeche Zollverein. Berlin 2012.
Freitag, 27. November 2020 09:40 DENKMALWERTE IM DISKURS. EINE POSITION DER STAATLICHEN DENKMALPFLEGE Dorothee Boesler; LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen Aufgrund der Bedeutungsmerkmale „künstlerisch“, „geschichtlich“, „städtebaulich“ etc. werden Objek- te zu Denkmalen nach den Denkmalschutzgesetzen. Wie sind diese Tatbestandsmerkmale mit dem Wert eines Denkmals verknüpft? Leiten sich von diesen Kriterien Werte ab? Einleitend sollen die Begriffe „extrinsische und intrinsische Denkmalwerte“, „öffentliches (Erhaltungs-) Interesse“ und „Tatbestandsmerkmal“ definiert werden. Danach wird dargestellt, wie die Tatbestands- merkmale sowie das öffentliche Interesse in die Denkmalschutzgesetze hineingekommen sind und warum die Verbindung zwischen den extrinsischen Werten, dem öffentlichem Interesse und den intrin- sischen Werten oft nicht hilfreich für den öffentlichen Diskurs ist. Letztendlich geht es im Diskurs um Denkmalwerte um die gesellschaftliche Relevanz des Erhalts von Denkmalen und die Gründe dafür. Diese ist in hohem Maße manchmal mit dem Wert des einzelnen Denkmals meist aber mit der Gesamtheit der Denkmale für die Gesellschaft verbunden. Dieser Dis- kurs ist derzeit noch verknüpft mit der Diskussion, ob und wie einzelne Tatbestandsmerkmale der Denkmalschutzgesetze von der Denkmalpflege bearbeitet und bewertet werden bzw. welche Tatbe- standsmerkmale vor dem Hintergrund der veränderten Erwartungen in der Gesellschaft zusätzlich in die Denkmalschutzgesetze aufgenommen werden müssten. Das halte ich für nicht weiterführend. Ge- rade in der Diskussion um dasjenige Erbe, dessen Bedeutung nicht leicht in eine breitere Öffentlichkeit zu vermitteln ist, kann der Rückgriff auf die grundsätzliche Bedeutung des Erhalts von geschichtlichen Zeugnissen eine Brücke darstellen. Anhand von einzelnen Beispielen aus Westfalen wird der öffentliche Diskurs um Denkmalwerte mit sei- nen vielschichtigen Zwischentönen dargestellt. Seit 2007 ist Dr. DOROTHEE BOESLER bei der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur, dem Denkmalpflegefachamt für Westfalen, beschäftigt, hier leitet sie seit 2014 das Referat Städtebau und Landschaftskultur. Sie studierte Kunstgeschichte, Städtebau sowie Geschichte und wurde 1994 promo- viert. Sie war sowohl in der Inventarisation als auch in der praktischen und städtebaulichen Denkmal- pflege an staatlichen und kommunalen Denkmalämtern tätig.
Freitag, 27. November 2020 10:20 SONDIERUNGEN IM FELD DER ERBEVORSTELLUNGEN. BEISPIELE AUS DENKMALPFLEGELEHRE UND -PRAXIS Iris Engelmann, Mark Escherich, Heike Oevermann, Bauhaus-Universität Weimar Die Tagung Ort und Prozess thematisiert Bewertungs-, Aushandlungs- und Selektionsprozesse von Kulturerbe auf der örtlichen/lokalen Ebene. In das Spektrum von „InWertsetzungen, Argumentations- strategien, Interaktionsmustern und formellen wie informellen Umsetzungsinstrumente, die den Umgang mit den gebauten, strukturellen und auch immateriellen Werten vor Ort beeinflussen“, gehört auch die Frage, wie Studierende auf diese Praktiken vorbereitet werden. Mit Semesterprojekten für Urbanistikstudierende an konkreten Orten begibt sich die Professur Denk- malpflege und Baugeschichte der Bauhaus-Universität Weimar in ‚Wirklichkeitsexperimente‘, in deren Rahmen Deutungen und Wertzuschreibungen baulichen Erbes untersucht werden. Dabei steht im Fokus, dass die Studierenden den Zusammenhang zwischen historischen baulichen Objekten und den gesellschaftlichen Prozessen der Wertzuschreibung verstehen, indem sie ihn nicht nur aus der Distanz analysieren, sondern sich auch selbst als Akteur in diese Prozesse hineinbegeben. Der Vortrag versteht sich als Werkbericht. Im Wintersemester 2019/20 wurde die „Industrie-Moderne“ des 20. Jahrhunderts thematisiert und Erbevorstellungen am Beispiel von fünf Industriedörfern und Agrostädten im ländli- chen Raum Thüringens untersucht. Der erste Teil des Vortrages stellt die methodische Konzeption und Durchführung dieser studentischen Forschung vor. Der zweite Teil des Vortrages reflektiert ein Modellprojekt der Erfurter Denkmalschutzbehörde zum Thema „Partizipation in der Denkmalpflege“, das im Sommer 2020 stattfand und von der Professur begleitet wurde. Die Behörde versuchte dabei, die interessierte Öffentlichkeit direkt in Denkmalfragen einzubeziehen. Mittels eines Votings wurde das bisher noch nicht als Denkmal zertifizierten Bauerbe der DDR-Moderne in der thüringischen Landeshauptstadt zur Debatte gestellt: Anhand von zehn aus- gewählten Bauwerken und Ensembles waren die Erfurterinnen und Erfurter nach ihrer Einschätzung gefragt – entbehrlich oder erhaltungswürdig? Dr. IRIS ENGELMANN, Architekturstudium in Dresden, Brüssel und Stockholm, seit 2008 Mitarbeite- rin an der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte der Bauhaus-Uni Weimar, sowie freiberufliche Tätigkeiten im Bereich Denkmalpflege, Bauforschung, Fotografie und künstlerischen Ausstellungspro- jekten mit Bezug zu diesen Themen. Dr. MARK ESCHERICH, Studium des Bauingenieurwesens, der Architektur und der Kunstgeschichte, seit 2008 Mitarbeiter bei der Denkmalbehörde Erfurt, seit 2011 zusätzlich Mitarbeiter an der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte der Bauhaus-Uni Weimar, u. a. seit 2016 Kollegiumsmitglied beim DFG-Graduiertenkolleg 2227 „Identität und Erbe“. Dr. habil. PD HEIKE OEVERMANN, studierte Architektur an der TU Braunschweig und der ETSA Se- villa sowie World Heritage Studies an der BTU Cottbus. Lehrt an der Humboldt Universität zu Berlin, Technischen Universität Berlin und an der Bauhaus-Uni Weimar. In ihrem DFG-Forschungsprojekt (2011–2014) untersucht sie Transformationsprozesse historischer Industrieareale auf europäischer Ebene.
Freitag, 27. November 2020
DIE KURATIERTE STADT
13.00 Kann materielles Erbe transnational sein? Eine Annähe-
rung am BeIspiel der Städtepartnerschaft
München – Verona
Vivienne Marquart, Stadtarchiv München
13.20 „Il museo diffuso“ – Verfallsästhetik als Teil der Inwert-
setzung von Difficult Heritage in der Emilia-Romagna
Uwe Baumann, Universität Freiburg
13.40 Museum der Wohnsiedlungen – Muzeum Osiedli
Mieszkaniowych MOM / Lublin Polen. Das urbane Erbe
zum Mitgestalten
Karolina Hettchen, BTU Cottbus
14.20 Karten als Verhandlungsgrundlage für Erbe in
Aufbaustädten, 1939–1949
Carmen M. Enss, Universität Bamberg
14.40 Die 750-Jahr-Feier Westberlins als Impulsgeber für die
Wiederentdeckung der Stadt am Beispiel der Colonie Alsen
abrina Flörke, Universität SiegenFreitag, 27. November 2020 13:00 KANN MATERIELLES ERBE TRANSNATIONAL SEIN? EINE ANNÄHERUNG AM BEISPIEL DER STÄDTEPARTNERSCHAFT MÜNCHEN – VERONA Vivienne Marquart, Stadtarchiv München Seit 1960 besteht eine Städtepartnerschaft zwischen München und Verona. Diese weist bereits auf die besondere Verbindung hin, die zwischen beiden Städten in der Zeit der staatlich organisierten Anwer- bung von Arbeitskräften zwischen 1955 und 1973 bestand. An diese Zeit und die Verbindung der beiden Städte als wichtige Orte der Migration erinnert in München allerdings bisher lediglich eine Tafel am Hauptbahnhof. Eine intensivere Würdigung und Sichtbarkeit im Stadtbild steht in München noch aus. Dies scheint aber besonders deshalb zentral, weil diese Migrationsbewegung die Stadt und das Stadt- bild nachhaltig bis heute geprägt und verändert hat. Nur was ist transnationales Erinnern? Wie kann transnationales Erinnern im Stadtbild sichtbar gemacht werden? Wie wird erinnert, wenn Migrationsgeschichte nicht sichtbar ist? Überlegungen zur Etablierung einer transnationalen Erinnerungspolitik in den beiden Städten München und Verona ermöglichen es, über neue Erinnerungsformen nachzudenken, die über die gängigen Formate, wie Stelen, Plaketten oder Denkmäler, hinausgehen. Der Beitrag möchte eine Diskussion darüber anregen, inwieweit materielles Erbe zur Manifestierung transnationaler Erinnerung geeignet ist und welche Möglichkeiten und Schwie- rigkeiten in einer solchen Zuschreibung liegen. Ich, VIVIENNE MARQUART, habe am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung zum materiel- len Kulturerbe in Istanbul promoviert. Dabei erforschte ich den Konflikt zwischen Stadterneuerung und dem Erhalt von materiellem Erbe. Als Ergebnis entstand die Dissertation Monuments and Malls: Her- itage Politics and Urban Struggles in Istanbul. Seit 2016 arbeite ich am Stadtarchiv München und setze mich innerhalb der Migrationsgeschichte
Freitag, 27. November 2020 13:20 „IL MUSEO DIFFUSO“ – VERFALLSÄSTHETIK ALS TEIL DER INWERTSETZUNG VON DIFFICULT HERITAGE IN DER EMILIA-ROMAGNA Uwe Baumann, Universität Freiburg Gerade in der medialen Repräsentation des Ruinentourismus verwebt sich fiktionales und faktionales Erzählen auf mehreren medialen Ebenen und erschafft neue Erfahrungsräume, die schließlich konsu- miert und/oder nacherlebt werden wollen. Urban Exploration, Lost Places-Fotografie, Dark Tourism, Ghost Hunting, und ähnliche internetbasierte Reisepraktiken sind somit „placemaking“ und „armchair travelling“ in einem. In meinem kulturanthropologischen Dissertationsprojekt „,Dunkle Moderne’ als Reiseziel – Touristifizierung und mediale Repräsentation von ‚verlassenen’ Architekturen europäischer Regime. Ein adriatischer Vergleich“ beschäftige ich mich mit der Ästhetisierung und Touristifizierung von Difficult Heritage (hier: Überreste des italienischen Faschismus und des jugoslawischen Sozialis- mus im öffentlichen Raum) anhand zweier Kulturroutenprojekte. Profitiert wird bei diesen touristi- schen Erschließungsprojekten von der Popularität der designierten Orte im Web, wo sie sich bereits zu Destinationen für spezifische Formen des Ruinentourismus etabliert haben, eigene Narrative abseits der konkreten Objektgeschichte gewoben wurden und mediale Verfertigungen spezifischer Verfalls- ästhetik auszumachen sind. Zusätzlich scheint der Fokus auf ästhetisches Erleben in der touristischen Aufarbeitung die Spannungen zu umgehen, die eine Fokussierung auf Historisierung und Neunutzung in den jeweiligen Gesellschaften ergeben würde. In meinem Vortrag möchte ich auf die Ergebnisse eines Forschungsaufenthaltes in der italienischen Romagna eingehen. In der Herkunftsregion Benito Mussolinis hat sich eine Vielzahl an Überresten des italienischen Faschismus erhalten, die bislang kontrovers verhandelt werden und sich mitten im Prozess der Inwertsetzung befinden. Im Zuge dessen haben sich verschiedene Formen des lokalen Ruinentourismus etabliert, die bewusst das Erleben der Verfallsfaszination in den Vordergrund rücken. So stellt beispielsweise das Großprojekt „Spazi Indecisi“ mit der zugehörigen App „In Loco – Il Museo diffuso“ ein alternatives Museum dar, das Besuchende dazu einlädt, die Ruinen der Romagna selbst zu erkunden. Hierbei wird Kulturerbe aus dem Blickwinkel der Urban Exploration sichtbar gemacht. Eine vornehmlich internetbasierte Praktik der Erfahrung von Orten wird durch die Katalogisierung per App einem breiteren Publikum zugänglich, wobei ästhetische Dispositive und Narrative teilweise in der Ver- mittlung übernommen werden. Hier treffen sich aktuelle Überlegungen zu Difficult Heritage und Ge- dächtnisorten (McDonald) und der Inszenierung von Verfall als Form der Erhaltung und Inwertsetzung von Kulturerbe (DeSilvey), die ich in meinem Vortrag beispielbezogen diskutieren möchte. UWE BAUMANN, Studium von 2011 bis 2015 an der Universität Freiburg und der Universität Basel (EUCOR) in Kulturanthropologie und Geschichte, anschließend interdisziplinäres Masterstudium „Studies in European Culture“ an der Universität Konstanz von 2015 bis 2018 mit einem Auslandsauf- enthalt an der UC Berkeley, USA (2016). Seit November 2018 Wiss. Mitarbeiter am Institut für Kultur- anthropologie und Europäische Ethnologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Promotions- projekt im Rahmen des Forschungskollegs „Neues Reisen – Neue Medien“.
Freitag, 27. November 2020 13:40 MUSEUM DER WOHNSIEDLUNGEN – MUZEUM OSIEDLI MIESZKANIOWYCH MOM / LUBLIN POLEN. DAS URBANE ERBE ZUM MITGESTALTEN Karolina Hettchen, BTU Cottbus Die Osiedle Słowackiego, erbaut in den 1960er als materielle Verwirklichung der Offenen Form, kann vor allem als eine Manifestation des Protestes gegen die Idee einer optimierten Architektur für den durchschnittlichen Nutzer gelesen werden (Hansen 2005: 242). Das polnische Architektenpaar Zofia und Oskar Hansen verstand seine Entwürfe als ein Handlungshintergrund für die Alltagspraktiken der Menschen. Der Architekt sollte Möglichkeitsräume schaffen und so einen Rahmen für die Interpreta- tion und Aneignung des Gebauten durch die Nutzer bieten. Indem die Bewohner ihren Lebensraum kreativ gestalten, werden sie zu Co-Autoren des Raumes befördert. Diesen Gedanken greift das Museum der Wohnsiedlungen (Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, MoM), eine Initiative der Bewohner der Lubliner Wohngenossenschaft (Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, LSM), auf. Der Pavillon, in dem sich der Sitz des Museums befindet, wurde – wie die angrenzende Siedlung – von den Architektenpaar Hansen entworfen. Somit wird es selbst zu einem Museumsobjekt im Maßstab 1:1. Es fügt sich in den lokalen Kontext ein und baut eine Beziehung zu seiner Umgebung auf. Hier werden alltägliche Situationen und Spannungen verdichtet, die Annahmen der kooperativen Selbstorganisation und insbesondere deren Verständnis aus einer halbperipheren Perspektive be- obachtet. Die Museumsidee verkörpert das Konzept der Offenen Form von Hansen als Weg zu einer offenen Moderne sowie zu einer urbanen Pädagogik. Über seine Architektur projiziert das Bauwerk die Vorstellungen der Architekten auf die Nutzer und lädt sie zu aktiver Mitgestaltung von Wohn- und Stadträumen ein. MoM versteht sich vor allem als ein offener und neutraler Ort für Veranstaltungen und Diskussionen rund um das Thema Wohnen. Hier können multiple parallele Narrative und Erbediskurse außerhalb des Hauptkanons nebeneinander existieren. Den ersten Teil der Sammlung füllen subjektive Erfahrun- gen der Bewohner und die Geschichten über die Anfänge von Wohnsiedlungen, verschiedene Taktiken und Strategien der Wohnungssuche im schwierigen Alltag der Polnischen Volksrepublik. Der zweite Teil bildet eine Reflexion über den städtischen Aktivismus und die neue Museologie, die sich als Bei- trag zum Diskurs über die Städte der Zukunft versteht. Fragen, die gestellt werden, lauten: Wie können Bewohner und Nutzer Einfluss auf die gebaute und gelebte Stadt nehmen? Wollen und brauchen sie das? Wie kann dieser Prozess in Gang gebracht, bzw. aktiviert werden? KAROLINA HETTCHEN, M.Sc. / M.A. studierte Marketing und Management an der TU Wrocław (PL) und World Heritage Studies an der BTU Cottbus. Als wiss. Mitarbeiterin im Institut für Neue Industrie- kultur INIK forschte sie zu Themen der Nachnutzung und Aktivierung von Industriebrachen in der Lau- sitz. Derzeit ist sie akademische Mitarbeiterin am Fachgebiet Planen in Industriefolgelandschaften mit den (Groß)Siedlungen der Nachkriegszeit und Wohnen als kulturelles Erbe. Ihre Dissertation forscht zu Transformationen in den Siedlungen der Nachkriegsmoderne in Polen und der ehemaligen DDR. Hansen, Oskar (2005): Towards open form. Ku formie otwartej. Frankfurt am Main: Revolver Archiv für Aktuelle Kunst. On- line verfügbar unter: http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2662305&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm
Freitag, 27. November 2020 14:20 KARTEN ALS VERHANDLUNGSGRUNDLAGE FÜR ERBE IN AUFBAUSTÄDTEN, 1939–1949 Carmen M. Enss, Universität Bamberg Bereits in der späten Phase des Zweiten Weltkriegs begannen Experten aus Denkmalpflege und Planung darüber zu verhandeln, welche Denkmäler und auch allgemein welches kulturelle Erbe den Wiederaufbau mitprägen sollte. Nach dem Krieg wurde diese Diskussion unter den Bedin- gungen neuer Pressefreiheit auch in der Öffentlichkeit geführt. In den regen Forschungen zum Wiederaufbau einzelner Städte wurden diese Diskurse, sofern sie verschriftlicht waren, schon vielerorts aufgearbeitet. Neu ist, dass in letzter Zeit vermehrt Schadenskarten und Karten, die historische Bauten oder Baualter im Zuge neuer Stadtkartierung zwischen 1939 und 1949 do- kumentieren, zur Verfolgung dieser Diskurse in den Stadtgesellschaften herangezogen werden. Ein Vergleich dieser Prozesse in Kassel und Nürnberg soll zeigen, dass die Verhandlungen dabei aber auch ganz unterschiedlichen Ausgang nehmen können. Die Kasseler Karten wurden von Folkert Lüken-Isberner bereits publiziert und ausführlich im Zusammenhang mit Stadtpla- nung kommentiert. Der Vortrag stellt aktuelle Forschung für Nürnberg daneben, vergleicht die Verhandlungen und fragt danach, wie der Ausgang dieser Prozesse Aussehen und Struktur der Nachkriegsstädte Kassel und Nürnberg mitbestimmte. Zunächst wird anhand der Pläne diskutiert, welches Erbe in Stadtkarten überhaupt jeweils angesprochen wird. Die Einbindung der Karten in ein weiteres Forschungsumfeld zur Stadt- geschichte zeigt, dass Themenkarten Elemente kulturellen Erbes nicht nur abbilden, sondern selbst zum entscheidenden Verhandlungstool um städtisches Erbe wurden. Akteure nutzten Stadtkarten, um ihre eigenen Vorstellungen von Erbe zu objektivieren. Unterschiedliche Vor- stellungen von Erbe konnten auch innerhalb einer Stadt in Karten einander gegenüberstehen. Die Vorstellung von städtischem Erbe, die sich in Verhandlungen durchsetzt, wird durch das Medium Karte im Laufe der Aufbauprozesse verfestigt. Welches Erbe wurde für welche Moder- ne ausgewählt? Diese Frage können Karten vielerorts beantworten. CARMEN M. ENSS, Dr.-Ing. studierte Architektur und Denkmalpflege in Weimar, München, Trondheim und Bamberg. Seit 2017 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenz- zentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Im November 2020 startete der von ihr geleitete BMBF-Forschungsverbund „Kartie- ren und Transformieren. Internationale Zugriffe auf Stadtkarten als visuelles Medium urbaner Transformationen in Mittel- und Osteuropa, 1939–1949“.
Freitag, 27. November 2020 14:40 DIE 750-JAHR-FEIER WESTBERLINS ALS IMPULS-GEBER FÜR DIE WIEDERENTDECKUNG DER STADT AM BEISPIEL DER COLONIE ALSEN Sabrina Flörke, Universität Siegen Pünktlich zur 750-Jahr-Feier der geteilten Stadt Berlin im Jahr 1987 wurde die von der Gartendenk- malpflege durch den Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz veranlasste gutachterliche Untersuchung über die Colonie Alsen (1864 bis 1898)1 in Berlin-Wannsee vorgestellt. Die einzigartige großbürgerliche Sommerkolonie wies in jenem Jahr selbst bereits gut 120 Jahre Entstehungs- und Ent- wicklungsgeschichte auf, jedoch auch gleichermaßen Jahrzehnte „des völligen Vergessens und emp- findlicher Einbußen“. Durch die gartendenkmalpflegerische Restaurierung Klein-Glienickes rückte auch die dazu nahe gelegene ehemalige Sommerkolonie in den Fokus der Berliner Verwaltung. Repräsentati- ve Villen in herrschaftlichen Gärten waren als kleine Ensembles in einem gemeinschaftlich bewohnten Park konzipiert. Zusätzlich durch grundbuchrechtlich gesicherte Blickachsen verbunden boten sie einst ein für den Berliner Raum einzigartiges Bild großbürgerlicher Sommerfrische jenseits der Stadtgrenzen dar. Das Gutachten zeigt deutlich, was nach Enteignung und Umnutzung durch die Nazis, leichten Kriegszerstörungen und provisorischen Zwischennutzungen während und nach dem Zweiten Weltkrieg sowie einer daran anschließenden flickenteppichartigen Stadtplanung zur Zeit der Teilung Berlins noch von dem Koloniebestand von vor 1945 übriggeblieben war – ein erheblicher Bestand an Gebäuden und Gartenelementen sowie -gesamtanlagen. Mit dem Ziel der Unterschutzstellung sollte die Unter- suchung helfen zu bewahren. Der Vortrag zeigt anhand des Berliner Ortsteils auf, in wieweit Stadtjubiläen und andere Großveranstal- tungen ein Motor sein können für eine verstärkte Auseinandersetzung mit Ortsgeschichte und deren denkmalpflegerischem Umgang. Auch der Erfolg laufender und abgeschlossener Restaurierungspro- jekte kann ermutigend für Beteiligte und Außenstehende wirken verstärkt und zielgerichtet zu handeln. Der Umgang mit dem Wannseer Bestand hat Akteure aus Politik, Hochschule, privaten Institutionen und Anwohnern zusammengebracht. Gerade die Entscheidung gegen eine flächendeckende Unter- schutzstellung hat Diskussionsprozesse auf verschiedenen Ebenen ausgelöst, befeuert und zu viel- gestaltigen Verhandlungsprozessen im Kleinen geführt, die für sich betrachtet bis heute erfolgreiche Ergebnisse vorbringen und den städtischen Wertewandel prägen. Dipl.-Ing. SABRINA FLÖRKE ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrgebiet Architekturgeschichte der Universität Siegen. Nach Ihrem Architekturstudium an der BTU Cottbus hat sie sich im Rahmen ih- rer Dissertation mit der Villencolonie Alsen in Berlin-Wannsee beschäftigt. Sie ist assoziiertes Mitglied am Graduiertenkolleg „Kulturelle und technische Werte historischer Bauten“ der BTU Cottbus-Senften- berg. Ihre Forschungsinteressen liegen in der Bauforschung und Architekturvermittlung. 1 Veröffentlicht wurde das Gutachten unter dem Namen „Colonie Alsen – Ein Platz zwischen Berlin und Potsdam“ im Jahr 1988. Verfasser waren Tilmann Johannes Heinisch und Horst Schumacher.
denkmalpflege/tagung-ort-und-prozess/
https://www.uni-bamberg.de/kdwt/arbeitsbereiche/
Titelbild: Budapest, Kreuzung, Jósef Attila utca / hercegprímás utca mit Blick auf die St. Stephans-Basilka [Selitz, 2019].Sie können auch lesen