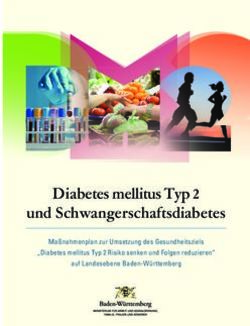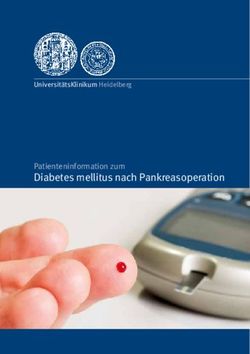Persönlichkeitseigenschaften bei Patienten mit Diabetes mellitus unter Anwendung des Freiburger Persönlichkeitsinventares (FPI-R)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
(Direktorin: Frau Prof. Dr. med. E. Fikentscher)
Persönlichkeitseigenschaften bei Patienten mit Diabetes
mellitus unter Anwendung des Freiburger
Persönlichkeitsinventares (FPI-R)
Dissertation
zur Erlangung des akademischen Grades
Doktor der Medizin (Dr. med.)
vorgelegt
der Medizinischen Fakultät
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
von Dorothee Elisabeth Rösner
geboren am 07.10.1971 in Torgau
Gutachter:
1. Frau Prof. Dr. med. Fikentscher (Halle/Saale)
2. Herr Prof. Dr. med. Schneyer (Halle/Saale)
3. Herr Prof. Dr. med. Plöttner (Leipzig)
Promotionsverteidigung: 18.07.2005
urn:nbn:de:gbv:3-000008858
[http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3Ade%3Agbv%3A3-000008858]Kurzreferat Ausgehend von einem Gesamtzusammenhang somatopsychischer-psychosomatischer Wech- selwirkungen im Krankheitsverlauf des Diabetes mellitus (Bewältigung, spezifischen Be- handlungsanforderungen mit angemessener Krankheitsverarbeitung sowie Compliance-Prob- lemen und Selbstmanagement einer chronischen Erkrankung) wird der Einfluss von Persön- lichkeitsfaktoren untersucht. Die vorliegende Arbeit stützt sich auf Daten einer multizentrischen Prävalenzstudie zu Ess- störungen bei Diabetes mellitus, in deren Rahmen 359 ambulant behandelte Diabetiker zwischen 18 und 65 Jahren (94 Typ-I- und 265 Typ-II-Diabetiker) untersucht wurden. Als Mess- instrument kam das Freiburger Persönlichkeitsinventar (revidierte Form - FPI-R) als Persönlich- keits-Struktur-Test zum Einsatz. Bei der Auswertung wurden auch alters- und geschlechtsspe- zifische Stanine-Werte herangezogen und Clusteranalysen (5-Cluster) gerechnet. In der Gesamtstichprobe der Studie lagen alle FPI-R-Skalenmittelwerte im unauffälligen Norm- bereich. Verschiebungen ergaben sich in Richtung Gesundheitssorgen/gesundheitsbewusstes Verhalten (Skala 9). Unterschiede zwischen den Diabetes-Typen zeigten sich nur insofern, dass der Typ-I durchschnittlich mehr körperliche Beschwerden (Skala 8) und der Typ-II ein aggressiveres Verhalten (Skala 6) aufwies. In der geschlechtsspezifischen Auswertung zeigten die weiblichen Probanden eine deutliche Furcht vor Erkrankungen und damit verbunden ein stark gesundheitsbewusstes Verhalten (Skala 9). Dagegen gaben die männlichen Probanden reduzierte körperliche Beschwerden (Skala 8) an und sie schätzten sich leistungsorientierter (Skala 3) ein. Im Mittelwertvergleich waren geschlechts- und altersabhängige Unterschiede be- merkenswert. Die über 45-jährigen Diabetikerinnen hatten den höchsten Anteil angespannter, überforderter Patientinnen. Zudem zeigten besonders die älteren Diabetikerinnen eine schlechte (HbA1c-Werte 9 - 12 %) und sehr schlechte (> 12 %) Stoffwechseleinstellung. Mittels Clusteranalyse ergab sich folgender Hinweis: Der einerseits gesundheitsbesorgte, andererseits ehrgeizig-leistungsaktiv-extrovertierte Persönlichkeitstyp charakterisierte eine Gruppe mit erhöhtem HbA1c-Wert. Er unterschied sich von den anderen Typen nicht hinsicht- lich Geschlecht, Alter und Diabetestyp, zeigte jedoch eine längere Dauer der Erkrankung und einen erhöhten BMI. Die durch diese Studie gewonnenen Aussagen könnten zusammen mit weiteren psycholo- gischen Merkmalen (z.B. Formen der Krankheitsverarbeitung, Narzissmus und Depressivität) zur Optimierung der Behandlung des Diabetes mellitus genutzt werden. Rösner, Dorothee: Persönlichkeitseigenschaften bei Patienten mit Diabetes mellitus unter Anwendung des Freiburger Persönlichkeitsinventares (FPI-R). Halle, Universität, Med. Fak., Diss., 80 Seiten, 2004
Inhaltsverzeichnis
Seite
1. Einleitung und Problemstellung 1
2. Theoretische Grundlagen 3
2.1 Psychosoziale Belastungen durch die chronische Krankheit
Diabetes mellitus 3
2.2 Krankheitsbewältigung beim Diabetes mellitus 4
2.3 Zusammenhang von Krankheitsverarbeitung, Stress, Auftreten psychischer
Störungen, Qualität der Stoffwechselkontrolle und diabetischen Folge-
erkrankungen 6
2.4 Mythus der Diabetespersönlichkeit und Persönlichkeitscharakterisierung 10
2.5 Komorbidität und Prävalenz psychischer Störungen bei Diabetes
mellitus 11
2.5.1 Depressivität und Angst 11
2.5.2 Aggressivität 13
2.5.3 Essstörungen, Selbstbild und Körperbild 14
2.6 Chronische Erkrankungen und die Anwendung des FPI-R 15
2.6.1 Anwendung des Freiburger Persönlichkeitsinventars (FPI) beim Diabetes
mellitus 16
2.6.2 Anwendung des FPI bei Angina pectoris, KHK und Hypertonie 17
2.6.3 Anwendung des FPI bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn 18
2.6.4 Anwendung des FPI bei der Epilepsie 19
2.6.5 Anwendung des FPI bei Rheumatoider Arthritis, Sarkoidose und Coxarthrose 19
2.6.6 Anwendung des FPI bei der Niereninsuffizienz 20
3. Fragestellungen und Hypothesen 21
4. Methodik 23
4.1 Rekrutierung der Stichprobe 23
4.2 Durchführung und Untersuchung 24
4.3 Angaben zum Diabetes mellitus und zur Person 24
4.4 Das Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R) 24Seite
4.4.1 Testart, Testgliederung und Grundkonzept des FPI-R 24
4.4.2 Beschreibung der Skalen 25
4.4.3 Durchführung und Auswertung des FPI-R 25
4.5 Clusteranalyse des FPI-R bei den untersuchten Diabetikern 26
4.6 Statistische Auswertung 27
5. Ergebnisse 27
5.1 Beschreibung der Stichprobe 27
5.2 Darstellung der FPI-R-Testergebnisse für die Gesamtstichprobe 30
5.2.1 Darstellung der FPI-R-Testergebnisse für die Typ-I-Diabetiker 32
5.2.2 Darstellung der FPI-R-Testergebnisse für die Typ-II-Diabetiker 33
5.2.3 Darstellung der FPI-R-Werte für die männlichen und weiblichen Probanden
der Stichprobe 35
5.2.4 Darstellung der FPI-R-Werte in acht alters- und geschlechtsspezifischen
Untergruppen 38
5.3 Güte der Stoffwechseleinstellung (HbA1c-Werte) 40
5.4 Auswertung durch Ermittlung einer 5-Clustervariante für die Diabetes-
Typen-I und -II 44
5.4.1 Beschreibung der Cluster mittels FPI-R-Skalen 45
5.4.2 Verteilung der Diabetestypen in den einzelnen Clustern 48
5.4.3 Geschlechtsverteilung 49
5.4.4 Altersverteilung 50
5.4.5 Diabetesdauer 51
5.4.6 HbA1c-Werte 52
6. Diskussion der Ergebnisse 53
7. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 64
8. Literaturverzeichnis 67
9. Anhang 75
10. Thesen 79Erläuterung wichtiger Begriffe
Pankreopriver Diabetes mellitus:
Auftreten eines Diabetes mellitus nach Pankreatektomie, bei chronischer Pankreatitis,
Hämochromatose, zystischer Fibrose oder Pankreaskarzinom; in etwa 2 % nach einer
akuten Pankreatitis
Sekundärer (medikamentös bedingter) Diabetes mellitus:
Einfluss auf den Glucosestoffwechsel durch Medikamente und Chemikalien; z.B. Glu-
cocorticoide, Nitrosaminderivate, Pentamidin
HbA1c-Wert
HbA1c ist ein glykosyliertes Hämoglobin. Es entsteht durch Anlagerung von Glukose an
das Hämoglobinmolekül. Durch die Bestimmung erhält der Arzt die Information, ob ein
Diabetiker in den zurückliegenden 6 - 8 Wochen richtig eingestellt war.
Bewertung für Diabetiker: unter 6 % sehr gut eingestellt
6-8% gut eingestellt
8-9% befriedigend eingestellt
9 - 12 % schlecht eingestellt
über 12 % sehr schlecht eingestellt
Body-mass-index:
Verhältnis Körpergewicht (kg) zur Körperhöhe (m) = kg/m²Abkürzungsverzeichnis
Abb. = Abbildung
BZ = Blutzucker
et al. = und andere
FPISK = FPI-Skala
HbA1c = glykosyliertes Hämoglobin
IDDM = insulin-dependent diabetes mellitus
Lj. = Lebensjahr
MMPI = Minesota Multiphasic Personality Inventory
NIDDM = non-insulin-dependent diabetes mellitus
SPSS = Statistical Package for the Social Sciences
Tab. = Tabelle
vs. = versus
WHO = World Health Organisation1 1. Einleitung und Problemstellung Der Diabetes mellitus, erstmals von Aretaeus von Kappadokien im Jahre 200 vor Christus be- schrieben, stellt heute eine der häufigsten chronischen Erkrankungen der Welt dar. Von der WHO wird für die USA eine Häufigkeit von 5-10 %, für Europa von 2-5 % sowie für die Bundes- republik von 2-3 % der Allgemeinbevölkerung angenommen, weltweit ist mit wenigstens 30 Millionen Diabetikern zu rechnen (Mehnert et al. 1994). Unter dem Begriff „Diabetes mellitus“ wird ein Syndrom zusammengefasst, das durch eine chronische Hyperglykämie und Störungen im Zusammenhang mit dem Kohlehydrat- und Fett- stoffwechsel charakterisiert ist. Nach den Richtlinien der WHO und der National Diabetes Data Group unterscheidet man eine Reihe von Diabetes mellitus-Typen und verwandten Stoffwech- selstörungen. Die beiden häufigsten Krankheitsformen sind der Typ-I- (insulinpflichtiger) und Typ-II- (nicht insulinpflichtiger) Diabetes mellitus (Mehnert et al. 1994). Die Erforschung der Diabeteserkrankung erfolgte überwiegend von der Inneren Medizin und Endokrinologie. Bei einer umfassenden Erörterung der mit der Krankheit verbundenen Proble- me sollten jedoch auch psychologische Gesichtspunkte nicht unberücksichtigt bleiben, denn eine Erkrankung ist eine Lebenskrise und fordert den Menschen in seiner Gesamtheit heraus. Die von der Ätiologie her somatisch bedingte Krankheit kann z. B. durch die Berücksichtigung psychologischer Erkenntnisse in ihrem Verlauf günstig beeinflusst werden, da beim Krankheits- bild des Diabetes mellitus vegetative und metabolische Prozesse in enger Beziehung zu zent- ralnervösen, kognitiven und behavioralen Faktoren stehen. Um ein vertieftes Verständnis zu gewinnen, warum und wie Menschen auf eine chronische Erkrankung wie den Diabetes melli- tus reagieren, ist es notwendig, die individuelle Persönlichkeit und Lebensbedingungen zu ken- nen (Strian und Waadt 1989, Waadt et al. 1992). Die Reaktionen variieren in Abhängigkeit von Persönlichkeits-, Krankheits- und medizinischen Behandlungsfaktoren. Krankheitsbewältigung ist abhängig von der gesamten Person, ihren (prämorbiden) Bedingungen, wie Alter, Ge- schlecht, Lebenserfahrung, sozialem Status, der persönlichen Geschichte, ihren intrapsychi- schen Konflikten und deren Verarbeitung (Beutel 1985, Mehnert et al. 1994). Die Wechselwir- kungen zwischen psychosozialer Belastung, Compliance, Krankheitsbewältigung und Verarbei- tung, Persönlichkeit, Auftreten psychischer Probleme, sozialer Unterstützung sowie Stoffwech- selkontrolle sind dabei vielfältig. So können z. B. Verbindungen zwischen negativen Ich- Bewertungen und anderen Persönlichkeitsvariablen, wie erhöhter Neurotizismus, Ängstlichkeit, Nervosität, Irritierbarkeit, Gehemmtheit und Depressivität, vor der Diagnosestellung des Diabe- tes mellitus existieren und die Basis für Non-Compliance und schlechte Stoffwechselkontrolle bilden (Petermann et al. 1987; Roth & Borkenstein 1989). Auf der anderen Seite kann z. B. ein Nichtbefolgen von Therapieanforderungen (Nichteinhalten von Diät, Weglassen von oralen Antidiabetika und Insulininjektionen) durch Ablehnung und Leugnung in der Bewältigungsphase
2
des Diabetes zu einer Verschlechterung der Stoffwechseleinstellung mit der Folge von gehäuf-
tem und komplikationsreicherem Auftreten von Folgeerkrankungen führen. Das wiederum kann
eine Verschlechterung des Wohlbefindens und der Lebenszufriedenheit mit sich bringen und
Anlass für das Auftreten von Depressionen, Ängsten, Irritierbarkeit und Gehemmtheit sein und
somit zu psychischen Störungen und Veränderungen der Persönlichkeit führen und einen Cir-
culus vitiosus in Gang setzen.
Die Beschäftigung mit psychologischen Faktoren und Persönlichkeitseigenschaften von Patien-
ten mit Diabetes mellitus ist Gegenstand zahlreicher Arbeiten (z. B. Aikens et al. 1994; Gill
1991; Greydanus & Hofmann 1979; Jacobson et al. 1990; Kohlmann & Kulzer 1994; Kruse et
al. 2003; Robinson et al. 1991; Petermann et al. 1987; Surridge et al. 1984; Wilkinson et al.
1987). Die Literatur zu diesen Themen ist vielfältig und schwer überschaubar. Es gibt Studien,
die mittels ausgewählter Persönlichkeitsinventare (z.B. Crowell 1953; Denolin et al. 1982) und
diabetesspezifischer Fragebögen (z.B. Bradley 1994; Bradley et al. 1990; Dunn et al. 1986)
eine Beschreibung von Persönlichkeitseigenschaften und psychologischen Faktoren beim Dia-
betes mellitus vornehmen. Hervorzuheben ist die Arbeit von Strian und Waadt (1989), die mit
ihrem Modell der metabolischen Diabeteseinstellung die Komplexität der beim Diabetes mellitus
zu berücksichtigenden Probleme verdeutlicht.
Wissen, Compliance metabolische
Kognitive und Kontrolle
Motorische
Fertigkeiten
Verhaltensaspekte, Transfer, Psychosoziale
Bedingungen, Persönlichkeit, Belastung, Stress
Schulung
Verhaltenstherapie
Abb. 1: Modell der metabolischen Diabeteseinstellung (Strian und Waadt 1989)
Anhand dieses Modells lassen sich die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Persönlichkeit,
psychosozialer Belastung, Krankheitsverarbeitung, Compliance, Stress, Lebenssituation, Stoff-
wechsel, Auftreten von Folgeerkrankungen sowie sozialer Unterstützung veranschaulichen.
Die vorliegende Arbeit soll durch die Betrachtung von Persönlichkeitsvariablen einen Beitrag in
diesem Gesamtrahmen leisten. Gegenstand ist die Auswertung von Ergebnissen einer prospek-
tiven Studie an 366 Patienten mit Typ-I- und Typ-II-Diabetes mellitus in Halle und Umgebung.
Als Messinstrument kam zur Charakterisierung von Persönlichkeitseigenschaften die revidierte
Form des Freiburger Persönlichkeitsinventars (FPI-R) zur Anwendung. Mit Hilfe dieses Persön-3 lichkeits-Struktur-Testes können eventuell vorhandene Auffälligkeiten hinsichtlich der Ausprä- gung wichtiger Persönlichkeitsdimensionen an der untersuchten Stichprobe ermittelt werden. Gerade die Kenntnis von Beschwerden im emotionalen Bereich (Auftreten von Ängsten und Depressionen), einer verminderten Lebenszufriedenheit/Lebensqualität oder einer verstärkten Belastung/Beanspruchung durch die chronische Krankheit Diabetes mellitus ist für die behan- delnden Ärzte wichtig. Die Beachtung derartiger Auffälligkeiten kann bei der Betreuung von Diabetikern durch die gezielte ärztliche Einflussnahme zu einem größeren psychischen Wohl- befinden und zu einer besseren Compliance der Patienten mit verbesserter Stoffwechsellage führen. Hierdurch verringert sich wiederum das Risiko des Auftretens diabetischer Komplikatio- nen, und die Lebensqualität steigt. Letztendlich bedeutet ein komplikationsloser Verlauf der Zuckerkrankheit mit insgesamt zufriedeneren Patienten eine Senkung der materiellen Belas- tungen für den betroffenen Patienten, wie für das gesamte Gesundheitssystem. 2. Theoretische Grundlagen 2.1 Psychosoziale Belastungen durch die chronische Krankheit Diabetes mellitus Durch eine chronische Erkrankung, wie Diabetes mellitus kommt es für den Betroffenen zu vielfältigen psychosozialen Belastungen. Petermann et al. (1987) haben dazu eine Übersicht zusammengestellt (Anlage 1 im Anhang). Einzelne Aspekte sollen näher ausgeführt werden. Während die Symptomatik des Diabetes mellitus medizinisch teilweise gut kontrollierbar ist, ist die Grundkrankheit dauerhaft kaum zu heilen. Die Prognose und Lebenserwartung der Patien- ten mit Diabetes mellitus werden durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt. So spielen z. B. das Lebensalter bei Diabetes-Manifestation, der Diabetestyp, die Krankheitsdauer, der Schwe- regrad der Stoffwechseldekompensation, die Art und Güte der Stoffwechseleinstellung, das Auftreten diabetischer Langzeitkomplikationen und das Vorhandensein weiterer Begleiterkran- kungen eine entscheidende Rolle (Mehnert et al. 1994). Die spezifischen Belastungen hängen weniger vom jeweils vorliegenden klinischen Bild und den betroffenen Organen ab, sondern richten sich besonders auch nach dem Verlauf der Krankheit. Der Diabetes ist durch typische Krankheitserfahrungen geprägt: Es handelt sich dabei um Ein- schränkungen durch Diät, Verabreichung von Injektionen, Durchführen von Harn- und Blutzu- ckertests usw. Es besteht die Notwendigkeit eines angemessenen Gesundheits- und Patien- tenverhaltens. Die häufigste akute Komplikation bei diabetischen Jugendlichen ist die Unterzu- ckerung (Hypoglykämie). Bei schweren Formen kann es mitunter zu Sprachstörungen, Aggres- sivität, Verwirrtheitszuständen, zu Krämpfen oder tiefer Bewusstlosigkeit kommen. Lang an- dauernde Anfälle können zu irreversiblen Hirnschädigungen führen. Hieraus können die Angst vor einem öffentlichen Kontrollverlust resultieren und Gefühle von Hilflosigkeit und Abhängigkeit auftreten (Waadt et al. 1992). Dem gegenüber kann ein anhaltend erhöhter Blutzuckerspiegel
4
unbemerkt vorliegen oder mit nur leichten Störungen einhergehen. Bei zu hohem Blutzucker-
spiegel droht akut eine Stoffwechselentgleisung mit diabetischer Ketoacidose sowie langfristig
die Entstehung diabetischer Spätschäden. Es existiert eine Belastung durch die Gewissheit,
lebenslänglich krank zu sein bzw. die Ungewissheit über den Verlauf der Erkrankung, eine ver-
ringerte Planbarkeit der Zukunft sowie eine existentielle Bedrohung durch die Möglichkeit, frü-
her als Gleichaltrige zu sterben.
Bedell et al. (1977) sehen aufgrund ihrer Ergebnisse die Annahme bestätigt, dass eine chroni-
sche Krankheit, wie der Diabetes mellitus, mit einem erhöhten Risiko einhergeht, dass die Be-
troffenen psychisch auffällig werden. Nach Petermann et al. (1987) erfordern chronische Krank-
heiten eine bio-psycho-soziale Sichtweise, weil Belastungen, die sich zunächst hauptsächlich
auf der körperlichen Ebene abspielen, „genug Zeit haben“, sich auch im psychischen und sozia-
len Leben des Erkrankten niederzuschlagen. Steinhausen et al. (1987) fanden, dass für das
Ausmaß psychischer Störungen die Schwere der chronischen Erkrankung im Einzelfall eine
entscheidende Rolle spielt.
2.2 Krankheitsbewältigung beim Diabetes mellitus
Abhängig davon, wie der einzelne Patient mit den psychosozialen Belastungen durch die chro-
nische Krankheit Diabetes mellitus umgeht und diese zu bewältigen versucht, können der Ver-
lauf der Erkrankung günstig beeinflusst oder auch somato-psychische Störungen resultieren.
Zur Bewältigung von Belastungen oder Stresssituationen liegen Theorien unterschiedlicher
Herkunft vor. Die Modelle zur Krankheitsverarbeitung basieren z. B. auf verhaltensbiologischen
(Lazarus 1966), kybernetischen, soziologischen (Mechanic 1974) oder überwiegend psycho-
analytischen Grundlagen (Heim 1983, Schüßler 1993).
Das Modell von Broda (1990) zeigt die Zusammenhänge zwischen Belastung und Bewältigung.
Belastung Moderator- Lebensereignisse Wahrnehmung Bewältigungs-
variablen (life events) °der Situation verhalten
°der eigenen (Coping)
- Geschlecht soziales Netzwerk Ressourcen - Handlung
- Alter (social support) °d. Kontrollierbarkeit - Kognition
- Persönlichkeits- - Ambiguität - Emotion
variablen - Antizipationszeit - Physiologie
- Bewältigungsstile - in der Belastungs-
situation
Abb. 2: Zusammenhang von Belastung und Bewältigung (Broda 1990)5 Diesem Modell ist zu entnehmen, dass die Persönlichkeit als Ganzes in den Verarbeitungspro- zess eingebunden ist, und dass an diese sowohl situative als auch länger überdauernde Anfor- derungen gestellt werden. Für die klinische Anwendung scheint es wichtig zu sein, die Verarbei- tung der Erkrankung in ihrem Verlauf darzustellen und die Reaktion auf spezifische und indivi- duelle Belastungen aufzuzeigen. Bei der chronischen Erkrankung Diabetes mellitus zeigt sich deutlich das stetige Wechselspiel von Bewertungsprozessen und Bewältigungsversuchen. Die Art und Weise, wie der Patient und die Familie die Belastung durch den Diabetes mellitus verarbeitet, hängt ab von Persönlich- keitsstruktur, psychischer Stabilität, vorausgehender Erfahrung mit einschneidenden Erlebnis- sen, subjektiven Krankheitstheorien des Betroffenen, Bewertung der Belastung, soziodemogra- fischen Variablen (z. B. Alter, Geschlecht), Lebenssituation/Lebensereignissen, sozialer Unter- stützung (Partner, Familie), medizinischer Betreuung (Qualität der Arzt/Patient-Beziehung als wichtige Grundlage der Compliance). Dies entspricht den von der Analyse allgemeiner Trauer- arbeit bekannten Verarbeitungsphasen. Demnach durchläuft ein Diabetiker typischerweise Pha- sen des Schocks, der Ablehnung/Verleugnung, der Auflehnung/Revolte, des Feilschens, der Aggression, der Schuld, der Depression bis hin zum Sich-Abfinden und Akzeptieren des Diabe- tes. Eine festgelegte Phasenfolge für den individuellen Verlauf besteht nicht. Assal und Gfeller (1985) verglichen den Prozess des Akzeptierens des Diabetes mit dem Modell der Trauerarbeit von Kübler-Ross und konnten bei Untersuchungen typische Phasen von Ablehnung, Verleug- nung, Revolte, Feilschen, Depression, Sich-Abfinden feststellen. Neuere Untersuchungen von Hirsch (1992) stellten jedoch diese Phasenfolge des Trauerkonzeptes in Frage. In ihrer Studie an 52 Diabetikern konnten sie im ersten Jahr nach der Diagnose zwar erhöhte Werte für die Gesamtkonstellation von „Gefühlen und Trauerkognitionen“ feststellen, aber eine Zuordnung zu bestimmten Trauerphasen nicht vornehmen, da es unspezifische negative emotionale Reaktio- nen gab. Die Diagnose Diabetes mellitus geht mit einer radikalen Umstellung der bisher gewohnten Le- bensweise einher und stellt je nach Persönlichkeit für den Patienten ein mehr oder minder schweres psychisches Trauma dar. Es herrschen Gefühle von Unsicherheit, Schock, Ärger, Trauer, Schuld, Rebellion (Gearhart 1995) vor. Für den Typ-I-Diabetiker ist die Notwendigkeit gegeben, neben regelmäßigen Blutzuckerkontrollen die Insulindosis und die Ernährung aufein- ander abzustimmen. Dies schränkt fast immer die bisherige Lebensführung ein (Kulzer 1992) und stellt den Betroffenen zunächst vor schwierige Bewältigungsaufgaben. Es ist davon auszu- gehen, dass die Krankheitsbewältigung bei Typ-I-Diabetikern mit zunehmender Krankheitsdau- er durch die verbesserte Adaptation leichter fällt. Daher ist ein positiver Zusammenhang zwi- schen den Maßen des Wohlbefindens und der Krankheitsdauer sowie eine negative Korrelation zu Depression und Angst bei Typ-I-Diabetikern zu erwarten (Hermanns & Kulzer 1992). Für die meisten jungen Typ-I-Diabetiker, bei denen die Diagnose in der ersten oder zweiten Lebensde-
6 kade gestellt wird, gerät das Selbstbild ins Wanken. Sie befinden sich in einer Entwicklungs- phase, in der die Persönlichkeit nach Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung und Anerkennung strebt. Das Diabetesregime steht dazu im krassen Gegensatz. Die Typ-II-Diabetiker sehen sich mit der Anforderung konfrontiert, ihre jahrzehntelangen Ess- und Trinkgewohnheiten umfassend zu verändern. Darüber hinaus ist es notwendig, diese Modi- fikation des Ernährungsverhaltens dauerhaft beizubehalten (Kulzer 1992). Beim Typ-II-Diabetes stellt sich das Problem der Krankheitsverarbeitung meist unter umgekehrten Vorzeichen. Viele Typ-II-Diabetiker begreifen ihre Erkrankung als sogenannten milden Alterszucker, für dessen Behandlung man keine großen Anstrengungen zu unternehmen braucht (Hermanns & Kulzer 1992; Kulzer 1992). Deshalb wird bei Typ-II-Diabetikern im Vergleich zu Typ-I-Diabetikern mit einem höheren Ausmaß an Wohlbefinden respektive einer geringeren Ausprägung von De- pressivität und Angst gerechnet. Die Ergebnisse zur Konstruktvalidität zeigen deutliche Unter- schiede zwischen Typ-I- und Typ-II-Diabetikern hinsichtlich ihres psychischen Wohlbefindens. Dies könnte durch krankheitsspezifische Faktoren, wie beispielsweise unterschiedliches Krank- heitserleben und Behandlungsstrategien, oder durch demographische Unterschiede wie z. B. das Lebensalter, begründet sein. Bei Typ-II-Diabetikern wurden bedeutsame Zusammenhänge zwischen Lebensalter und Depressivität sowie Wohlbefinden (Bradley et al. 1990) ermittelt, durch welche die Differenzen zwischen Typ-I- und Typ-II-Diabetikern mitbegründet sein könn- ten. In einer Studie von Petermann et al. (1987) an 21 jugendlichen Diabetikern im Alter von 16 bis 22 Jahren zeigte sich ein bedeutender Zusammenhang zwischen der Krankheitsbewälti- gung und den sozialen Kompetenzen eines Patienten. So konnten kontaktfreudige, selbstsiche- re Patienten ihre Erkrankung besser bewältigen als solche, die im Sozialkontakt weniger geübt waren. Je nachdem, ob ein Typ-I-Diabetiker sich selbst soziale Kompetenzen zuschreibt oder nicht, resultiert ein gelungener bzw. verfehlter Umgang mit der Krankheit. Die Studie von Lundman & Norberg (1993) untersucht die Wechselwirkungen von Coping-Strategien und gly- kämischer Kontrolle von 20 IDDM (25 bis 59 Jahre) und zeigt, wie individuell, komplex und vari- abel sie sein können. Aspekte zur Krankheitsverarbeitung bei Patienten mit Diabetes mellitus und die Betrachtung dieser Thematik an Hand der Hallenser Untersuchungsstichprobe können der Dissertationsar- beit von Koch (2002) entnommen werden. 2.3 Zusammenhang von Krankheitsverarbeitung, Stress, Auftreten psychischer Störungen, Qualität der Stoffwechselkontrolle und diabetischen Folgeerkrankungen In zahlreichen Studien wurde darauf hingewiesen, dass psychosoziale Faktoren für eine befrie- digende Stoffwechsellage eine wichtige Rolle spielen, und viele Autoren stimmten darin über- ein, dass die Krankheitsverarbeitung eine Moderatorfunktion zwischen belastendem Ereignis und Stoffwechseleinstellung bzw. -qualität einnimmt. Die Persönlichkeit kann durch das Bevor-
7 zugen von gesundheitsorientiertem Verhalten vor psychischen Krankheiten schützen oder durch Non-Compliance zu psychischen Krankheiten und Änderungen im Bereich des Körper- und Selbstbildes prädisponieren. Eine wichtige Rolle spielt z. B. der Umgang mit stressreichen Lebenssituationen. Jacobson & Hauser (1983) haben einen bedeutenden Einfluss auf die Aus- bildung physischer und psychischer Krankheiten durch stressreiche Alltagsbelastungen gefun- den. Für die Beurteilung der psychosozialen Anpassung ist die Erfassung von Art und Umfang von „Alltagsbelastungen“ bedeutend. Unter Alltagsbelastungen versteht man Situationen im Leben eines Patienten, die dieser als belastend bewertet. Die Gesamtbelastung einer Person ergibt sich als Summe der Einzelbelastungen aus relevanten Alltagssituationen. Die Gesamtbe- lastung ist ein psychologisches Konstrukt zur Beschreibung einer Person (Waadt et al. 1992). Ein Zusammenhang von Beeinträchtigungserleben und Alltagsbelastungen beim Diabetes mel- litus an der Hallenser Stichprobe wurde in der Dissertationsarbeit von Stahl (2000) untersucht. Stress und bestimmte psychosoziale Faktoren können die Krankheit direkt über hormonelle und neuroendokrine Prozesse oder über das Immun-System (Baker et al. 1969; Becker & Janz 1985) sowie indirekt über schädigende Effekte im Gesundheitsverhalten und Coping beeinflus- sen und somit eine destabilisierende Glucoseregulation ausüben. Die Literatur wirft die Frage auf, von welchen Einflussfaktoren es abhängen könnte, ob belastende Ereignisse die Stoff- wechseleinstellung von Diabetikern ernsthaft beeinträchtigen. Es wurden verschiedene Persön- lichkeits- und Umweltvariablen diskutiert, denen eine entsprechende Moderatorfunktion zu- kommen könnte. Zu nennen sind Studien zum Typ A-Verhalten bei Diabetikern (Cox et al. 1984, Stabler et al. 1987), zu Gewohnheiten der Stressbewältigung (Delamater et al. 1987) und sozialer Unterstützung (Cox et al. 1984). In diesem Zusammenhang konnten bereits Hinkle und Wolf (1952) nachweisen, dass Stressin- terviews zu Schwankungen des Blutzuckerspiegels führten. Sterky (1963) beschrieb in einer Studie an 145 Typ-I-Diabetikern und 126 gesunden Vergleichsprobanden das häufigere Auftre- ten von mentalen Störungen bei „schlecht eingestellten Diabetikern“ im Vergleich zu guter Stoff- wechselkontrolle. In einer Längsschnittstudie fand Koski (1969), dass schlecht eingestellte Dia- betiker eher einen negativen Verlauf der Erkrankung zu verzeichnen hatten und mehr Sprach-, Schlaf-, Verhaltensstörungen aufwiesen und aggressiver waren. Hinsichtlich Angst und Depressionen unterschieden sich die beiden Gruppen nicht. Bei schlecht eingestellten diabetischen Kindern und Jugendlichen traten eindeutig mehr psychische Probleme auf, als bei gut eingestellten (Koski & Kumento 1975; Eiser 1985; Steinhausen & Börner 1978). Der Zusammenhang zwischen einer mangelhaften Kontrolle des Diabetes und gehäuft auftre- tenden psychischen Problemen ist wechselseitig. So hatten Diabetiker, die schon seit dem Aus- bruch der Erkrankung Verhaltensstörungen aufwiesen, größere Probleme, ihren Diabetes kon- sequent zu kontrollieren. Andererseits konnte eine schlechte Stoffwechseleinstellung zu psy- chosozialen Problemen beitragen und diese verstärken. Simonds (1976/77) verglich gut und
8 schlecht eingestellte Typ-I-Diabetiker untereinander und mit einer gesunden Vergleichsgruppe. Bei den schlecht eingestellten Diabetikern traten generell mehr Verhaltensstörungen, massivere Konflikte mit den Eltern, Geschwistern und Gleichaltrigen, geringeres Selbstvertrauen, mehr Schul- und Lernprobleme sowie massivere Abhängigkeits-, Unabhängigkeitskonflikte auf als bei gut eingestellten Diabetikern. Erstaunlicherweise waren gut eingestellte Diabetiker in dieser Studie sogar weniger konfliktbeladen als gesunde Vergleichspersonen. Laut Simonds (1976/77) könnte man argumentieren, dass die gut eingestellten Diabetiker in ihrem Sozialverhalten an- gepasster waren, deshalb ärztliche Therapievorschriften gut befolgten und Konflikten mit ande- ren Personen eher aus dem Weg gingen. Gut eingestellte Diabetiker waren kontaktfreudiger, lebhafter und weniger abhängig. Simonds vertrat die Ansicht, dass Diabetiker mit guter Stoff- wechselkontrolle effektivere Mechanismen zur Bewältigung der Krankheitserfordernisse hatten und deshalb weniger Konflikte resultierten. Gath et al. (1980) fanden bei 76 Typ-I-Diabetikern in jeweils 19 Prozent psychische und Verhal- tensstörungen und belegten wiederum einen Zusammenhang zwischen einer schlechten Stoff- wechselkontrolle und dem gehäuften Auftreten von psychischen Problemen. Anderson et al. (1981) fanden, dass Diabetiker mit guter Stoffwechselkontrolle weniger Ängste, eine positive Selbsteinstellung und bessere Problemlösungsmöglichkeiten mit der Familie aufwiesen. Mazze et al. (1984) untersuchten 84 IDDM zur glykämischen Kontrolle, Persönlichkeit, Angst, Depression und Lebensqualität. Die Persönlichkeit zeigte keine, während Angst, Depression und Lebensqualität eine Beziehung zur glykämischen Kontrolle aufwiesen. Niedrige Angst und Depression waren mit besserer Diabetes-Kontrolle (HbA1c < 8,9) verbunden. Wilkinson et al. (1987) untersuchten 211 IDDM im Alter von 16 bis 65 Jahren und fanden, dass Patienten mit guter Stoffwechselkontrolle ein geringeres Potential für psychiatrische Erkrankungen aufwiesen. Lustman et al. (1986) fanden bei schlecht eingestellten Diabetikern (HbA1>10%) eine signifi- kant höhere Prävalenzrate psychosomatischer Störungen als bei gut eingestellten Diabetikern. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass steigender Stress zu Vermeidungscoping, aber auch Vermeidung zu hohem Stress führen kann. Ein hohes Stresslevel kann wiederum eine schlechte metabolische Kontrolle nach sich ziehen. Die schlechte metabolische Situation selbst kann auch ein Stressfaktor sein. In einer Untersuchung von Delamater (1987) an 27 ado- leszenten Typ-I-Diabetikern mit der Way of Coping Checklist stellte sich ein signifikanter Zu- sammenhang zwischen Stoffwechseleinstellung und Copingmethoden heraus. Die Patienten wurden nach ihrer Stoffwechselqualität in drei Gruppen eingeteilt. Patienten mit schlechter me- tabolischer Kontrolle zeigten signifikant mehr Wunschdenken und Hilfesuchen. Kruse et al. (2003) fanden in ihrer repräsentativen Stichprobe an 7124 Probanden keine erhöh- te Prävalenz für psychische Störungen gegenüber Probanden ohne Diabetes. Diabetiker hatten eine erhöhte Rate an Depressionen und Angststörungen (insbesondere Dysthymia und Pho- bien). Es zeigte sich, dass Diabetiker mit psychischen Störungen eine bessere Stoffwechsel-
9 einstellung (HbA1c) aufwiesen, als Diabetiker ohne psychische Störungen. Die vermehrte Inan- spruchnahme medizinischer Dienste durch Patienten mit psychischen Störungen ist ein Erklä- rungsansatz für die günstigere Stoffwechsellage dieser Patientengruppe. Die Compliance der Diabetiker ist stark abhängig von der Coping-Fähigkeit und der sozialen Unterstützung. Geringe soziale Unterstützung steht im Zusammenhang mit schlechter metabo- lischer Kontrolle und Depression, insbesondere wenn zusätzlicher Stress auftritt. Kvam & Lyons (1991) beschrieben, dass sich Patienten (häufiger Männer), die problemlösende Coping-Stile aufwiesen und eine gute soziale (familiäre) Unterstützung erfuhren, an stressreiche Lebenser- eignisse besser anpassten und ein größeres Wohlbefinden äußerten. Verleugnende und ver- meidende Coping-Strategien waren häufiger mit einer schlechten Krankheitsanpassung kombi- niert. Des weiteren fanden die Autoren Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von Depres- sionen bei Patienten mit verleugnenden und vermeidenden Coping-Strategien sowie negative Assoziationen zwischen problemorientierten Coping-Stilen und Depressionen. Gelingt es Diabetikern langfristig nicht, die Therapiemaßnahmen in ihrem Alltag umzusetzen, so verschlechtert sich ihre Stoffwechselsituation, und gleichzeitig steigt das Risiko, diabetische Folgeerkrankungen wie Augenschäden, Nierenversagen, Herzinfarkt, Durchblutungsstörungen der Beine oder einen Schlaganfall zu bekommen (Janka et al. 1992; Willms & Standl 1993). Winocour et al. (1990) fanden in einer Studie an 130 IDDM eine deutlich erhöhte Rate an De- pressionen, wobei Frauen vs. Männer höhere Werte aufwiesen. Höhere Depressivität und Angst zeigte sich besonders bei Patienten mit Neuropathie, Impotenz, makrovaskulären Gefäß- schäden und Retinopathie. Das Auftreten dieser diabetischen Komplikationen ging mit einer Beeinträchtigung der Lebensqualität einher. Die Studie von Lloyd et al. (1992) beschäftigte sich mit Lebensqualität, depressiven Symptomen und Persönlichkeitscharakterisierung von Diabeti- kern mit makrovaskulären Folgeschäden und Nephropathie. Sie zeigt eine signifikant schlechte- re Lebensqualität und bei Patienten mit makrovaskulären Schäden ein größeres Depressions- potential verglichen mit Patienten ohne Folgeerkrankungen. Die Lebensqualität sank und die Depression stieg mit zunehmender Anzahl an Folgeerkrankungen. In ihrer Studie an 130 NIDDM und IDDM im Alter von 35 - 59 Jahren fanden Robinson et al. (1991) keine signifikanten Unterschiede in der Extraversionsskala und keine signifikanten Be- ziehungen zwischen Persönlichkeitscharakteristiken und der Diabetesdauer, dem Vorhanden- sein von Diabeteskomplikationen und der diabetischen Stoffwechselkontrolle (BZ, HbA1). Bei Popkin et al. (1988) war keine Abhängigkeit psychosomatischer Störungen von der Präsenz diabetischer Komplikationen erkennbar.
10 2.4 Mythus der Diabetespersönlichkeit und Persönlichkeitscharakterisierung Die Persönlichkeit eines Menschen stellt eine wichtige Moderatorvariable im Bedingungsgefüge einer chronischen Erkrankung, wie dem Diabetes mellitus, dar und soll näher betrachtet wer- den. Erste Ansätze zur Beschreibung der Persönlichkeit der Diabetiker stammten von Thomas Willis (1679), Maudsley (1899) und Horace (1921), weitere Arbeiten folgten in den 30er und 40er Jahren, z.B. durch Menninger (1935), Matz (1936) und Daniels (1939). Zahlreiche Studien hat- ten die Aufgabe, die sogenannte „diabetische Persönlichkeit“ herauszuarbeiten. So nahmen beispielsweise Dunbar et al. schon 1936 an, dass Diabetiker besondere Merkmale, wie Angst, Depression oder paranoide Zustände gehäuft aufwiesen. Loughlin & Mosenthal führten 1944 eine Studie an 114 Diabetikern im Alter von 6 bis 18 Jahren durch und fanden Anzeichen für eine erhöhte Aggressivität, Unreife und Zurückgezogenheit. Diese persönlichkeitspsychologi- sche Sicht konnte allerdings nicht durch empirische Befunde gestützt werden (vgl. Dunn & Turt- le 1981). In der Meta-Analyse von Dunn & Turtle (1981) wurden zahlreiche Studien aus den Jahren 1940 bis 1980 unter der Überschrift „Mythus der Diabetespersönlichkeit“ zusammenge- tragen (Anlage 2 im Anhang). Von den 28 bearbeiteten Studien zeigten 12 signifikante psycho- logische Unterschiede zwischen Diabetikern und nichtdiabetischen Vergleichsgruppen, wäh- rend 16 Studien ohne Unterschied blieben. Auffälligkeiten fanden sich z. B. bei den Jugendli- chen in den Studien von McGavin (1940) mangelhafte soziale Anpassung, bei Slome (1959) abnorme Mutter-Kind-Beziehung, bei Swift (1967) umfassende Psychopathologie, bei Fällström (1974) Identitätsprobleme und bei Hauser (1979) niedrige Ich-Entwicklung sowie bei den Er- wachsenen in Studien von Slawson (1963), Murawski (1970) und Sanders (1975) Depressio- nen, bei Mills (1973) mangelhafte soziale Anpassung. Unterschiede zwischen Diabetikern und Gesunden traten vornehmlich dann auf, wenn man globale Merkmale, wie soziale Schicht, Dauer der Krankheit und Alter der Patienten bzw. Gesunden in Beziehung setzte. In Studien, die Einstellungen zum eigenen Körper, Selbstbild, Frustrationstoleranz oder Abhängigkeitsver- halten näher spezifizierten, fanden sich selten Unterschiede zwischen Diabetikern und Gesun- den. In diesem Kontext betonte Johnsen (1980), dass sich bei der Durchsicht von 16 metho- disch akzeptablen empirischen Studien nur sehr wenige psychologische Merkmale und Prob- leme herauskristallisierten, die sich eindeutig als Kennzeichen für Diabetes eigneten. Als wich- tiges Merkmal zeigte sich die Unterscheidung zwischen Diabetikern mit guter oder schlechter Stoffwechselkontrolle. Bei schlecht eingestellten Diabetikern traten eindeutig mehr psychische Probleme auf als bei solchen, die gut eingestellt waren (Koski 1969; Grey et al. 1980; Simonds 1977). Untersuchungen von Strian & Waadt (1987) zeigten, dass sich Diabetiker in ihrer Per- sönlichkeitsstruktur nicht bedeutsam von gesunden Vergleichsgruppen unterschieden. Prämor- bide Persönlichkeitsstrukturen, wie Introversion und Neurotizismus könnten jedoch emotionale Reaktionstendenzen begünstigen (Strian & Haslbeck 1986; Strian et al. 1987). Eine interessan-
11 te Studie zur Ich-Entwicklung bei Diabetikern lieferten Jacobson et al. (1982). Sie untersuchten 74 diabetische Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren und 57 gesunde Kontrollpersonen und stellten die Hypothese auf, dass diabetische Jugendliche in frühere Stufen der Ich- Entwicklung einzuordnen sind als die Kontrollgruppe und dadurch z. B. als ängstlich, impulsiv und abhängig charakterisiert werden können. Die Ich-Entwicklung wurde mit einem 36-Item Fragebogen gemessen. Es zeigte sich, dass die Diabetiker niedrigere Ich-Werte aufwiesen. Die Existenz einer spezifischen „diabetischen Persönlichkeit“ konnte bisher nicht nachgewiesen werden, jedoch zeigten einige Studien, dass im Bereich einzelner Persönlichkeitsdimensionen pathologische Befunde auftreten können. 2.5 Komorbidität und Prävalenz psychischer Störungen bei Diabetes mellitus In den bisher veröffentlichten Arbeiten zu psychischen Problemen und Persönlichkeitsstörun- gen bei Diabetes mellitus waren die Angaben über die Natur und das Ausmaß von psychischen Störungen bei Diabetes mellitus widersprüchlich. Wilkinson et al. (1987) beobachteten bei insulinpflichtigen Diabetikern (N = 194, Alter 16 bis 65 Jahre) eine Prävalenzrate für psychische Störungen von 18 %. Im Gegensatz dazu fand Cro- well (1953) bei Patienten mit Diabetes mellitus und Rheumatischem Fieber und einer gesunden Kontrollgruppe mittels Persönlichkeitsinventaren wie MMPI, Rorschach-Test und Taylor Anxiety Scale keine signifikanten Unterschiede. Ebenso ermittelte Simonds (1977) mit Hilfe eines semi- strukturierten Interviews bei jugendlichen Diabetikern (N = 80, mittleres Alter 13 Jahre) im Ver- gleich zu gleichaltrigen Nichtdiabetikern keine Häufung von psychischen Störungen. Es zeigte sich jedoch, dass jugendliche Diabetiker mit guter Stoffwechseleinstellung und die Jugendlichen der Kontrollgruppe deutlich weniger psychische Konflikte aufwiesen, als die jugendlichen Diabe- tiker mit einer schlechten Stoffwechseleinstellung. In ihrer Studie fanden Petrak et al. (2002), dass die untersuchten Typ-I-Diabetiker (N=313) eine etwa 2-fach erhöhte Rate an Major Depression aufwiesen. Hinsichtlich aller anderen psychi- schen Störungen unterschieden sie sich nicht signifikant von der Allgemeinbevölkerung. Im Folgenden soll an ausgewählten Beispielen die Prävalenz für bestimmte psychische Störun- gen und die Möglichkeit für das Auftreten von Auffälligkeiten im Bereich von Persönlichkeitsdi- mensionen näher betrachtet werden. Besonders im emotionalen Bereich findet man die Präva- lenz für Angststörungen und Depressionen beim Diabetes mellitus. 2.5.1 Depressivität und Angst Erstmals erwähnten Menninger (1935) und Daniels (1939) das Auftreten von Depressionen bei Patienten mit Diabetes mellitus.
12 Surridge et al. (1984) beschrieben in ihrer Studie an 50 IDDM im Alter von 16 - 60 Jahren das Vorkommen von gesteigerter Ermüdbarkeit, Energieverlust, Depressionen sowie vermindertes sexuelles Interesse und vermindertes Verlangen nach Freizeitaktivität. Goodnick (1993), Han- dron & Leggett-Frazier (1994), Kovacs et al. (1985), Lustman et al. (1983), Naliboff & Rosenthal (1989) fanden eine erhöhte Prävalenz an Depressionen. Gavard et al. (1993) beschrieben die Prävalenz für Depressionen mit 8 – 27 %. Lustman et al. (1986) führten eine Studie an 114 Typ-I- und Typ-II-Diabetikern zur Prävalenz von psychiatrischen Erkrankungen durch. Von den untersuchten Patienten fanden die Autoren in 71,1 % (= 81 Patienten) das Vorkommen einer psychiatrischen Erkrankung, darunter in 33 % depressive Episoden. Es zeigte sich kein signifi- kanter Unterschied zwischen Typ-I- und -II-Diabetikern. Ein gehäuftes Auftreten von Depressio- nen (10,1 %) fand man auch in einer Studie von Wrigley & Mayou (1991). Songar et al. (1991) untersuchten 45 Diabetiker mit schlechter Stoffwechseleinstellung mittels Taylor Anxiety Scale und Beck Depression Scale und fanden bei 19 Patienten (42,2 %) eine Depression und bei 34 Patienten (75,5 %) erhöhte Angstwerte sowie von 15 gut eingestellten Diabetikern 7 Patienten mit dem Nachweis einer Depression. Insgesamt waren die Ergebnisse nicht signifikant und zeigten bezogen auf die Gesamtbevölkerung keine erhöhten Werte. Palinkas et al. (1991) untersuchten an 1586 NIDDM das Vorkommen von depressiven Sym- ptomen. Männer und Frauen mit früh diagnostiziertem Diabetes mellitus zeigten mittels Beck Depression Inventory eine höhere Depressivität als gesunde Vergleichspersonen und Patienten mit neu diagnostiziertem Diabetes mellitus. Insgesamt fand sich in dieser Studie eine höhere Prävalenz für Depressionen bei Typ-II-Diabetikern vs. gesunden Vergleichsgruppen sowie hö- here Depressivitätspotentiale bei diabetischen Frauen vs. Männern. In zahlreichen Studien wurde sowohl ein direkter als auch ein indirekter Effekt der Depression auf die metabolische Kontrolle des Diabetes mellitus beschrieben. Einen direkten Einfluss hat- ten Wechsel der Kortisol-, Adrenalin-, Noradrenalin-, Wachstumshormon- und/oder Glucagon- Spiegel verbunden mit der Depression auf den Kohlenhydrathaushalt und damit auf den Blutzu- ckerspiegel (Barglow et al. 1984; Fisher et al. 1982; Kaplan & Atkins 1985; Lustman et al., 1981). Weitere Studien, z. B. Carroll (1969) und Wright et al. (1978) beschrieben eine niedrige- re Glucosenutzbarmachungsrate und erhöhte Insulinunempfindlichkeit bei Patienten mit endo- gener Depression. Der indirekte Einfluss zeigte sich, indem depressive Patienten ein schlechte- res Behandlungsregime aufwiesen, die vorgegebenen Therapiestrategien nicht befolgten und somit höhere Blutzuckerspiegel resultierten (Glasgow et al. 1986, Wilson et al. 1986). Slawson et al. (1963), Liamou et al. (1994), Littlefield et al. (1990) und Kubany et al. (1956) fanden bei Diabetikern keine Häufung von Depressionen.
13 Daniels et al. (1939) beschrieben Angststörungen als prominenten Faktor bei Diabetikern und Turkat (1982) berichtet über höhere HbA1-Spiegel bei Diabetikern mit erhöhten Angstwerten. Wells et al. (1989) untersuchten in einer Studie an 2554 Patienten mit Diabetes mellitus, Arthri- tis, Herzerkrankungen, Bluthochdruck und chronischen Lungenerkrankungen die Prävalenz von Angststörungen und fanden, dass o.g. Patienten mit einer chronischen Erkrankung eine signifi- kant höhere Prävalenz für eine Angststörung besaßen als Vergleichspersonen ohne chronische Erkrankung. Diabetiker wiesen eine stark erhöhte Prävalenz für lebenslange affektive und Angststörungen auf. Lustman et al. (1986) fanden bei 114 Diabetikern (Typ-I- und Typ-II) mit Hilfe des Diagnostic Interview Shedule (DIS) eine Lebenszeitprävalenz für generalisierte Angst- störungen von 40,9 % und für phobische Störungen von 26,3 %. Agora- und einfache Phobien waren bei Typ-II-Diabetikern häufiger (p
14 sionen. Jochmus beschrieb 1971 in einer Studie das gehäufte Auftreten von Aggressionen. Börner (1976) belegte, dass aggressive Kinder eine schlechtere Stoffwechselkontrolle aufwie- sen und zugleich vermehrt ängstlich und depressiv reagierten. Ahnsjö et al. (1981) führten eine kontrollierte Studie an 64 jugendlichen Diabetikern und 30 Vergleichspersonen mit Untersu- chung des mentalen Status, der sozialen Situation, der intellektuellen Kapazität und des Rohr- schachtestes durch. Diabetiker zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant höhere Wer- te im Bereich der Aggression. Brobrow et al. (1985) fanden bei Patienten, die ihre Therapiere- gime nicht befolgten, eine erhöhte Aggressivität. Bei Diabetikern zeigte sich in einigen Studien bis zu ca. 35 - 75 % ein Nichtbefolgen der Diät, in 80 % ein Nichtbefolgen des korrekten Um- ganges mit Insulin und in ca. 93 % ein fehlendes Zusammenspiel zwischen Insulingabe, Nah- rungskontrolle, Diät und Urinzuckermessung. 2.5.3 Essstörungen, Selbstbild und Körperbild Besonders zu Beginn der Diabetes-Erkrankung ist es wichtig, das Essen kontrollieren zu ler- nen. Die mit den Diätvorschriften geforderte Kohlenhydrataufnahme kann zu metabolischen und psychischen Veränderungen führen, die kurzfristig Essanfälle und langfristig Störungen des Hunger- und Sättigungsgefühls, aber auch Depressionen hervorrufen können. Die ständige Reduktion glucosehaltiger Nahrungsmittel erfordert ein gezügeltes Essverhalten. Dieses kann durch Beeinflussung zentraler Neurotransmittersysteme, insbesondere serotonerger Mecha- nismen, sekundäre Stimmungsschwankungen auslösen (Mehnert et al. 1994). Deshalb kann der Diabetes mellitus als ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Essstörung betrachtet wer- den, der auch die Wahrscheinlichkeit einer Folgeerkrankung erhöht (Szmukler et al. 1985). Blouin et al. (1989) fanden in einer kontrollierten Studie an 19 Typ-I-Diabetikerinnen, 19 Bulimi- kerinnen und 19 gesunden Vergleichspersonen im Alter von 18 bis 30 Jahren mittels SCL-90, EDI und EAT ein deutlich erhöhtes Potential an Perfektionismus bei den Diabetikerinnen und Bulimikerinnen. Bei prädisponierten Patienten kann eine Essstörung i.S. einer Anorexia oder Bulimia nervosa (DSM III-R) auftreten. Der erste veröffentlichte Fall einer Patientin mit der Kombination von Anorexie und Diabetes mellitus stammte von Bruch (1973). Berichte über Diabetes und Anorexie veröffentlichten Fairburn & Steel (1980), Powers et al. (1983) sowie über Diabetes mellitus und Anorexie mit Bulimie Szmukler & Russell (1983), Hillard et al. (1983). Bei Typ-II-Diabetikern fanden Wing et al. (1989) im Rahmen eines Gewichtsreduktions- programms bei 21,9 % der Frauen und 9 % der Männer Symptome, die Kriterien für Binge Ea- ting Disorder (DSM IV-Entwurf) erfüllten. Eine Essstörung steht mit dem Körper- und Selbstbild in Zusammenhang. Gefühle der körperli- chen Unattraktivität sind oft mit niedrigem Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen verbunden. Untersuchungen zum Körperbild ergaben, dass diabetische Kinder und Jugendliche ihre Kör- perdimensionen recht genau wahrnahmen, ihr Körperinneres aber in Abhängigkeit von der
15 Krankheit deformiert und die Attraktivität ihres Körpers herabgesetzt erlebten. Auf psychologi- scher Ebene waren ein verändertes Körperbild, exzessive Beschäftigung mit dem Essen, dem Gewicht und Diät, depressive Verstimmungen, ein negatives Selbstkonzept und Konflikte mit Autonomie und Unabhängigkeit relevante Aspekte. Auf der sozialen Ebene schienen schwierige Familienverhältnisse, Schul- und Berufsprobleme aufzutreten und zur Aufrechterhaltung des Teufelskreises beizutragen (Hillard & Hillard 1984). Untersuchungen von Roth & Borkenstein (1990) an 212 Kindern (69 Gesunde, 59 Adipöse und 84 Diabetiker) ergaben, dass Diabetiker insgesamt eine sehr realistische Sicht von ihren Kör- perdimensionen hatten, je nach Essverhalten aber sehr unterschiedliche emotionale Bewertun- gen des Körpers existierten. Bäck et al. (1984) untersuchten 78 Typ-I-Diabetiker und fanden, dass sich gut und schlecht eingestellte Diabetiker nicht hinsichtlich Persönlichkeitsfaktoren unterschieden, sondern im Selbstbild, wobei dieses Ergebnis geschlechtsabhängig war - gut eingestellte Jungen, aber schlecht eingestellte Mädchen wiesen ein hohes Selbstbild auf. Tie- fengruber (1984) berichtete, dass schlecht eingestellte Diabetiker ein negatives Selbstbild auf- wiesen und massivere Konflikte mit Eltern und Gleichaltrigen austrugen. Andererseits konnte ein negatives Selbstbild auch aus der Erfahrung erwachsen, den Diabetes nicht im Griff zu ha- ben und so die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren. Barglow et al. (1983) stellten fest, dass Typ-I-Diabetiker mit hohem Selbstbild meist einen höheren Wissensstand über die Krank- heit hatten und ausgezeichnete Stoffwechselkontrollen aufwiesen. 2.6 Chronische Erkrankungen und die Anwendung des FPI-R Steinhausen (1984) und Petermann et al. (1987) beschäftigten sich in ihren Studien mit der Annahme ähnlich gelagerter Belastungen bei verschiedenen chronischen Krankheiten. Den- noch fanden sich bei jeder chronischen Krankheit Beeinträchtigungen, die mehr oder weniger spezifisch waren. Petermann et al. (1987) stellten in einer Studie die chronischen Erkrankungen Krebs, Diabetes mellitus und angeborener Herzfehler gegenüber (Anlage 3 im Anhang) und erwarteten in weiteren Untersuchungen bei der Epilepsie vergleichbare psychosoziale Aus- wirkungen, wie beim Diabetes mellitus, obwohl zwischen beiden vom Krankheitsbild her gese- hen kaum eine Verbindung besteht. Der Epileptiker ist ebenso, wie der Diabetiker plötzlich ge- zwungen, sein Körperbild zu korrigieren. Beide Krankheiten können noch nicht kausal behan- delt werden und bilden sich nicht spontan zurück. Die Erkrankung kann jedoch, eine gute medi- zinische Behandlung vorausgesetzt, über lange Zeiträume für die Umwelt verborgen bleiben. Sowohl der Epileptiker, wie der Diabetiker haben es in der Hand, durch eine konsequente The- rapiemitarbeit (Antiepileptika, Insulininjektion, Kontrollmessungen) kritischen Zuspitzungen (epi- leptischer Anfall, hypoglykämischer Schock) vorzubeugen. Für Petermann et al. (1987) war der Diabetes mellitus aufgrund seines typischen Verlaufes auch der Hämophilie oder der Nierenin- suffizienz ähnlich. Muthny (1988) fand bei krankheitsspezifischen Untersuchungen gravierende
16 Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten in der Krankheitsverarbeitung. Gemeinsame Aus- gangspunkte könnten sein: Nichtheilbarkeit und Fortschreiten der Erkrankung, eingeschränkte körperliche Verfassung und verkürzte Lebenserwartung, Behandlungsanforderung, Kranken- hausaufenthalte, häufige Arztbesuche, Verlust von Eigenständigkeit, Bedrohungsängste (sozia- le Isolation, körperlicher Verfall, Tod), vielfältige emotionale Probleme. Um die Spezifität von Persönlichkeit und Krankheitsverarbeitung genauer zu erforschen, sind Vergleichsstudien not- wendig. Das Freiburger-Persönlichkeitsinventar wurde im Zusammenhang mit solchen Überlegungen inzwischen in mehreren Untersuchungen verwendet. Im Bereich der chronischen Erkrankungen kam das FPI u. a. bei folgenden Erkrankungen zum Einsatz: Alkohol-Krankheit (Pfrang und Schenk 1983), Angina pectoris und KHK (Heine & Weiss 1988), Hypertonie (Fahrenberg et al. 1995), Ulcus ventriculi (Franz et al. 1996), Myasthenia gravis (Knieling et al. 1995), atopische Dermatitis (Mohr & Beck 1993), Rheumatoide Arthritis, Sarkoidose und Coxarthrose (Köhler et al. 1993; Schüßler 1993), Colitis ulcerosa und Morbus Crohn (Probst et al. 1990; Küchenhoff 1995), Asthma bronchiale (Feiereis et al. 1985; Bönke et al. 1987), Epilepsie (Herzer & Raben- ding 1990, 1992), Niereninsuffizienz (Petzold & Rudolphi 1996; Driessen & Balck 1991, 1993). Einige ausgewählte Untersuchungen sollen näher dargestellt werden: 2.6.1 Anwendung des Freiburger Persönlichkeitsinventars (FPI) beim Diabetes mellitus Pauli et al. (1989) untersuchten 46 Typ-I-Diabetiker im Alter zwischen 15 und 44 Jahren mit Diabetes-Neuropathie auf körperliche Befindlichkeit und Emotionalität. Im Stress- und Coping- Verhalten und in Bezug auf einige Persönlichkeitsdimensionen fanden sich Hinweise auf eine verminderte emotionale Reaktivität. Patienten mit fortgeschrittener autonomer Neuropathie hatten zumeist ausgeprägte diabetische Folgekrankheiten (etwa diabetische Retinopathie, Mak- ro- und Mikroangiopathie), nahmen aber die damit verbundenen körperlichen Beeinträchtigun- gen und emotionalen Belastungen nicht stärker wahr als Diabetiker ohne Neuropathie. Halm & Pfingsten (1990) untersuchten insulinabhängige Diabetiker (N = 36, Durchschnittsalter 39,2 Jahre) hinsichtlich Alltagsstress (gemessen mit einem Fragebogen, der sich an Kanner´s „Hassle Scale“-Fragebogen (1981) orientiert), Stressverarbeitung und Stoffwechseleinstellung u. a. mittels FPI-K und fanden Beziehungen zwischen der FPI-Skala Gelassenheit, Stress und HbA1c-Werten. Bei wenig Stress reagierten gelassene Diabetiker mit einer vergleichsweise guten Stoffwechseleinstellung, während irritierbare, wenig gelassene Personen ungünstige HbA1c-Werte aufwiesen. Der positive Effekt kehrt sich allerdings bei höherer Stressbelastung rasch um. Schon bei durchschnittlichem Alltagsstress gerieten betont gelassene Personen in einen kritischen Bereich und erreichten bei hoher Stressbelastung bedenklich hohe HbA1c- Werte. Demgegenüber wurde die Anpassung bei den eher irritierbaren Personen mit zuneh- mendem Stress nicht schlechter, sondern eher besser. Personen mit einem durchschnittlichen
Sie können auch lesen