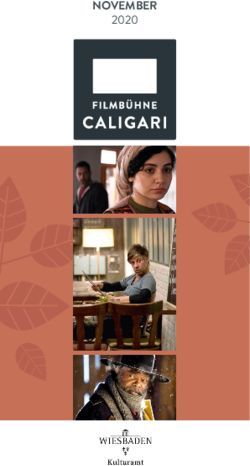PRESS REVIEW Tuesday, February 2, 2021 - Daniel Barenboim Stiftung Barenboim-Said Akademie & Pierre Boulez Saal - Index of
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
PRESS REVIEW
Daniel Barenboim Stiftung
Barenboim-Said Akademie & Pierre Boulez Saal
Tuesday, February 2, 2021PRESS REVIEW Tuesday, February 2, 2021 Rondo, PBS Bild der Woche: 30. Januar - 05. Februar 2021 Schubert ganz nah Rbb Inforadio Trotz Corona wird im Februar an der Staatsoper die Premiere der Oper „Jenufa“ mit Sir Simon Rattle stattfinden Der Tagesspiegel Die Starsängerin Anna Prohaska hat viel zu tun im Shutdown. Aber ihr fehlt das Lampenfieber. Ein Gespräch über Balkonkonzerte, Frauenfiguren in der Oper, Bach als Todes- und Trostkomponist Berliner Morgenpost Am Montag stellten die Festivalleiter und die Kulturstaatsministerin ihre Pläne für die Festspiele in Pandemie-Zeiten vor Frankfurter Allgemeine Zeitung Tyrannei als Privatsache. Kanadas Theater und die Meinungsfreiheit Frankfurter Allgemeine Zeitung Ein hinreißender Ballettabend an der Pariser Oper wird zu einem wunderbaren Film. Doch sehen kann man ihn nur in Frankereich Süddeutsche Zeitung KLASSIKKOLUMNE
Startseite (index.php) · Bild der Woche (bdw.php)
••••
30. Januar — 05. Februar 2021
Schubert ganz nah
Wenn man das Rund bzw. Oval des Berliner Pierre Boulez Saals so menschenleer sieht, stellt man
sich unweigerlich die Frage: Wie viel Nähe kann hier aufkommen, wenn eine Sängerinnen oder ein
Sänger versucht, mit dem Publikum – nicht physisch versteht sich, sondern digital – auf
Tuchfühlung zu gehen? Zumal in einer so intimen und persönlichen Gattung wie dem Kunstlied.
Keine Frage, es geht viel verloren, das zeigen die Konzerte der Schubert-Woche unter der Leitung
von Thomas Hampson. Doch wen wundert das. Eine Erkenntnis liegt vielmehr darin, dass die
Workshops, in denen der Bariton Basics bis Geheimnisse des Liedsingens verrät und an
Interpretationen gefeilt wird, auch auf digitalem Wege vermitteln können, worin der besondere Reiz
dieser mehr nach innen als nach außen gerichteten Gattung liegt. Gemeinsam mit den jungen
Nachwuchssängern und Nachwuchssängerinnen der Lied Akademie des Heidelberger Frühlings
begibt man sich so auf eine Reise in den Kunstlied-Kosmos. Mit Geschichten, Kontexten und
Hintergründen, mit Gedichten – und natürlich mit der so feinsinnig und versatil verschiedene
Gefühls- und Seelenzustände zum Klingen bringenden Musik Franz Schuberts. Ob nun mit
Bekanntem wie dem „Erlkönig“ und „Gretchen am Spinnrade“ oder selten Gesungenem. Die
Workshops, wie alle Veranstaltungen der Schubert-Woche noch bis zum 25. Februar über die Seite
des Boulez Saals (https://boulezsaal.de/de/schubert-week) abrufbar, geben interessante Einblicke in
Denk- und Erarbeitungsprozesse – sie lohnen sich, für die Sänger und Sängerinnen wie für die
Zuschauer.
(Fotos: Peter Adamik)••• 23. — 29. Januar 2021 Frösche oder Katzen? Wie klingt die Dunkelheit? In Béla Bartóks Klavierstück „Klänge der Nacht“ aus dem Zyklus „Im Freien“ webt der ungarische Komponist impressionistisch wie Claude Debussy einen aus unterschiedlich akzentuieren Clustern bestehenden Klangteppich, über dem sich die titelgebenden Klänge der Nacht ausbreiten – zum Beispiel Frösche, Katzen, Insekten oder kleine Steine, die ins Wasser geworfen werden. So beschreibt es András Schiff. Auf der multimedialen Website explorethescore.org (https://explorethescore.org/) kann der interessierte Hörer vom ungarischen Pianisten angeleitet in Bartóks Klangkosmos eintauchen. „Das Projekt nutzt die medialen Möglichkeiten des Internets, um Musik des 20. Jahrhunderts zugänglicher zu machen. Die dynamische Koppelung von Partitur und Aufführungsvideo schafft eine direkte Verbindung zwischen Notenbild und Klang. Die Partitur wird dadurch auch für diejenigen zum Sprechen gebracht, die sie vielleicht nicht im Detail lesen können“, beschreibt der Musikwissenschaftler Tobias Bleek, verantwortlich für die Education-Projekte beim Klavier-Festival Ruhr, die Idee. „Entscheidend ist die Rolle der Interpreten. Sie spielen und erläutern Musik, zu der sie eine besonders enge Beziehung haben – im Fall von András Schiff zum Beispiel die Klavierwerke von Bartók.“ Erwachsen ist die Website, die zudem Exkursionen zu Strawinski, Ligeti und Boulez ermöglicht, aus den Vermittlungsprojekten des Klavier-Festivals Ruhr, etwa in Duisburg-Marxloh, für die Bartóks Musik eine wichtige Rolle spielt. „Bartóks Musik und seine pädagogischen Aktivitäten sind auf vielfältige Weise geprägt durch seine Auseinandersetzung mit Volksmusik“, erzählt Bleek. „Für uns ist das ein Geschenk. Viele der Werke erfüllen das Kriterium der Sangbarkeit. Auf der anderen Seite gibt es eine komplexe und mitreißende rhythmische Dimension. Das lässt sich wunderbar in Bewegung umsetzen.“ In Zeiten, in denen auch Musikvermittlung digital stattfinden muss, kann man sich auf dieser lehr- wie assoziationsreichen Plattform trefflich weiterbilden. (Fotos: Stiftung Klavier-Festival Ruhr)
•• 16. — 22. Januar 2021 Wunschdenken Keine Sorge, diese Aufnahmen kommen aus dem Archiv. Ein voll besetzter Saal im Opernhaus, Stuhlreihen und Publikum dicht und dicht – das mutet heute fast wie ein Relikt vergangener Zeiten an. Es ist weiterhin Geduld gefragt, und die Nachricht zum Bild aus der Dresdner Semperoper verheißt nichts Gutes, wundert aber letztlich kaum: In Dresden wurde die restliche Spielzeit 2020/21 abgesagt, im Sommer soll ein Ersatzspielplan Abhilfe schaffen. Wie der im Detail aussehen wird, muss sich noch zeigen. Auch die sächsische Staatsoper bleibt bis zum 31. März geschlossen. Und die Absagewelle geht weiter: In Frankfurt startet der Spielbetrieb erst wieder im April, gaben die Verantwortlichen in dieser Woche bekannt. Ähnliche Neuigkeiten kommen aus Weimar und Hannover, hier stellte man den Spielbetrieb zunächst bis Ende Februar ein. Der Franz-Liszt- Wettbewerb für junge Pianisten und Pianistinnen, bereits um ein Jahr verschoben, entfällt nun ersatzlos. Doch enden wir positiv: Beim Festival für neue Musik „Ultraschall Berlin“ sind zwar wie überall Programmänderungen erforderlich und die Konzerte mit dem Deutschen Symphonie- Orchester Berlin und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin können nicht stattfinden, doch es gibt ein Alternativprogramm. Das Eröffnungskonzert am 20. Januar mit dem Notos Quartett wird bei rbbKultur übertragen, im Anschluss spielt der Bratschist Nils Mönkemeyer Musik von Hildegard von Bingen und Konstantia Gourzi. Am 21. Januar sendet dann Deutschlandfunk Kultur ein Konzert mit dem ensemble mosaik und viel neuem Repertoire, weitere Programmpunkte (https://ultraschallberlin.de/) folgen. Immerhin Musik, auch wenn volle Säle Wunschdenken bleiben. (Fotos: Klaus Gigga)
09. — 15. Januar 2021 Das große Warten Was gibt es Neues in der Klassikwelt? Erstens: Es wird weiterhin verschoben und aufgeschoben. Nach der Salzburger Mozartwoche gab nun die Telemann-Gesellschaft bekannt, dass sich der Internationale Telemann-Wettbewerb Pandemie-bedingt um ein halbes Jahr verschiebt. Statt im März findet der Wettbewerb nun Ende August/Anfang September statt. Mit nur 40 Teilnehmern, um größere Reisebemühungen zu verhindern. In diesem Jahr sind in Magdeburg die historischen Holzblasinstrumente an der Reihe: Blockflöte, Traversflöte, Barockoboe. Zweitens: Es wird weiterhin modifiziert. Das Schleswig-Holstein Musikfestival soll 2021 zu zwei Dritteln als Open-Air- Veranstaltung stattfinden, um Publikum und Künstler zu schützen. Weitere könnten folgen. Drittens: Man ärgert sich noch immer über die Politik. Diesmal Martin Kusej vom Wiener Burgtheater. Nach der Verlängerung des Lockdowns in Österreich ist unklar, wann sein Haus wieder seine Tore öffnen kann. Viertens: Es gibt auch positive Nachrichten! Etwa vom Kammermusikfest Oberlausitz, dem neuen Klassik-Festival in Sachsen. Im September soll es unter dem Motto „Begegnungen“ in seine zweite Ausgabe gehen. Und fünftens: Personalia. Beim Bach-Archiv Leipzig hat der neue Geschäftsführer Klaus Hartig sein Amt angetreten. Und beim Orchestre Symphonique de Montréal wird der venezolanische Dirigent Rafael Payare (oben im Bild) ab 2022 als neuer Music Director den Taktstock von Kent Nagano übernehmen. (Foto: Benjamin Ealovega)
02. — 08. Januar 2021
Unerwünscht dramatisch
Das hatte sich Rolando Villazón anders vorgestellt: Nachdem die Salzburger Mozartwoche zunächst
trotz der Corona-Pandemie stattfinden sollte, wurde das ursprüngliche Programm nun doch in eine
Online-Version umgewandelt. Rund um den 265. Geburtstag des Komponisten sollte die
ursprünglich für 21. Januar bis 31. geplante Version des Festivals vorerst nur leicht angepasst
werden, hieß es noch im November. Die szenischen Aufführungen wären zwar entfallen, die Konzerte
sollten hingegen, zum Teil in doppelter Ausführung, stattfinden. Die Mozartwoche wäre damit das
erste Festival des neuen Jahres gewesen, mit insgesamt mehr als 50 Veranstaltungen. Das Motto in
diesem Jahr – Musico drammatico – hätte Mozarts Moll-Werke und somit die besonders expressive
Seite des Komponisten, dessen Instrumentalmusik opernhafte Dramatik innewohnt, in den
Mittelpunkt gerückt. Nun kommt die unerwünschte Dramatik von außen: Die in Österreich
geplanten Öffnungen der Kultur ab 18. Januar seien für das Festival nicht praktikabel, gaben die
Verantwortlichen bekannt. Organisatorische und rechtliche Fragen blieben ungeklärt. Die
Mozartwoche kann lediglich als Stream stattfinden, teilte der Intendant Rolando Villazón mit. Ob
ausgewählte Veranstaltungen tagsüber mit getestetem Publikum möglich sind, wird sich Mitte
Januar zeigen.
(Foto: Andreas Hechenberger)
89846&c=1642.2.2021 Digital-Premiere an der Staatsoper: "Haben viel für die Sicherheit getan" | Inforadio Startseite > Programm > Kultur Mo 01.02.2021 | 12:55 | Kultur Digital-Premiere an der Staatsoper: "Haben viel für die Sicherheit getan" Trotz Corona wird im Februar an der Staatsoper die Premiere der Oper "Jenufa" mit Sir Simon Rattle stattfinden. Der rbb überträgt. Wie das geht - Oper rein digital, vor leeren Rängen – erklärt Staatsoper-Intendant Matthias Schultz. Stand vom 01.02.2021 Beitrag hören https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/kultur/202102/01/staatsoper-intendant-schultz-premiere-jenufa-digital.html 1/1
2.2.2021 https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474465/20-21
Dienstag, 02.02.2021, Tagesspiegel / Kultur
ZUR PERSON
„Wir brauchen die Ekstase“
Die Starsängerin Anna Prohaska hat viel zu tun im Shutdown. Aber ihr fehlt das
Lampenfieber. Ein Gespräch über Balkonkonzerte, Frauenfiguren in der Oper,
Bach als Todes- und Trostkomponist – und Sopranistinnen-Witze
© Imago
Mag keine Kammerkätzchen. Anna Prohaska als Susanna in „Figaros Hochzeit“, 2015 an der Staatsoper.
Frau Prohaska, Singen ist eine öffentliche Äußerung und gleichzeitig etwas Privates, fast
Intimes. Hat sich Ihr Verhältnis zum Singen im Lockdown verändert?
Wir brauchen ja nicht nur die stimmlichen Muskeln und die Zwerchfellstütze, sondern auch un-
sere Nerven. Wir betreten die Höhle des Löwen; wie die Muskeln will auch das Lampenfieber trai-
niert sein. Wenn das fehlt, ist man aus der Bahn geworfen. Wobei es keinen großen Unterschied
macht, ob 200 statt 2000 Zuschauer im großen Saal sitzen. Manchmal ist es mit der anonymen
Menge im Dunkeln sogar einfacher als im kleinen Saal vor vielleicht 70 Leuten. Plötzlich sieht man
die Gesichter.
Und das Publikum beim Streaming?
Gestreamte Konzerte vereinen eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten, das des physischen
Konzerts und das der Konserve. Bei einer Tonaufnahme kann man auf Risiko gehen, ausprobieren
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474465/20-21 1/62.2.2021 https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474465/20-21
und korrigieren, beim realen Konzert gibt es das Adrenalin. Beim Livestreaming fehlt beides. Es ist
eine gute Überbrückung im Lockdown, mehr aber nicht.
Die Balkonkonzerte in Ihrer Schöneberger Wohnung, war das eine spontane Idee?
Ich war so inspiriert von den Balkonkonzerten in Italien und Spanien, und weil ich das Singen
nicht lassen konnte, habe ich zu Hause mit einem guten Freund, der Pianist ist, Repertoire
ausprobiert, das mir sonst nicht so liegt. Zum Beispiel die Mimi aus Puccinis „La Bohème“. Das ist ja
eine Rolle, die seit Karl Böhms Zeiten mit dramatischen Stimmen besetzt ist, eine prägende Hörge-
wohnheit aus den sechziger, siebziger Jahren. Dabei ist Mimi ein junges, lungenkrankes Mädchen,
stimmlich eher weniger kräftig als Musetta. Ich stellte mich also etwas verschämt an die offene Bal-
kontür und plötzlich applaudierten Passanten, wollten noch eine Arie und noch eine. So fing es an.
Sie haben auf dem Balkon auch „Somewhere over the Rainbow“ gesungen, waren mal
Rammstein- und Metallica-Fan. Wie halten Sie es heute mit der Popmusik?
Heavy Metal liebe ich immer noch. Auch Stilmix mag ich sehr gerne, schwedischen Folk mit
Elektronik, griechische Volksmusik mit Hip-Hop. Beim Kochen habe ich eben wild zu Rihanna und
Placebo getanzt. Privat höre ich wenig klassische Musik, man möchte ja nicht immer von Arbeit
umgeben sein. Viele Musiker hören deshalb gar keine Musik, ich höre gern sehr viel andere.
Zu Beginn der Pandemie brachen Sie in hyperaktive Betriebsamkeit aus, warum?
Meine Agentin in England war in Kurzarbeit, die Briten sind da superstreng. Also habe ich selber
organisiert, herumtelefoniert, Verträge verhandelt. Sich anzupreisen, ist gar nicht so einfach, es
war eine gute Übung. Im Sommer habe ich eine komplette CD-Aufnahme organisiert, „La Follia“,
einschließlich Fotosession, der Kostüme dafür und der Frage, welche Instrumente wir haben
wollen. Sie kommt im Frühjahr heraus. Ich denke mir ja gerne Konzeptalben aus; Programmarbeit,
Konzertdramaturgie, das liegt mir. Wenn ich den Gesang eines Tages aufgeben sollte, könnte ich in
eine Konzertdirektion wechseln oder gründe vielleicht ein kleines Festival...
Sie haben unter anderem das Bach-Kantaten-Album „Redemption“ herausgebracht, mit der
Lautten Compagney. Die Texte klingen ungeheuerlich in Corona-Zeiten: „Ich ende behende
mein irdisches Leben“, „Ich freue mich auf meinen Tod“ …
… oder auch „Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe“. Das Rezitativ „Die ganze Welt ist ein
Hospital“ haben wir dann doch we gelassen. Ich lege lieber den Finger in die Wunde. Ein
Operetten-Album zur Ablenkung? Das hätte für mich ein Durchhalteparolen-Gschmäckle gehabt.
Wir brauchen doch Komödien in diesen grauen Tagen.
Wie viele andere hatte ich wichtige Projekte verloren, nicht nur den „Idomeneo“ an der Staatsoper
wenige Tage vor der Premiere, sondern auch eine Riesentournee mit dem „Paradise Lost“-Album
oder Messiaens „Saint François d’Assise“ in der Elbphilharmonie mit Kent Nagano, eine tolle, selten
aufgeführte Oper. Mir war nicht nach was Lustigem. Und Bach, das ist ja nicht nur Pest und Tod, er
komponiert auch Zeilen wie „Weichet nur, betrübte Schatten“. Er nimmt einen an der Hand und
führt einen durch die Dunkelheit. Nach der tiefen Depression in der Mitte des Albums hellt sich die
Stimmung wieder auf. Ich wollte die Sinuskurve nachzeichnen, das Auf und Ab, das wir alle gerade
erleben.
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474465/20-21 2/62.2.2021 https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474465/20-21
Ist Bach ein Komponist des Trostes?
Total, er verarbeitet noch in den traurigsten Stücken Tanzrhythmen aus der barocken Suite-
Tradition, verwendet Gigue-Elemente, lädt zur Gavotte. Das mag ich auch in der Popmusik: tief me-
lancholische Stücke, zu denen man beschwingt tanzen kann. Bach ist ein Meister des Danse
Macabre. Es ist gerade schlimm für die Kultur und die Musikwelt, vor allem für die zahllosen
Freischaffenden, trotzdem brauchen wir die Ekstase. Der barocke Mensch hatte mit vielen Infekti-
onskrankheiten zu kämpfen, Pest, Tuberkulose, Syphilis, es gab keine Antibiotika. Der Tod war
omnipräsent, aber es wurden rauschende Feste gefeiert, opulente Opern aufgeführt, und jeden
Sonntag erfreute Bach die Leipziger Kirchgänger mit einer neuen Kantate.
Sie befassen sich gern mit dem Tod. 2014 brachten Sie das Weltkriegsalbum „Behind the
Lines“ heraus. Das Konzerthaus, bei dem Sie Artist in Residence sind, folgt dem Jahresmotto
„Der Pakt mit dem Teufel“, geplant ist ein „Freischütz“ mit La Fura dels Baus. Und Sie hatten
mal eine Gothic- Phase. Woher der Hang zum Morbiden?
Als Opernsängerin kommt man nicht drumherum. Butterfly, Cleopatra, Mimi, Traviata, auf der
Bühne wird viel gestorben. Schon als Kind hat mich Moll mehr angesprochen als Dur. Am tollsten
ist es bei Schubert, wenn die Moll-Lieder fröhlich sind wie „Mut“ in der „Winterreise“ und sich die
„Nebensonnen“ in Dur umgekehrt als das denkbar Traurigste erweisen. Genauso fasziniert mich
bei der Go thic-Szene, welche lebensfrohen, höflichen, unglaublich hilfsbereiten Leute diese düs-
tere Musik hören. Als Teenie fühlte ich mich in der Berliner schwarzen Szene wie in einer Familie.
Man weidet sich an der Melancholie und schöpft Lebensmut daraus. Wobei die Faszination für die
Endlichkeit, das Jenseits und das Leid der verlorenen Liebe ja keine Erfindung des Punk ist. Sie
stammt aus dem Sturm und Drang, aus der viktorianischen Gothic Novel des 19. Jahrhunderts.
In der klassischen Musik scheinen Sie weniger das 19. Jahrhundert zu lieben als den Barock
und die Neue Musik.
Weil das Terrain da weniger abgesteckt ist und sich so viel entdecken lässt. Mit dem Belcanto tue
ich mich schwer. Donizetti, Bellini, da fühle ich mich wie ein Voltigierpferd, mehr wie beim Sport
als bei der Musik. Mein Belcanto ist der Hochbarock, das ist mein Champagner.
Im Video zu „Paradise Lost“ auf Ihrer Webseite tanzen Sie förmlich bei der Aufnahme,
barfuß, mit expressiver Gestik – können Sie dann besser singen?
Wolfgang Katschner, der Leiter der Lautten Compagney, meinte auch bei „Redemption“, du tanzt ja
herum wie ein Skelett! Gerade bei Aufnahmen im Studio hilft es mir sehr, mich zu bewegen. Beim
Liederabend stehe ich auch mal vollkommen ruhig, das hat seinen eigenen Magnetismus. Auf der
Opernbühne ist es die kontrollierte Bewegung: Als Susanna muss ich ständig jemanden an- oder
ausziehen; diese Fummelei erfordert Koordinationstraining, wie wenn man sich mit der einen
Hand den Bauch reibt und mit der anderen auf den Kopf haut. Man singt oft natürlicher, wenn man
von der Gesangstechnik abgelenkt ist.
Und Passagen, vor denen Sie sich fürchten?
Beim Konzert ist meist genug Adrenalin im Spiel, aber bei der Probe denkt man, die Chorsänger
lauern jetzt: Na, kriegt sie den hohen Ton? Es sind schon die Spitzentöne. Wie viele Sopranistinnen
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474465/20-21 3/62.2.2021 https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474465/20-21
braucht es, um eine Glühbirne einzuschrauben? Zehn. Eine holt die Leiter, eine klettert rauf, acht
schubsen sie wieder runter und sagen: So hoch kommt die doch nie!
Es gibt Sopranistinnen-Witze?
Klar, auch Tenorwitze. Wie viele Tenöre braucht es, um eine Glühbirne einzuschrauben? Einen. Er
hält sich an der Birne fest und wartet, bis die ganze Welt sich um ihn dreht.
Ist Singen immer auch etwas Kindliches?
Im besten Fall ja. Wobei wir Profis das leicht verlernen. Aber ich mag es, einen kindlichen Ton an-
zuschlagen und in Mahlers Vierter Sinfonie bei „Das irdische Leben“ vom weiblichen, tröstenden
Engel zum kindlichen Engel zu switchen.
Und ist es gleichzeitig etwas Spirituelles?
Ich bin sehr katholisch geprägt. Unsere Gesellschaft fußt auf dem Christentum und den monothe-
istischen Religionen. Auch Atheisten feiern Weihnachten, es gibt keinen Grund, das verschämt zu
negieren, und wenn die christliche Abendlandsideologie von Pegida und Co. noch so schrecklich
ist. Die Oper erwuchs aus dem szenischen Oratorium, ohne Gottesdienst würde es sie nicht geben.
Mittelalterliche Lieder mit oft unanständigen Texten basieren auf gregorianischen Chorälen, um-
gekehrt hat Händel sich für die Oratorien bei seinen teils schlüpfrigen Opernarien bedient. Das
Profane und das Sakrale sind untrennbar miteinander verbunden. Auch deshalb finde ich es übri-
gens unmöglich, dass beim Lockdown zwischen Kirchen und Konzerthäusern ein Unterschied ge-
macht wird.
Die Kunst sich zu verausgaben, ohne sich zu überfordern, kriegen Sie das hin? Auch Sie hat-
ten schon Kehlkopfentzündungen.
Die Crux ist das Neinsagen-Können. Natürlich ist die Stimme jetzt im Lockdown ausgeruhter. Ich
hoffe, es gelingt mir auch in der Post-Corona-Zeit, nicht von Termin zu Termin zu hetzen, aus
Angst, meine Miete nicht zahlen zu können, wenn ich nicht tausend Projekte habe.Je gestresster
man ist, desto anfälliger wird man für Viren und die klassische Kehlkopfentzündung, vor allem,
wenn man im Winter zwischen Hotels, Flughäfen und Auftritten hin- und herjettet.
Über Nachhaltigkeit reden gerade viele.
Ich hoffe, die Agenturen und Veranstalter besinnen sich tatsächlich. Warum nicht mehr
Residenzen, also auch mal zwei Wochen in einer Stadt, mit mehreren Programmen? Warum steht
auf dem Tourneeplan Berlin–London–Hamburg und nicht die Zugstrecke Berlin–Hamburg? Der
Musikbetrieb muss flexibler werden, auch was den Fetisch Exklusivität betrifft. Da will ein Veran-
stalter ein bestimmtes Werk nur deshalb nicht, weil man es ein paar Tage vorher in einer Stadt auf-
geführt hat, die weniger als 200 Kilometer entfernt liegt. Das ist doch Mist. Oder die
Konzertprogramme: Ouvertüre, Solokonzert, Pause, Symphonie, immer dasselbe. Selbst im 19.
Jahrhundert war man experimenteller als beim eingeschweißten Konzertabo-Angebot von heute.
Was sollte sich noch ändern?
Die Machtstrukturen. Viele Solisten trauen sich zum Beispiel nicht, im Vertrag auf Ausfallhonorar-
Klauseln zu bestehen, weil sie Angst haben, als schwierig abgestempelt und nicht mehr engagiert
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474465/20-21 4/62.2.2021 https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474465/20-21
zu werden. Es gibt tolle, unterstützende Intendanten, Dirigentinnen und Dirigenten, aber eben
auch solche, die hofiert werden wollen. Ohne Hierarchie geht es nicht, einer sollte in der Kunst das
letzte Wort haben. Aber ohne Austausch und die Gemeinschaft aller Gewerke geht es auch nicht.
Ich möchte eine Rolle mitentwickeln dürfen, ich gehöre ja zu denen, die auch schauspielerisch be-
reit sind, sehr weit zu gehen. Ich bin nicht zimperlich, also keine Primadonna.
Sehen Sie sich als Sängerin in der Verantwortung für Frauenbilder?
Wenn die Regie Blondchen in Mozarts „Entführung aus dem Serail“ zum Kammerkätzchen
verniedlicht, ist das furchtbar. Viel lieber arbeite ich mit Schauspielregisseuren wie Michael
Thalheimer, Katie Mitchell, Jürgen Flimm oder Jossi Wieler zusammen, die einen einbinden. Wie
Katie Mitchell habe ich Interesse an komplexen, widersprüchlichen Frauenfiguren. Aber ich fände
es falsch, keine Opfer mehr zu verkörpern. Frauen werden geschlagen und missbraucht, häusliche
Gewalt ist eine Realität. Ein ikonischer Held wie Marlon Brando in „Endstation Sehnsucht" würde
heutzutage nicht mehr als sympathischer, erotischer Mann verherrlicht werden. Aber überall wol-
len die Leute jetzt safe spaces, ich kann das Wort nicht mehr hören. Wer in Watte eingepackt leben
möchte, soll nicht ins Internet gehen. Die Welt ist hart, es gibt böse Menschen, die Böses sagen.
Dieser Radikalisierung kann man aber mit Graustufen entgegentreten. Wir müssen uns mehr mit
den Ambivalenzen des Lebens auseinandersetzen.
Wie haben Sie die MeToo-Debatte erlebt?
Ich hatte den Eindruck, in den USA hört man eher den Opfern zu, mögliche Täter werden schnell
an den Pranger gestellt. Im deutschsprachigen Raum herrscht ein unglaublicher Respekt vor
grauen Eminenzen. Anders kann ich mir die Bereitschaft nicht erklären, großen Künstlern
menschliche Verfehlungen oder sogar Straftaten zu verzeihen. Roman Polanski wird in den USA
verteufelt, in Europa wurde er auf Händen getragen.
Das hat sich inzwischen geändert. Und über den Führungsstil prominenter Dirigenten wurde
kontrovers diskutiert.
Wenn einer wie Simon Rattle große Musik machen kann, ohne rumzuschreien oder andere zu
demütigen, wieso können das andere nicht auch? Bei Rattle geht die Genialität Hand in Hand mit
einer tiefen Menschlichkeit; noch wenn er einen kritisiert, bleibt er Gentleman. Manche Musiker
haben aber auch eine masochistische Ader, sie wollen zusammengepfiffen werden, glauben, nur
dann wird es gut. Es ist nicht leicht, sich im Ökosystem Orchester zu behaupten. Wer schleimt sich
beim Chef ein, wer wird immer ignoriert –da bin ich lieber ein freies Radikal.
Das Gespräch führte Christiane Peitz.
Anna Prohaska, zurzeit Artist in Residence beim Berliner Konzerthaus, ist eine der besten So-
pranistinnen ihrer Generation. Sie stammt aus einer irisch-englisch-österreichischen
Musikerfamilie; der Vater ist Opernregisseur, die Mutter Sängerin.
Aufgewachsen in Wien und Berlin, studierte sie an der Musikhochschule „Hanns Eisler“. Mit 18 de-
bütierte sie an der Komischen Oper, mit 20 an der Staatsoper, der sie seitdem eng verbunden ist.
Sie gastiert regelmäßig an den gro- ßen Opern- und Konzerthäusern der Welt.
Zuletzt erschienen
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474465/20-21 5/62.2.2021 https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474465/20-21
bei Alpha ihre Alben
Redemption und Paradise Lost. Dort kommt auch die Konzerthaus- Jubiläums-CD mit Christoph
Eschenbach und Werken von Weber heraus. Im Konzerthaus nimmt sie im Februar zudem mit
Philippe Jaroussky Pergolesis
Stabat mater auf, das Konzert soll um Ostern
ausgestrahlt werden. Die Gala zum 200.
Geburtstag des Konzerthauses ist für den 26./27. 5. geplant, im Freischütz mit La Fura dels Baus
singt sie das Ännchen (18. 6.).
Gerade probt die 37-
Jährige den Freischütz an der Bayerischen Staatsoper (Streaming-
premiere 13. 2.). Wir
skypen am Abend, in München gilt eine Ausgangssperre ab 21 Uhr.
Prohaska sitzt auf dem Sofa ihrer Unterkunft, sie ist guter Laune und redet sehr schnell.
Mag keine Kammerkätzchen. Anna Prohaska als Susanna in „Figaros Hochzeit“, 2015 an der
Staatsoper. Foto: Imago
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474465/20-21 6/62.2.2021 Berliner Morgenpost
KULTUR SEITE 9 | DIENSTAG 2. FEBRUAR 2021
Berlinale mit vielen Unwägbarkeiten
Ein Event in zwei Stufen, kann das gut gehen? Am Montag stellten die Festivalleiter und die Kulturstaats-
ministerin ihre Pläne für die Festspiele in Pandemie-Zeiten vor
Bei der Berlinale im März wird es kein Publikum geben, keine Gäste und keinen roten Teppich. Auch der Berlinale-Palast
bleibt zu. Zinken picture alliance/dpa
Peter Zander
„Es wird eine ganz einmalige Berlinale“, gibt Carlo Chatrian, der Programmleiter
des Festivals, zu: „Die Lösung, die wir gefunden haben, ist vielleicht nicht die
beste, aber die beste unter diesen Bedingungen.“ Eigentlich hätten die Berliner
Filmfestspiele kommende Woche, am 11. Februar, starten sollen. Doch spätestens
im November, als wegen der Pandemie der zweite Lockdown verhängt wurde, war
klar, dass ein klassisches Festival undenkbar ist.
https://emag.morgenpost.de/titles/bmberlinermorgenpost/10120/publications/830/articles/1290040/9/3 1/52.2.2021 Berliner Morgenpost
Am Montag nun verkündete Chatrian zusammen mit Mariette Rissenbeek, der Ge-
schäftsführerin der Berlinale, genauere Details, wie das Festival in Zeiten von Co-
rona stattfinden soll. Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters wurde
zugeschaltet. Das hat es auf der Berlinale auch noch nie gegeben. Und Grütters
betont, dass alle Entscheidungen selbstverständlich allein Sache der Berlinale-Ver-
antwortlichen blieben. „Aber was die Form der diesjährigen Filmfestspiele und de-
ren Finanzierung angeht“, so die CDU-Politikerin, „musste die Politik diesmal
doch intensiver einbezogen werden.“ Seit November habe man sich immer wieder
beraten und mehrere Varianten besprochen, ob und wie ein Festival vertretbar sein
könne. Das jetzige Pressegespräch wurde dann aber doch recht kurzfristig, man
könnte auch sagen: hastig einberufen. Ein Zeichen für den Krisenmodus des
Festivals.
Der März gehört der Industrie, der Juni dem Publikum
Im Rückblick grenzt es an ein Wunder, dass die 70. Berlinale am 29. Februar 2020
zu Ende ging, ohne dass auch nur eine einzige Corona-Infektion auf dem Festival
festgestellt wurde. Kurz danach ging die Infektionskurve steil nach oben, und es
folgte der erste Lockdown. Dann hoffte man lange, dass die Pandemie bis zur
nächsten Ausgabe ausgestanden oder doch kontrollierbar sei. Davon kann noch
keine Rede sein. Die 71. Berlinale wird deshalb, wie bereits im Dezember
verkündet, aufgesplittet. Ein Industrie-Event wird es in einem Monat geben, in ent-
schlackter Form vom 1. bis 5. März, also nur halb so lang wie üblich. Vom 9. bis
20. Juni soll dann ein Publikums-Event folgen, in dem Filmfans die Festivalfilme-
beiträge nachholen können.
https://emag.morgenpost.de/titles/bmberlinermorgenpost/10120/publications/830/articles/1290040/9/3 2/52.2.2021 Berliner Morgenpost
Jetzt wurden mehr Details genannt. Dabei hebt die Berlinale noch einmal hervor,
dass die 71. Ausgabe kein Online-Festival wird. Filme können also nicht von Cine-
asten zuhause gegen ein Entgelt gestreamt werden, wie das zuletzt kleinere Festi-
vals wie Tribeca in New York oder die Nordischen Filmtage in Lübeck angeboten
haben. Es stand auch zur Diskussion, das Festival ganz abzusagen. Das wäre sicher
das Einfachste gewesen. Und das hätte wohl auch jeder verstanden. Doch das kam
nicht in Frage. Denn damit, so Grütters, wolle man gleich zwei Signale setzen. Ein
filmpolitisches Signal, dass für die globale Filmwirtschaft trotz Corona das Jahr
traditionell mit dem Europäischen Filmmarkt startet. Und ein Signal an das
Publikum, das seit Monaten keinerlei kulturelle Veranstaltungen besuchen kann
und dem man mit dem „Summer Special“ Hoffnung machen will. Für manche er-
füllt sich damit sogar ein Traum, dass die Berlinale wieder zur schönsten
Jahreszeit, im Sommer, stattfindet. So wie schon bei der allerersten Berlinale vor
70 Jahren, am 6. Juni 1951, und dann bis 1977.
Die Zweiteilung wirft indes viele Fragen auf. Die kniffligste: Kann unter solchen
Umständen so etwas wie Berlinale-Feeling oder Festivalfieber überhaupt
aufkommen? Die Filmindustriellen werden ihre Geschäfte diesmal vom heimischen
Computer aus und nicht im Martin-Gropius-Bau abschließen. Dennoch soll es auch
ein offizielles Programm geben, bei dem – außer den Berlinale-Classics und der
Hommage – sämtliche Sektionen vertreten sind. Auch einen Wettbewerb wird es
geben, das Zentrum oder, wie Chatrian meint, „die Sonne des Festivals“. Nur mit
deutlich weniger Filmen: rund 100. Im Vorjahr waren es noch 340. So viele Filme
kann kein Mensch in so kurzer Zeit sehen. Ein Pensum von 100 zwar auch nicht,
aber die Zahl ist wenigstens überschaubarer. Wie viele Filme die Berlinale durch
das Hin und Her aber an Cannes verloren hat, wollte Chatrian nicht verraten.
Eine Berlinale light: Es wird keine Premieren im Berlinale-Palast geben, keine
Gäste, keinen roten Teppich. Die Filme werden erst mal nur Vertreter der Filmin-
dustrie sehen, ein paar ausgewählte Journalisten – und vier Jurys, die am Ende
auch ihre Preise bekanntgeben.
https://emag.morgenpost.de/titles/bmberlinermorgenpost/10120/publications/830/articles/1290040/9/3 3/52.2.2021 Berliner Morgenpost
Die Zuschauer werden die Filme erst am 9. Juni nachholen können, in den üblichen
Kinos, und wohl auch an mehreren Open-Air-Standorten. Selbst über Autokinos
denkt man derzeit nach. Noch völlig unwägbar ist, wie gut man die Pandemie im
Sommer schon im Griff hat und wie viele Zuschauer in welchem Abstand vonein-
ander sitzen können. Der Berlinale-Palast, sonst der Festivalanker, wird dabei nicht
bespielt, dafür soll es vom Eröffnungsfilm und anderen Beiträgen mehrere Vorfüh-
rungen gleichzeitig geben. Dann auch mit einem roten Teppich und, so hofft das
Festival, mit ein paar Gästen der Filme.
Wie spannend aber wird es sein, einen Wettbewerb zu verfolgen, dessen Preise
längst feststehen? Ein Festival hat seine eigene Dynamik. Ein Film wie „Toni
Erdmann“ hat in Cannes für Furore gesorgt, auch wenn er am Ende keinen einzigen
Preis erhielt. Aber wird man im Sommer wirklich Filme sehen wollen, von denen
man dann schon weiß, dass sie keinen Bären gewonnen haben, die also von Anfang
an wie Verlierer dastehen? Und reizt es wirklich, wenn die Preisverleihung im Juni
nachgeholt wird, wenn die Sieger dann schon drei Monate feststehen? Und was
überhaupt, wenn die Lockerungen bis dahin doch noch nicht so weit gehen, wie
man zurzeit hofft? Es gibt dazu, das macht Mariette Rissenbeek ganz klar, keinen
Plan B.
So oder so bleibt die Berlinale 2021 ein Festival mit vielen Unwägbarkeiten. Auch
was die Finanzen betrifft. Das Budget von zuletzt rund 26 Millionen Euro setzt sich
zu je einem Drittel aus Bundesmitteln, Sponsorengeldern und Ticketverkauf
zusammen. Doch noch kann niemand voraussagen, wie viele Tickets (2020 wurden
350.000 verkauft) man in diesem Jahr anbieten kann. Deshalb wird der Bund, der
schon zum 70. Jubiläum 2020 um 1,3 Millionen Euro aufstockte, noch stärker
einspringen.
Im schlimmsten Fall drohen 15 Millionen Euro Verlust
Und deshalb ist auch Monika Grütters zugeschaltet. Für Einnahmenausfälle gebe es
ein Best- und ein Worst-Case-Szenario: zehn und 15 Millionen Euro. Der Bedarf,
orakelt sie, wird „irgendwo dazwischen“ liegen. Das aber, betont sie, sei die Berli-
nale der Politik wert. So einen großzügigen Zuschlag in einem Superwahljahr ver-
künden zu dürfen, ist natürlich auch die beste Werbung für die
Kulturstaatsministerin. Zumal, wenn sie das beim Sommer-Event noch mal in aller
Öffentlichkeit wiederholen kann – so kurz vor der Bundestagswahl.
https://emag.morgenpost.de/titles/bmberlinermorgenpost/10120/publications/830/articles/1290040/9/3 4/52.2.2021 Berliner Morgenpost
Keinen richtigen Spaß machen dürfte in diesem Jahr die Jury-Tätigkeit. Die Inter-
nationale Jury, die am Ende die Bären vergibt, wird auf sechs Teilnehmer reduziert.
Die aber werden, darauf legt Carlo Chatrian wert, wirklich in Berlin sein und zu-
sammen ins Kino gehen. Davor werden sie erstmal in Quarantäne gehen und dann
auch die Berlinale light als solche erleben. Dennoch kann Chatrian mit einer Spit-
zenjury aufwarten.
Sie alle, sechs Frauen und sechs Männer, haben bereits einen Goldenen Bären
gewonnen. Fünf davon in den letzten fünf Jahren: der Iraner Mohammad Rasoulof
2020 für „Es gibt kein Böses“, der Israeli Nadav Lapid 2019 für „Synonymes“, die
Rumänin Adina Pintilie 2018 mit „Touch Me Not“, die Ungarin Ildikó Enyedi 2017
mit „Körper und Seele“ und der Italiener Gianfranco Rosi 2016 mit „Seefeuer“.
Außerdem kommt noch die die Bosnierin Jasmila Žbanić hinzu, die 2006 mit
„Grbavica“ gewann.
Rasoulof freilich wurde vom Iran, auch wegen seines Siegerfilms, unter Hausarrest
gestellt. Und wird als Einziger seine Jurytätigkeit von zu Hause aus vornehmen. Es
wird aber nicht, wie noch 2011 bei Jafar Panahi, einen leeren Stuhl in der Jury
geben. Stattdessen wird Rasoulof von einem Vertrauten vertreten. In diesem Jahr
wird es auch keinen Jury-Präsidenten geben. Unter Goldbären-Gewinnern kann es
laut Chatrian niemanden geben, der über den anderen steht. In Zeiten von Gleich-
stellung und Diversität ist auch dies ein klares Signal.
Berliner Morgenpost: © Berliner Morgenpost 2021 - Alle Rechte vorbehalten.
https://emag.morgenpost.de/titles/bmberlinermorgenpost/10120/publications/830/articles/1290040/9/3 5/52.2.2021 https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466353/11
F.A.Z. - Feuilleton Dienstag, 02.02.2021
Tyrannei als Privatsache
Kanadas Theater und die Meinungsfreiheit
Das Theater der Gegenwart scheint kein Ort der politischen Debatte, sondern der moralischen
Manifestationen. Wenn Regisseurinnen oder Dramaturgen sich mit ihren Inszenierungen
„politisch äußern“, dann klingt das heute meist wenig provokativ, sondern im besten Fall
öffentlich-rechtlich. Nahezu kein Theater hierzulande, das sich nicht als Zeichen des Kampfes
„gegen rechts“ dem Verein „Die Vielen“ angeschlossen hätte, dessen ehrhaftes Ziel es ist, „an
einer Gesellschaft zu arbeiten, die sich aus Menschen aller Hautfarben und Geschlechtervaria-
tionen, vieler sexueller Orientierungen, unterschiedlichster Bedürfnisse und Fähigkeiten
zusammensetzt“. Was aber als Zielvorhaben fehlt, ist eine Vielfalt der Überzeugungen. So
musste ein renommierter Regisseur wie der Lette Alvis Hermanis vor einigen Jahren erfahren,
dass sich in Deutschland die Bühnenhäuser von ihm abwandten, nachdem er sich kritisch zur
westeuropäischen Migrationspolitik geäußert hatte. Seitdem wird er bei Wikipedia als „konser-
vativ“ geführt und inszenierte wieder vornehmlich in Riga.
Der von Theatern oft beschworene Wert der Diversität ist in Wahrheit nämlich recht exklusiv:
Er beschränkt sich auf Herkunft und Geschlecht, aber nicht auf Geisteshaltungen oder
Meinungen. Auf diesen blinden Fleck im Theaterbetrieb hat nun die kanadische Schauspielerin
und Dramatikerin Carmen Aguirre in einem klug argumentierenden Video-Essay hingewiesen.
Sie, die auf ihre chilenischen Wurzeln stolz ist und nach eigenen Angaben ihr Leben lang dafür
gekämpft hat, dass Menschen aus den kaum sichtbaren Teilen der Gesellschaft „ihr ganzes
Selbst auf der Bühne zeigen können“, kritisiert scharfzüngig die Hypokrisie, die inzwischen das
Klima an vielen Theatern präge. In ihrer knapp dreißigminütigen Rede bezeichnet sie die letz-
ten Jahre im Theaterbetrieb als „beschämende Zeit der großen Säuberung“, die von Grausam-
keit und psychologischer Gewalt und nicht von Empathie und Solidarität gekennzeichnet
worden sei. Statt Konflikte als inspirierend zu begreifen, habe sich am Theater eine Geisteshal-
tung eingebürgert, die nicht mehr zwischen richtigen und falschen, sondern nur noch zwischen
guten und bösen Meinungen unterscheide, und jene, die sich dem Einverständnis mit den
absoluten Wahrheiten der identitären Linken entziehen, auf den Platz „rechts außen“ verweise.
Aguirre zählt Beispiele für digitale Mobilmachung gegen Theatermacher auf, die etwa den
Buchtitel einer Transfrau kritisiert oder ein Video von Jordan Peterson geteilt hatten. In der
Theaterszene von Vancouver herrsche mittlerweile ein Klima der Angst und der Selbstzensur,
das nicht vom Staat, sondern von „Säuberern“ in der Szene selbst hervorgerufen werde, die mit
den Mitteln einer „privatisierten Tyrannei“ dafür sorgten, dass Menschen öffentlich gedemü-
tigt, in sozialen Netzwerken gemobbt und von ihren Arbeitgebern gefeuert würden – nicht weil
sie gegen festgelegte Gesetze der „hate speech“ verstoßen oder sich unanständig verhalten
hätten, sondern schlicht kontroverse Überzeugungen geäußert hatten.
https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466353/11 1/22.2.2021 https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466353/11
„Warum erwarten wir, dass im Theater alle dieselbe Geisteshaltung teilen?“, fragt Aguirre, „wo
wir doch auch nicht annehmen, dass in einem Restaurant oder in einer Fabrik alle einer politi-
schen Meinung sind.“ Die erfolgreiche Buchautorin, die in Vancouver ein lateinamerikanisches
Theaterkollektiv gegründet hat, fürchtet, dass die Kreativität Schaden nehmen könnte. Kunst,
die nur noch Statements produziere und sich nicht traue, offene Fragen zu stellen, sei keine.
Manches von dem, was Aguirre vorbringt, klingt selbstverständlich: Etwa, dass der Begriff der
öffentlichen Debatte nicht allgemeines Einverständnis bedeute und der mit Worten ausgetra-
gene Konflikt ein Zeichen des Fortschritts sei. Aber die Verve, mit der sich hier eine Vertreterin
der Minderheitsgesellschaft zum künstlerischen Wert des kontroversen Austauschs bekennt,
ist beeindruckend: „Wenn wir statt einer Souveränität des Denkens eine Uniformität der
Gedanken in unserer Theaterwelt wollen, haben wir kein Recht, zu behaupten, dass wir uns
bemühen, inklusiv und vielfältig zu sein. Dann haben wir kein Recht, Kunst zu machen.“
Aguirres leidenschaftlicher, inzwischen vielverbreiteter Zwischenruf ist ein weiterer Beweis
dafür, dass die Identitätspolitik besonders wirkungsvoll von jenen kritisiert werden kann, die –
nach der Eigenlogik der Theorie – zu ihrer eigentlichen Zielgruppe gehören. Zum Charakter
der „identity politics“ bemerkt die dreiundfünfzigjährige Chilenin nüchtern, dass es sich dabei
um die politische Theorie einer Mittelklasse handele, die damit vor allem Selbstidentifikation
und „elitäre Sprachspiele“ betreibe. Allerdings mit einem mächtigen Einfluss: Vor allem von
jüngeren Menschen habe sie begeisterte Zuschriften erhalten, viele hätten jedoch Angst, das
Video zu teilen. SIMON STRAUSS
https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466353/11 2/22.2.2021 https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466353/12
F.A.Z. - Feuilleton Dienstag, 02.02.2021
In der Gewalt der Wellen
Ein hinreißender Ballettabend an der Pariser Oper wird zu einem wunderbaren
Film. Doch sehen kann man ihn nur in Frankreich.
Filmaufzeichnungen geben einen vollkommen anderen Eindruck von einem Tanzstück, als
Zuschauer ihn während einer Vorstellung gewinnen können. Erst die Kamera erlaubt dem
Publikum eine im Theater nie gekannte räumliche Nähe zu den Tänzern. Kameraleute, Regis-
seure und Choreographen haben in den letzten Jahren die Scheu vor Nahaufnahmen verloren.
Durch sie wird es zwar schwieriger, die choreographischen Raummuster wahrzunehmen, doch
steht dem der Gewinn einer ungeahnten Intimität gegenüber, das Gefühl, einbezogen in die
Bühnenhandlung zu sein, wo man sonst, doppelt getrennt durch großen Abstand und Bild-
schirm, seine ganze Konzentration braucht, um nicht am Ende ungerührt und distanziert zu
bleiben.
Die Möglichkeiten der audiovisuellen Dokumentation und Digitalisierung sind auch für den
Tanz im Lockdown ein Glücksfall. Wie jetzt die Fernsehausstrahlung eines neuen Ballettabends
der Pariser Oper demonstrierte, der unter dem Titel „Choreographieren heute“ vier Urauffüh-
rungen versammelte, sind es die Erfahrungen der Choreographen im Metier Film, die sich in
phantastischen Bildern niederschlagen. Das gilt in besonderer Weise für die Arbeiten von zwei
der Beteiligten, Sidi Larbi Cherkaoui und Damien Jalet. Hatte Cherkaoui etwa 2018 Beyoncé
und ihrem Mann Jay-Z geholfen, sich für das im Louvre gedrehte Video zu ihrem Song „Apes-
hit“ tänzerisch zu inszenieren, so choreographierte Damien Jalet 2019 den Netflix-Musikfilm
von Paul Thomas Anderson, den Radiohead-Sänger Thom Yorke zu seinem Soloalbum
„Anima“ produzierte und sich dabei als exzentrischer, aber fabelhafter Tänzer zeigte. An ihren
neuen Werken für die Pariser Tänzer lässt sich auch ablesen, wie genau die schauspielerischen
Ausdrucksmittel des Ensembles inzwischen auf die Arbeit mit der Kamera abgestimmt sind.
Die jetzige Generation von Tänzern und Choreographen ist mit diesem Medium groß geworden
und prädestiniert dafür, den Tanz im Film durchzusetzen und zu mehr als einem Nischenpro-
gramm für die Mitternachtssendeplätze von Arte zu machen. Damien Jalet und Sidi Larbi
Cherkaoui haben sich das Tanzen selbst beigebracht, indem sie vor dem Fernseher Musikvide-
os mittanzten. Kein Wunder, dass sie das elektronische Framing ihrer Bewegungen lieben.
Dass sich Tänzer dem Blick der Kamera, den Blicken der anderen um sie herum aussetzen,
aber auch wie wir alle der schwierigen Pandemielage ausgeliefert sind, das alles lässt sich mit
Cherkaouis Stücktitel „Exposure“ mühelos assoziieren. Wer die vom Haus Chanel elegant
eingekleideten Tänzer sieht, kann sich eines Gefühls der Beklemmung nicht erwehren.
Zwischen den vergoldeten barocken Logen liegt das blendend weiße Quadrat des Tanzbodens.
Das Ensemble bewegt sich wie in einem staub- und keimfreien Studio, gerahmt von den Zeug-
nissen einer einschüchternden Vergangenheit. Die Tanzfläche ist über den leeren, geschlosse-
nen Orchestergraben gebaut. Getanzt wird in „Exposure“ vor zwei wandhohen weißen Stell-
wänden. Perfekt natürlich geschminkt, tanzen die Frauen in schwarzen Strumpfhosen, deren
Fußsohlen verstärkt wurden, und schwarzen engen Trikots oder in weißen Seidenkleidern.
https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466353/12 1/22.2.2021 https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466353/12
Das zentrale Paar tanzt mit Masken, denn es war kurz vor den Aufnahmen aus der Quarantäne
zurückgekehrt. Eine Kamera hängt im Bühnenhimmel und bietet immer wieder die Vogelper-
spektive auf das Stück: arme, hilflose Wesen. Wie fühlt es sich an, jederzeit und aus allen
Winkeln betrachtet zu werden, welchem Perfektionszwang, welchem Druck der Umwelt sind
wir ausgesetzt? Andererseits, und das unterstreicht Cherkaoui, indem er einen Tänzer mit
einer Kamera ins Geschehen schickt und die Bilder live projiziert, sind es aufsehenerregend
schöne Bilder, die so entstehen. An die Wand geworfene Zitate der Künstlerin Nan Goldin
betonen, das Fotografieren sei ein Akt der Zärtlichkeit und der Nähe. Subtil schöpft das Stück
diese Ambivalenzen aus, manchmal allerdings wird diese Energie fast zu schön, um wahr zu
sein. Traumverloren erklingt dazu der elegische, elektronisch begleitete Gesang von DJ und
Komponist Woodkid.
Seine Auftragsmusik für Damien Jalets „Wellenbrecher“ spielt der japanische Komponist und
Pianist Koki Nakano selbst ein. Ein grauer, an Schwarzweißaufnahmen des Meeresbodens erin-
nernder Tanzteppich und fließende, graugestreifte Unisex-Kostüme des französischen
Streetart-Künstlers und Fotografen JR sind zugleich abstrakt und zusammen mit dem gleißend
wie Sonnenstrahlen zwischen Wolken hervorbrechenden Licht auch gut für Naturassoziatio-
nen. Die Choreographie für neun Frauen und Männer ist viel rauher, geerdeter, kraftvoller und
ungeschönter als Cherkaouis Stück. Viel Bewegung kommt auf Knien getanzt aus den weit
schwingenden Oberkörpern. Mal sind es die Tänzer, die Wellen zu brechen scheinen, sich
gegen das Untergehen, Ertrinken, das Sterben wehren, dann wieder sind sie die Welle, ein
gemeinsamer Körper, eine Naturgewalt. Am Ende liegen sie in der Form eines Zodiaks auf dem
Boden, gesunken mit einem eigentlich unsinkbaren Wellenbrecherboot. Verlieren wir eines
Tages den Kampf gegen die Naturgewalten?
Diese beiden eindringlich gegenwartsbezogen und tief reflektierten Stücke und auch die ergän-
zenden Arbeiten von Tess Voelker und Mehdi Kerkouche stehen noch sechs Monate auf der
Website der Pariser Oper. Produziert hat den Film allerdings der Fernsehsender France 5, und
auf dessen Seite wird man in Frankreich weitergeleitet, um den Abend gratis zu sehen. Aber
eben nur in Frankreich! Das nennt man Geoblocking: Der Tanz, die internationalste künstleri-
sche Sprache der Welt, aufgehalten von Lizenzen. Die Inhalte anderer Ensembles wie etwa des
Royal Ballet in Covent Garden oder des Bayerischen Staatsballetts sind Eigenproduktionen und
manchmal nur gegen Gebühr zu sehen, aber von überall. Das Ballett der Pariser Oper sieht
derzeit aus Deutschland nur, wer zu kriminellen Handlungen willens und in der Lage ist. Ein
Unding. Wiebke Hüster
https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466353/12 2/22.2.2021 https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/802173/10
KLASSIKKOLUMNE
Ham let flucht. Die Welt sei aus dem Leim ge gan gen und aus ge rech net er, „ver flucht, Verdruss!“, müs se sie jetzt wie -
der wie ein stüm pern der Heimwer ker (Gott sei Dank, dass die Bau märk te der zeit ge schlos sen sind!) not dürf tig zu-
sam men flicken. Das Bei spiel des ne ben Oblo mow be rühm tes ten Nichts tuers der Li te ra tur ge schich te lehrt uns Heu-
ti ge, dass es kei ner Seuche be darf, um die Welt schau rig und mies zu fin den. Ham lets „The world is out of joint“ lässt
den un be darf ten Le ser na türlich ganz un bewusst an Dro gen den ken und die da mit dro gen haft be tö ren de Wir kung
von Mu sik. Das gilt auch und be son ders für den hem mungs lo sen Kon struk tivis ten Jo hann Se bas ti an Bach . Und da
die Zei ten schon mal aus den Fu gen sind, spricht rein gar nichts da ge gen, des sen Weih nachts-Ora to ri um jetzt mit
ein mo na ti ger Verspä tung (oder elf Mo na te zu früh) zu hö ren. Zu mal die se Mu sik, fern von Weih nachts rum mel und
Tan nen bäu men sehr viel stär ker und be frei ter wirkt. Ha ben nicht auch die Christ bäu me an äs the ti schem Wert ge -
won nen, seit es kein La met ta mehr gibt? Wie dem auch sei, die Neuein spie lung durch den Al te-Mu sik-Alt meis ter
Jor di Sa vall , er wird im Som mer die sen Jah res und nur we ni ge Ta ge nach sei nem gleich alt ri gen Kol le gen Ric cardo
Mu ti 80 Jah re alt, be ein druckt durch ei ne ka tho lisch ba ro cke Klan gent fal tung (AliaVox).
Aber so viel Le bens be ja hung ge gen die mie se Welt wie Bach bringt nicht je der Mu si ker auf. Vor al lem nicht die Sän -
ger Ge org Nigl (Al pha) und Phil ip pe Ja rouss ky (Era to), die sich auf ih ren ak tuel len Al ben der Va ni tas verschrie ben
ha ben, der Sinn lo sig keit und Flüch tig keit der re al exis tie ren den Welt. Der bi bli sche Exis ten zia list Ko he let, der Ur va -
ter die ser Phi lo so phie, spricht vom Wind hauch, mo der ne Exege ten überset zen den Kern satz Ko he lets mit „Al les ist
sinn los.“ Nun sind die Al ben Nigls wie Ja rouss kys durch aus nicht sinn los. Die Va ni tas, die bei de be schwö ren, äh nelt
sehr dem Wind hauch Ko he lets: Ist doch je de Mu sik ge nau so schnell wie ein Wind hauch vor bei, exis tiert die Sü ße des
Ge sangs doch nur in ei nem un mess bar kur zen Mo ment – und dann in der Er in ne rung, die ei nem ei ne Stim me
manch mal Jahr zehn te lang nicht ver ges sen lässt. Der Coun ter te nor Ja rouss ky bril liert in To des sehn süch ten des Ba -
rock, der Ba ri ton Nigl spannt den Bo gen von Ludwig van Beet hovens wi derspens ti ger „Fer ner Ge lieb ter“ über Schu-
bert-Lie der hin zu Traum stücken nach Tex ten des Ba rockdich ters und Va ni tas-Ex per ten An dre as Gry phi us. Die hat
Wolf gang Rihm in Mu sik ge setzt und der ganz un prä ten tiö se Rihm-Ex per te Nigl singt sie mehr als nur gut. So je den -
falls ist die Sinn lo sig keit der Welt ziem lich leicht zu er tra gen.
Me dea da ge gen, die gro ße Lie ben de, Zau be rin und nicht nur die Mörde rin der ei ge nen Kin der, er trägt die Va ni tas
der Welt aber so gar nicht. Sie stört kon kret, dass ihr in nig ge lieb ter Ja son, für des sen Lie be sie wirk lich al les und
noch mehr ge tan hat, sie jetzt schnö de für ein nichts sa gen des Prin zes schen verlässt. Wes halb Me dea dem Ja son das
Liebs te um bringt, die ge mein sa men Kin der. Der aus Böh men stam men de, vor al lem in Deutsch land tä ti ge Ge org An ‐
ton Ben da , ein Früh klas si ker, hat die se bit te re Ge schich te als pa cken des Me lo dram ver tont, al so für Sprech stim men
mit il lus trie ren der und die Groß ge füh le zu lie fern der Mu sik. Die Schau spie le rin Ka tha ri na Thal bach nutzt als Me dea
al le Mit tel ex trover tier ter Schau spiel kunst, ih re hoch schäu men den Emo tio nen werden durch den Di ri gen ten Mar-
cus Bösch wei ter an ge heizt, und zu letzt ist der Hö rer gern be reit, Mes ser, Pis to le oder Gift zum Kin der mord zu rei-
chen. Ob dann die Va ni tas der Welt er träg licher wird? (Coviel lo)
Die Flucht aus den gän gi gen For men der Kunst mu sik, wie sie Ben da in sei nem Me lo dram vor macht, erleich tert es
of fen sicht lich, die Va ni tas der Welt zu er tra gen. Ei ne seit der Wie ner Klas sik gern ge üb te Welt flucht führt di rekt zur
Volks mu sik, de ren rot zi ge Wi derstän dig keit sich nur un gern den er ha be nen Zie len der Klas sik fügt. Die bes ten
Volks lied be ar bei ter krie gen denn auch den Spa gat zwi schen un be hauen und raf fi niert hin, zwi schen Wind hauch
und Ewig keit. So Lu cia no Be rio in sei nen „Folk Songs“ , die flüch ti ge Mo men te der Schön heit durch Mo der ne-Ein -
spreng sel in Zart heit und Brüchig keit ver zau bern. Der im mer stets Zau be reien voll brin gen de Di ri gent Syl vain Cam ‐
bre ling und die über wäl ti gen de Sän ge rin Ca trio na Mo ri son ge ben Be rio, aber auch Ma nuel de Falls To des fan ta sie „El
amor bru jo“ ei nen traum haf ten Touch, Zart heit und Zu kunfts freu de mit (Sym pho ni ker Ham burg).
Rein hard J.
Brem beck
https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/802173/10 1/2Sie können auch lesen