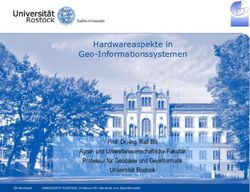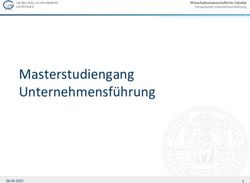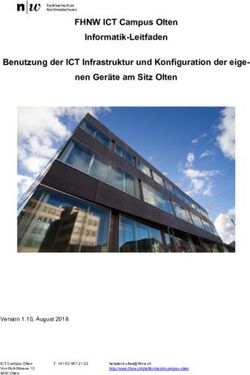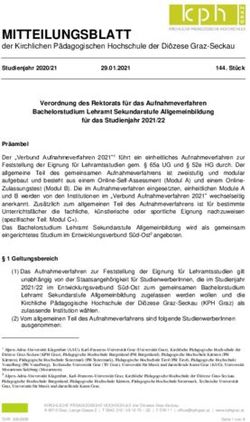Professionalisierung in den Berufspraktischen Studien - Aktuelle Erkenntnisse Prof. Dr. Julia Kosinar - PHBern
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Professionalisierung in den Berufspraktischen Studien -
Aktuelle Erkenntnisse
Prof. Dr. Julia Kosinar
Professur für Professionsentwicklung
Pädagogische Hochschule FH NordwestschweizInhalte des Vortrags 1. Berufspraktische Studien – der heilige Gral zur Berufsbefähigung 2. Professionalität und Professionalisierung: Theoretische Rahmung eines bewegten Diskurses 3. Das Praktikum aus Sicht von Studierenden: A) Entwicklungsaufgaben und Anforderungen in den schulpraktischen Studien B) Typen der Anforderungsbearbeitung. C) Spannungsfelder zwischen Praxislehrpersonen und Studierenden 4. Implikationen für die berufspraktische Ausbildung 5. Stabilität der Orientierungen = wie geht es weiter im Berufseinstieg? 6. Diskussion Prof. Dr. Julia Kosinar, Institut Primarstufe, Pädagogische Hochschule FHNW 28.05.18 2
1. Berufspraktische Studien- der heilige Gral zur Berufsbefähigung? PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 3
Zum Stand der Forschung
Zur Bedeutung von Praktika: z.B. Kosinar, Schmidt & Diebold 2016, Hascher
2012, Arnold et al 2011.
Problem der Bewertung:
Unterricht, der gelingt wird, wichtiger als lernförderlicher Unterricht => Fokus
Performanz
Ungewissheit und Interaktionsdynamik wird durch „Prepen“ versucht zu
vermeiden => Fokus Gewissheit
Zur Wirksamkeit von Praktika: z.B. De Zordo & Hascher 2017, Bach 2013,
Hascher 2011.
Mythos Praktikum (Hascher 2011) – obwohl die Wirksamkeit von Praktika
empirisch nicht eindeutig nachgewiesen wurde, wird davon ausgegangen, dass
Praktika per se wirkungsvoll sind und zur Professionalisierung beitragen.
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 4Professionshochschulen und Praxisfeld
Erwartungsdruck von Seiten des Praxisfeldes – unausgesprochene Erwartungen
von Seiten der PH (Stichwort: Akademisierte Lehrerbildung)
=> widersprüchliche Erwartungen – fehlende Kommunikation – „Theorie-Praxis-
Problem“.....
Berufspraktische Studien mal anders gedacht (Leonhard u.a. 2016):
- 2 Logiken: der Hochschule(n) und der Schule(n) mit ihren jeweiligen
Rahmenbedingungen und ihren Akteur/innen.
- 2 Praxen: Wissenschaftspraxis und Berufspraxis
- 2 Theorien: wissenschaftsbasierte Theorien, Konzepte, Empirie und mit
Praxiserfahrungen angereichertes Erfahrungswissen / kasuistisches Wissen /
pädagogisches und fachliches sowie fachdidaktisches Wissen
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 5Ausbildungsformate schulpraktischer Professionalisierung (Kosinar, 2018)
Praktikum Basis- Reflexionsseminar
Als authentischer Erfahrungsraum, Als Fallwerkstatt: über kasuistische
seminar Zugänge methodisch kontrolliert und
der seiner eigenen Logik und seinen Grundlegung
Notwendigkeiten folgt => keine theoriegeleitet analysieren => keine
basaler
„Aufträge“ der PH erfüllen Wissensbestände „Planungssitzungen“, kein Austausch
und Techniken von „Tipps“
Kultur der Nähe = Mentorat Kultur der Distanz =
Erfahrungen machen Biographisch- theoriegeleites Analysieren und
Aus der reflexive Arbeit; Reflektieren; das eigene
Handlungsnotwendigkeit Austausch in Handeln / Entscheidungen
Entscheidungen treffen Erfahrungsgemein begründen
-schaften
Praxisbesuche
Reden über Unterricht aus verschiedenen
Begründungszusammenhängen. Gemeinsames
Nachdenken über Folgelektionen und
Handlungsalternativen
Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für ProfessionsentwicklungNeuere Formen der Zusammenarbeit
Das Partnerschulmodell
• 1 Schule (ein Verbund)
• 12 Studierende
• 6 Praxislehrpersonen
• 1 Koordinationsperson (Schule)
• 1 Moderator/in (PH); zugleich Reflexionsseminarleitung und Mentor/in
• 1 Fachdidaktiker/in
Der hybride Raum: Interinstitutionelle Kooperation und regelmässiger
Austausch aus den jeweiligen Perspektiven, geteiltes
Professionaliserungsverständnis, gemeinsam getragene Verantwortung für
die Ausbildung, gemeinsame Reflexionsseminare, ein Projekt
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 72. Professionalität und Professionalisierung -
Theoretische Rahmung eines bewegten Diskurses
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 8Ein paar einleitende Worte zu Begrifflichkeiten 1. Professionalität a) eine modellhafte Zusammenstellung verschiedener Wissens-und Inhaltsbereiche sowie Dispositionen von Lehrpersonen / Kompetenzen (z.B. Baumert/Kunter 2006, Bauer 2005, Keller-Schneider 2010, Nieke 2012) Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für Professionsentwicklung
Modelle lehrberuflicher Professionalität
Baumert & Kunter 2006, Kunter u.a. 2011
(Paseka u.a. 2011, 24)
Struktur der professionellen pädagogischen Handlungskompetenz (Nieke 2012, 51)
Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für ProfessionsentwicklungEin paar einleitende Worte zu Begrifflichkeiten 1. Professionalität a) eine modellhafte Zusammenstellung verschiedener Wissens-und Inhaltsbereiche sowie Dispositionen von Lehrpersonen / Kompetenzen (z.B. Baumert/Kunter 2006, Hericks 2006, Bauer 2005, Keller-Schneider 2010, Nieke 2012) b) als Qualitätsaussage über das pädagogische Handeln (Helsper/Tippelt 2011) 2. Professionalisierung: (berufliche) Entwicklungsprozesse (angehender) LP – sehr unspezifische Konzeptionen (z.B. Frey 2002), Stufenmodelle (z.B. Dreyfus/Dreyfus 1987, Fuller & Brown 1975), komplexere Modelle (z.B. Keller- Schneider 2010, Kosinar 2014), die die Prozessstruktur aufgreifen. Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für Professionsentwicklung
Modelle (lehr-)beruflicher Professionalisierung
3. Stufe
2. Stufe „routine stage“
1. Stufe „mastery stage“ Die Lehrperson bemüht sich
„survival stage“
um die Ausübung
Die Lehrperson bemüht sich
erzieherischer
um Beherrschung/ Gestaltung
Verantwortung. Schülerinnen
Die Lehrperson ist damit der Unterrichtssituation.
und Schüler und deren
beschäftigt, den Alltag zu Langsam erfolgt eine
individuelle Interessen und
bewältigen und im Ablösung vom Ich-Bezug
Nöte stehen im Zentrum.
Klassenzimmer ‚zu zum Situationsbezug, vom
Übergang auf eine
überleben‘. Sie ist sich blossen Überleben zur
individual-pädagogische
gewissermassen selbst noch routinierten
Perspektive.
das grösste Problem. Unterrichtsgestaltung. Kompetenzentwicklung nach Frey (2006, 127)
Stufenmodell nach Fuller/Brown 1975, in Messner/Reusser 2000, 160
Rahmenmodell der Anforderungswahrnehmung und Kompetenzentwicklung
Fünfstufiges Experten-Novizenmodell nach Dreyfus/Dreyfus 1987
(Keller-Schneider 2010)
Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für ProfessionsentwicklungDrei professionstheoretische Zugänge
1. Der strukturtheoretische Ansatz
• beschreibt im Anschluss an Oevermann (1996) das pädagogische Handeln
von seiner Strukturproblematik her
• verweist auf dessen antinomischen (Helsper 1996), diffusen und quasi-
therapeutischen Strukturen.
2. Der kompetenztheoretische Ansatz
• setzt bei der Organisation schulischer Lernprozesse an
• bildet zentrale Kompetenzen und Dispositionen ab, die Lehrpersonen zur
erfolgreichen Bewältigung ihrer beruflichen Aufgaben mitbringen müssen (vgl.
Baumert & Kunter 2006).
3. Der berufsbiographische Ansatz
• Professionalität entwickelt sich im Prozess des Lehrerwerdens (vgl. Terhart 2001, 56)
• Vollzieht sich auf der Grundlage bisheriger (berufs-)biographischer
Erfahrungen (vgl. Entwicklungsaufgabenkonzept, Hericks 2006).
Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 13Entwicklungsaufgabentheorie (Havighurst)
Berufliche Entwicklungsaufgaben können definiert werden als (ein Bündel von)
Anforderungen,
− die individuell als Aufgaben eigener Entwicklung gedeutet werden können.
− die „unhintergehbar“ sind, „d.h., sie müssen wahrgenommen und bearbeitet
werden, wenn es zu einer Progression von Kompetenz und zu einer
Stabilisierung von Identität kommen soll“ (Hericks 2006, 60).
Kanonmodell für den Berufseinstieg von Lehrpersonen (Keller-Schneider /Hericks 2011,
Keller-Schneider 2010, Hericks 2006).
Identitätsbildende Adressatenbezogene
Rollenfindung Vermittlung
Anerkennende Mitgestaltende
Klassenführung Kooperation
Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für ProfessionsentwicklungBerufsbiographische Prozesstheorie
Für die Prozessstruktur von Anforderungsbearbeitung braucht es eine
berufsbiographische Prozesstheorie, die danach fragt:
1. Wie wird Entwicklung ausgelöst und dauerhaft?
2. Wie lassen sich das Verhältnis äußerer Anlässe und innerer Anstöße und
deren Nachhaltigkeit beschreiben (vgl. Terhart 2011, 208)?
2. Theorie des Erfahrungslernens (nach Dewey, vgl. Combe 2015, Combe / Gebhard
2007)
• Das Krisenlösungsverlaufsmodell als Heuristik für die Rekonstruktion des
Umgangs mit berufsphasenspezifischen Anforderungen (z.B. im Referendariat,
Kosinar 2014, im Studium und im Berufseinstieg, Kosinar & Laros 2018)
Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für ProfessionsentwicklungTheorie des Erfahrungslernens (Combe 2010, 2015)
im Kontext lehrberuflicher Professionalisierung (Kosinar 2014, 2018)
Heuristisches Verlaufsmodell: Professionalisierungsprozess während der Bearbeitung einer Erfahrungskrise (Kosinar 2014, 101)
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 21.03.2018 163. Das Praktikum aus Sicht der Studierenden a) Entwicklungsaufgaben und Anforderungen in den berufspraktischen Studien Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 17
Forschungsdesign des Gesamtprojektes
Anforderungen Studierender in den Berufspraktischen Studien
Projektphase I Projektphase II Anschlussprojekte
Narrative Fragebogen-
Interviews entwicklung Fragebogen-Längsschnittstudie
Kategoriale
mit Studier- Vollerhebung einer Studienkohorte
Auswertung Pre-Test
enden
SNF-Projekt (2017-2020)
Interview-Längsschnittstudie
Professionalisierungsprozesse ange-
Fallvergleichende Rekonstruktion und
hender Primarlehrpersonen im Kontext
Typenbildung n = 25 => n = 14 berufspraktischer Studien: Eine
Mehrebenen- und Längsschnittanalyse.
t1 t2 t3
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Studierende in den Berufseinsteigende
Praxisphasen 1-4
Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für ProfessionsentwicklungErkenntnisinteresse und Fragestellungen Projektphase I
1. Welche Anforderungen erleben Studierenden in ihren Praktika und wie
deuten sie diese?
2. Welche Strategien und Praktiken im Umgang mit diesen entwickeln sie?
3. Welche Rolle spielen die Ausbildenden für die Deutung und Bearbeitung
von Anforderungen?
Projektphase I, Teilstudie 1:
Qualitative induktive kategoriale Auswertung von Anforderungen (N = 20)
aus ca. 100 identifizierten Anforderungen
⇒ Bildung von Oberkategorien (Anforderungsbereiche)
⇒ Bildung von Hauptkategorien (Entwicklungsaufgaben)
Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 19Entwicklungsaufgaben Studierender
in den berufspraktischen Studien
Berufliches
Adressatenbezogene
Selbstverständnis
Vermittlung
entwickeln
Zusammenarbeit mit
Anerkennende
verschiedenen
Klassenführung
Akteur/innen
Sich in Ausbildung befinden
(Leineweber, S., Billich-Knapp, M. & Košinár, J. (in Vorbereitung)
Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für ProfessionsentwicklungVergleich: Entwicklungsaufgaben Studierender –
Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg
Identitätsbildende Adressatenbezogene
Rollenfindung Vermittlung
Berufliches
Adressatenbezogene
Selbstverständnis
Vermittlung
entwickeln
Anerkennende Mitgestaltende
Klassenführung Zusammenarbeit mit Kooperation
Anerkennende
verschiedenen
Klassenführung
Akteur/innen
Sich in Ausbildung befinden
Leineweber, S., Billich-Knapp, M. & Košinár, J. (in Vorbereitung)
Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für Professionsentwicklung3. Das Praktikum aus Sicht der Studierenden b) Typen der Anforderungsbearbeitung Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 22
Methodologie und Datenanalyse Analyse des Textdatenmaterials mit der Dokumentarischen Methode (Bohnsack 1999, 2010, Nohl 2009): Rekonstruktion habitualisierter Strukturen, die als handlungsleitende Orientierungen über Erzählungen und Beschreibungen transportiert werden. 1) Formulierende Interpretation: WAS wird inhaltlich verhandelt? 2) Reflektierende Interpretation: Textsortenanalyse und Rekonstruktion des Orientierungsrahmens: WIE wird etwas dargestellt / erlebt? 3) Komparative Analyse – fallübergreifende und fallimmanente Vergleiche entlang von Suchstrategien und Vergleichsdimensionen 4) (Relationale) Typenbildung (vgl. Nohl 2013) Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für Professionsentwicklung
Vergleichsdimensionen
Ausgewählte Suchstrategien dienen als Vergleichsdimensionen für die
komparative Analyse
1. Welche Bedeutung haben die Praktika für die Studierenden?
2. Wie konstituieren sich Anforderungen in den Praktika im Erleben der
Studierenden und wie bearbeiten sie diese? (subjektive Deutung und
Lösungssuche)
3. Welche Rolle haben die Praxislehrpersonen im Rahmen der
Konstituierung von Anforderungen in den Praktika?
Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für ProfessionsentwicklungTypen der Anforderungsbearbeitung im Überblick
Typus Selbst-
Vermeidung Entwicklung Bewährung
Vergleichs-
verwirklichung
Dimensionen
1. Bedeutung
der Praktika
2. Konstituierung und
Bearbeitung von
Anforderungen
3. Rolle der
Praxislehrperson
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 25Typen der Anforderungsbearbeitung: Selbstverwirklichung
Typus Selbst-
Vermeidung Entwicklung Bewährung
Vergleichs- verwirklichung
Dimensionen
1. Bedeutung
Entfaltungsraum
der Praktika
2. Konstituierung und Sich
Bearbeitung von Gestaltungsraum
Anforderungen nehmen
3. Rolle der Ermöglichende
Praxislehrperson oder Verhindernde
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 26Typus Selbstverwirklichung Anita Villiger Also ich habe mich- vielmals im Praktikum fühl ich mich ein bisschen wie in einem Vogelkäfig. Weil im recht begrenzten Rahmen, den einem die Praxislehrperson gibt, darf man so probieren zu fliegen, kommt es mir vor. Und da habe ich dann gedacht, so ja, lass mich doch einfach mal fliegen. Und darum bin ich eigentlich auch froh, habe ich mein Abschlusspraktikum im Ausland machen können. Weil nochmals so einen Vogelkäfig brauche ich jetzt nicht unbedingt. PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 27
Typen der Anforderungsbearbeitung: Vermeidung
Typus Selbst-
Vermeidung Entwicklung Bewährung
Vergleichs- verwirklichung
Dimensionen
1. Bedeutung
Entfaltungsraum Bewertungsraum
der Praktika
2. Konstituierung und Sich Von aussen
Bearbeitung von Gestaltungsraum herangetragene
Anforderungen nehmen Erwartungen erfüllen
3. Rolle der Ermöglichende
Bewertungsinstanz
Praxislehrperson oder Verhindernde
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 28Typus: Vermeidung Natascha Gubler Man kann ein bisschen mehr sich selber sein, wenn niemand da ist. Man ist sonst ja auch sich selber, aber, jeder ist anders, wenn er nicht beobachtet wird [...] So, das ist eigentlich das Positive gewesen an diesen Morgen oder Nachmittagen [wenn die Praxislehrperson nicht da war, J.K. ] . Ja, dass halt, wenn etwas passiert, dass du nicht irgendwie das Gefühl hast: Oh Gott, jetzt hat sie es gesehen, jetzt muss ich schnell es wieder gut machen, sondern du hast einfach deine Zeit und es ist halt so mehr dein Rhythmus. PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 29
Typen der Anforderungsbearbeitung: Entwicklung
Typus Selbst-
Vermeidung Entwicklung Bewährung
Vergleichs- verwirklichung
Dimensionen
1. Bedeutung
Entfaltungsraum Bewertungsraum Entwicklungsraum
der Praktika
2. Konstituierung und Sich Von aussen Berufsbezogene
Bearbeitung von Gestaltungsraum herangetragene Herausforderungen
Anforderungen nehmen Erwartungen erfüllen meistern
3. Rolle der Ermöglichende Beratende im
Bewertungsinstanz
Praxislehrperson oder Verhindernde Entwicklungsprozess
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 30Typus: Entwicklung
Pit Santoro
Während dem ersten Praktikum, das ist super gewesen. Dort hat man gesagt was
gut ist was nicht, und vor allem auch wie könnte man's machen, ohne mir gerade
eine Stunde in die Finger zu geben: Schau, mach's so. Aber mehr so auf Fragen:
Überlege mal, wie wie würdest du es machen wenn das und das und das. [Die
Praxislehrperson] hat das irgendwie können, wegen einer Frage von ihr hat man
nachher angefangen zu studieren und ist nachher schlussendlich auf die Lösung
vom Problem gekommen. Das hat mich genial gedünkt. Und das hat mich sehr
sehr weit gebracht.
* Pseudonym
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 31Typen der Anforderungsbearbeitung: Bewährung
Typus Selbst-
Vermeidung Entwicklung Bewährung
Vergleichs- verwirklichung
Dimensionen
1. Bedeutung
Entfaltungsraum Bewertungsraum Entwicklungsraum Bewährungsraum
der Praktika
2. Konstituierung und Sich Von aussen Berufsbezogene
Berufsbezogene
Bearbeitung von Gestaltungsraum herangetragene Herausforderungen
Defizite aufarbeiten
Anforderungen nehmen Erwartungen erfüllen meistern
3. Rolle der Ermöglichende Beratende im Einschätzende des
Bewertungsinstanz
Praxislehrperson oder Verhindernde Entwicklungsprozess Entwicklungsbedarfs
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 32Relation der Vergleichsdimensionen zueinander
Subjektive
Bedeutungszuschreibung
der Studierenden an die
Praktika
Rollenzuweisung Verständnis vom eigenen
Lernen im Praktikum
Rolle der Deutung und Bearbeitung von
Praxislehr- herangetragenen und situativ
person Ressource erlebten Anforderungen
für die Bewältigung
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 333. Das Praktikum aus Sicht der Studierenden c) Spannungsfelder zwischen Studierenden und Praxislehrpersonen – Nicht-Passung von Orientierungen Prof. Dr. Julia Kosinar, Pädagogische Hochschule FHNW, Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 34
„Man hat es so aus ihr müssen rausziehen“ Giulia Botta: Im P2 haben wir eine Praxislehrerin gehabt [...] Wir hätten uns dort einfach gewünscht, oder wir haben sie auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass sie uns ein bisschen mehr begleitet. Nachbesprechungen, Vorbesprechungen. Weil sie hat wirklich einfach gesagt „macht mal“ und nach dem Unterricht hat sie gesagt „ja, ist gut gewesen“. Und das ist [...] einfach nicht sehr befriedigend. Wir haben immer wieder müssen nachfragen und [...] man hat es so aus ihr müssen rausziehen [...] Auch während dem Unterricht, statt dass sie uns beobachtet hat, ist sie hinten an den Computer und hat ihre Sachen gemacht. Studentin: Entwicklungstypus – Dissens: Praxislehrperson soll Beratende im Entwicklungsprozess sein ABER Praxislehrperson agiert in der Rolle der Ermöglicherin (Selbstverwirklichungstypus) PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 35
“Ich bekomme eh ein rotes Blitzlein irgendwo“ Anna Fabiano Mein erstes Praktikum ist wirklich schrecklich gewesen, also ich habe mir dort überlegt gehabt auszusteigen [...] Ich habe dort eine extrem strenge Praxislehrperson gehabt, die hat wirklich einfach alles herausgenommen, das nicht gut gewesen ist: Sie hat so einen Bogen gemacht gehabt mit so Blitzen und wenn es einen Blitz gegeben hat, dann ist es einfach sehr schlecht gewesen. Und wenn es ein rotes Minus gehabt hat ist, es einfach schlecht gewesen. Und ein grünes Plus ist dann gut gewesen [...] Es hat dann immer pro Stunde irgendwie vier, fünf Zeichen gegeben mit einem Kommentar dazu und ich habe jedes Mal schon gewusst ich bekomme eh ein rotes Blitzlein irgendwo [...] Ich habe wirklich am Abend bis weiss ich wann vorbereitet. Habe jedes Mal Angst bekommen vor dieser Rückmeldung. Studentin: Entwicklungstypus Dissens: Praxislehrperson soll Beratende im Entwicklungsprozess sein ABER Praxislehrperson agiert als Bewertungsinstanz (Vermeidung ) PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 36
„Das ist dann halt schon schülerrollenmässig“ Tayfun Özdemir* Im P4 ist es so gewesen [...] wir haben schon alles gegeben, und dann haben sie irgendwie verlangt, wir sollen noch mehr geben. Und ich habe mich einfach gefragt, wie will ich noch mehr geben, wenn ich schon alles gebe. Dort habe ich halt schon gesagt, öhm sorry, ich bin ein bisschen überfordert, ich weiss nicht ganz genau, was du damit meinst [...] . Aber dann haben sie es auch nachher gesagt - eben, das eine ist gewesen dann, „nicht immer ständig fragen, was wir noch müssen machen“. Das ist nämlich der Schüler, wo quasi Aufgaben bekommt, und die abhäkelt. Sondern, dass man wie Eigeninitiative ergreift. Wenn ich weiss, was ich muss machen, dann mache ich es. Aber selber würde ich nicht drauf kommen [...] Und das ist halt schon ein bisschen schülerrollenmässig. Student: Vermeidungsstypus – Praxislehrperson verteilt Aufgaben. Dissens: Praxislehrperson agiert in der Rolle der Ermöglicherin (Selbstverwirklichungstypus) und fordert Eigeninitiative und Selbstverantwortung PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 37
Resümee Ø Studierende weisen entsprechend ihrer Orientierungen dem Praktikum eine ganz unterschiedliche Bedeutung zu. Ø In Relation hierzu vollzieht sich die Deutung und Relevanzsetzung der sich in den Praktika konstituierenden Anforderungen: 1. Anforderungen als Herausforderung mit Blick auf die berufliche Entwicklung (Typ Entwicklung, Typ Bewährung) 2. Vermeidung von Anforderungen, Eingeschränkte Bearbeitung (Typ Selbstverwirklichung, Typ Vermeidung). Ø Praxislehrperson werden analog dazu ganz unterschiedlich adressiert – unabhängig von deren eigenen Orientierungen. Ø Probleme entstehen aus Nicht-Passung der Orientierungen (Vorstellungen, Haltung, Erwartungen) Institut PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 38
Implikationen für die Ausbildung in den Berufspraktischen Studien Bsp: Institut Primarstufe PH FHNW Das Praktikum als Erfahrungsraum gestalten PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 39
Anforderungen in den Berufspraktischen Studien
(an die Studierenden herangetragene Aufgaben und (eigene) Erwartungen)
Bedeutsam und
Widerstand Sinngebung und
bewältigbar ? Phantasie Handlung - Reflexion -
Nein (rückgreifender Sprachschöpfung -Evaluation
Vorgriff)
Annahme der Lösungssuche: Verbegrifflichung/
Ja
Irritation/ Anforderung / (Gedanken)Experiment Dialog in Veränderung
Krise Deutung als /Konstruktion und Erfahrungs- Entwicklung
Herausforderung Rekonstruktion gemeinschaften
Einbruch von
Routinen,
Verlust von
Sicherheit Die Prozessstruktur des Erfahrungslernens /Lösung einer Erfahrungskrise
Individueller berufsbiographischer Entwicklungsprozess
Habituelle Struktur des Subjekts
Professionswissen Ressourcen
Erfahrungswissen Kompetenzen
Berufliches Selbstverständnis Selbstwirksamkeit
Institutionelle Gesellschaft/
Bedingungen soziales Umfeld
Professionalisierungsverständnis bildet sich in den Praktika ab
Irritationen zulassen Irritation/Krise Irritationen Raum geben
Selbstverantwortung der Individuelle Deutung und Individuell begleiten
Studierenden einfordern (eigene Bearbeitung von Anforderungen (individuelle Entwicklungsziele im
Schwerpunktsetzung, Identifizierung von Beratungsgespräch erarbeiten)
Entwicklungszielen)
Bewertungsneutralen Fokus Lösungssuche, Dialog in Im Co-Planning und Co-Teaching
setzen: Nicht die eigene Erfahrungsgemeinschaften Unterrichtsqualität gemeinsam
Performanz, sondern die verantworten
Unterstützung des Schülerlernens (Verabschiedung Meisterlehre-Prinzip)
hat Priorität
Kultur der Nähe im Praktikum: Reflexion und Evaluation von Kultur der Distanz: Analyse- und
Planungs-, Handlungs-, Praxis-Erfahrungen Reflexionskompetenzen im
Entscheidungsfähigkeiten ReflexionsseminarAufgaben zur Bearbeitung der Entwicklungsziele
aus Sicht der Akteursgruppen
Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 41Bewertung in den Berufspraktischen Studien IP
Basisphase Partnerschulphase I Partnerschulphase II Fokusphase
phasenspezifische Entwicklungsziele und Aufgaben zu deren Bearbeitung
Praktikum als Entwicklungsraum
Angemessene Bearbeitung der Entwicklungsziele
Formale Kriterien
Formale Kriterien
Einschätzungs- -und Feedbackbogen=> kriteriengeleitete
Rückmeldung entlang der Entwicklungsziele
Bereitschaft zur Einlassung
Praktikum als Bewertungsraum
InstitutPH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 425. Stabilität der Orientierungen = wie geht es weiter im Berufseinstieg? PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 43
Typologie im Längsschnitt
Typologie t1 Studienende
Selbstverwirklichung Entwicklung Bewährung Vermeidung
Gestaltung Bewältigung An(Passung)
Typologie t2 nach 1.5 Berufsjahren
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 21.03.2018 44Typologie im Längsschnitt: Fallbezogene Bewegungen PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 21.03.2018 45
Typologie im Längsschnitt: Fallbezogene Bewegungen
D
P
D
P
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 21.03.2018 46Prozessverläufe: Typ Bewährung => (An)Passung
Typ Bewährung Denise Perrin: Ja, einfach (.) die (.) neuen Unterrichtsformen, die
ich nicht gekannt habe, die neue Pädagogik, die ich nicht gekannt
Praktikum als
Bewährungsraum hab, das: ganze Schweizer System zum Teil auch […]
Ähm (2) ja, habe mich eigentlich sehr damit auseinandergesetzt,
Berufsbezogene
Defizite aufarbeiten (.) kann ich überhaupt vor einer Klasse stehen, ähm (.) kommt das
diesen Kindern zugute (. ) Ja. Und das hat mich immer wieder
Praxislehrperson zum Zweifeln gebracht auch. […] die Zweifel sind eigentlich
als Einschätzende während dem ganzen Studium eigentlich immer da gewesen, und
des Entwicklungs-
darum habe ich zum Teil recht mit mir müssen kämpfen. Aber für
bedarfs
mich ist es eigentlich auch nicht wirklich eine Option gewesen, das
abzubrechen oder das gar nicht erst studieren. (2) Ja. (.) @(.)@
(DP_t1_376-394)
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 21.03.2018 47Prozessverläufe: Typ Bewährung => (An)Passung
Denise Perrin: dann haben wir dieses Gespräch [mit der
Typ (An)Passung
Schulleitung] gehabt, und sie hat dann (.) gefunden sie finde nicht,
Passung prüfen und Passung
herstellen im (vor-
dass das mein Traumberuf sei, und ja::: das ist dann ein wenig
)gegebenen Rahmen heftig gewesen für mich, (.) und=ehm:: (1) dann hat sie gefunden,
Selbstverortung angesichts (.) dass wir diese Mathestunde, (.) wo sie immer kommt, weil sie
normativer Berufsbilder
gibt noch Förderunterricht bei mir, dass wir die immer gemeinsam
Passung suchen zwischen
Gegenpositionierung und
besprechen […] ich bin dann voll darauf eingegangen und habe
Anpassungsbemühung gefunden ja (.) sehr gerne (.) eben ich wisse, dass ich noch nicht
Sich zwischen perfekt, bin und ich bin (.) dankbar um jeden Tipp oder für jede
„Schülerverhalten“ und
Verantwortungsübernahme
Verbesserung […] und dann irgendwann, (1) haben wir dann
bewegen plötzlich aufgehört (.) ich glaube das ist auch gut, weil das heisst
ich habe mich auch ein wenig verbessert also (.) wenn sie es nicht
mehr für nö- wirklich für nötig gehalten hat das zu=machen
(DP_t2_34-51)
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 21.03.2018 48Prozessverläufe: Typ Bewährung => (An)Passung
Typ (An)Passung Zur Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin
Passung prüfen und Passung
herstellen im (vor-
)gegebenen Rahmen Denise Perrin: (...) sie ist ein wenig älter, hat graue Haare und
Selbstverortung angesichts ich nenne sie immer, (.) meinen Engel mit grauen Haaren, (.) es
normativer Berufsbilder ist so:: (.) ja:::: immer so ein wenig meine Retterin und wenn ich
Passung suchen zwischen unterrichte und irgendetwas kommt und ich weiss es nicht oder
Gegenpositionierung und
Anpassungsbemühung ich weiss nicht ob=es stimmt oder (1) dann schaue ich immer
sie an und dann: n:ickt sie, oder schüttelt den Kopf, und dann
Sich zwischen
„Schülerverhalten“ und weiss ich es immer. (DP_t2_862-872)
Verantwortungsübernahme
bewegen
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 21.03.2018 49Fallanalyse im Längsschnitt: Denise Perrin
• keine Veränderung des Orientierungsrahmens erkennbar
• nimmt nach wie vor auf andere Bezug:
• t1 - Praxislehrperson,
• t2 - Schulleitung (als kritisch-bestrafende Instanz) und Heilpädagogin
(als Retterin)
• reflexive Auseinandersetzung mit beruflicher Entwicklung ist nicht erkennbar
(sie zeigt sich als entwicklungsbereit gegenüber Schulleitung)
• hilfsbedürftiges Verhalten als verberuflichte Lehrperson stellt sie nicht infrage
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 21.03.2018 50Typologie im Längsschnitt: Fallbezogene Bewegungen
F
S
F
S
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 21.03.2018 51Prozessverläufe: Typ Bewährung => Bewältigung
Typ Bewährung
Praktikum als
Bewährungsraum
Flora Steiger: also mich so zu entfalten in dem Schulzimmer und
Berufsbezogene mich zu getrauen einfach so zu machen wie ich denke ist mir dort
Defizite aufarbeiten
sehr schwer gefallen, weil ich nicht aufgefordert worden bin (.)
(FS_t1_665-670)
Praxislehrperson
als Einschätzende
des Entwicklungs-
bedarfs
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 21.03.2018 52Prozessverläufe: Typ Bewährung => Bewältigung
Typ Bewältigung
Sich Einfinden in den Beruf Flora Steiger: ich möchte möglichst viel hinausgehen mit den
im Realitätsraum Schule Kindern (.) und erleben (.) und Sachen sehen und erfahren und
Reibung zwischen eigenem nicht einfach im Schulzimmer zu sitzen vor einem Blatt [...] und
Anspruch und
Möglichkeiten auch wenn es vorgegeben ist was man alles sollte schaffen und
was man alles sollte thematisieren mit den Kindern ich glaube ich
(Revidierte)
Handlungsentwürfe m- man muss sich einfach getrauen (2) das nicht genau so wollen
angesichts neuer Aufgaben
und Unwägbarkeiten zu machen sondern vielleicht auch einen anderen Weg zu finden
den Kindern das beizubringen (.) und das ist so (.) meine
Schule und Unterricht neu
denken innerhalb der Grundidee (.) ich weiss nicht ob ich das immer schaffe aber ich
(verhindernden)
Rahmenbedingungen möchte eigentlich so arbeiten mit ihnen (FS_t2_875-890)
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 21.03.2018 53Fallanalyse im Längsschnitt: Flora Steiger
• weist eine Veränderung ihres Orientierungsrahmens auf.
• orientiert sich im Berufseinstieg nicht mehr an anderen (Autoritäten), sondern
an sich selbst (Ressourcen, Vorstellungen von Unterricht)
• t1 Praxislehrperson
• t2 eigenen Referenzrahmen
• reflexive Auseinandersetzung mit beruflicher Entwicklung erkennbar:
übernimmt Verantwortung für Einfinden im Beruf und setzt sich kritisch mit
gegebenen Strukturen und Normen auseinander
PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 21.03.2018 54Zusammenfassung und Ausblick Ø Die Bewertung in den Praktika verführt Studierende (fast) aller Typen zu Anpassungsbemühungen Ø Ziel der Bpst sollte ein Entwicklungsraum sein, in dem Irritationen / Krisen als Entwicklungschance gedeutet und genutzt werden Ø Praxislehrpersonen und Dozierende müssen Orientierungen Studierender erkennen können, um sie typengemäss zu fördern und zu fordern Ø Es braucht eine selbstreflexive Haltung von Praxislehrpersonen ihrer eigenen Rolle und ihrem Professionalisierungsverständnis gegenüber Ø Studierende brauchen Formate in denen ihnen ihre Überzeugungen und Orientierungen reflexiv zugänglich werden und sie als selbstkritische lebenslang Lernende adressiert werden. Ø Grösste Herausforderung: Orientierungen sind stabil und vermutlich nur durch intensive Krisenerfahrungen zu irritieren (Frage der Einlassung) Institut PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 28.05.18 55
Literatur
Arnold, K.-H., Gröschner, A. & Hascher, T. (2014) (Hrsg.): Schulpraktika in der Lehrerbildung: Theoretische Grundlagen, Konzeptionen,
Prozesse und Effekte. Waxmann.
Bach, A. (2013): Kompetenzentwicklung im Schulpraktikum: Ausmaß und zeitliche Stabilität von Lerneffekten hochschulischer
Praxisphasen. Waxmann.
Bauer, K.-O. (2005): Pädagogische Basiskompetenzen. Theorie und Training. Weinheim und München: Juventa.
Baumert, J. & Kunter, M. (2006): Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 9 (4), S.
469–520.
Bohnsack, R. (2013). Dokumentarische Methode und die Logik der Praxis. In A. Lenger, C. Schneickert & F. Schumacher (Hrsg.), Pierre
Bourdieus Konzeption des Habitus (175-200). Wiesbaden: Springer VS.
Combe, A. (2015): Dialog und Verstehen im Unterricht. Lernen im Raum von Phantasie und Erfahrung. In Gebhard, U. (Hrsg.): Sinn im
Dialog. Zur Möglichkeit sinnkonstituierender Lernprozesse im Fachunterricht. Wiesbaden: Springer VS, 51-66.
Combe, A. & Gebhard, U. (2007): Sinn und Erfahrung. Zum Verständnis fachlicher Lernprozesse in der Schule. Opladen: Barbara Budrich.
Dewey, J. (1994). Erziehung durch und für Erfahrung. Stuttgart: Klett-Cotta.
De Zordo, L. & Hascher, T. (2017). Kooperation lernen im Teampraktikum? Journal für LehrerInnenbildung, 1(17), 20-25.
Dreyfuß, Hubert L.; Dreyfuß, Stuart E. (1987): Künstliche Intelligenz. Von den Grenzen der Denkmaschine und dem Wert der Intuition.
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Frey, A. (2002): Berufliche Handlungskompetenz. Kompetenzentwicklung und Kompetenzvorstellungen in der Erzieherinnenausbildung. In:
Empirische Pädagogik 16 (2), S. 139–156.
Fuller, Frances F.; Brown Oliver H. (1975): Becoming a teacher. In: Kevin Ryan (Hg.): Teacher Education, II. Chicago: The university of the
chicago press, S. 25–52.
Hascher, T. (2012) Forschung zur Bedeutung von Schul- und Unterrichtspraktika in der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung - In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung 30 (1), S. 87-98
Hascher, T. (2011). Vom "Mythos Praktikum" ... und der Gefahr verpasster Lerngelegenheiten. Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung.
11. 8-16.
Helsper, W. (1996): Antinomien des Lehrerhandelns in modernisierten pädagogischen Kulturen. Paradoxe Verwendungsweisen von
Autonomie und Selbstverantwortlichkeit. In: A. Combe und W. Helsper (Hg.): Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus
pädagogischen Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 521–569.
28.05.18 56Literatur (Fortsetzung) Helsper, W. & Tippelt, R. (2011): Ende der Profession und Professionalisierung ohne Ende? Zwischenbilanz einer unabgeschlossenen Diskussion. In: W. Helsper und R.Tippelt (Hg.): Pädagogische Professionalität. Zeitschrift für Pädagogik (57. Beiheft), S. 268–288. Hericks, U. (2006): Professionalisierung als Entwicklungsaufgabe. Wiesbaden: Springer VS. Keller-Schneider, M. (2010): Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen. Münster: Waxmann. Košinár, J. (2018): Das Mentorat zwischen Individualisierung und Standardisierung – eine empirie- und theoriebasierte Konzeption. In: Reintjes, Ch., Bellenberg, G. & Im Brahm, G. (Hrsg.): Mentoring und Coaching als Beitrag zur Professionalisierung angehender Lehrpersonen. Münster: Waxmann. Košinár, J. (2014): Professionalisierungsverläufe in der Lehrerausbildung. Anforderungsbearbeitung und Kompetenzentwicklung im Referendariat. Opladen: Barbara Budrich. Košinár, J. & Schmid, E. (2018). Die Rolle der Praxislehrperson aus Studierendensicht – Rekonstruktionen von Praxiserfahrungen. In: BzL (3), 459-471. Košinár, J. & Laros, A. (2018): Orientierungsrahmen im Wandel? Berufsbiografische Verläufe zwischen Studienende und ersten Berufsjahren. Vortrag im Rahmen des Symposions: (Such-)Bewegungen auf dem Weg zur Professionalität. Längsschnittliche Rekonstruktionen von Professionalisierungsprozessen in der Lehrkräftebildung. DGfE-Kongress, Essen, 21.3.2018. Košinár, J. Schmid, E. & Diebold, N. (2016): Anforderungswahrnehmung und -bearbeitung Studierender in den Berufspraktischen Studien. In: Košinár, J., Leineweber, S. & Schmid, E. (Hrsg.): Schulpraktische Professionalisierung: Entwicklungsprozesse angehender Lehrpersonen Münster: Waxmann, 139-154. Leineweber, S., Billich-Knapp, M. & Košinár, J. (in Vorbereitung): Entwicklungsaufgaben Studierender in den Berufspraktischen Studien. Anforderungsdeutung und -bearbeitung im Studienverlauf. Leonhard, T., Fraefel, U., Jünger, S., Reintjes, C., Kosinar, J. et al. (2016). Zwischen Wissenschafts- und Berufspraxis. Berufspraktische Studien als dritter Raum der Professionalisierung von Lehrpersonen. Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 11 (1), 79 - 98. Nieke, W.P (2012): Kompetenz und Kultur. Beiträge zur Orientierung in der Moderne. Wiesbaden: Springer. Nohl, A.-M. (2013): Relationale Typenbildung und Mehrebenenvergleich. Wiesbaden: Springer VS. Oevermann, U. (1996). Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns. In A. Terhart, E. (2001): Lehrerberuf und Lehrerbildung. Forschungsbefunde, Problemanalysen, Reformkonzepte. Beltz. PH FHNW, Institut Primarstufe Professur für Professionsentwicklung 23.11.2017 57
Sie können auch lesen