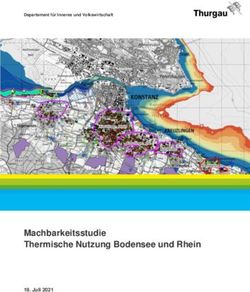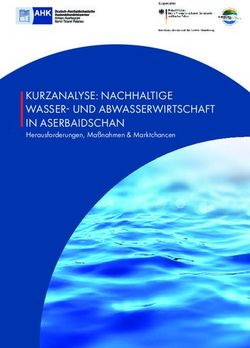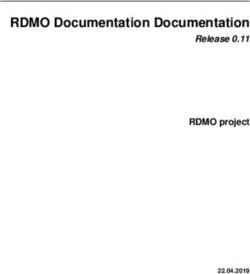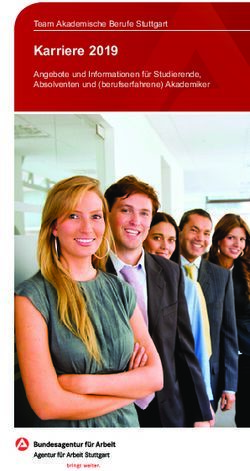Smart Work - Gesünderes Arbeiten durch Unterstützung von farbigem Licht
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bachelorarbeit
Thema:
Smart Work – Gesünderes Arbeiten durch
Unterstützung von farbigem Licht
Cornelius Hänsch
Matrikelnummer: 38326
Studiengang: Informatik 172079
Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. Rainer Wasinger
Zweitgutachter: Prof. Dr.-Ing Thomas Franke
Bearbeitungszeit: 23.09.2020 bis 18.12.2020
Abgabetermin: 17.12.2020Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................4
Tabellenverzeichnis................................................................................................................5
1. Einleitung ...........................................................................................................................6
2. Fragestellung und Ziel ........................................................................................................7
3. Theoretischer Hintergrund ..................................................................................................8
3.1. Arbeitsplatz ..................................................................................................................8
3.2. Gesundheit ..................................................................................................................9
3.3. Krankheit ...................................................................................................................10
3.4. Bewegung ..................................................................................................................11
3.5. Licht ...........................................................................................................................11
3.6. Betriebliches Gesundheitsmanagement .....................................................................13
4. Methodik ..........................................................................................................................16
5. Vergleich der Techniken zur Steigerung der Bewegungsaktivität an Büroarbeitsplätzen ..17
5.1. Auswahl der Technologien für den Vergleich .............................................................17
5.1.1 Darma-Kissen.......................................................................................................17
5.1.2 Bildschirmzeit .......................................................................................................18
5.1.3 Philips Hue ...........................................................................................................20
5.1.4 Alarm & Uhr..........................................................................................................21
5.1.5 MasterMove .........................................................................................................22
5.2. Vergleich der Technologien .......................................................................................23
5.3. Tabellarischer Vergleich der Technologien ................................................................26
5.4. Bewertung des Vergleichs .........................................................................................28
5.4.1 Schlussfolgerung der fünf Technologien ...............................................................28
5.4.2 Schlussfolgerung für die eigene Anwendung ........................................................28
6. Design eines Programms .................................................................................................29
6.1. Anforderungen an das Programm ..............................................................................29
26.2. Designvorschläge ......................................................................................................29
6.2.1 Design 1 ...............................................................................................................30
6.2.2 Design 2 ...............................................................................................................31
6.2.3 Design 3 ...............................................................................................................31
6.3. Nutzerstudie für das Design .......................................................................................33
6.3.1 Methode ...............................................................................................................33
6.3.2 Ergebnisse ...........................................................................................................34
6.4. Finalisierung des Designs ..........................................................................................36
6.5. Bewertung des Designs .............................................................................................37
7. Entwicklung eines Programms .........................................................................................38
7.1. Kriterien des Programms ...........................................................................................38
7.2. Umsetzung des Programms.......................................................................................38
7.3. Bewertung des Programms........................................................................................41
8. Fazit und Ausblick ............................................................................................................43
Quellenverzeichnis ...............................................................................................................44
Selbstständigkeitserklärung..................................................................................................47
Anhang.................................................................................................................................48
3Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Licht .................................................................................................................12
Abbildung 2: Arbeitsunfähigkeits-Tage und -Fälle pro Jahr...................................................14
Abbildung 3: Anteil von Krankheiten .....................................................................................15
Abbildung 4: Personalkosten ................................................................................................15
Abbildung 5: Darma-Kissen ..................................................................................................18
Abbildung 6: Bildschirmzeit ..................................................................................................19
Abbildung 7: Philips Hue ......................................................................................................20
Abbildung 8: Alarm & Uhr .....................................................................................................21
Abbildung 9: MasterMove .....................................................................................................22
Abbildung 10: Design 1 ........................................................................................................30
Abbildung 11: Design 2 ........................................................................................................31
Abbildung 12: Design 3 ........................................................................................................32
Abbildung 13: Finales Design ...............................................................................................36
Abbildung 14: Finales Design - Start/Pause und Layout .......................................................37
Abbildung 15: Benutzeroberfläche der in Java umgesetzten Anwendung.............................39
Abbildung 16: Umgesetzte Anwendung - Fehlermeldungen .................................................40
4Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Vergleich der modernen Techniken .....................................................................27
Tabelle 2: Vergleich der Designs ..........................................................................................34
51. Einleitung
Die Gesundheit ist ein wichtiger Faktor für ein langes Lebens. Werden Menschen
krank, sind sie in ihrem Leben eingeschränkt und werden unzufrieden. Ursachen für
Erkrankungen sind zum Beispiel an Arbeitsplätzen zu finden. In Deutschland
arbeiteten 2018 Vollzeitbeschäftigte im Durchschnitt 41 Stunden pro Woche. Das
bedeutet, Menschen verbringen die meiste Zeit ihres Lebens auf Arbeit, weshalb ein
besonderes Augenmerk an die Gesundheit in diesem Setting gelegt werden sollte. [1]
Auch für Arbeitgeber spielt die Gesundheit ihrer Mitarbeiter eine große Rolle. 2009
wurden durch Ausfalltage von Mitarbeitern im Durchschnitt Kosten in Höhe von 628€
verursacht. Kranke oder unglückliche Arbeitnehmer können die Arbeit nicht oder nur
ungenügend erledigen. Mit gesetzlichen Vorschriften, wie beispielsweise der
Arbeitsstättenverordnung und anderen gesundheitsfördernden Maßnahmen an
Arbeitsplätzen, werden die Arbeitnehmer vor Schaden geschützt. Nichtsdestotrotz gibt
es nach wie vor viele Krankheiten von Arbeitnehmern. [2]
Im Speziellen werden die Bildschirmarbeitsplätze thematisiert. Die Zahl der
Büroarbeitsplätze wächst in Deutschland immer weiter. So waren 2012 noch knapp
11,9 Millionen Menschen in Büros beschäftigt. 2018 waren es bereits 14,8 Millionen
Menschen. In sechs Jahren kamen fast drei Millionen neue Büroangestellte dazu. Ein
großes Problem bei den Büroarbeitsplätzen ist das Sitzen, was als das neue Rauchen
angesehen wird. Diese langen Sitzzeiten sollten nicht unterschätzt werden. [3] [4]
Neben gesundheitsfördernden Maßnahmen wie Sport oder gesunder Ernährung kann
auch der Einsatz von Technik dazu beitragen, die Gesundheit zu verbessern. Viele
technische Geräte werden immer smarter. Mit Hilfe einer Smart Watch oder eines
Fitnesstrackers kann zum Beispiel jederzeit überprüft werden, ob genügend Schritte
am Tag gelaufen worden sind. Der Einsatz smarter Geräte ist bisher allerdings eher
auf den privaten Bereich beschränkt. Es soll gezeigt werden, wie sich der „Smart
Home“-Gedanke auch auf die Arbeit übertragen lässt.
Dafür werden fünf moderne Techniken, die Büroangestellte zur Bewegungsaktivität
motivieren sollen, analysiert, verglichen und auf Eignung im Arbeitsleben bewertet. Die
Technologie Philips Hue ist bei der Einrichtung für Windows-Geräte an die Hue-App
gebunden. Um dies zu optimieren, wird eine Applikation entworfen und umgesetzt.
62. Fragestellung und Ziel
Hauptfragestellung:
Wie können Unternehmen mit moderner Technik die Bewegungsaktivität der
Arbeitnehmer, die an Büroarbeitsplätzen arbeiten, steigern?
Unter moderner Technik sind neue Technologien gemeint, die hardware- und
softwareseitig zusammenarbeiten. Sie gehören damit zu dem Internet der Dinge,
welches im englischen Internet of Things genannt wird. Diese Technologien
ermöglichen es, spezielle Gegenstände zusammenarbeiten zu lassen. Dabei sind
physische und virtuelle Gegenstände miteinander vernetzt. [5]
Damit die Hauptfrage besser beantwortet werden kann, gibt es noch drei Teilfragen.
Erste Teilfragestellung:
Was gibt es schon an moderner Technik, die die Bewegungsaktivität der
Arbeitnehmer, die an Büroarbeitsplätzen arbeiten, steigert?
Zweite Teilfragestellung:
Welche der modernen Techniken, die die Bewegungsaktivität der Arbeitnehmer, die
an Büroarbeitsplätzen arbeiten, steigert, ist am besten einsetzbar für Unternehmen?
Dritte Teilfragestellung:
Was kann an einer von den analysierten modernen Techniken, die die
Bewegungsaktivität der Arbeitnehmer, die an Büroarbeitsplätzen arbeiten, steigert,
optimiert werden, damit es einen Vorteil für Unternehmen gibt?
Ziel ist es, die Frage zu beantworten, wie die Bewegungsaktivität der Arbeitnehmer,
die an Büroarbeitsplätzen arbeiten, mit Hilfe von moderner Technik gesteigert werden
kann. Dazu soll ein Überblick zu moderneren Techniken erstellt und analysiert werden,
welche davon am besten für Unternehmen geeignet sind. Zusätzlich wird eine der
analysierten Techniken optimiert, sodass ein Vorteil für Unternehmen entsteht.
73. Theoretischer Hintergrund
Um genauer auf das Thema „gesünderes Arbeiten durch Unterstützung mit Licht“
einzugehen werden zunächst die wichtigsten Begriffe, wie Arbeitsplatz, Gesundheit,
Krankheit, Bewegung, Licht und betriebliches Gesundheitsmanagement genauer
definiert. Darüber hinaus wird ein Überblick über aktuelle Möglichkeiten erarbeitet.
3.1. Arbeitsplatz
Um für einen Betrieb eine Leistung als Arbeitnehmer zu bringen, ist der Arbeitsplatz
eine wichtige Komponente. In der Arbeitsstättenverordnung §2 (4) steht:
„Arbeitsplätze sind Bereiche, in denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit tätig sind.“
[6]
Zusätzlich sind an Arbeitsplätzen zum Beispiel Maschinen, Geräte und Möbel, die für
das Arbeiten notwendig sind oder diese erleichtern, zu finden. Eine einheitliche
Definition gibt es nicht. [7]
Es geht primär um Büroarbeitsplätze. Diese werden auch Bildschirmarbeitsplätze oder
Wissensarbeitsplätze genannt.
In der Arbeitsstättenverordnung §2 (5) steht:
„Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, die sich in Arbeitsräumen befinden und die
mit Bildschirmgeräten und sonstigen Arbeitsmitteln ausgestattet sind.“ [6]
Ursprünglich war der Büroarbeitsplatz zum Erzeugen von Schriftstücken vorhanden.
Durch die Digitalisierung wird aktuell hauptsächlich Informationsverarbeitung an
diesen Plätzen betrieben. Eine klare Trennung zu anderen Berufen ist schwierig, da
es Informationsverarbeitung auch in anderen Berufen gibt. [8]
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat im Jahr 2019 ein
Informationsdokument herausgebracht, in der der Büroarbeitsplatz wie folgt
beschrieben wird.
„Büroarbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz, an dem Informationen erzeugt, erarbeitet,
bearbeitet, ausgewertet, empfangen oder weitergeleitet werden. Dabei werden zum
8Beispiel Planungs-, Entwicklungs-, Beratungs-, Leitungs-, Verwaltungs- oder
Kommunikationstätigkeiten sowie diese Tätigkeiten unterstützende Funktionen
ausgeführt.“ [8]
3.2. Gesundheit
Für den Begriff Gesundheit gibt es bis heute keine allgemein gültig anerkannte
Definition. In den verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen, wie Philosophie,
Medizin, Jura, Theologie, Geschichtswissenschaft, Psychologie und Soziologie wurde
sich mit der Definierung der Gesundheit auseinandergesetzt. Auch Schriftsteller,
Dichter, Politik, das Versicherungswesen und Verwaltungen erweiterten die
Gesundheitsdefinition. Es gibt viel Literatur, die sich mit dem Wesen und Wert der
Gesundheit auseinandersetzt, aber nur wenig wissenschaftliche Gesundheitstheorien.
[9]
Eine ältere Definition von der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 1946 lautet
übersetzt:
„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen.“ [10]
Eine neuere Definition aus der Enzyklopädie Brockhaus von 2006 lautet:
„Das «normale» (bzw. nicht «krankhafte») subjektive Befinden, Aussehen und
Verhalten sowie das Fehlen von der Norm abweichender ärztlicher Befunde.“ [11]
Um für ein gesünderes Arbeiten am Büroarbeitsplatz zu sorgen, wurden schon
mehrere Ideen umgesetzt. Arbeitsmittel wie die Maus, das Mauspad und die Tastatur
können ergonomisch gestaltet werden. Die Arbeitsmöbel können ebenso ergonomisch
gestaltet werden. Ein stufenlos verstellbarer Schreibtisch ist für jeden Mitarbeiter
individuell anpassbar und die Arbeit im Stehen ist damit auch möglich. Für die sitzende
Arbeit gibt es auch individuell anpassbare Bürostühle oder man benutzt einen
Gymnastikball. Bürostühle können durch verschiedenste Kissen unterstützt werden,
wie zum Beispiel mit einem Ballkissen, einem Keilkissen oder einem Kissen, welches
nach einer bestimmten Zeit anfängt zu vibrieren. Eine weitere Möglichkeit ist es, sich
bei der Arbeit zu bewegen. Dies wird umgesetzt, indem ein Laufband mit einem
Schreibtisch kombiniert wird. [12]
93.3. Krankheit
Auch bei dem Begriff Krankheit gibt es bis heute keine allgemein gültig anerkannte
Definition. Im Gegensatz zu der Definition von Gesundheit, hat die Definition von
Krankheit sehr viele Theorien über Entstehung und Aufrechterhaltung, aber dafür nur
wenige Auseinandersetzungen mit dem Phänomen der Erkrankung. [9]
Eine Definition von der Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung lautet:
„Krankheit ist im engeren medizinischen Sinn Behandlungs- und/oder
Pflegebedürftigkeit. Das deutsche Standardwerk der medizinischen Wörterbücher, der
„Pschyrembel“, definiert Krankheit als „Störung der Lebensvorgänge in Organen oder
im gesamten Organismus mit der Folge von subjektiv empfundenen und/oder objektiv
feststellbaren körperlichen, geistigen oder seelischen Veränderungen“. Eine
Abgrenzung wird vorgenommen zwischen Krankheiten in diesem Sinn und
Befindlichkeitsstörungen ohne objektivierbare medizinische Ursache. Weit verbreitet ist
eine Unterscheidung in körperlich-organische, psychosomatische und psychische
Krankheiten. Krankheit ist sowohl ein Begriff der Lebenswelt als auch ein theoretischer
Begriff der medizinischen Wissenschaft.“ [13]
In dem Buch „Modelle von Gesundheit und Krankheit“ wird aufgezeigt welche Kriterien
aktuell für die Kennzeichnung von Krankheiten eine Rolle spielen:
• „das Vorhandensein von objektiv feststellbaren körperlichen, geistigen und/ oder
seelischen Störungen bzw. Veränderungen, also das Vorliegen eines Befunds
• die Störung des körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens
• eine Einschränkung von Leistungsfähigkeit und Rollenerfüllung
• die Notwendigkeit professioneller (medizinischer) und sozialer, d. h.
mitmenschlicher und gesellschaftlicher Betreuung.“ [9]
Im Zusammenhang mit der Arbeit an einem Büroarbeitsplatz sind einige Krankheiten
besonders auffällig. Darunter fallen die Rücken-, Kopf-, Nacken-, Schulter-,
Ellenbogen- und Handgelenkschmerzen. [12]
Darüber hinaus gehen auch ein erhöhtes Diabetesrisiko, Krebsrisiko und
Sterblichkeitsrisiko mit der Büroarbeit einher. [14]
103.4. Bewegung
Bei einem Büroarbeitsplatz verbringt man den größten Teil der Zeit im Sitzen in einer
monotonen Stellung an einem Schreibtisch vor einem Monitor. Selbst nach der Arbeit
gibt es viele Tätigkeiten, die auch zu Hause im Sitzen verbracht werden, wie zum
Beispiel fernsehen und spielen von Computer- oder Konsolenspielen. In einer Studie
aus dem Fachblatt BMC Public Health wurde festgestellt, dass der Bewegungsmangel
in Europa von Jahr zu Jahr zunimmt. [15] [16]
Eine Folge aus diesem Verhalten von Menschen ist ein Bewegungsmangel, wodurch
gesundheitliche Probleme bei den Menschen entstehen können. Diese Probleme
sollten angegangen werden indem sich die Arbeitnehmer mehr bewegen, denn das
wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Eine Studie aus dem Juli 2015 belegt, dass
es den Probanden mit einer geringeren Sitzzeit und mehr Bewegung besser geht.
Davon profitieren der Stoffwechsel und das Herz-Kreislaufsystem, der Body-Mass-
Index wurde niedriger, der Bauchumfang nahm ab, der Blutzuckerspiegel und die
Blutfettwerte wurden besser. [17] [18] [19]
3.5. Licht
Licht spielt auch bei Büroarbeitsplätzen eine große Rolle. Die Fähigkeit des Sehens
wird durch das Licht erst ermöglicht und hat deshalb direkten Einfluss auf die
Büroarbeitsplätze. Licht ist eine elektromagnetische Strahlung in einem bestimmten
Wellenlängenbereich, die von menschlichen Augen wahrgenommen werden kann. Der
Wellenlängenbereich des Lichts ist definiert von 380 bis 780 Nanometer, wie in
Abbildung 1 auf Seite 12 dargestellt. In bestimmten Wellenlängenbereichen wird das
Licht für das menschliche Auge in unterschiedlichen Farben wahrgenommen. Bei einer
Wellenlänge von 380 Nanometer beispielsweise sieht das menschliche Auge violettes
Licht und bei 780 Nanometern rotes Licht. In den Wellenlängenbereichen zwischen
diesen befindet sich das gesamte Farbspektrum von Violett über Blau, Grün, Gelb,
Orange bis zu Rot. [20]
11Abbildung 1: Licht
Quelle: Industrieverband Büro und Arbeitswelt, Fachschrift Nr. 12 – Licht, S. 5 [20]
Der Mensch kann durch Farben psychologisch beeinflusst werden. Gelb wirkt zum
Beispiel sonnig, hell, leicht, frisch und warm, wohingegen dunkelgrau trostlost,
drohend, trüb wirkt. Diese psychologischen Farbwirkungen können dazu verwendet
werden, um Umgebungsbedingungen auszugleichen. Farben können auch
Informationen aufzeigen, wie zum Beispiel bei Sicherheitsschildern in bestimmten
Farben, die einem etwas Verbieten, Warnen oder Informieren. [21]
Für den Menschen hat Licht noch eine weitere wahrnehmbare Eigenschaft. Die
Helligkeit bewirkt wie hell oder dunkel etwas wahrgenommen wird. Zum einen kann
der Mensch bei zu geringer Helligkeit seine Umgebung nicht mehr sehen und zum
anderen schmerzt zu hohe Helligkeit den menschlichen Augen.
Am Arbeitsplatz wird so eine passende Beleuchtung vorgeschrieben. Im Anhang der
Arbeitsstättenverordnung Nr. 6.1 Ziffer (4) und (8) steht, dass die Beleuchtung von
Büroarbeitsplätzen folgendermaßen eingerichtet werden muss.
(4) Die Bildschirmgeräte sind so aufzustellen und zu betreiben, dass die Oberflächen
frei von störenden Reflexionen und Blendungen sind.
(8) Die Beleuchtung muss der Art der Arbeitsaufgabe entsprechen und an das
Sehvermögen der Beschäftigten angepasst sein; ein angemessener Kontrast zwischen
12Bildschirm und Arbeitsumgebung ist zu gewährleisten. Durch die Gestaltung des
Bildschirmarbeitsplatzes sowie der Auslegung und der Anordnung der Beleuchtung
sind störende Blendungen, Reflexionen oder Spiegelungen auf dem Bildschirm und
den sonstigen Arbeitsmitteln zu vermeiden. [6]
Bei industriellen und kognitiven Aufgaben können Menschen durch Licht positiv
beeinflusst werden. Durch hohe Beleuchtungsstärke und hohe Farbtemperaturen wird
die Produktivität gesteigert, denn die Sehleistung wird erhöht und
Ermüdungserscheinungen werden abgeschwächt. Die Beleuchtungsstärke gibt dabei
an, wie viel Licht auf eine Fläche fällt. Über die Farbtemperaturen wird angegeben wie
warm oder kalt eine Farbe ist. Dabei werden niedrige Farbtemperaturen, wie blau, als
kalt empfunden und hohe Farbtemperaturen, wie rot, als warm empfunden. Es gibt
auch eine Lichttherapie, die zur Behandlung von Depressionen und Schlafstörungen
eingesetzt wird. [22]
3.6. Betriebliches Gesundheitsmanagement
Zwei Definitionen aus dem Buch „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ von
Eberhard Kiesche lauten:
„Betriebliches Gesundheitsmanagement ist die bewusste Steuerung und Integration
aller betrieblichen Prozesse mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden der
Beschäftigten zu erhalten und zu fördern.“
„Betriebliches Gesundheitsmanagement im Sinne einer ganzheitlichen Strategie
umfasst alle Maßnahmen, die sowohl zur individuellen Gesundheit als auch zur
›gesunden‹ Organisation beitragen.“ [23]
Die Aufrechterhaltung der Gesundheit steht im Mittelpunkt. Es gibt im betrieblichen
Umfeld viele Faktoren, die zu Krankheiten führen. Zum Beispiel psychischer Druck
durch Personalabbau und der daraus folgenden Leistungssteigerung der
Arbeitnehmer oder physischer Belastung durch lange Sitzzeiten am Schreibtisch,
wegen längerer Arbeitszeiten. [23]
13Seit 2009 steigen die krankheitsbedingten Fehltage, wie man aus dem Diagramm in
Abbildung 2 von dem wissenschaftlichen Institut der AOK entnehmen kann. Es ist über
die letzten Jahre hinweg ein deutlicher Zuwachs an Arbeitsunfähigkeitstagen (AU-
Tage) und Arbeitsunfähigkeitsfällen (AU-Fälle) zu erkennen. 2009 waren es noch 51,2
AU-Tage je 1.000 AOK-Mitglieder und 2018 sind die AU-Tage je 1.000 Mitglieder auf
120,5 angestiegen. Bei den AU-Fällen je 1.000 Mitglieder stieg der Wert von 2009 mit
3,1 auf den Wert 5,7 im Jahr 2018. Nicht alle AU-Tage sind auf die Arbeit
zurückzuführen, denn im privaten Bereich der Menschen können ebenfalls Ursachen
zu finden sein. [24]
Abbildung 2: Arbeitsunfähigkeits-Tage und -Fälle pro Jahr
Quelle: Fehlzeiten-Report 2019, S.470 [24]
Ein großer Anteil für die Fehltage liegt an Muskel- und Skelett-Erkrankungen, wie in
Abbildung 3 auf Seite 15 zu sehen ist. Diese konnten zwar von 22,5% im Jahr 2017
schon auf 22,0% im Jahr 2018 verringert werden. Trotzdem macht diese Gruppe fast
noch ein Viertel der Krankheiten aus. Des Weiteren steigen Atemwegskrankheiten und
psychische Krankheiten. [24]
14Abbildung 3: Anteil von Krankheiten
Quelle: Fehlzeiten-Report 2019, S.447 [24]
Folgen für Unternehmen durch Fehltage von Mitarbeitern sind in drei Kategorien
aufgeteilt. In der Abbildung 4 werden die unmittelbaren Personalkosten, mittelbaren
Personalkosten und die sonstigen Kosten aufgelistet.
Abbildung 4: Personalkosten
Quelle: Controlling & Management Review, S.369 [2]
Fehltage der Mitarbeiter sind also schlecht für die Unternehmen, weshalb Maßnahmen
ergriffen werden müssen, um diese zu verhindern. Ein gesundes Arbeitsumfeld, in dem
sich die Mitarbeiter wohlfühlen, ist dabei sehr wichtig.
154. Methodik
Für die Analyse von Technologien zur Steigerung der Bewegungsaktivität an
Büroarbeitsplätzen wurde in der Bibliothek und über Internetsuchmaschinen, wie
Google Scholar, passende Literatur herausgesucht.
Um herauszufinden, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter zur Bewegung motivieren
können, werden verschiedene Technologien miteinander verglichen. Es wird eine
Auswahl von fünf möglichst verschiedenen Technologien für den Vergleich getroffen.
Genau wie in der Studie vom „Journal of Medical Internet Research“. Bei der Studie
„Smartphones for Smarter Delivery of Mental Health Programs: A Systematic Review“
wurden fünf Apps verglichen in dem Bereich für psychische Gesundheit. Das Ergebnis
der Studie zeigte, dass die Apps wirksam sind und die Zugänglichkeit der Behandlung
erheblich verbessern, aber es fehlen noch wissenschaftliche Beweise für diese
Wirksamkeit. Um die Technologien miteinander vergleichen zu können, werden dafür
Kriterien benötigt. Diese fokussieren sich deshalb nicht auf die Wirksamkeit, sondern
auf die Verwendbarkeit der Technologien für Unternehmen. [25]
Folgende Kriterien wurden im Rahmen dieser Arbeit ausgearbeitet:
1. Über welche Reize wird der Anwender informiert?
2. Wurde die Technologie speziell für den Büroarbeitsplatz entwickelt?
3. Wie wird die Technologie gesteuert?
4. Welches Betriebssystem ist vorausgesetzt?
5. Welche technischen Voraussetzungen benötigt die Technologie?
6. Wie ist der Kostenfaktor dieser Technologie?
7. Ist das Produkt verfügbar?
Für jede Technologie wird jede Frage beantwortet und zusätzlich werden Punkte dazu
vergeben. Anhand dieser Punkte wird eine Bewertung durchgeführt, die zeigt, welche
Technologie am besten abgeschnitten hat. Eine analysierte Technologie wird
optimiert, damit die Verwendbarkeit der Technologie für Unternehmen verbessert wird.
165. Vergleich der Techniken zur Steigerung der
Bewegungsaktivität an Büroarbeitsplätzen
Folgend geht es um den Vergleich der modernen Technologien an Büroarbeitsplätzen,
die zu einer gesteigerten Bewegungsaktivität oder dem Beenden der Arbeitszeit
anreizen sollen. Um die Technologien vergleichen zu können, werden dafür die
Kriterien aus der Methodik benutzt. Für die Technologien, die es in verschiedenen
Ausführungen gibt, wird jeweils ein eindeutiger Vertreter festgelegt, der mit anderen
verglichen werden kann.
5.1. Auswahl der Technologien für den Vergleich
Es gibt viele verschiedene moderne Technologien, um auf eine notwendige
Bewegungsaktivität oder das Beenden der Arbeit an einem Büroarbeitsplatz
hinzuweisen. Aufgrund dessen werden Technologien mit voneinander möglichst stark
abweichenden technologischen Ansätzen verglichen. Für jeden Technologieansatz
wird ein typischer Vertreter für den Vergleich herangezogen.
5.1.1 Darma-Kissen
Die erste Technologie informiert den Anwender mittels haptischen Feedbacks. Der
gewählte Vertreter davon ist das Darma-Kissen, welches speziell für einen
Büroarbeitsplatz ausgelegt ist. Dieses Smart-Kissen dient als Sitz- und Körpertrainer.
Durch Vibrationen wird dem Anwender dabei geholfen, seine schlechten
Sitzgewohnheiten zu ändern und Schmerzen im Rücken oder in den Schultern zu
lindern.
Ausgestattet ist das Kissen mit Glasfaser-Sensoren, die laut Hersteller im Gegensatz
zu Drucksensoren viel empfindlicher und präziser sind. Durch die mehrlagige
Schaumstoffpolsterung und das hochwertige Kunstleder soll der Komfort für
Bürostühle gegeben sein.
17Um das Kissen zu benutzen, muss es einfach nur auf den Stuhl gelegt werden und
darauf Platz genommen werden. Sobald der Stuhl benutzt wird, werden automatisch
die Köperhaltung, Sitzzeit, Vitalfunktionen wie Stresslevel, Herzfrequenz und
Atemfrequenz des Anwenders aufgezeichnet. Über sanfte Vibrationen und
Benachrichtigung über ein Smartphone wird der Anwender daran erinnert, die
Körperhaltung zu korrigieren oder eine Bewegung zu tätigen, wie zum Beispiel eine
Dehnung. Die Verbindung zwischen Kissen und Smartphone wird über Bluetooth 4.0
hergestellt. Das Kissen ist kompatibel zu Android-Geräten und Apple-Geräten. Das
Smartphone muss die kostenlose Darma-App heruntergeladen haben, damit das
Kissen mit dem Smartphone kommunizieren kann. Die Akku-Laufzeit des Kissens
beträgt 80 bis 90 Sunden. Damit kann das Kissen mit jeder Ladung etwa 2 Wochen
benutzen, bevor es wieder aufgeladen werden muss. In der Abbildung 5 ist das Darma-
Kissen und die dazugehörige App zu sehen. [26] [27] [28]
Abbildung 5: Darma-Kissen
Quelle: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71o3fxNA9fL._AC_SL1500_.jpg [28]
5.1.2 Bildschirmzeit
Die zweite Technologie informiert den Anwender über visuelle Reize. Der ausgewählte
Vertreter ist dabei die Anwendung Bildschirmzeit von Apple-Geräten, welche nicht
speziell für den Büroarbeitsplatz entwickelt wurde. In den Einstellungen bei den iOS
und macOS Betriebssystemen kann der Anwender unter Bildschirmzeit oder auch
18Screen Time Einblicke über sein Nutzungsverhalten aller seiner Apple-Geräte
einsehen. Wie oft und wie lang das Gerät benutzt wurde oder welche Apps am meisten
benutzt wurden, kann sich der Anwender über dieses Menü auswerten lassen. Für
Apps können auch individuelle Zeitlimits gesetzt werden, sodass man seine
gewünschten Zeiten einhält. Es kann aber auch der ganze Bildschirm ausgeschaltet
werden nach einer festgelegten Zeit. Dabei bekommt der Anwender fünf Minuten vor
Abschalten des Bildschirms eine Ankündigung, dass sich der dieser ausschalten wird.
Wenn der Anwender diese Funktion nutzt, kann er die Bildschirmauszeit dafür nutzen
sich nach bestimmten Zeiten für eine Bewegungsaktivität zu motivieren oder in den
Feierabend zu gehen. In Abbildung 6 ist eine Darstellung von der Bildschirmzeit zu
sehen. [29]
Abbildung 6: Bildschirmzeit
Quelle: https://support.apple.com/library/content/dam/edam/applecare/images/en_US/macos/Big-Sur/macos-big-
sur-screen-time-hero.jpg [30]
Für die Betriebssysteme Windows und Linux gibt es ebenfalls ähnliche Möglichkeiten
eine Begrenzung der Benutzung des Computers festzulegen. Diese sind nicht so
ausgereift wie bei Apple. Bei dem Betriebssystem Android gibt es einige Apps im
Google Play Store, die die Funktionen von Bildschirmzeit umfassen. Android-Geräte
werden aber größtenteils nicht als Computer für den Büroarbeitsplatz eingesetzt.
195.1.3 Philips Hue
Die dritte Technologie informiert den Anwender über visuelle Reize. Der ausgewählte
Vertreter ist Philips Hue und ist nicht speziell für den Büroarbeitsplatz entwickelt
worden. Philips Hue ist ein smartes Lichtsystem, dass über Bluetooth oder die Hue-
Bridge gesteuert werden kann. Gesteuert werden die verschiedensten Lampen von
Phillips Hue. In der Abbildung 7 sind eine Hue-Bridge in der Version 2 und zwei
Lampen zu sehen. Ein Smartphone, dass die Philips Hue-App installiert hat, kann mit
dieser die Lampen bedienen. Die App funktioniert auf Android-Geräten und iOS-
Geräten. Ebenfalls gibt es offiziell ein Programm für macOS und Windows 10 mit dem
Namen Hue Sync. Hue Sync unterstützt nur die Hue-Bridge Version 2 und benötigt die
Hue-App für eine erste Konfiguration. Die Lampen können einzeln oder in Gruppen
bedient werden. Wenn die farbigen Lampen vorhanden sind, können diese in
verschiedene Lichtfarben eingestellt werden. Es können Routinen erstellt werden,
wann und wie lang eine Lampe leuchten soll. Ein Timer kann ebenso benutzt werden.
Der Benutzer wird durch die Veränderung der Beleuchtung daran erinnert, sich zu
bewegen oder seine Arbeit zu beenden. Dies wird beispielsweise durch die
Veränderung der Lichtfarbe ermöglicht. [31] [32] [33] [34] [35]
Abbildung 7: Philips Hue
Quelle: https://www.philips-hue.com/de-de/starter-kits [31]
205.1.4 Alarm & Uhr
Die vierte Technologie informiert den Anwender über akustische und visuelle Reize.
Der ausgewählte Vertreter ist ein klassischer Wecker in Form einer Anwendung mit
dem Namen Alarm & Uhr auf dem Betriebssystem Windows 10. Dieser ist nicht speziell
auf die Büroarbeitsplätze ausgelegt. Es können Alarmzeiten eingestellt werden, wann
der Anwender informiert werden möchte. Ein Countdown und eine Stoppuhr können
ebenfalls benutzt werden. Beim Auslösen des Alarms wird über die Lautsprecher ein
Signal abgegeben und über das Display eine Nachricht angezeigt. Durch diese
Benachrichtigungen wird der Anwender informiert. Die Anwendung ist bei Windows in
der Suche zu finden, wie in der Abbildung 8 dargestellt ist.
Abbildung 8: Alarm & Uhr
Quelle: Eigene Darstellung
Auf Computern, Laptops, Smartphones, Tablets, Smartwatches und Fitnesstrackern
mit den verschiedensten Betriebssystemen, wie Windows, iOS, macOS, Linux oder
Android, gibt es einen Wecker. Diese haben verschiedene Umfänge, wie das Stellen
eines Timers oder das Einrichten von Routinen. Bei Ablauf der Zeit oder Erreichen der
21gewünschten Uhrzeit ertönt ein Signal. Es kann auch eine Nachricht auf dem
Bildschirm erscheinen oder der Anwender wird durch Vibrationen informiert. Die drei
Möglichkeiten können auch in Kombination auftreten. Der Benutzer wird dadurch
daran erinnert, dass er sich bewegen sollte oder es Zeit wird für den Feierabend.
5.1.5 MasterMove
Die fünfte Technologie informiert den Anwender über akustische, visuelle und
haptische Reize. Der ausgewählte Vertreter ist ein Ergonomie-Sensor mit dem Namen
MasterMove und wurde von Inwerk, einem Büromöbelhersteller, direkt für
Büroarbeitsplätze entwickelt. Es ist ein kleines externes Gerät, welches an der
Unterseite eines Bürostuhls befestigt wird, wie Abbildung 9 zeigt. Dieses Gerät besitzt
fünf Sitz-Sensoren. Winkel-, Beschleunigungsmessung in allen drei Dimensionen,
Lautstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit können mit diesen Sensoren erfasst
werden. Das Gerät wird mit Batterien oder Akkus betrieben. Über eine App bekommt
der Anwender die Informationen des Geräts auf sein Smartphone. Durch die Sensoren
kann die Umgebung und das ergonomische Sitzen in Echtzeit analysiert werden. Das
Gerät informiert den Anwender darüber, was dieser tun sollte, um eine gesündere
Arbeitsweise an seinem Büroarbeitsplatz umzusetzen. [36]
Abbildung 9: MasterMove
Quelle: https://www.inwerk-
bueromoebel.de/media/wysiwyg/Bueromoebel/DE/Content/mastermove/element1_1_1.jpg [36]
225.2. Vergleich der Technologien
Um die Technologien zu vergleichen, werden die verschiedenen Fragen beantwortet,
die in der Methodik festgelegt wurden.
1. Über welche Reize wird der Anwender informiert?
Das Darma-Kissen informiert die Benutzer über haptische Vibrations-Signale. Die
Bildschirmzeit agiert visuell über den Bildschirm. Phillips Hue arbeitet ebenso visuell,
allerdings mit Lampen. Im Unterschied dazu informiert Alarm & Uhr den Benutzer
visuell über den Bildschirm und akustisch über die Lautsprecher. Andere Wecker
können über Vibrations-Signale auch auf sich aufmerksam machen. Der MasterMove
kann den Anwender haptisch über Vibration, visuell über LEDs und akustisch über
Summen informieren. Das Darma-Kissen, Bildschirmzeit und Phillips Hue besitzen nur
eine Art, um die Benutzer zu erreichen. Deshalb erhalten die Technologien jeweils
einen Punkt. Alarm & Uhr verwendet zwei Arten der Informationsweitergabe und
bekommt deshalb zwei Punkte. Der MasterMove verwendet drei Arten und bekommt
deshalb drei Punkte.
2. Wurde die Technologien speziell für den Büroarbeitsplatz entwickelt?
Bildschirmzeit, Phillips Hue und Alarm & Uhr wurden nicht speziell für den Einsatz an
Büroarbeitsplätzen entwickelt, weshalb die Technologien dafür keinen Punkt
bekommen. Das Darma-Kissen und der MasterMove bekommen jeweils einen Punkt,
da diese speziell dafür entwickelt wurden. Sie besitzen jeweils eine App für Android
und iOS, die als virtueller Coach oder Trainer eingesetzt werden können, um die
Bewegung am Arbeitsplatz positiv zu beeinflussen. Für diese Coach oder Trainer
Funktion gibt es zusätzlich noch einen Punkt.
3. Wie wird die Technologie gesteuert?
Das Darma-Kissen und der MasterMove werden mit dem Smartphone gesteuert.
Alarm & Uhr wird über eine Arbeitscomputer mit Windows gesteuert. Dafür bekommen
die drei Technologien jeweils einen Punkt, weil sie mit einem Gegenstand gesteuert
23werden können. Die Bildschirmzeit und Philips können direkt am Arbeitscomputer und
am Smartphone bedient werden. Dafür bekommen die beiden Technologien jeweils
zwei Punkte. Zu erwähnen ist, dass für die Ersteinrichtung der Hue Sync von Philips
Hue für Windows oder macOS ein Smartphone mit der Philips Hue-App benötigt wird.
4. Welches Betriebssystem ist vorausgesetzt?
Für jedes Betriebssystem, dass eine Technologie unterstützt, bekommen diese einen
Punkt. Wobei iOS und macOS zusammen als ein Betriebssystem von Apple gelten
und somit nur einen Punkt ergeben. Das Darma-Kissen und der MasterMove
unterstützen die Betriebssysteme Android und iOS. Das bedeutet jeweils zwei Punkte
für die zwei Techniken. Bildschirmzeit unterstützt die Betriebssysteme von Apple und
Alarm & Uhr das Betriebssystem von Windows. Dafür bekommen beide jeweils einen
Punkt, weil sie jeweils nur ein Betriebssystem unterstützen. Philips Hue bekommt drei
Punkte, weil es auf den Betriebssystemen Android, Windows, iOS und macOS
funktioniert. Philips Hue Sync funktioniert aber erst nach einer Ersteinrichtung per
Smartphone auf macOS und auf Windows 10 mit 64 Bit. Die Funktion der
Bildschirmzeit kann auf Android und Windows unter anderen Namen ebenso benutzt
werden. Genau wie der Wecker Alarm & Uhr auf anderen Betriebssystemen unter
anderen Namen existiert.
5. Welche technischen Voraussetzungen benötigt die Technologie?
Für das Darma-Kissen wird das Kissen mit geladenem Akku und ein Smartphone mit
der passenden App benötigt. Die Bildschirmzeit kann genutzt werden, sobald ein Apple
Laptop, Computer oder Smartphone verfügbar ist. Philips Hue benötigt die Hue-Bridge
für die Verbindung, Hue-Lampen für die visuellen Reize und ein Smartphone mit der
passenden App für die Bedienung. Alarm & Uhr benötigt nur ein Windows-Gerät und
ist damit einsatzfähig. Der MasterMove benötigt sich als Gerät selbst, mit geladenen
Batterien und ein Smartphone mit passender App für die Bedienung. Darma-Kissen,
Philips Hue und MasterMove bekommen keinen Punkt, da diese mehrere
Voraussetzungen haben. Bildschirmzeit und Alam & Uhr bekommen jeweils einen
Punkt, weil jeweils nur das Gerät mit dem passenden Betriebssystem benötigt wird.
246. Wie ist der Kostenfaktor dieser Technologie?
Ein Darma-Kissen kostet 199 $. Umgerechnet wären das aktuell rund 168 €. Das
Philips Hue Starter-Kit White & Color kostet 149,99 € auf der offiziellen Internetseite.
MasterMove kostet 99 € in der Anschaffung. Für diese drei Technologien gibt es durch
die Anschaffungskosten keine Punkte. Bildschirmzeit und Alarm & Uhr bekommen
jeweils einen Punkt, weil sie Standardfunktionen sind, die in den jeweiligen
Betriebssystemen schon vorhanden sind. [26] [37] [38]
7. Ist das Produkt verfügbar?
Das Darma-Kissen ist zur Zeit dieser Arbeit nicht verfügbar und bekommt deshalb
keinen Punkt. Bildschirmzeit, Philips Hue, Alam & Uhr sind verfügbar und bekommen
deshalb jeweils einen Punkt. Der MasterMove ist ab dem 10.05.2021 verfügbar und
bekommt ebenfalls einen Punkt. [38]
Für die bessere Übersicht ist der Vergleich in Tabelle 1 auf Seite 26 und 27 dargestellt.
255.3. Tabellarischer Vergleich der Technologien
Technologie und 1 2 3 4 5
Vertreter Darma-Kissen Bildschirmzeit Phillips Hue Alarm & Uhr MasterMove
Haptisch
Visuell über Vibration,
Über welche Reize
Haptisch Visuell Visuell über Bildschirm, Visuell
wird der Anwender
über Vibrationen über Bildschirm über Lampen Akustisch über LEDs,
informiert?
über Lautsprecher, Akustisch
über Summen
Punkte 1 1 1 2 3
Speziell für den
Ja Nein Nein Nein Ja
Büroarbeitsplatz?
Punkte 2 0 0 0 2
Wie wird die
Arbeitscomputer, Arbeitscomputer,
Technologie Smartphone Arbeitscomputer Smartphone
Smartphone Smartphone
gesteuert?
Punkte 1 2 2 1 1
26Technologie und 1 2 3 4 5
Vertreter Darma-Kissen Bildschirmzeit Phillips Hue Alarm & Uhr MasterMove
Welches Android,
Android, Android,
Betriebssystem ist iOS, macOS iOS, macOS Windows 10
iOS iOS
vorausgesetzt? Windows 10
Punkte 2 1 3 1 2
Welche technischen
Darma-Kissen, Hue-Bridge, MasterMove-Gerät,
Voraussetzungen
Geladener Akku, Apple-Gerät Hue-Lampen, Windows 10-Gerät Batterien,
benötigt die
Smartphone Smartphone Smartphone
Technologie?
Punkte 0 1 0 1 0
Wie ist der
Starter-Kit White &
Kostenfaktor dieser 199 $ (~ 168 €) - - 99 €
Color 149,99 €
Technologie?
Punkte 0 1 0 1 0
Ist die Technologie Ja
nein ja Ja Ja
verfügbar? (ab 10.05.2021)
Punkte 0 1 1 1 1
Gesamtpunkte 6 7 7 7 9
Tabelle 1: Vergleich der modernen Techniken
275.4. Bewertung des Vergleichs
5.4.1 Schlussfolgerung der fünf Technologien
Die Gesamtpunktzahl ist bei MasterMove mit neun Punkten am höchsten. Darauf
folgen Bildschirmzeit, Philips Hue und Alarm & Uhr mit sieben Punkten. Das Darma-
Kissen kommt am Ende auf sechs Punkte. MasterMove bekam die meisten Punkte,
weil es eine einfache kleine Technologie ist, die an jedem Stuhl befestigt werden kann
und mit verschieden Arten den Anwender informieren kann. Zusätzlich unterstützt es
die zwei gängigen Smartphone-Betriebssysteme Android und iOS. Mit einem
persönlichen Trainer punktet der MasterMove zusätzlich.
Bei dem Vergleich fällt auf, dass viele Technologien ein Smartphone voraussetzen.
Smartphones sind bei den Arbeitgebern, aber nicht gern gesehen, da diese den
Arbeitnehmer ablenken können. Anwender, die kein Smartphone besitzen, können
diese Technologien nicht benutzen.
Die speziell für die Büroarbeitsplätze entwickelten Technologien bieten den Vorteil
eines persönlichen virtuellen Trainers. Dieser meldet sich per Smartphone und
informiert den Benutzer, wenn zum Beispiel monotone Haltungen zu lang
eingenommen werden oder es Zeit wird, aufzustehen. Bei den anderen Technologien
müssen vorher eigene Einstellungen konfiguriert werden. Zuerst sollte sich aber
darüber informiert werden, wie lang man am Stück sitzen sollte. Die Anschaffung von
externer Technik ist jeweils mit Kosten verbunden. Bei einer reinen Software-
Technologie wird dagegen kein Aufpreis verlangt, da diese schon in das
Betriebssystem integriert ist.
5.4.2 Schlussfolgerung für die eigene Anwendung
Für die eigene Anwendung soll die Philips Hue-Technologie auf der Windowsplattform
optimiert werden. Aktuell wird bei der offiziellen Windows-App, Hue Sync, ein
Smartphone benötigt um diese zu verwenden. Nur über die Philips Hue-App kann eine
erste Konfiguration an Hue Sync stattfinden. Ebenso sind Nutzer mit einer älteren Hue-
Bridge Version 1 nicht in der Lage Hue Sync zu nutzen, da diese nicht unterstützt wird.
286. Design eines Programms
6.1. Anforderungen an das Programm
Um Büroarbeitsplätze mit moderner Technik zu unterstützen, soll die Möglichkeit
geschaffen werden, die Funktionen der Philips Hue-App auf einem Windows-Gerät zu
nutzen. Dies soll so umgesetzt werden, dass die Benutzer kein Smartphone benötigen
für eine erste Konfiguration. Das Programm soll den Anwender mit Hilfe von
farbenwechselnden Hue-Lampen warnen, wenn dieser zulange an einem
Büroarbeitsplatz arbeitet. Der Arbeitspatz muss mit dem Hue-Lampensystem
ausgestattet sein. Der Anwender muss eine Verbindung zur Hue-Bridge mit dem
Programm über den PC herstellen und trennen können. Die gewünschten
Arbeitsstunden, die der Anwender arbeiten möchte, bevor ihn das Programm warnt,
müssen ebenfalls eingegeben und geändert werden können. Ebenso muss die Zeit
gestartet, pausiert und zurückgesetzt werden können. Um einen praktischen Nutzen
aus dem Programm zu ziehen, muss das Programm so gestaltet sein, dass es
benutzerfreundlich zu bedienen ist.
6.2. Designvorschläge
Die Designs wurden mit dem Programm Balsamiq Mockups 3 erstellt. Dies bot die
Möglichkeit die Designprototypen in PDF-Formate zu exportieren. Diese PDF-Dateien
konnten von den Probanden zum Testen genutzt werden. Die PDF ist ein gängiges
Format, welches unabhängig von dem Betriebssystem benutzt werden kann. In der
Datei werden nur Bilder von dem Design des Programms gezeigt. Die Buttons in dem
Design sind verlinkt mit anderen Bildern, so können die Probanden durch einen Klick
auf den Button zu anderen Bildern gelangen. Dadurch erhalten sie eine Vorstellung,
wie das Programm aussieht und funktioniert.
296.2.1 Design 1
Design 1 wird in Abbildung 10 dargestellt. Es zeigt die Oberfläche erst, wenn eine
Verbindung hergestellt wird. Die Oberfläche ist mit unterschiedlichen Buttongrößen
ausgestattet und enthält eine kreative Anordnung der Buttons. Es gibt eine
Hilfeschaltfläche, die alle Buttons erklärt. Um den Start-Button gibt es einen Kreis der
den Fortschritt der Zeit anzeigt.
Abbildung 10: Design 1
Quelle: Eigene Darstellung
306.2.2 Design 2
Design 2 wird in der Abbildung 11 dargestellt. Es ist eine sehr schlichte und einfach
gehaltene Oberfläche, bei der alles einheitlich und ohne Text auf einer Oberfläche zu
finden ist. Es gibt eine Hilfeschaltfläche, die alle Buttons erklärt.
Abbildung 11: Design 2
Quelle: Eigene Darstellung
6.2.3 Design 3
Design 3 wird in der Abbildung 12 auf Seite 32 dargestellt. Es ist eine komplexere
Variante, in der es drei Menüpunkte gibt. Die erste ist für die Verbindung und das
Trennen zuständig. In dem zweiten Menüpunkt wird die Hauptfunktion, das Abspielen
der Zeit, übernommen. Der rechte Menüpunkt ist für die Einstellung der Zeit
vorhanden. Auf ein extra Hilfemenü wird verzichtet, dafür steht an jeder Stelle, eine
genaue Beschreibung der Funktionalität.
31Abbildung 12: Design 3
Quelle: Eigene Darstellung
326.3. Nutzerstudie für das Design
Um herauszufinden, welches der drei Designs für eine Umsetzung in Frage kommt,
wurde eine Studie durchgeführt.
6.3.1 Methode
Für die Studie wurden drei Gruppen mit je fünf Personen getestet, welche anonym
sind. Gruppe 1 bestand aus angehenden Informatikern im Alter von 21 bis 24 Jahren.
Gruppe 2 bestand aus 24 bis 32-Jährigen und Gruppe 3 bestand aus 36 bis 55-
Jährigen. Gruppe 2 und 3 waren in einem Beruf mit Büroarbeitsplatz tätig.
Wegen der aktuellen Corona Pandemie wurden die Tests Online über die Programme
Skype oder Discord durchgeführt. Die Probanden bestätigten, dass Sie sich
wohlfühlten und freiwillig an dem Test teilnehmen. Die Probanden bekamen über eines
der Programme drei Designs und ein Probedesign im PDF-Format gesendet. Anhand
des Probedesign wurde den Probanden erklärt, wie der Test ablaufen wird und wie die
Designs im PDF-Format funktionieren. Jeder Proband durfte sich die Reihenfolge der
zu testenden Designs aussuchen.
Um die Designs zu testen wurde die Think-Aloud-Methode angewandt. Dabei
bekamen die Probanden eine Aufgabe, die Sie mit den Designs eigenständig erfüllen
sollten. Nebenbei berichtete jeder Proband, was er bei seinen Aktionen dachte. Die
Zeit für diese Aufgabe wurde festgehalten und in drei Hauptaktionsziele unterteilt.
Alle anderen Aktionen, die nicht bei der Aufgabenlösung ausgeführt wurden, galten als
Nebenaktionsziele und wurden nach der Lösung der Aufgabe direkt abgefragt. Wurden
alle Ziele absolviert, benoteten die Probanden die einzelnen Aktionsziele und
entschieden sich für einen Favoriten aus den drei Designs. Probanden konnten auch
Verbesserungsvorschläge in Hinblick auf Grafik und Benutzerfreundlichkeit äußern.
Die Ergebnisse wurden für jeden Probanden separat in einer Tabelle festgehalten.
336.3.2 Ergebnisse
Analyse:
Aus den mitgeschriebenen Daten konnten folgende Ergebnisse analysiert werden, die
in einer Tabelle dargestellt werden:
Design 1 Design 2 Design 3
Notendurchschnitt 1,33 1,45 2,25
Durchschnittliche
00:25 Minuten 00:20 Minuten 00:55 Minuten
Zeit der Probanden
Gesamtzeit aller
06:17 Minuten 05:09 Minuten 13:51 Minuten
Gruppen
Favorit von Gruppe 1 und 2 Gruppe 3 -
Tabelle 2: Vergleich der Designs
Design 1 hat den besten Notendurchschnitt mit 1,33 erhalten und ist der Favorit für
alle jüngeren Probanden der Gruppe 1 und 2. Zeitlich gesehen wurde bei Design 1 die
Aufgabe etwas langsamer gelöst als Design 2. Gelobt wurde der große Play-Button,
der den Anwender direkt anspricht. Wenig Kritik und mehr Lob gab es über die
Anfangsseite des Programms. An dieser Stelle muss sich erst mit der Hue-Bridge
verbunden werden, bevor die ganze Oberfläche gezeigt wird. Dadurch wurden die
Probanden von keinen anderen Buttons abgelenkt. Kritik gab es beim Eintragen der
Zeit, was den Probanden zu uneindeutig war.
Design 2 lag im Notendurschnitt nur knapp hinter Design 1 mit einem Wert von 1,45.
Dieser Wert ist statistisch unsicher, weil es nur mit einer kleinen Gruppe von
Testprobanden getestet wurde. Die Gruppe 3 mit den älteren Probanden fanden
dieses Design durchweg als Favorit. Die Aufgabe wurde mit diesem Design am
schnellsten gelöst. Gelobt wurde die strukturierte, einheitliche und schlichte
Darstellung auf einer Oberfläche. Kritisiert wurde der Verbindungsaufbau, weil die
Farbe Rot des Power-Buttons als Status benutzt wurde und keine weitere Erklärung
auf den ersten Blick zu sehen ist. Einige Probanden dachten der rote Power-Button ist
für die Trennung der Verbindung.
34Design 3 hat den schlechtesten Notendurschnitt bekommen mit einem Wert von 2,25.
Alle Gruppen benötigten hierbei auch am längsten, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Keiner
der Probanden in allen drei Gruppen nannte dieses Design als Favorit. Zudem gab es
mehr Kritik als bei Design 1 und 2. Häufig genannt wurde die Tatsache, dass die drei
einzelnen Menüpunkte unübersichtlich und verwirrend seien. Auch die direkte
Abkürzung von den Einstellungen direkt in den Smart-Work-Bereich trug zur
Verwirrung bei. Die Probanden fanden es problematisch, dass die Zeit in einem
anderen Menü eingetragen wird und nicht in dem Smart-Work-Bereich, in dem die Zeit
gestartet wird. Viele Probanden kritisierten, dass zu viel Text in den Menüs zu sehen
ist. Beim Testen haben die meisten Probanden die Texte nicht gelesen oder nur
teilweise. Die Probanden, die sich die Zeit zum Lesen nahmen, kamen besser mit dem
Design zurecht.
Für Verbesserungsvorschläge wünschten sich die Probanden, dass der Play-Button
und Pause-Button zusammengeführt werden und bei Betätigung das Symbol wechselt.
Den Fragezeichen-Button fanden einige Probanden fehlplatziert und nicht auffällig
genug bei Design 1 und 2. Der Stopp-Button für das Zurücksetzen der Zeit war einigen
Probanden nicht eindeutig genug. Allgemein wurde sich auch ein eindeutiger Einsatz
von Farben gewünscht. Mehr Umfang könnte durch Fortschrittsbalken und Profile mit
Wochenplänen umgesetzt werden.
Zusammenfassung:
Design 1 und 2 sind am beliebtesten. Den jüngeren Probanden gefällt das Design 1
besser und den älteren das Design 2. Bei diesen beiden Designs gibt es allerdings
noch einige Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge.
Schlussfolgerungen:
Eine Kombination aus Design 1 und 2 wäre eine Möglichkeit, um die positiven Punkte
aus beiden zu vereinen. Eine andere Möglichkeit wäre es, beide Designs anzubieten.
So könnten sich die Anwender ein Design aussuchen.
35Sie können auch lesen