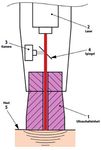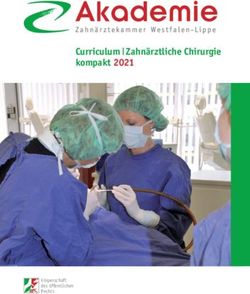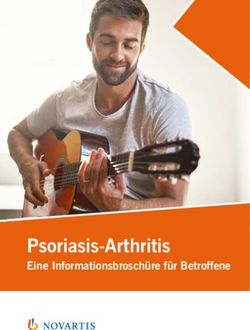Spektrum Dermatologie - wissenswert, kompakt, anregend
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
KALEIDOSKOP
Kompass Dermatol 2020;8:82–85
DOI: 10.1159/000507009
Spektrum Dermatologie –
wissenswert, kompakt, anregend
Mikroskopische Aufnahme eines längs angeschnittenen menschlichen Kopfhaarfollikels,
ohne Haarschaft. Nanopartikel sind rot markiert, Zellkerne blau. Beide Farbstoffe überlagern
sich am Follikelrand. © Rebekka Christmann / HIPS.
Universität des Saarlandes |
Haarfollikel der Kopfhaut als Depot für Arzneimittel – auch bei kreisrundem Haarausfall
Medikamente zur Behandlung des kreis- nismus bisher nicht nachgewiesen worden. dort an den Grund des Haarfollikels diffun-
runden Haarausfalls werden bisher entwe- «Darüber hinaus haben wir uns gefragt, ob diert und von den follikulären Epithelzellen
der in Tablettenform verabreicht oder groß- Nanopartikel überhaupt in Haarfollikel ein- und Immunzellen aufgenommen wird», er-
flächig auf der Kopfhaut angewendet. dringen können, die vom Haarausfall be- läutert der Leiter der Hautklinik am Univer-
Meist handelt es sich um Cortison-Präpara- troffen sind», sagt Lehr. sitätsklinikum Homburg, Thomas Vogt.
te oder noch stärkere Mittel, die starke Ne- Als Nanopartikel wurden biologisch abbau- Im nächsten Schritt wollen die Wissen-
benwirkungen hervorrufen können. «Um bare, bio-kompatible Polymere genutzt, schaftler die Nanopartikel mit Wirkstoffen
die Arzneimittelbelastung zu minimieren, die mit einem fluoreszierenden Farbstoff beladen, da in der aktuellen Arbeit lediglich
wäre es von Vorteil, die Wirkstoffe direkt an markiert wurden. Mittels dermatologischer «Dummys» benutzt wurden. Dabei solle es
ihren Wirkort, nämlich in die Haarfollikel, zu Untersuchungen, bei denen die Haut mik- darum gehen, den nackten Wirkstoff und
bringen», sagt Claus-Michael Lehr, der am roskopisch bis in tiefere Schichten unter- das Nano-Medikament miteinander zu ver-
Helmholtz-Institut für Pharmazeutische sucht wird, fanden die Forscher heraus, gleichen, so Lehr. Ihre Ergebnisse haben die
Forschung Saarland (HIPS) die Abteilung dass im Haarfollikel ein Wirkstoffdepot an- Wissenschaftler im JOURNAL OF INVESTIGATIVE
«Wirkstoff-Transport» leitet. gelegt wird, in dem das verkapselte Medi- DERMATOLOGY publiziert.
Dass es grundsätzlich möglich ist, Wirkstof- kament gut gegen äußere Einflüsse wie
fe mithilfe von Nanopartikeln in Haarfollikel Waschen geschützt ist. «Die Nanopartikel
einzuschleusen, hat Lehr gemeinsam mit lagern sich im oberen Teil der Haarfollikel
anderen Forschern bereits in früheren Stu- ab. Wir nehmen an, dass sie das Medika-
dien gezeigt. Für den Kopf war der Mecha- ment kontrolliert freisetzen und dass es von www.uni-saarland.de
information@karger.com © 2020 S. Karger GmbH, Freiburg
www.karger.com/kkdTechnische Hochschule Köln |
Tätowierungen entfernen mit Laser und Ultraschall
Die üblichen Methoden, um ungeliebte Tä- besser zerkleinert werden», so Wellendorf.
towierungen zu entfernen, sind häufig Zudem erfahre die Haut durch den Ultra-
schmerzhaft und mit Narbenbildung ver- schall eine Tiefenmassage. Dadurch werde
bunden. Die TH Köln entwickelt daher zu- der Stoffwechsel aktiviert und der Transport
sammen mit dem Universitätsklinikum Es- von Lymphflüssigkeit vorangetrieben. Die
sen und der Epimedic GmbH ein neues Ver- Aktivität der Zellen wird gesteigert und de-
fahren, das die etablierte Laserentfernung ren Regeneration vorangetrieben.
mit Ultraschall kombiniert. «Für die Patientinnen und Patienten erhof-
«Um ein unerwünschtes Tattoo mittels Laser fen wir uns eine deutlich geringere Anzahl
wieder loszuwerden, sind bis zu 15 Sitzungen der Behandlungen, die zudem mit weniger
nötig, bei denen die Farbpigmente durch die starken Laser-Impulsen durchgeführt wer-
hohe Energie des Lasers zertrümmert und den. Damit soll der empfundene Schmerz
anschließend über das Lymphsystem ab- gesenkt werden und sich der Heilungspro-
transportiert werden», erläutert Projektleiter zess deutlich verkürzen. Ebenso erwarten
Prof. Dr. Axel Wellendorf vom Campus Gum- wir ein verbessertes Hautbild nach der Ent-
mersbach der TH Köln. «Wir erhoffen uns fernung im Vergleich zur herkömmlichen
vom Ultraschall mehrere Dinge: Er soll das Ge- Behandlung und weniger Narbenbildung»,
webe anregen und auflockern, damit sich die sagt Wellendorf.
Farbpigmente leichter lösen. Darüber hinaus
Grafische Darstellung der Ultraschall- und Lasereinheit erwarten wir, dass die Farbpigmente durch
im Kopf des Behandlungsgerätes. ©TH Köln die Kombination von Laser und Ultraschall
www.th-koeln.de
ETH Zürich |
Neuartiges Verbandmaterial wirkt blutstillend und verklebt nicht
ungeeignet. Die Wissenschaftler realisier-
ten jedoch rasch, dass sich dieses Material
hervorragend als Wundverband eignet.
Zum ersten Mal bringen Wissenschaftler
diese beiden Eigenschaften in einem Mate-
rial zusammen.
Die Forschenden beschichteten ein klassi-
Links eine herkömm-
liche Baumwoll-Gaze. sches Baumwoll-Gaze-Gewebe mit einem
Sie saugt Blut auf. Rechts Gemisch aus Silikon und Kohlenstoff-Nano-
die mit Kohlenstoff-Na- fasern. Warum genau das neue Material die
nofasern beschichtete
Gaze. Unten: Elektronen- Blutgerinnung auslöst, ist noch unklar und
mikroskopie-Bilder zei- Gegenstand weiterer Forschung. Die Wis-
gen Nahaufnahmen senschaftler vermuten jedoch, dass die
der Baumwollfasern. © Li
Z et al. / Nature Commu- Kohlenstofffasern dafür verantwortlich
nications 2019. sind. Ebenfalls konnten die Forschenden
zeigen, dass die beschichtete Gaze antibak-
«Eigentlich war das nicht so geplant, doch be Materialien. Ziel war es, Beschichtungs- teriell wirkt – weil sich Bakterien nur schlecht
so funktioniert Wissenschaft manchmal materialien zu finden für Geräte, die mit Blut an der Oberfläche anhaften.
eben: Man beginnt an einer Sache zu for- in Kontakt kommen.
Literatur
schen und endet woanders», sagt ETH-Pro- Eines der getesteten Materialen zeigte da-
fessor Dimos Poulikakos. Gemeinsam mit bei unerwartete Eigenschaften: Es wies Blut Li Z et al.: Nat Commun 2019; 10: doi: 10.1038/s41467-
019-13512-8.
Wissenschaftlern seiner Arbeitsgruppe und nicht nur ab, sondern brachte dieses auch
solchen der National University of Singapo- zum Gerinnen. Um damit eine Blutpumpe
www.ethz.ch
re testete er verschiedene superhydropho- zu beschichten, war das Material deshalb
Kompass Dermatol 2020;8:82–85 83
DOI: 10.1159/000507009Universität Würzburg |
Wann wirkt eine Immun-Checkpoint-Blockade bei metastasiertem Melanom?
Diese Assoziation konnte in der Studie aller-
dings nicht gesehen werden, was auf die
Integration klinischer Daten zurückzufüh-
ren ist.
Durch die Studie bereits bestätigt werden
konnte hingegen ein anderer Zusammen-
hang, der bislang nur auf Erkenntnissen aus
vergleichsweise wenigen Proben beruhte:
Wenn die Hautkrebs-Tumore bestimmte
Defekte in einem Signalweg aufweisen, ha-
ben die betroffenen Patienten geringere
Chancen, von einer PD-1-Blockade zu profi-
tieren. «Patienten mit diesen Eigenschaften
Manche Krebsarten produzieren ein Protein (PD-L1), das die körpereigenen Immunzellen daran hindert, den Krebs können wir, falls möglich, heute eine ande-
zu erkennen und effektiv zu bekämpfen. Immun-Checkpoint-Inhibitoren sind in der Lage, den PD-1-Rezeptor zu
re Therapie empfehlen», so Prof. Schilling.
blockieren, so dass PD-L1 die Immunzellen nicht mehr behindert. Der Krebs ist damit für das Immunsystem sicht-
bar und kann angegriffen werden. © Uni Würzburg Ein weiteres Ergebnis der Studie: Wenn die
Tumore besonders gut Antigene an ihrer
Oberfläche präsentieren, profitieren die
Zur Behandlung des Schwarzen Hautkreb- die, die mit der Veröffentlichung der Ergeb- Melanom-Patienten besonders gut von der
ses – oder auch Melanoms – wird bei Pati- nisse in der Fachzeitschrift NATURE MEDICINE PD-1-Blockade. Neben diesem neu gewon-
enten mit fortgeschrittener Erkrankung in im Dezember 2019 ihren Abschluss fand. nenen oder verfestigten Wissen ist die für
vielen Fällen ein Immun-Checkpoint-Inhi- «Grundsätzlich geht man von Folgendem die Studie zusammengetragene Datenba-
bitor (PD-1-Blocker) eingesetzt. «Diese The- aus: Je stärker ein Tumor mutiert ist, desto sis eine extrem wertvolle Ressource für die
rapie funktioniert nicht bei allen Patienten fremder erscheint er dem Immunsystem zukünftige Forschung.
gleich gut – und wir wissen bislang noch und umso besser kann er abgestoßen wer-
Literatur
nicht genau, woran das liegt», sagt Prof. Dr. den», erläutert Prof. Schilling. «Deshalb
Bastian Schilling, Melanom-Experte an der nahm man auch in Bezug auf das Melanom Liu D et al.: Nat Med. 2019; 25(12):1916-1927
Hautklinik des Uniklinikums Würzburg. Zur an, dass über die Mutationslast – also die
Suche nach einer Antwort auf diese und Anzahl aller somatischen Mutationen – ei-
weitere Fragen startete Ende 2015 eine in nes Tumors eine Vorhersage über die Wirk-
ihrer Größe beispiellose europaweite Stu- samkeit der PD-1-Blockade zu treffen ist.» www.ukw.de
Deutsche Krebsgesellschaft |
Update der Leitlinienempfehlungen für Patienten im fortgeschrittenen Stadium
Unter Federführung der Deutschen Der- ler von der Universitäts-Hautklinik Tübin- um III angeboten werden soll», so Eigent-
matologischen Gesellschaft und der Ar- gen, einer der Leitlinienkoordinatoren. Die ler. «Es zeigte sich, dass diese Therapie das
beitsgemeinschaft Dermatologische On- neuen Empfehlungen betreffen vor allem Fortschreiten der Erkrankung aufhalten
kologie (ADO) der Deutschen Krebsgesell- Patientinnen und Patienten mit Metasta- kann.»
schaft (DKG) wurde im Rahmen des sen in Lymphknoten und der Haut (Stadi- An der S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie
Leitlinienprogramms Onkologie die aus um III) und mit Fernmetastasen (Stadium und Nachsorge des Melanoms waren 40
dem Jahr 2018 stammende S3-Leitlinie zum IV). In diesen fortgeschrittenen Stadien be- Fachgesellschaften und Organisationen
Melanom aktualisiert. steht auch nach einer operativen Entfer- beteiligt. Sie kann online abgerufen wer-
«Auf dem Gebiet der adjuvanten Therapie nung der Metastasen ein hohes Rezidivrisi- den unter: www.leitlinienprogramm-
hat sich aufgrund von neu zugelassenen ko. «Neu ist unter anderem die Empfeh- onkologie.de/leitlinien/melanom/.
Therapeutika und einer verbesserten Stu- lung, dass Betroffenen in Stadium III und IV
dienlage einiges getan, deshalb haben wir ohne Metastasennachweis eine adjuvante
das entsprechende Kapitel in der Leitlinie Therapie mit einem anti-PD1-Antikörper
aktualisiert», sagt Prof. Dr. Thomas Eigent- oder mit zielgerichteter Therapie im Stadi- www.krebsgesellschaft.de
84 Kompass Dermatol 2020;8:82–85
DOI: 10.1159/000507009Universitätsklinik Freiburg |
Lichttherapie für Immunzellen hilft bei Nebenwirkungen von Krebstherapie
Erst seit wenigen Jahren ist schwarzer Haut-
krebs, auch Melanom genannt, medika-
mentös behandelbar. Allerdings kommt es
bei jedem zweiten Patienten zu starken Au-
toimmunreaktionen wie Hautausschlag
oder Durchfall. Dass sich diese mit einer
speziellen Lichttherapie aufhalten lassen,
haben jetzt Forscherinnen und Forscher
des Universitätsklinikums Freiburg mit
schweizerischen Kollegen gezeigt. Einen
29-jährigen Krebspatienten mit einer
schweren Entzündung der Darmschleim-
haut behandelten sie sehr erfolgreich mit-
tels Extrakorporaler Photopherese (ECP).
Dabei werden Immunzellen außerhalb des
Körpers mit einem lichtreaktiven Medika-
ment versetzt, mit UV-Licht bestrahlt und in
den Körper zurückgegeben. Durch das Ver-
fahren werden vermutlich Immunzellen ak-
Unterschied auf Zellebene: Während vor der Therapie das Darmgewebe unstrukturiert wuchert, sind am Ende
tiviert, die die Entzündung stoppen. Die
der Therapie die schleimbildenden Zellverbünde wieder gut zu erkennen. © The New England Journal of Medi-
Photopherese-Therapie führte bei dem Pa- cine 2020.
tienten zu einem vollständigen Abklingen
der Beschwerden, während durch die fort- des Immunsystems einwirken und so die Wirkstoffen behandelt, was aber nicht im-
laufende Krebstherapie der Hautkrebs er- Entzündung ausbremsen», erklärt Zeiser. mer wirkt oder starke Nebenwirkungen ha-
folgreich behandelt werden konnte. Bishe- «Ganz wichtig für die begleitende Therapie ben kann», so Zeiser. Außerdem steht Korti-
rige, etablierte Behandlungsansätze waren war, dass die ECP-Behandlung keinen nega- son im Verdacht, die Immunantwort auf
im Vorfeld erfolglos geblieben. Die Fallbe- tiven Einfluss auf die Anti-Tumor-Wirkung den Tumor zu blockieren und damit die
schreibung erschien im NEW ENGLAND JOUR- der Immunmedikamente hatte.» Krebsbehandlung zu torpedieren.
NAL OF MEDICINE. Bei der Behandlung von schwarzem Haut- Einen Wissenstransfer von Herrn Professor
«Prinzipiell ist der Therapieansatz auch bei krebs und vielen anderen Krebsarten kom- Bertram Bengsch zu dieser Publikation fin-
immunvermittelten Nebenwirkungen an- men sogenannte Immuncheckpoint-Inhibi- den Sie in KOMPASS AUTOIMMUN, Heft 2/20.
derer Krebstherapien denkbar», sagt Studi- toren zum Einsatz. Allerdings beginnt das Das Heft erscheint am 06.05.2020.
enleiter Prof. Dr. Robert Zeiser, Leiter der Ab- Immunsystem oft auch, körpereigene Struk-
Literatur
teilung Tumorimmunologie der Klinik für turen zu zerstören. Diese Nebenwirkungen
Innere Medizin I am Freiburger Universitäts- können verschiedene Organe betreffen wie Apostolova P. et al.: N Engl J Med. 2020; 382(3):294-296.
klinikum. Wie die Forscher feststellten, wur- zum Beispiel Darm, Haut, Schilddrüse, Leber
de während der ECP-Therapie eine be- oder Gehirn. «Bisher werden Patienten mit
stimmte Art von Immunzellen größer und derartigen Nebenwirkungen einer Krebs-
aktiver. «Wir gehen davon aus, dass diese Immuntherapie meist längere Zeit mit Korti-
vergrößerten Immunzellen auf andere Teile son oder anderen immunmodulierenden www.uniklinik-freiburg.de
Kompass Dermatol 2020;8:82–85 85
DOI: 10.1159/000507009Sie können auch lesen