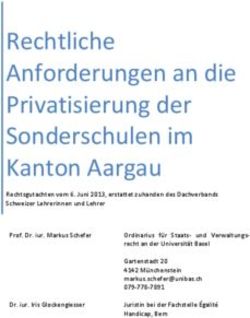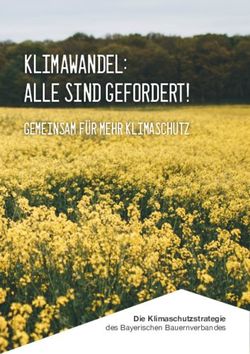Strategie Natur und Landschaft 2030+ - Strategische Schwerpunkte des Natur- und Landschaftsschutzes im Kanton Solothurn - Gemeinde Langendorf
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Amt für
Raumplanung
Strategie Natur und Landschaft 2030+
Strategische Schwerpunkte des Natur- und Landschaftsschutzes
im Kanton Solothurn
2018S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
Inhalt
Vorwort .................................................................................................................................. 3 Hinweis
Zusammenfassung ..................................................................................................................4 Wenn im folgenden Text von
Bewirtschafter, Grundeigentümer
1. Ausgangslage ...............................................................................................................6 usw. die Rede ist, so sind damit
1.1 Bedarf für eine kantonale Strategie Natur und Landschaft ............................ 6 immer Menschen beiderlei
1.2 Entwicklung von Natur und Landschaft auf nationaler Ebene........................ 7 Geschlechts gemeint. Die kon-
1.3 Entwicklung von Natur und Landschaft auf kantonaler Ebene....................... 8 sequente Schreibweise, die so-
1.4 Ergebnisse aus dem Erarbeitungsprozess ........................................................ 10 wohl die weibliche wie auch die
1.5 Erarbeitung der Strategie................................................................................. 12 männliche Form berücksichtigt
2. Ziele der Strategie N+L 2030+..................................................................................13 (Bewirtschafterin und Grund-
2.1 Zielsetzung der Strategie ................................................................................. 13 eigentümerin), ist sehr oft um-
2.2 Partner/Beteiligte ............................................................................................. 14 ständlich und für den Lesefluss
2.3 Strategische Grundsätze ................................................................................... 16 hemmend.
3. Schwerpunkte mit Handlungsfeldern ......................................................................17
3.1 Die vier Schwerpunkte der Strategie N+L ....................................................... 17
3.2 Die zwölf Handlungsfelder .............................................................................. 18
4. Umsetzung der Strategie ..........................................................................................19
4.1 Vorgehensweise ................................................................................................ 19
5. Massnahmen ..............................................................................................................23
5.1 Massnahmenblätter zu den zwölf Handlungsfeldern .................................... 23
5.2 Nächste Schritte ................................................................................................ 48
Anhang ..................................................................................................................................50
A Strategische Grundsätze ...........................................................................................50
B Abkürzungsverzeichnis .............................................................................................53
C Glossar ........................................................................................................................54
D Quellenverzeichnis ....................................................................................................57
2S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
Vorwort
Mit dem als «Solothurner Modell» bezeichneten, Mit der Erarbeitung einer Strategie ist die Arbeit aber
schweizweit bekannten und bewährten «Mehrjahres- nicht getan. Im Vordergrund steht die Realisierung
programm Natur und Landschaft» (MJPNL) entschied von Massnahmen. Der Umsetzungsprozess wurde
sich der Kanton bereits in den 1980er Jahren für deshalb als Bestandteil der Strategie von Anfang an
einen eigenen Weg im Natur- und Landschaftsschutz. mitberücksichtigt. Die wichtigsten Akteure, welche
Nebst dem hoheitlichen Naturschutz wird mit diesem für die Realisierung von Massnahmen zuständig sind,
freiwilligen, auf Langfristigkeit ausgelegten und waren am Erarbeitungsprozess beteiligt. Ihre Erfah-
auf einem Anreizsystem basierenden Programm die rungswerte waren es auch, welche primär zur Fest-
naturnahe Bewirtschaftung von Landwirtschafts- und legung von Grundsätzen und Schwerpunkten beige-
Waldflächen gefördert. Das Ziel ist, grosse, zusam- tragen haben. Auf aufwändige Datenanalysen wurde
menhängende Lebensräume zu erhalten und aufzu- bewusst verzichtet.
werten. Der Einführung und Etablierung dieses Pro-
gramms und dem tatkräftigen Mitwirken zahlreicher Die Strategie N+L 2030+ zeigt auf, in welche Richtung
Vereinbarungspartner ist es zu verdanken, dass sich der Natur- und Landschaftsschutz in den kom-
der Kanton heute noch über wertvolle, naturnahe menden Jahren entwickeln soll. Sie ist dabei aber
Lebensräume, eine regionaltypische Flora und Fauna nicht als starres Gerüst zu verstehen. Umsetzung und
sowie landschaftliche Schönheiten verfügt. Diese Wirkung der Massnahmen sollen laufend bilanziert
Landschaften sind es, in denen sich Menschen wohl und gegebenenfalls neu justiert werden. Nach Bedarf
fühlen und Erholung finden. Und diese Landschaften kann auch die Gesamtausrichtung den aktuellen
sind letztlich auch wichtige Standortfaktoren für den Bedürfnissen angepasst werden.
Kanton.
Die Strategie N+L 2030+ richtet sich primär an kanto-
Im Jahr 2020 endet die Programmperiode des laufen- nale Amtsstellen, kann aber nur in Zusammenarbeit
den MJPNL. Für die Erarbeitung des Folgeprogramms mit verwaltungsexternen Partnern (Gemeinden,
stellen sich grundlegende Fragen: Wie sollen sich Organisationen, Private, etc.) umgesetzt werden.
die Landschaften im Kanton Solothurn künftig ent- Durch die partizipative Ausrichtung des Umsetzungs-
wickeln? Wie kann der Kanton den Naturschutz, für prozesses und den primären Fokus auf Freiwilligkeit
welchen er gemäss Bundesverfassung zuständig ist, und Eigenverantwortung bin ich aber überzeugt,
in Zukunft unter den vielseitigen Herausforderungen dass die erforderlichen Massnahmen partnerschaftlich
wie zum Beispiel das Siedlungswachstum, die Ver- und zum Nutzen für Natur und Landschaft und damit
kehrszunahme, der Klimawandel oder der steigende zum Nutzen von uns allen realisiert werden können.
Druck durch Naherholungssuchende sicherstellen?
Bernard Staub
Mit der vorliegenden Strategie Natur und Landschaft Chef des Amtes für Raumplanung
2030+ (N+L 2030+) sollen diese Fragen und die Zu-
ständigkeiten im Naturschutzvollzug geklärt und
auch eine Basis für die Weiterentwicklung des MJPNL
geschaffen werden.
3S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
Zusammenfassung
Dank Erfolgen auf verschiedenen Ebenen konnten Q Kommunikation: Wert von Natur und Landschaft
in den vergangenen Jahren bedeutende Natur- und anschaulich und eindrücklich vermitteln, Erfolge
Landschaftswerte im Kanton Solothurn bewahrt wer- kommunizieren
den. Sie gehören zum Kapital des Kantons und sind Q Kooperation, Synergie: Zusammenarbeit zwischen
ein wichtiger Standortfaktor. Insbesondere aufgrund «Schützern und Nutzern» von Natur und Land-
anhaltend hoher Intensität der Raumnutzung hat der schaft im Vollzug fortsetzen
Druck auf Natur und Landschaft in den letzten Jahren Q Freiwilligkeit und Hoheitlichkeit: Naturschutzvoll-
weiter zugenommen. Ohne weitergehende Anstren- zug weiterhin durch Freiwilligkeit sicherstellen,
gungen droht unser Natur- und Landschaftserbe sub- ergänzender hoheitlicher Vollzug v.a. in kanto-
stantiell an Qualität zu verlieren. nalen Naturreservaten angehen
Q Verlässlichkeit, Kontinuität, Mehrwert: Der Vollzug
Die Strategie Natur und Landschaft 2030+ zeigt auf, setzt auf diese drei Werte
in welchen Bereichen im kantonalen Natur- und Q Klare Verantwortlichkeiten: Aufgaben des Natur-
Landschaftsschutz vordringlich Handlungsbedarf be- und Landschaftsschutzes und Schnittstellen zu
steht und setzt die Schwerpunkte für den Zeitraum anderen Politikbereichen durch eindeutige Zustän-
bis nach 2030. digkeiten regeln
Q Ressourcen: Ausreichend finanzielle und perso-
Für den Natur- und Landschaftsschutz des Kantons nelle Ressourcen für den zielgerichteten Natur-
Solothurn ist in erster Linie das Amt für Raumpla- und Landschaftsschutz bereitstellen
nung zuständig, welches im Auftrag des Regierungs-
rates die Strategie Natur und Landschaft 2030+ Für die Umsetzung der Strategie stehen zwölf Hand-
erarbeitet hat. Weitere Ämter sowie auch verwal- lungsfelder im Vordergrund, gruppiert nach vier
tungsexterne Institutionen sind massgebend am Voll- Schwerpunkten (siehe Kasten Seite 5).
zug beteiligt. Sie wurden in den Erarbeitungsprozess
der Strategie involviert. Damit wird die Koordina- Die ausgewählten Handlungsschwerpunkte mit den
tion der Aufgaben aller Akteure im Natur- und Land- Handlungsfeldern orientieren sich in erster Linie
schaftsschutz sichergestellt, und die Zuständigkeiten an aktuellen, sektorübergreifenden Chancen und
werden geklärt. Dies ermöglicht einen transparenten Defiziten.
und zielführenden Vollzug der künftigen Aufgaben
des Natur- und Landschaftsschutzes im Kanton. Die Umsetzung und Wirkung der Massnahmen werden
periodisch bilanziert und gegebenenfalls neu justiert
Die Strategie umfasst die folgenden strategischen oder ergänzt. Dieses Vorgehen ermöglicht laufend
Grundsätze, welche zu einem gemeinsamen Ver- auf neue Herausforderungen im Natur- und Land-
ständnis und Vorgehen aller Akteure im Vollzug des schaftsschutz einzugehen.
Natur- und Landschaftsschutzes führen:
Q Bestehendes erhalten: Solothurner Natur- und Die Strategie richtet sich in erster Linie an die zustän-
Landschaftserbe für kommende Generationen digen kantonalen Amtsstellen. Sie sind für die Um-
erhalten setzung der einzelnen Handlungsfelder zuständig.
Q Zusätzliche Qualität und Quantität nötig: Natur Von den Massnahmen sind verschiedene Akteure wie
und Landschaft qualitativ aufwerten und wert- Gemeinden, Grundeigentümer, Bewirtschafter, Ver-
volle Flächen gezielt ergänzen bände, etc. betroffen. Deshalb muss der Umsetzungs-
Q Lebensraumverbund: Grosse, zusammenhängende, prozess breit abgestützt werden.
weitgehend unverbaute Lebensräume erhalten,
wertvolle Flächen miteinander verbinden
Q Artenförderung: Prioritäre Arten im Kanton Solo-
thurn gezielt fördern
Q Siedlungsraum: Potentiale im Siedlungsraum für
Natur und Landschaft vermehrt nutzen
4S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
Die zwölf Handlungsfelder
I Qualität gezielt steigern III Natur im Siedlungsraum fördern
1. Folgeprogramm MJPNL: erarbeiten und 9. Kantonale und kommunale Flächen: naturnahe
umsetzen Gestaltung, Bewirtschaftung und Pflege fördern
2. Folgeprogramm Biodiversität im Wald: 10. Qualitätsvolle Innenentwicklung: Kommuni-
erarbeiten und umsetzen kationsoffensive zum Erhalt naturnaher Grün-
3. SO-Prioritätsarten: festlegen und fördern flächen; Vorzeigeprojekte mit Gemeinden zu
4. Vernetzungsprojekte Landwirtschaft: Zusam- Biodiversität, Vernetzung und Gestaltung von
menarbeit intensivieren, Beratung optimieren Siedlungsrändern generieren
5. Gewässer-Landwirtschaft-Naturschutz:
optimale Koordination sicherstellen IV Erholungsnutzung und Landschaftswerte
6. Neobiota: bekämpfen und eindämmen gezielt in Einklang bringen
11. Regionen: landschaftsverträgliche Entwick-
II Ökologische Vernetzungsstrukturen lungen sicherstellen
optimieren 12. Agglomerationen: naturverträgliche Naher-
7. Wildtierkorridore: Vorhandene Vernetzungs- holung fördern
strukturen sichern, optimieren und ergänzen
8. Verkehrsinfrastruktur: Vernetzungspotential
von Begleitflächen nutzen
Projektteam Projektgruppe
Brügger Peter, Solothurner Bauernverband
Begleitgremium Dietschi Christoph, Amt für Umwelt
Barth Gaston, Verband Solothurner Einwohner- Emch Norbert, Amt für Landwirtschaft
gemeinden Hausammann Ariane, Pro Natura Solothurn
Brügger Peter, Solothurner Bauernverband Kissling Walter, Amt für Verkehr und Tiefbau
Cessotto Enzo, FDP-Kantonsratsfraktion Lüthi Thomas, BirdLife Solothurn
Flück Urs W., Pro Natura Solothurn van der Veer Gabriel, Amt für Wald, Jagd und Fischerei
Froelicher Jürg, Amt für Wald, Jagd und Fischerei von Däniken Patrick, Bürgergemeinden und
Künzli Beat, SVP-Kantonsratsfraktion Waldeigentümer Verband Solothurn
Kupper Edgar, CVP/EVP/glp/BDP-Kantonsratsfraktion
Schibli Felix, Amt für Landwirtschaft Projektleitung
Staub Bernard, Amt für Raumplanung (Leitung) Bruggisser Odile, Amt für Raumplanung
Staub Martin, Bürgergemeinden und Waldeigentümer Schwaller Thomas, Amt für Raumplanung (Stv.)
Verband Solothurn
Wyss Marianne,Kantonsratsfraktion SP Externe Unterstützung des Projektteams
Wyss Flück Barbara, Kantonsratsfraktion Grüne Marti Fridli, quadra Mollis gmbh
5S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
1. Ausgangslage
1.1 Bedarf für eine kantonale Strategie Auftrag
Natur und Landschaft Der Regierungsrat hat deshalb dem Amt für Raum-
planung den Auftrag zur Erarbeitung einer Strategie
Für den Natur- und Heimatschutz sind nach Art. 78 für den Natur- und Landschaftsschutz im Kanton So-
der Bundesverfassung (BV; SR 101) explizit die Kan- lothurn erteilt. Eine übergeordnete kantonale Strate-
tone zuständig. Im Kanton Solothurn liegt der Voll- gie des Natur- und Landschaftsschutzes fehlte bisher.
zug des Natur- und Heimatschutzes sowie des Land- Mit der geplanten Strategie N+L sollen generelle
schaftsschutzes in der Zuständigkeit des Amtes für Grundsätze festgelegt, zeitgemässe Handlungsfelder
Raumplanung. Dank vielseitiger Bemühungen ver- definiert, priorisiert und die Zuständigkeiten geklärt
schiedener Akteure im Natur- und Landschaftsschutz werden. Dies ermöglicht einen transparenten und
verfügt der Kanton Solothurn heute noch über be- zielführenden Vollzug der künftigen Aufgaben des
sondere Natur- und Landschaftswerte, welche auch Natur- und Landschaftsschutzes im Kanton. Die Stra-
für die Bevölkerung wertvolle Erholungsräume dar- tegie soll sowohl die Bereiche Natur wie auch Land-
stellen und als wichtiger Standortfaktor gelten. Doch schaft abdecken. Die anstehende Erarbeitung eines
wie andere Kantone hat auch der Kanton Solothurn Folgeprogramms zum Mehrjahresprogramm Natur
Verluste an naturnahen und natürlichen Lebensräu- und Landschaft (MJPNL) war ein Impuls zur Erar-
men und deren Artenviefalt sowie traditionellen Kul- beitung der Strategie; die Strategie versteht sich je-
turlandschaften zu verzeichnen1. Zu dieser Entwick- doch deutlich übergreifender. Projektauftrag sowie
lung haben im Wesentlichen die Zersiedelung sowie Projektorganisation richten sich nach dem Regie-
die Zunahme von Verkehr und Freizeitaktivitäten bei- rungsratsbeschluss vom 4. Juli 2017 (2017/1241).
getragen. Unter diesen Rahmenbedingungen ist die
Sicherung und Inwertsetzung von Natur- und Erho- Vorgehen
lungsräumen umso wichtiger. Die Überlagerung ver- Zur Abschätzung des Handlungsbedarfs der vor-
schiedener Interessen von Gesellschaft, Wirtschaft liegenden Strategie wurden folgende Aspekte
und Umwelt wird in den nächsten Jahren vermehrt berücksichtigt:
zu anspruchsvollen Interessenabwägungen führen. Q Zustand und Entwicklung von Natur und Land-
Diese Herausforderungen können nur durch einen schaft auf gesamtschweizerischer Ebene (vgl.
verantwortungsvollen Umgang mit Natur- und Land- Kap. 1.2)
schaftswerten und einer gemeinsamen Zusammen- Q Mit Blick auf die Entwicklung von Natur und Land-
arbeit aller beteiligten Akteure angepackt werden. schaft auf kantonaler Ebene ( vgl. Kap. 1.3) wurde
Um einen zielführenden und effizienten Natur- und durch die Abteilung Natur und Landschaft eine
Landschaftsschutz zu gewährleisten, sollen mit die- Beurteilung von Stärken, Schwächen, Chancen
ser Strategie Prozesse und Zuständigkeiten im Natur- und Risiken des gegenwärtigen Natur- und Land-
und Landschaftsschutz des Kantons Solothurn über- schaftsschutzes vorgenommen (vgl. Kap. 1.4)
prüft, den aktuellen Herausforderungen angepasst Q Relevante Ergebnisse des Erarbeitungsprozesses
und wo nötig optimiert werden. (vgl. Kap. 1.4)
Insgesamt wurde der Weg einer eher pragmatischen
Analyse gewählt, welche sich auf die bisherigen Er-
fahrungen etwa auch aus dem MJPNL sowie weite-
ren laufenden Programmen stützt und mit den Work-
shops mit Einschätzungen verschiedener Partner und
Fachleuten gespiegelt wurde.
1
Beispiele für Lebensraumverluste: Feuchtstandorte in der Witi, im Wasseramt und
im Bucheggberg. Beispiele zum Verlust von Arten: Braunkehlchen, Wiedehopf,
Rebhuhn, Raubwürger, Apollofalter, Grosse Moosjungfer, Kleine Binsenjungfer
6S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
1.2 Entwicklung von Natur und Landschaft Q Zersiedelung, Zerschneidung und damit Fragmen-
auf nationaler Ebene tierung der Landschaft
Q Nutzungsaufgabe einerseits und Intensivierung
Zustand von Biodiversität und der Nutzung andererseits
Lebensraumtypen Q Düngung der Böden sowie Einsatz von Pflanzen-
In den letzten Jahren sind mehrere Berichte und Ana- schutzmitteln in der Landwirtschaft
lysen zum Zustand der Biodiversität erschienen (vgl. Q Verdichtung Siedlungsraum (Verlust an
BAFU 2014, BAFU 2017a, BAFU & BLW 2016, Fischer Grünräumen)
et al. 2015, OECD 2017). Deren Auswertungen zeigen Q Zunahme Störung (Freizeitnutzung)
übereinstimmend, dass zwar einige Fortschritte er- Q invasive, gebietsfremde Arten
reicht werden konnten und verschiedene Massnah- Q neue Entwicklungen wie Klimawandel und
men wirksam sind, dass aber der Zustand der Bio- Lichtverschmutzung
diversität in der Schweiz weiterhin nicht zufrieden-
stellend ist. So gelten etwa 50% der Lebensraum- Übersicht laufender Aktivitäten auf
typen in der Schweiz als bedroht (vor allem Gewässer, Bundesebene
Feuchtgebiete und extensives Kulturland). Und bei- Q SBS und Aktionsplan SBS – mit Schwerpunkten
nahe die Hälfte der untersuchten Tier-, Pflanzen- und Siedlungsökologie sowie Ökologische Infrastruktur
Pilzarten in der Schweiz werden als bedroht oder (ÖI): Mit der Unterschreibung der Biodiversitäts-
potentiell gefährdet eingestuft. konvention 1992 hat sich die Schweiz verpflichtet,
Massnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt zu er-
Die aktuell zu beobachtenden Entwicklungstrends greifen. Diese Massnahmen sollen mit der Strate-
lassen noch auf keine entscheidende Trendumkehr gie Biodiversität Schweiz, welche 2012 vom
schliessen. Daten aus dem Biodiversitätsmonitoring Bundesrat gutgeheissen wurde, und dem dazuge-
Schweiz (BDM-CH) oder dem Brutvogelatlas zeigen hörigen Aktionsplan zur Erhaltung und Förderung
zwar ein Halten der Artenvielfalt oder sogar einen der Biodiversität, welcher im September 2017 vom
leichten Anstieg etwa im Wald oder im Siedlungsge- Bundesrat beschlossen wurde, umgesetzt werden.
biet. Im Kulturland dagegen sind weitere Verluste zu Q Sicherung der Biotope von nationaler Bedeutung,
verzeichnen. Dies deckt sich mit den Einschätzungen Artenschutz, Förderung von National Prioritären
von BAFU & BLW (2016), dass Biodiversitätsförder- Arten (NPA) und Lebensräumen (NPL): Um die
flächen weiterhin Defizite bezüglich Qualität sowie Lebensräume bedrohter Tiere und Pflanzen wirk-
Lage und Vernetzung aufweisen. samer schützen zu können, wurde 1987 die ge-
setzliche Grundlage für die nationalen Biotop-
Die Vereinheitlichung der Artengemeinschaften ist inventare geschaffen (Art. 18a NHG). Der Bund hat
eine weitere Entwicklung, die durch das schweize- in den letzten Jahren Lage und Schutzziele von
rische Biodiversitätsmonitoring sowie weitere Unter- nationalen Biotopinventaren für fünf Lebens-
suchungen schon mehrfach belegt wurde. Dadurch räume – Hoch- und Übergangsmoore, Flachmoore,
gehen Arten und Eigenheiten von Artengemein- Auengebiete, Amphibienlaichgebiete sowie
schaften aber auch Landschaften verloren, die für be- Trockenwiesen und -weiden – festgelegt. Die Um-
stimmte Regionen typisch sind. Mit dieser Vereinheit- setzung der Inventare ist Aufgabe der Kantone,
lichung gehen auch Charakteristiken verloren, die welche in der Regel über die Gemeinden für den
für eine Heimatverbundenheit stehen. Landschaften grundeigentümerverbindlichen Schutz sorgen.
werden als eintönig wahrgenommen. Q Freisetzungsverordnung und Strategie der Schweiz
zu invasiven gebietsfremden Arten: Um die Viel-
Als Gefährdungsursachen für die Biodiversität in der falt einheimischer Arten zu erhalten, ist der Um-
Schweiz werden immer wieder dieselben Entwick- gang mit gebietsfremden Pflanzen und Tieren in
lungen genannt: der Freisetzungsverordnung (FrSV) geregelt. Der
Q Bevölkerungswachstum und Flächenkonkurrenz Bund konkretisiert die Regelung des Umgangs mit
führen zu Verlust von Lebensräumen diesen Organismen und koordiniert das Manage-
7S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
ment von invasiven Arten auf Bundesebene, inter- rungswiesen, Ansaatwiesen, Hecken und Lebhäge,
kantonal und international. Die 2016 veröffent- Hochstammobstbäume oder Wiesen am Bach er-
lichte Strategie konkretisiert die Zielsetzungen halten und aufgewertet werden, um die Vielfalt
und zeigt die erforderlichen Massnahmen auf. an regionstypischen Pflanzen und wildlebenden
Q Agrarpolitik 2014-2017 (AP 14–17) und folgende: Tieren langfristig zu fördern und zu erhalten.
Mit der Agrarpolitik 2014–2017 des Bundes wurde Q Sichern der Biotope von nationaler Bedeutung:
die Förderung der Biodiversität in der Landwirt- Der Bund bezeichnet nach Anhörung der Kantone
schaft weiterentwickelt. Der Fokus der Biodiver- die Biotope von nationaler Bedeutung, bestimmt
sitätsförderung wurde auf die Verbesserung der die Lage und legt die Schutzziele fest (Art. 18a
Qualität von Biodiversitätsförderflächen und auf NHG). Die Umsetzung der Inventare ist Aufgabe
deren verstärkte Vernetzung gelegt. Zudem wur- der Kantone. Für den Kanton Solothurn sind ins-
den Landschaftsqualitätsbeiträge eingeführt, die besondere Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen
teilweise biodiversitätsrelevant sind. Die Grund- und -weiden sowie Wasser- und Zugvogelreservate
bewirtschaftung von Biodiversitätsförderflächen von Relevanz.
auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird ak- Q Schutz- und Unterhaltskonzepte für kantonale
tuell durch landwirtschaftliche Direktzahlungen Naturreservate: Überprüfung und gegebenenfalls
abgegolten. Anpassung von Perimetern und Schutzzielen der
Q Landschaftskonzept Schweiz 1998 (in Revision): kantonalen Naturreservate zur langfristigen Siche-
Das Landschaftskonzept Schweiz (LKS) ist ein Kon- rung dieser Biotope als Lebensgrundlage für be-
zept nach Artikel 13 des Raumplanungsgesetzes sonders schützenswerte Arten.
(RPG) und wurde im Dezember 1997 vom Bundes- Q Liste kantonal prioritärer Arten und spezifische
rat gutgeheissen. Es formuliert eine kohärente Fördermassnahmen: abgestimmt mit den Bundes-
Politik, legt behördenverbindlich allgemeine Ziele vorgaben werden Fördermassnahmen für jene
und Sachziele fest und schlägt Massnahmen vor. Arten erarbeitet, für welche der Kanton Solothurn
Aktuell ist eine Überarbeitung im Gange. eine besondere Verantwortung trägt.
Q Riedförderprogramm Grenchner Witi: Riedland-
schaft in der Grenchner Witi instandstellen und die
1.3 Entwicklung von Natur und Landschaft auf noch vorhandenen Reste von Riedvegetation er-
kantonaler Ebene halten, aufwerten und ökologisch vernetzen.
Q Umsetzung revidierte BLN-Ziele: Das Bundesinven-
Übersicht laufender Aktivitäten im Natur- und tar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN)
Landschaftsschutz des Kantons Solothurn erfasst die typischsten und wertvollsten Landschaf-
Die folgende Zusammenstellung liefert eine Über- ten der Schweiz. 2017 wurde das Inventar revidiert
sicht der laufenden Aktivitäten des Natur- und Land- und spezifische Schutzziele präzisiert. Die neuen
schaftsschutzes des Kantons Solothurn, welche für Bestimmungen sind in künftigen Planungsvorha-
die Erarbeitung dieser Strategie von Bedeutung ben zu berücksichtigen.
sind. Es handelt sich nicht um eine abschliessende Q Laufende Beurteilung von Bau- und Planungsvor-
Zusammenstellung. haben hinsichtlich Übereinstimmung mit den Be-
stimmungen der Juraschutzzone.
Q Richtplan (10/2018): behördenverbindliche Festle- Q Überarbeitung der Ortsplanungen mit dem Ziel,
gung in den Kapiteln Siedlung (S) und Landschaft (L) den Siedlungsraum zu verdichten und damit die
Q Mehrjahresprogramm N+L 2009–2020 (SGB Fragmentierung der Landschaft zu stoppen.
099/2008): Mit dem auf Freiwilligkeit beruhenden Q Sanierung Amphibienzugstellen: Durch bauliche
Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft sol- oder planerische Massnahmen gefahrenfreie Wan-
len möglichst grossflächige und naturnahe Lebens- derung von Amphibienpopulationen sicherstellen.
räume und charakteristische Landschaftsbilder wie Q Förderflächen für die Biodiversität im Landwirt-
Waldreservate, Waldränder, Jura-Sömmerungswei- schaftsgebiet: Die Anlage von Biodiversitätsförder-
den und andere Weiden, Heumatten und Rückfüh- flächen (BFF) ist Teil des Ökologischen Leistungs-
8S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
nachweises (ÖLN) gemäss Direktzahlungsverord- den Organismen und die Zuständigkeiten für die
nung (DZV). Die Erfüllung des ÖLN ist Vorausset- Bekämpfungsmassnahmen.
zung für den Erhalt von Direktzahlungen. Die Q Kantonale Strategie Bekämpfung und Kontrolle
Landwirtschaftsbetriebe müssen einen Anteil an von Neophyten (2012): Der Kanton Solothurn
BFF von mindestens 7% (3,5% für Spezialkulturen) sucht mit allen Akteuren aktiv die Zusammenar-
der landwirtschaftlichen Nutzfläche ausweisen. beit. Vorrang hat die Prävention. Die Bekämpfung
Q Darüber hinaus erfolgen auf freiwilliger Basis Auf- erfolgt gezielt, das heisst nur, wenn Schutzgüter
wertungen für Natur und Landschaft durch Ver- gemäss Zielsetzung bedroht sind. Die Umsetzung
netzungs- und Landschaftsqualitätsprojekte (vgl. von Massnahmen wird in erster Linie durch die
Kantonale Richtlinien Vernetzung, Massnahmen- Fachstellen der kantonalen Verwaltung begleitet
katalog LQ-Projekte). und durch die kantonale Arbeitsgruppe Neobioten
Q Förderprogramm Biodiversität im Wald 2011–2020 koordiniert (vgl. auch RRB 2016/1255).
(RRB 2010/1699): Das Förderprogramm Biodiver- Q Gesetzlicher Auftrag zur Bekämpfung und Elimi-
sität im Wald hat zum Ziel, den Lebensraum Wald nation von Neozoen gemäss Jagdgesetz (JaG).
für regionstypische einheimische Pflanzen und Q Reduktion der Ammoniakverluste in der Landwirt-
Tiere, vorab die seltenen und gefährdeten Arten, schaft im Rahmen des Luftmassnahmenplans (RRB
zu erhalten und aufzuwerten. Es ist eine Ergän- 2018/1346) mit dem Ziel, den Stickstoffeintrag in
zung zu den im Mehrjahresprogramm Natur und Naturräumen zu verringern.
Landschaft 2009–2020 beschlossenen Massnahmen Q Aktionsplan Pflanzenschutzmittel: Massnahmen-
für Waldreservate sowie Waldränder und konzen- plan des Kantons Solothurn mit dem Ziel, die
triert sich auf naturschützerische Massnahmen im Risiken durch Pflanzenschutzmittel zu halbieren.
bewirtschafteten Wald. Q Aktionsplan zur Anpassung an den Klimawandel
Q Nachhaltigkeitsbericht Wald 2015: Mit diesem (11/2016): Klimawandel in biodiversitätsrelevanten
Bericht wird erstmals eine Gesamtschau über Zu- Strategien, Planungen und Projekten berücksichti-
stand und Entwicklung der Solothurner Wälder be- gen, insbesondere im Bereich von Fliess- und Still-
treffend der wichtigsten Waldthemen angestrebt. gewässern, sowie in der Raumentwicklung (Erhalt
Q Waldreservatskonzept Kanton Solothurn: Kantons- und Erweiterung städtischer Grünflächen und de-
übergreifendes Konzept zur Erhaltung und Förde- ren positiven Einfluss auf das Mikroklima).
rung der biologischen, standörtlichen und struktu- Q Massnahmen zur Verringerung des Ausstosses von
rellen Vielfalt im Wald sowie das Gewähren einer Klimagasen beispielsweise durch die Förderung
natürlichen und nach Möglichkeit ungestörten von erneuerbaren Energien, damit langfristig die
Waldentwicklung (RRB 1999/233). Klimaerwärmung eingeschränkt werden kann.
Q Strategische Gewässerplanung Kanton SO: Die Q Energiekonzept Kanton SO (2014): Mit der Analyse
strategische Planung Revitalisierung Fliessgewäs- der Potentiale erneuerbarer Energien, der
ser zeigt, welche Gewässer sich für eine Revitali- Abwärme sowie den Einsatzmöglichkeiten von
sierung eignen, welche in den nächsten 20 Jahren dezentralen fossilen Wärmekraftkopplungsanla-
revitalisiert werden sollen und wo die Fischwan- gen (WKK-Anlagen) im Kanton Solothurn besteht
derung prioritär gefördert werden soll (Schlussbe- eine Übersicht der heutigen und zukünftig mög-
richt 12/2014). lichen Nutzung. Mögliche Gebiete und Standorte
Q Planung zur Fischgängigkeit bei Kraftwerksan- für Energieanlagen sind im kantonalen Richtplan
lagen, zum Geschiebehaushalt in Fliessgewäs- festgesetzt.
sern, interkantonale Planung der Aare und zum
Geschiebehaushalt.
Q Biosicherheitsverordnung, BioSV SO: Voraussicht-
lich 2019 wird eine regierungsrätliche Vollzugsver-
ordung zur Freisetzungsverordnung (FrSV) und zur
Einschliessungsverordnung (ESV) erlassen. Diese
regelt vor allem den Umgang mit gebietsfrem-
9S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
1.4 Ergebnisse aus dem Erarbeitungsprozess
SWOT-Analyse Natur- und Landschaftsschutz im
Kanton Solothurn
Stärken Schwächen
Q Zusammenarbeit über die Ämter und Natur- Q In gewissen Bereichen Zuständigkeiten unge-
schutzorganisationen: Breite Abstützung, nügend geklärt: Doppelspurigkeiten
Vielseitigkeit Q Mehr Quantität statt Qualität
Q MJPNL: Freiwilliges, flexibles Instrument Q Zu wenig Kommunikation (Erfolgsbeispiele
mit grosser Verlässlichkeit ´ garantiert nicht bekannt)
Langfristigkeit Q Verdichtung Siedlungsraum: Wertvolle Grün-
Q Stolz auf wertvolles Naturerbe: Solothurner räume gehen verloren
Fauna und Flora mit besonderen Arten und Q Top-Landschaften aber zu wenige Kleinstruk-
ihren Lebensräumen, schöne Landschaften turen. Teilweise fehlende Vernetzung von
Q Zusammenarbeit Raumplanung (Naturschutz- Lebensräumen
fachstelle im Amt der Interessenabwägungen Q Fehlende Lebensräume in Ackerbaugebieten
richtig situiert) Q Zu wenig personelle Ressourcen: Zu viele
Q Verständnis und Akzeptanz für den Naturschutz Tagesgeschäfte, zu wenig Zeit für effektive
im Kanton Solothurn vorhanden Umsetzungsprojekte
Q Gut verankerter Juraschutz / Heimatschutz Q Naturförderung im Siedlungsgebiet fehlt
Chancen Risiken
Q Intensivierung Zusammenarbeit: Effizienzstei- Q Verlässlichkeit von freiwilligem Naturschutz
gerung, raschere Reaktionsfähigkeit (Umwelt- abhängig von finanziellen Ressourcen
faktoren wie Klimawandel) Q Klimawandel, weitere Umweltfaktoren
Q Steigerung Qualität Naturschutzflächen. MJPNL Q Verlust Lebensräume (Flächenkonkurrenz)
schafft gute Grundlage. Was noch verbessert Q Minimale Raumansprüche diverser Zielarten im
werden kann ist Qualität. Mittelland gar nicht mehr erreichbar
Q Vereinheitlichung strategische Ausrichtung über Q Zunahme Bevölkerungsdichte, erhöhter Nut-
mehrere Fachstellen (alle ziehen am gleichen zungsdruck (Störung) ´ Kein Platz für Entflech-
Strang)´ Naturschutz stärken durch breitere tung (Besucherlenkung)
Abstützung Q Landwirtschaftlicher Strukturwandel (weniger
Q Gute Vernetzung für bessere Kommunikation Bewirtschafter durch Betriebsaufgaben),
nutzen Futterverwertungsprobleme)
Q Flaggschiff-Arten für Kommunikation nutzen
Q Bessere Besucherlenkung zur Vermeidung von
Störungen
Q Mehr Naherholungsräume nötig, wenn Verdich-
tung das Ziel bleibt.
Tab. 1: Übersicht zu Stärken und Schwächen sowie Chancen und
Risiken (vereinfachte SWOT-Analyse) im Bereich des Natur- und
Landschaftsschutzes.
10S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
Relevante Ergebnisse aus Diskussionen der
Projektgruppe und des Begleitgremiums
Diverse Diskussionen und Workshops haben dazu bei-
getragen den Charakter der zu erarbeitenden Strate-
gie noch etwas konkreter zu umreissen:
Q Die Abdeckung der Strategie soll flächende-
ckend sein und explizit auch das Siedlungsgebiet
einbeziehen.
Q Die Ausgangslage soll eine Einschätzung der Defi-
zite und des Handlungsbedarfs sein – sowohl auf
Ebene Schweiz wie auch konkreter für den Kanton
Solothurn.
Q Die Strategie soll auf sektorübergreifende Chan-
cen und Defizite fokussieren: Kooperation, Koor-
dination und Kommunikation sollen einen grossen
Stellenwert für die Strategie haben, ebenso wie
die optimale Nutzung des vorhandenen Potentials.
Q Qualität wird als ein wichtiger Faktor angesehen;
nur alleine ein Sichern des aktuellen Zustands er-
scheint angesichts der weiter zunehmenden Ge-
fährdungsfaktoren als nicht zielführend.
Q Strategische Grundsätze sollen den Rahmen der
Strategie für die weitere Ausrichtung im Natur-
und Landschaftsschutz festlegen (vgl. Kap. 2.3).
Q Die Strategie soll handlungsorientiert und damit
auch pragmatisch ausgerichtet sein und konkret
die wichtigsten Schwerpunkte aufzeigen, in denen
zeitnah Umsetzungen angegangen werden sollen.
Dabei gilt es, die Umsetzung der Strategie bereits
anzudenken und vorzubereiten.
Q Bisherige Tätigkeiten im Natur- und Landschafts-
schutz, welche durch verschiedene Fachstellen si-
chergestellt werden, stehen als «Pflichtaufgaben»
eher im Hintergrund der Strategie und werden da-
her nicht explizit behandelt.
11S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
1.5 Erarbeitung der Strategie
Für die Erarbeitung der Strategie wurde folgende
Rollenverteilung gewählt:
Q Begleitgremium: Festlegen der strategischen
Grundsätze als Rahmen, Charakter der Strategie
umreissen.
Q Projektgruppe: Auswahl und Konkretisierung
Handlungsfelder.
Abb. 1: Prozess der schrittweisen Erarbeitung und Zusammenspiel der Akteure
Startsitzung
Begleitgremium
Auftrag, Entwurf Grundsätze
1. Workshop
Projektgruppe
Rohfassung der Strategie
mit Vorschlag zu den Handlungsfeldern
2. Workshop
Projektgruppe
Entwurf der Strategie
bereinigte Liste der Handlungsfelder
und Stichworte dazu
2. Sitzung
Begleitgremium
Beschluss zum Entwurf
definitive Liste der Handlungsfelder
und Steckbriefe dazu erstellen
3. Workshop
Projektgruppe
Bereinigte Strategie
3. Sitzung
Begleitgremium
Strategie für Vernehmlassung
12S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
2. Ziele der Strategie N+L 2030+
2.1 Zielsetzung der Strategie Abgrenzung und Systemgrenzen
Die Strategie widmet sich Natur- und Landschaftsthe-
Zweck der Strategie men in allen Lebensraumtypen flächendeckend über
Die Natur- und Landschaftswerte des Kantons Solo- den ganzen Kanton. Dazu zählen auch Gebiete aus-
thurn sollen auch für kommende Generationen erhal- serhalb der Vorranggebiete Natur und Landschaft
ten werden. Die Strategie N+L 2030+ zeigt auf, wo oder im Siedlungsraum. Im Fokus stehen aber primär
der dringendste Handlungsbedarf besteht. Mit der sektorübergreifende Chancen und Defizite. Bisherige
Festlegung von übergeordneten strategischen Grund- Tätigkeiten im Natur- und Landschaftsschutz der
sätzen soll ein gemeinsames Verständnis und Vorge- einzelnen Fachstellen, welche teilweise im Kapitel 1.3
hen aller Akteure im Natur- und Landschaftsschutz aufgeführt sind, werden in dieser Strategie nicht
ermöglicht werden. explizit erwähnt. Sie sind aber ebenfalls wichtig und
Im Rahmen dieser strategischen Grundsätze sollen sollen als Pflichtaufgaben durch die zuständigen
gemeinsame Handlungsfelder erarbeitet werden. Die Fachstellen weitergeführt und weiterentwickelt
Zuständigkeiten sollen geklärt, die Zusammenarbeit werden.
verbessert und Abläufe optimiert werden um Kräfte
zu bündeln.
Abb. 2: Charakterisierung der Strategie N+L 2030+
Geht über MJPNL
Ziele: hinaus und
deckt Natur und Commitment
Ressourcen Landschaft der Verwaltung,
zielgerichtet gesamthaft ab dient als Leitschnur
und effizient
einsetzen
Schlank, auf
Erfahrungsschatz
aufbauend, Kohärente
an Chancen und Ausrichtung
Defiziten orientiert (Zusammenarbeit
Partner)
Produkte:
Strategische Schwerpunkte mit
Grundsätze Handlungsfeldern
13S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
Zeithorizont 2.2 Partner / Beteiligte
Die Massnahmen der Strategie Natur und Landschaft
reichen über das Jahr 2030 hinaus. Ein erstes Zwi- Für den Natur- und Landschaftsschutz des Kantons
schenfazit erfolgt 2024 nach Auswertung der ersten Solothurn ist in erster Linie das Amt für Raumpla-
Meilensteine (vergl. Kap. 5.2). Das weitere Vorgehen nung zuständig. Gewisse Teilbereiche (z.B. Förderung
kann gestützt auf dieses Zwischenfazit gegebenen- der Waldbiodiversität, Gewässerrenaturierungen,
falls angepasst werden. Artenfördermassnahmen, Sicherung der Grundbe-
wirtschaftung BFF1, BFF2, Vernetzung auf Gren-
Orientierungsrahmen der Strategie zertragsflächen) werden massgebend von anderen
Die einzelnen Handlungsfelder orientieren sich an Departementen (vorab vom VWD), Ämtern und Fach-
vorhandenen Gesetzgebungen (NHG und NHV, PBG stellen oder verwaltungsexternen Institutionen (z.B.
etc.), dem kantonalen Richtplan, aktuellen Strategien Natur- und Umweltbildung) bearbeitet (vgl. Abb. 3).
und Aktionsplänen sowie Legislaturplanungen.
14S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
Abb. 3: Auslegeordnung der relevanten Akteure im Natur- und Landschaftsschutz
Private Verwaltung
National/Bund
Nationale Naturschutz- BAFU, ARE, BLW, ASTRA
verbände: WWF,
Pro Natura, Stiftung
Landschaftsschutz, etc.
Kantonal
USO
SOBV BJD ARP
BWSO Q Raumplanung
Naturmuseum Solothurn Q Landschaft, Naherholung und
Naturmuseum Olten Freizeitnutzung
FHNW Q Lebensräume (Schutzzonen,
Reservate, Mehrjahresprogramm)
Q Arten
Q Wildtierkorridore
Q Amphibienzugstellen
AfU AVT HBA
Q Bodenschutz Q Gestaltung und Unterhalt Q Gestaltung und Unterhalt
Q Wasserbau Strassenbegleitgrün staatseigener Grünflächen
Q Deponie- und Abbauplanung QLanderwerb
Q Nachhaltigkeit/Klimawandel Q Verwaltung Staatsparzellen
Q Umweltbildung VVNS
VWD ALW AWJF
Q Strukturverbesserung Q Waldbiodiversität
Q Landwirtschaftliche Q Wildtierkorridore
Förderprogramme Q Wildruhezonen
(BFF, LQB, Vernetzung) Q Artenschutz JSG
Q Beratung, Aus- und Q Fischerei
Weiterbildung Q Jagd
Q Vollzugskontrolle
Regional/lokal
Natur- und Gemeinden
Vogelschutzvereine
15S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
2.3 Strategische Grundsätze und Chancen. Für die Strategie N+L 2030+ stecken sie
den Rahmen zum weiteren Vorgehen im Kanton
Die strategischen Grundsätze basieren auf den Über- Solothurn für den Natur- und Landschaftsschutz über
legungen zur generellen Ausrichtung der Strategie. 2030 hinaus ab.
Sie dienen der Konkretisierung dieser Ausrichtung
und berücksichtigen die aktuelle Ausgangslage im Eine ausführliche Fassung der strategischen Grund-
Kanton Solothurn wie auch die bestehenden Defizite sätze ist im Anhang zu finden.
Abb. 4: Die strategischen Grundsätze der Strategie N+L 2030+
Materielle Grundsätze Handlungsfelder Operative Grundsätze
Bestehendes erhalten Kooperation, Synergie
Solothurner Natur- und Landschaftserbe für Zusammenarbeit zwischen «Schützern und Nutzern»
kommende Generationen erhalten von Natur und Landschaft im Vollzug fortsetzen
Zusätzliche Qualität und Quantität nötig Freiwilligkeit und Hoheitlichkeit
Natur und Landschaft qualitativ aufwerten und Naturschutzvollzug weiterhin durch Freiwilligkeit
wertvolle Flächen gezielt ergänzen sicherstellen, ergänzender hoheitlicher Vollzug v.a.
in kantonalen Naturreservaten angehen
Lebensraumverbund Verlässlichkeit, Kontinuität, Mehrwert
Grosse, zusammenhängende, weitgehend unverbaute Der Vollzug setzt auf Verlässlichkeit, Kontinuität und
Lebensräume erhalten, wertvolle Flächen miteinander Mehrwert
verbinden
Artenförderung Klare Verantwortlichkeiten
Prioritäre Arten im Kanton Solothurn gezielt fördern Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes und
Schnittstellen zu anderen Politikbereichen durch
eindeutige Zuständigkeiten regeln
Siedlungsraum Ressourcen (Finanzen und Personal)
Potentiale im Siedlungsraum für Natur und Landschaft Ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen
vermehrt nutzen für den zielgerichteten Natur- und Landschaftsschutz
bereitstellen
Kommunikation
Wert von Natur und Landschaft anschaulich und
eindrücklich vermitteln, Erfolge kommunizieren
16S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
3. Schwerpunkte mit Handlungsfeldern
3.1 Die vier Schwerpunkte der Strategie N+L
A. Qualität gezielt steigern2 B. Ökologische Vernetzungsstrukturen
Im Mittelland ganz allgemein besteht eine grosse optimieren2
Flächenkonkurrenz, daher soll in erster Priorität Mittelfristig soll ein eigentliches Lebensnetz
die Qualität auf den bereits mit dem MJPNL Solothurn im Sinne einer optimalen Vernetzung
vereinbarten Flächen hinsichtlich Arten- und wertvoller Lebensräume entwickelt werden
Strukturvielfalt erhöht und optimiert werden. (Ökologische Infrastruktur), welche den Austausch
Es gilt, auch die Ansprüche der prioritären Arten zu und somit Erhalt von Populationen ermöglicht.
berücksichtigen. Ziel ist es, bestehende und neue naturnahe
Elemente so anzulegen, dass sie optimal der
Vernetzung von Lebensräumen dienen. Dazu
bedarf es einer Sicherung, Optimierung und
gegebenenfalls gezielten Ergänzung von
bestehenden Vernetzungsflächen.
C. Natur im Siedlungsraum fördern D. Erholungsnutzung und Landschaftswerte
Bei der Siedlungsökologie besteht im Kanton gezielt in Einklang bringen
Solothurn nach wie vor Handlungsbedarf. Der Kanton Solothurn zeichnet sich durch vielfältige
Gleichzeitig besteht hier auch ein Potential für Landschaftsräume (Flussebenen des Mittellandes,
artenreiche Lebensräume vor der Haustüre. hügeliges Mittelland, Kettenjura, Tafeljura,
Qualitativ hochwertige Projekte zur Oberrheinische Tiefebene) aus. Identitätsstiftende
Innenentwicklung sollen als Chance zur Förderung Räume sollen erhalten bleiben. Gleichzeitig steigt
der Biodiversität genutzt werden, aber auch mit dem Wunsch nach geeigneten Gebieten für
Bedürfnissen nach Naherholungsgebieten die Naherholung aber auch durch unterschiedliche
entgegenkommen. Nutzungsansprüche der Druck auf solche
Landschaften. Daher ist ein bewussterer Umgang
mit dem knapper werdenden, aber an Wert
zunehmenden Gut «Landschaft SO» angezeigt.
Es gilt, charakteristische Landschaften zu
erhalten und Interessenabwägungen vorzunehmen.
Wo nötig sind angemessene Massnahmen zur
Besucher- bzw. Erholungslenkung zu ergreifen.
2
Diverse Analysen weisen darauf hin, dass insbesondere für den Erhalt der Artenviel- lungsbedarf, decken dabei aber nicht alle Pflichten
falt ein zusätzlicher Flächenbedarf besteht. Dies ist auch im Kanton Solothurn der
Fall. Die Strategie N+L 2030+ legt den Fokus vor allem auf die Steigerung der Qualität
des Natur- und Landschaftsschutzes ab. Unabhängig
(Konzentration der Ressourcen), mit moderatem Flächenzuwachs («Arrondierungen»). von dieser Strategie sollen weitere wichtige Pflicht-
aufgaben weiterentwickelt und teilweise optimiert
Die Gliederung der Handlungsfelder nach Schwer- werden. Für die Abteilung Natur und Landschaft be-
punkten und nicht nach Sektoren oder Verwaltungs- trifft dies insbesondere folgende Themenbereiche:
einheiten wurde bewusst gewählt, um den übergrei- Q Kantonale Naturreservate: Schutzziele und -mass-
fenden Charakter der Strategie zu unterstreichen. nahmen überprüfen, Reservate pflegen, aufwerten,
beschildern
Weitere wichtige Pflichten des Natur- und Q Witischutzzone: Aufsichtspflicht wahrnehmen,
Landschaftsschutzes Monitoring durchführen
Die aufgeführten Schwerpunkte und Handlungs- Q Amphibienzugstellen: Durchgängigkeit bei
felder richten sich nach dem dringendsten Hand- Kantons- und Gemeindestrassen sicherstellen
17S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
3.2 Die zwölf Handlungsfelder
Zu den vier Schwerpunkten wurden folgende
zwölf Handlungsfelder eruiert, welche aktuell die
grössten Chancen bzw. Defizite aufweisen. Kon-
krete Massnahmen zu diesen vier Schwerpunkten
werden in Kapitel 5 der Strategie vorgestellt.
Abb. 5: Die 12 Handlungsfelder der Strategie N+L, gruppiert nach den vier Schwerpunkten
A. Qualität 1. Folgeprogramm MJPNL
Strategie N+L 2030+ gezielt steigern erarbeiten und umsetzen
2. Folgeprogramm «Biodiversität im Wald»
erarbeiten und umsetzen
3. SO-Prioritätsarten
festlegen und fördern
4. Vernetzungsprojekte Landwirtschaft
Zusammenarbeit intensivieren, Beratung optimieren
5. Gewässer-Landwirtschaft-Naturschutz
optimale Koordination sicherstellen
6. Neobiota
bekämpfen und eindämmen
B. Ökologische 7. Wildtierkorridore
Vernetzungsstrukturen Raumsicherung, sowie vorhandene Vernetzungsstukturen sichern,
optimieren optimieren und ergänzen
8. Verkehrsinfrastruktur
Vernetzungspotential von Begleitflächen nutzen (inner- und ausserorts)
C. Natur im 9. Kantonale und kommunale Flächen
Siedlungsraum fördern naturnahe Gestaltung, Bewirtschaftung und Pflege fördern
10. Qualitätsvolle Innenentwicklung
Kommunikationsoffensive zum Erhalt naturnaher Grünflächen,
Vorzeigeprojekte mit Gemeinden zu Biodiversität, Vernetzung und
Gestaltung von Siedlungsrändern generieren
D. Erholungsnutzung 11. Regionen
und Landschaftswerte landschaftsverträgliche Entwicklungen sicherstellen
gezielt in Einklang
bringen 12. Agglomerationen
naturverträgliche Naherholung fördern
18S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
4. Umsetzung der Strategie
4.1 Vorgehensweise tegie aber auch Anstoss zu neuen Projekten und
Massnahmen geben.
Übersicht zur Vorgehensweise
Die Umsetzung der Strategie wird zu einem grossen Der Umsetzungsprozess wird periodisch bilanziert
Teil im Rahmen von bestehenden Projekten und Pro- und je nach Entwicklungen im Umfeld angepasst
grammen erfolgen. Teilweise kann und soll die Stra- oder neu justiert.
Abb. 6: Schema zur Umsetzung der Strategie N+L 2030+
periodische Bilanzierung
Anpassungen?
Strategie N+L 2030+
Strategische Grundsätze
Handlungsfelder
19S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
Zuständigkeiten In der nachfolgenden Tab. 2 sind die Zuständigkeiten
Die Abteilung Natur und Landschaft des Amtes für zu den einzelnen Handlungsfeldern zusammenge-
Raumplanung koordiniert den gesamten Umset- stellt. Es wird unterschieden zwischen einer führen-
zungsprozess der Strategie. den Rolle («Federführung») und einer Beteiligung
(vgl. Massnahmenblätter Kapitel 5.1). Die Form der
Die eigentliche Umsetzung der Handlungsfelder ist Beteiligung (fachlich, finanziell etc.) wird dabei nicht
Sache der dafür federführenden Amtsstellen. Diese näher aufgeschlüsselt.
haben jeweils eine Ansprechperson pro Handlungs-
feld zu bezeichnen.
ARP ALW AWJF AfU HBA AVT Gemeinden Private
Handlungsfelder
A. Qualität gezielt steigern
1. Folgeprogramm MJPNL
2. Folgeprogramm «Biodiversität im Wald»
3. SO-Prioritätsarten
4. Vernetzungsprojekte Landwirtschaft
5. Gewässer – Landwirtschaft – Naturschutz
6. Neobiota3
B. Ökologische Vernetzungsstrukturen optimieren
7. Wildtierkorridore
8. Verkehrsinfrastrukturen
C. Natur im Siedlungsraum fördern
9. Kantonale (HBA) und kommunale Flächen (ARP)
10. Qualitätsvolle Innenentwicklung
D. Erholungsnutzung und Landschaftswerte gezielt in Einklang bringen
11. Regionen
12. Agglomerationen
Tab. 2: Übersicht zu den Zuständigkeiten für die einzelnen Federführung
Handlungsfelder Beteiligt
3
Federführung offen, abhängig von den Bestimmungen der geplanten
Biosicherheitsverordnung (BioSV SO).
20S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
Planung und Begleitung der Umsetzung Indikatoren und Bilanzierung
Die Abteilung Natur und Landschaft organisiert min- Eine Zwischenbilanz erfolgt in der Regel nach vier
destens ein jährliches Treffen mit den federführen- bis sechs Jahren. Eine erste Zwischenbilanz erfolgt im
den Amtsstellen, um einen Austausch zum Stand Jahr 2024 in Anlehnung an die NFA-Programmverein-
der Umsetzung zu ermöglichen und gegebenenfalls barungsperiode. Mit regelmässigen Zwischenbilanzen
Synergien zwischen den einzelnen Handlungsfeldern soll geprüft werden, ob der eingeschlagene Weg
zu nutzen. erfolgreich verläuft und die gesetzten Ziele erreicht
werden können. Diese Einschätzung ermöglicht, den
Die federführenden Amtsstellen verpflichten sich, die weiteren Verlauf der Strategie gegebenenfalls
nötigen Ressourcen für die Umsetzung der erforder- anzupassen. Bis 2030+ ist mindestens eine weitere
lichen Massnahmen sicher zu stellen. Ebenso sind sie Zwischenbilanz vorzusehen.
für den Einbezug der beteiligten Partner zuständig.
Sie orientieren die Abteilung Natur und Landschaft Zur Überprüfung der Ziele der einzelnen Handlungs-
laufend über wichtige Ereignisse und den Stand der felder wurden in den Massnahmenblättern erste
Umsetzung und stellen auch die externe Kommunika- Indikatoren festgelegt. Diese Indikatoren müssen zu
tion sicher. Beginn des Umsetzungsprozesses durch die zuständi-
gen Fachstellen überprüft und gegebenenfalls ange-
Die Umsetzung der Strategie soll durch die beste- passt und konkretisiert werden.
hende Arbeitsgruppe Natur und Landschaft begleitet
werden. Die nicht in der Arbeitsgruppe vertretenen
Amtsstellen werden einbezogen. Die Abteilung
Natur und Landschaft informiert die Arbeitsgruppe
Natur und Landschaft jährlich über den Stand der
Umsetzung.
Abb. 7: Schema zur Begleitung der Umsetzung der Strategie N+L 2030+
Bilanzierung nach sechs Jahren
Austausch zur Zielerreichung
Austausch zur Zielerreichung
Austausch zur Zielerreichung
Austausch zur Zielerreichung
Austausch zur Zielerreichung
Regierungsratsbeschluss
Umsetzung der Strategie N+L 2030+
21S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
Pflanzung einer Hecke durch den Vogel- und Bau von Amphibienbiotop im kantonalen
Naturschutz Grenchen Naturreservat Grien in Erlinsbach
Tümpelbau als Ausgleichs- und Ersatzmass- Pflegeeinsatz mit Asylbewerbern im kantonalen
nahme der Güterregulierung Bättwil/Witterswil Naturreservat
22 Dickbangrube in KestenholzS T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
5. Massnahmen
5.1 Massnahmenblätter zu den
zwölf Handlungsfeldern
Auf den nachfolgenden Seiten ist eine kurze Charak-
terisierung jedes Handlungsfelds zu finden. Pro Hand-
lungsfeld wurden Massnahmenvorschläge formuliert,
welche im Rahmen der Umsetzung überprüft, konkre-
tisiert, operationalisiert und gegebenenfalls neu
justiert werden. Nach einer ersten Zwischenbilanz im
Jahr 2024 kann nach Bedarf die Gesamtausrichtung
etwa mit neuen Handlungsfeldern den aktuellen
Bedürfnissen angepasst werden.
23S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
Handlungsfeld 1
Folgeprogramm Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft
(MJPNL):
erarbeiten und umsetzen
Obstbaumlandschaft Dorneck
24S T R AT E G I E N AT U R U N D L A N D S C H A F T 2 0 3 0 +
Hintergrund/ Q Erfolgreiche und wirksame Grundsätze des MJPNL weiterführen
Strategische Ausrichtung Q Qualität auf den bestehenden Flächen vordringlich optimieren
Q Fokus stärker auf objektspezifische Artenförderung als Zusatzleistung des
Vereinbarungspartners legen
Q Abstimmung mit landwirtschaftlichen Direktzahlungen (BFF, LQB, Vernetzung)
sicherstellen
Q Mit dem Handlungsfeld 2 «Folgeprogramm Biodiversität im Wald»:
Zusammenarbeit optimieren und einzelne Schnittstellen neu regeln, aber auch
Aufgabenteilung optimieren
Zuständigkeit Federführung ARP
Zusammenarbeit mit ALW und AWJF und weiteren Partnern (SOBV, etc.)
Begleitet durch Arbeitsgruppe Natur und Landschaft des MJPNL
Kurzfristige Massnahmen Q Laufendes Programm evaluieren und wo nötig optimieren
Q Folgeprogramm MJPNL 2021–32 im bisherigen Rahmen (finanziell und perso-
nell) erarbeiten, einfaches Monitoring sicherstellen
Q Bundesinventarobjekte (TWW) sichern, arrondieren von Vereinbarungsflächen
Q Beratung optimieren mit Schnittstellen zu BFF, LQ und Vernetzung
Q Fokus Artenförderung sowie Beitrag «Lebensnetz SO» (ÖI) verstärken
Q Zusammenarbeit mit «Wald» optimieren
Q Regionalspezifische und allenfalls neue Programmpunkte prüfen
Mittel- bis längerfristige Q Erfolgskonzept des freiwilligen Naturschutzes mit angemessenen Abgeltungen
Massnahmen für naturschützerische Leistungen auch längerfristig sicherstellen, inkl. Spezial-
finanzierung über Natur- und Heimatschutzfonds
Q Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels prüfen (z.B. Sömmerungs-
weiden)
Q Vereinfachung des administrativen Aufwands und Abbau von Doppelspurig-
keiten (Reduktion der Datenredundanz) für das Erreichen der MJPNL-Ziele
prüfen
Indikatoren / Durch Kantonsrat genehmigtes Folgeprogramm mit Fokus auf Qualitätssteigerung
Erfolgskontrolle der bestehenden Flächen und Artenförderung
Finanzierung Natur- und Heimatschutzfonds (N+H Fonds), neuer Verpflichtungskredit 2021–32
Planerische / SGB 190/2003; SGB 099/2008; RRB 2008/1213; Art. 37 Abs. 1, lit.c und Art. 74 lit. a
Rechtliche Grundlagen der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (BGS 111.1); §§119, 119bis und 128 des Pla-
nungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 (BGS 711.1)
25Sie können auch lesen